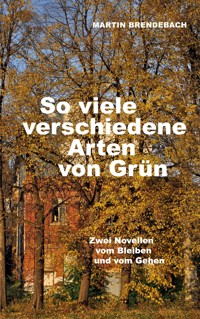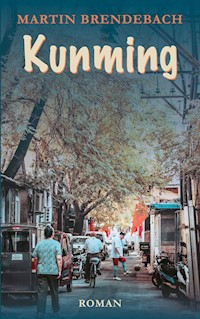
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer Frau, die gleich ein paar neue Leben auf einmal beginnt. Ein Roman über eine Zeit, als man dazu auf eine heute unvorstellbare Weise fort sein konnte. Eine Erzählung über ein Land, in dem alles möglich ist. Kirke, Lehrerin in einer deutschen Kleinstadt, reist durch Asien. Sabbatical - Die Töchter groß und in der Welt, die Ehe ausgelaugt, der Job ohne Perspektive. In Kunming, nachdem sie fast ganz China durchmessen hat, erhält sie berufliche und erotische Angebote, und sie bleibt. Genießt die Unbestimmtheit. Probiert alles aus. Und muss sich am Ende doch entscheiden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Geschichte einer Frau, die gleich ein paar neue Leben auf einmal beginnt.
Ein Roman über eine Zeit, als man dazu auf eine heute unvorstellbare Weise fort sein konnte.
Eine Erzählung über ein Land, in dem alles möglich ist.
Kirke, Lehrerin in einer deutschen Kleinstadt, reist durch Asien. Sabbatical - die Töchter groß und in der Welt, die Ehe ausgelaugt, der Job ohne Perspektive. In Kunming, nachdem sie fast ganz China durchmessen hat, erhält sie berufliche und erotische Angebote, und sie bleibt. Genießt die Unbestimmtheit. Probiert alles aus. Und muss sich am Ende doch entscheiden …
Martin Brendebach erlebte den Kalten Krieg am Nordrand des Westerwaldes und die roaring nineties in Berlin. Nach langen Aufenthalten in China arbeitete er als Lehrer. Heute lebt er in Potsdam und ist Referent für politische Bildung in einem Landesministerium.
Inhaltsverzeichnis
Peking, 2. Mai 1997
Die Zelle
Balu
Der Chor: Die erste Stimme
Post
Der Kurs
Kunming, 2. Mai 1997
Ausflüge
Klärungen
Fanny
Symposion
Teilhabe
Entscheidungshilfen
Der Chor: Die zweite Stimme
Zwei Angebote
Kunming, 2. Mai 1997
Entscheidung
Der Chor: Die dritte Stimme
Winterquartier
Lehrerin
Noch jemand
Der Chor: Die vierte Stimme
Der Chor: Die fünfte Stimme
Weihnachten
Back stage
Endlich
Neues Jahr
Karneval
Ausflug
Verdacht
Gehen oder Bleiben
Offenbarungen
Gewittergrollen
Der Chor: Die sechste Stimme
Beijing, 2. Mai 1997
Out of China
Chor: Die siebte Stimme
Die Tür
Peking, 2. Mai 1997
Der Offizier, dessen Namen Kirke nicht kennen soll, legt ihren Reisepass auf die Mitte des Tisches. Fragt wortlos, nur mit den Augen, ob sie nach Hause wolle. Sie wartet auf seine Stimme. Er spricht nicht sanft, das wäre der Situation unangemessen, aber er klingt wie seine Augen, groß, rund und beruhigend dunkel. Eine zudeckende Dunkelheit. In ihrer Zelle brennt ein schmerzendes Neonlicht, 18 Stunden. Sie erholt sich an seinen Augen. Sein Körper, das bezeugt sein Gang, wenn er endlich ins Verhörzimmer kommt, ist muskulös, ist es bis in die Stirn hinein. Stabil gebaut, ohne gedrungen zu wirken. Ohne ihn je fauchen oder brüllen gehört zu haben, kann sich Kirke gut vorstellen, dass er auch das beherrscht, wenn es nötig sein sollte. Ein Tiger, leise und schön. Aber ein Tiger. Im ersten Verhör hat er lange geschwiegen zwischen ihren Antworten und seiner nächsten Frage, mal nickend und sie weit anschauend als stimme er ihr in etwas zu, mal den Kopf wie innerlich abwesend zur Seite geneigt, so dass Kirke nicht sicher war, ob er überhaupt noch an sie dachte. Ihr fiel dann auf, wie klein, wohlgeformt und gepflegt seine Ohren waren, und dass im dichten kurzen Schwarz darüber einige silberne Haare blinkten. Auch seine Fragen wirkten zerstreut, als wisse er nicht recht, warum sie überhaupt hier sei. Auch hierin wie eine große, verschlafene Katze. Wenn Kirke gerade eine Strategie auszumachen glaubte –, etwa wenn er sie nach ihren Motiven befragte, nach China zu kommen und ob sie schon einmal in den USA gewesen wäre und was sie denn von dem Land hielte - schweifte er wieder ab, brachte es gar fertig, sie zu fragen, welche Teesorte ihr Favorit sei, der Olong?
Heute beginnt er also das Verhör, indem er ihren Reisepass auf den Tisch zwischen sie legt. Genau in die Mitte, so dass sie sich nicht aufgefordert fühlt, danach zu greifen. Sie versteht: Jetzt folgt ein Angebot. Er schaut sie lange an, wartet vielleicht darauf, dass sich genügend Hoffnung in ihrem Blick angesammelt hat, in die er sein Angebot pflanzen kann. „Der Botschafter ist da.“ Wartet wieder, etwas enttäuscht wohl über Kirkes Reglosigkeit. Er blickt auf seine Quarzuhr, als stünde dort der Flugplan. „Sie können noch heute Abend in Deutschland sein. Zu Hause.“ Nein, sie wartet auch. Das will er, dass sie Schwung holt, Hoffnungsschwung, der sie über etwas hinwegträgt, und sie ahnt nur zu gut, was das ist. Er schiebt den Pass eine Handbreit weiter zu ihr hin, belässt aber die Fingerkuppen darauf. Die Nägel akkurate Halbmonde. Bis in die Fingerspitzen gepflegte Genauigkeit, die ihre Angebote sicher sorgsam prüft. Zu billig hat sie in China noch nie etwas bekommen. Sie streckt ihre Hand nicht nach dem Pass aus. Die Großkatze will spielen. „Wieviel?“ fragt sie. Sie fragt es auf Chinesisch, mit exakt der Redewendung, mit der man auf dem Markt nach dem Preis der Melonen fragt. Er tut nur einen Moment so, als habe er sie nicht verstanden. Dann lehnt sich sein Oberkörper zurück auf seine Seite des Tisches. Der Pass liegt jetzt ungeschützt in ihrer Reichweite. Sie hätte erwartet, dass er jetzt lächelt, ein enttarnendes Lächeln, maliziös, ein Lächeln, das eigentlich bloß die Zähne fletscht. Aber er sieht sie traurig an. Sie hat sich diese drei Tage lang dagegen gewehrt, ihn sympathisch zu finden. Oder attraktiv. Oder beides. Sein Bedauern ist echt, so echt, dass sie fast die Fäden wahrzunehmen meint, die von seinen Gelenken nach oben führen, irgendwohin weit nach oben. „Sie müssen mir alles sagen. Alles.“ Er hat Chinesisch erwidert, zum ersten Mal. „Ich habe Ihnen alles gesagt.“ Er nickt, aber zieht dabei die Miene des Kopfschüttelns. Nimmt drei Bögen weißes Papier aus seiner Mappe und einen Kugelschreiber, legt alles neben den Pass. Steht auf, mit einer Schwerfälligkeit, als habe er auch seine Kraft auf dem Tisch liegen lassen. „Schreiben Sie. Geben Sie alles zu und entschuldigen Sie sich dafür. Sie haben drei Stunden.“ Nickt ihr zu und bedeutet den Soldaten, mit ihm den Raum zu verlassen. Kirke bleibt allein zurück mit ihrem Pass, einem Kugelschreiber und drei Seiten weißem Papier.
1. Die Zelle
Kunming, 10. Oktober 1996
Sie ließ sich von Lao Pang zu ihrer Zelle führen. Nackte Betonwände, der Boden mit grünem Filz ausgelegt. Bett, Stuhl, ein niedriges Abstelltischchen, darauf eine Waschschüssel und die zerbeulte Heißwasserkanne. Lao Pang wies auf die Gegenstände und sagte zu jedem: „Zhe ge!“ Mehr Chinesisch traute er Kirke offenbar nicht zu, womit er nicht ganz falsch lag. Sie hätte ihn gern mit einer eleganten Redewendung beschämt, musste aber nach Lage der Dinge schon zufrieden sein, dass er ihr wahrscheinlich falsch betontes „Yaoshi?“ richtig als Frage nach dem Schlüssel deutete. Lao Pang drehte einen imaginären Schlüssel in einem Schloss aus Luft, murmelte „deng yi xiar“ und schlurfte aus der Tür. Diese Wendung hatte Kirke in den letzten Wochen oft genug gehört, um sie zu verstehen: „Einen Moment.“ Sie ließ ihren Rucksack von der Schulter gleiten und pflanzte ihn mitten in den kleinen Raum wie eine Fahne bei neuer Landnahme. Das Fenster, durch das zur Not ein Kind oder ein sehr schmal gebauter Erwachsener sich hätte hindurchzwängen können, war vergittert. Kirke hatte nichts dagegen. In den Briefen, die sie in den folgenden Monaten in die Welt schickte („nach Hause“ ging davon nur ein kleiner Teil, und wenn man es genau nimmt, in das Haus, in dem sie gelebt hatte, kein einziger) nannte sie das Zimmer nie anders als „meine Zelle“, stolz-ironisch. Die meisten, denen sie davon schrieb, dachten an ein Gefängnis, in China allemal, und schrieben Tröstendes zurück. Aber die Idee war Kirke nie gekommen. Lao Pang schnaufte herein, einen Fernseher schleppend. Wahrscheinlich heißt yaoshi Fernseher, wenn man es auf dem ersten und dem vierten Ton spricht, und Schlüssel nur auf dem zweiten und dritten, aber Lao Pang legte einen winzigen Schlüssel, wie man ihn eher für ein Schließfach erwartet hätte, neben den Fernseher auf das Tischchen. Er wies auf beides und wollte wahrscheinlich „zhe ge“ sagen, war dazu aber zu sehr außer Atem. Kirke hätte ihm den Apparat am liebsten gleich wieder mitgegeben. Er störte, hatte in einer Zelle nichts zu suchen. Aber dem schnaufenden Alten das Gerät wieder aufzuhalsen wäre nicht nur nach chinesischen Maßstäben einer groben Unfreundlichkeit gleichgekommen.
Also sagte sie „chie-chie“. Lao Pang winkte ab und ging grußlos, sah dabei aber nicht unfreundlich aus. Die Tür ließ er offen, und Kirke wartete, bis er um die Ecke gebogen war, ehe sie das schmale Brett zudrückte. Neun Quadratmeter, vielleicht zehn. Aber allein, endlich. Nach neun Tagen im Viererabteil mit drei fröhlich-lauten Dänen, und vier Wo chen mit Martina, die sie im Zug kennengelernt hatte, in den Hotelzimmern von Peking über Xian bis Chengdu, zuletzt im Schlafsaal im Hostel hier in Kunming, nachdem Martina weitergereist war nach Vietnam. Nicht einmal auf der Toilette war man allein in diesem Land, die öffentlichen Klos, die sich während der ewigen Busfahrten quer durch das Land nicht ganz meiden ließen, waren Betonschuppen mit Löchern im Boden, die mit Türen oder anderem Sichtschutz zu versehen man hier offenbar überflüssig fand. Kirke hatte sich bei der Anmeldung zunächst davon überzeugt, dass hier im Wohnheim zumindest eine der drei Frauentoiletten eine Kabine hatte. Die neun Quadratmeter ihrer Zelle kamen ihr für einen Moment vor wie ein riesiges Reich. Den Fernseher stellte sie unter das Beistelltischchen, mit dem Schirm zur Wand. Dann nahm sie den Geldgürtel ab und legte ihn unter das Kopfkissen. Nachdem sie sich gestern davon überzeugt hatte, dass ihre Mastercard ihr hier allenfalls helfen würde, das Türschloss zu knacken, kam nun alles auf die Traveller-Cheques an. 1000 Dollar. Wie lange wollen Sie in China bleiben? 1000 Dollar lang. Ehe sie den Geldgürtel unter das Kissen legte, hat sie die Fotos herausgenommen. Marie hätte ihr gern das vom Abiball mitgegeben, aber das wollte Kirke nicht. Sie sieht zu glänzend darauf aus, verschwindet dahinter, ist nicht da. Sie hat ein heimliches mitgenommen, auf dem Marie liest, vom Schnappschuss überrascht keine Gelegenheit mehr hat, in die Kamera zu lächeln. Von Anna eines kurz nach einem Rennen, verschwitzt und noch wie erfüllt vom Tempo, die Arme nach hinten aufgestützt, die Augen halb geschlossen in den Himmel. Die Fotos kommen als erstes auf den Schreibtisch, in die linke obere Ecke, links oben, wo man auch zu lesen beginnt. Dann die Bücher, der „Lonely Planet China“, „Wild Swans“, „Chinesisch Schritt für Schritt“, ihr Reisetagebuch, die drei Stapel A5-Lernkarten. Zwei Kugelschreiber und der Walkman mit den beiden Kassetten, die sie mitgenommen hat. Das ist alles. Sie reiht ihre Habseligkeiten an der Wand auf, gegen die der Schreibtisch steht. Fast seine ganze zerkratzte Holzfläche ist noch frei. Mit den Klamotten ist es ähnlich: eine Garnitur zum Tragen, eine zum Waschen. Fünfmal Unterwäsche und ein Handtuch. Die Waschtasche enthält nur absolute Basics: Schmerztabletten, Zahnputzzeug, Binden, Lady Shave mit Klingen. Sie erklärt das Beistelltischchen zum Kleiderschrank. Der Rucksack kommt unter das Bett. Fertig eingerichtet. Es ist diese Einfachheit, die sie gesucht hat. Die sie der Tatsache entgegensetzt, dass alles andere so kompliziert geworden ist. Kirke setzt sich auf den verlebten Sessel und betrachtet ihre Zelle. Das ist der Nullmoment. Gleich gehst du durch diese Tür und das Leben hier baut sich auf, schon wenn du das erste Hallo wechselst mit irgendeinem der Jungs und Mädchen, die hier ihr Auslandsjahr verbringen. Wenn du die ersten Namen kennst und deinen hergibst. Wenn du Mittag isst in einem der kleinen Restaurants mit den drei oder vier Tischen, eine Zeitung kaufst, als könntest du sie schon lesen, froh über das eine oder andere wiedererkannte Zeichen. „Das Leben hier“, aber ein ganzes Leben wird es nicht mehr sein, hier nicht und nirgendwo sonst, ob sie ein zweites Leben anfangen wolle? aber das könne doch nur ein zweites halbes werden, und du kannst keine zwei halben Bäume haben, alles Leben stirbt, wenn man es teilt (bis auf – die Zelle, natürlich), dabei klingt es gut, zweites Leben, als bekomme man noch eines dazu, es klingt nach mehr.
Sie ruft sich aus dem Sessel, das bringt nichts. Nur noch eine Stunde bis zum Essen und sie hat ihr Pensum noch nicht geschafft. Sie legt den Stapel vor sich in die Mitte des blanken Tisches, spielt ihre Zeremonie, ein Sammeln wie vor einer schwierigen sportlichen Disziplin, bei der man die Bewegungsabläufe zuvor geistig durchgehen muss, Stabhochsprung vielleicht. Es sind 240, ihre Chinauhr: Zehn Zeichen jeden Tag außer Sonntag, seit sie in Peking aus dem Zug stieg. Aber zuvor muss sie 90 % memorieren, so ihre selbst erklärte Vorgabe. Sie nimmt den ersten Stapel, die erste Woche. Sie weiß noch, wo sie welche Karte beschrieben hat, beim Zeichen für „Mann“ riecht sie die Zwiebeln der Garküche, an deren Tischchen sie noch am ersten Abend die aus einem großen Bogen geschnittenen Karten mit vorsichtigen, und dennoch krakelig geratenen Strichen versah, ein Viereck mit einem Kreuz darin, das Zeichen für Feld, und die gekreuzten krummen Striche darüber, das Zeichen für Hacke; und das Zeichen für „Frau“, die nur noch zu erahnende vor dem Spinnrad kauernde Gestalt. „Geld“ riecht nach den fauligen Teppichen und Vorhängen des von Tropenfeuchtigkeit schon halb zersetzten alten Kolonialhotels in Chengdu, „arbeiten“ schmeckt nach dem Kohle- und Wüstenstaub Xians, der in den Tee sich senkte. „Groß“ und „klein“ klingen wie Schienenrattern, das war im Nachtzug aus Sichuan. Diese Zehn sind natürlich besonders missraten, aber Kirke hat sie nicht neu schreiben wollen, aus Angst, mit dem gleichförmigen „Klack-klack“ ihre Bedeutung zu vergessen. Sie versenkt sich in die Aufgabe. Sie weiß, sobald sie innerlich den Kopf hebt, sich zuschaut dabei und stolz empfindet, kann sie es nicht mehr. Es ist wie ein Märchenschwert, das einem von selbst in die Hand springen muss. Die Karten wandern von der linken in die rechte, sie sagt leise Aussprache und Bedeutung, legt die Karte ab, die Karten gleiten durch die Finger unter Gemurmel, das sie in tranceartige Fahrt bringen kann als sei dies ein Rosenkranz. Nur vier Ausfälle, die bei der zweiten Runde gleich sitzen. Jetzt gießt sie sich einen Instantkaffe auf, auch dies bereits ein kleines Ritual, bevor es an die zehn neuen Zeichen geht. Die Thermoskanne hat das Vogelmuster, es gibt zwei Sorten, Vögel und Chrysanthemen, die beide irgendwo in einem Werk zu hunderttausenden produziert werden müssen, sie stehen überall im Land in den Hotels, Restaurants, Wohnungen, Zügen. Die Vögel schwirren aufgeregt, blau auf rot, einer hat einen zerknitterten Flügel, wo das Blech gebeult ist. Kirke entkorkt die Flasche, das Wasser ist kaum noch lauwarm; länger als ein, zwei Stunden bleibt es nicht richtig heiß. Sie fasst die Flasche am Henkel und nimmt den Schlüssel in die hohle Hand. Zieht die Tür zu, aber das dient wie der Schlüssel nur zur Beruhigung: Sie ist sich sicher, selbst das Mädchen, das unten die Böden wischt, könnte das Pressholz einfach aufdrücken, verschlossen oder nicht. Kirke schaut in den Innenhof. Ihr Zimmer liegt im ersten Stock, an einem quadratischen Betongang, der den sechs Zimmern hier oben zugleich als Balkon dient. Die Sonne scheint, natürlich. Chün-cheng wird Kunming genannt, die Frühlingsstadt, weil fast immer schönes, mildes Wetter herrscht; es ist der Breitengrad von Afrika, aber 1800 Meter hoch gelegen, wie sie bereits aus dem Lonely Planet wusste, aber noch bisher von jedem aufs Neue erfahren hat, der sie in der Stadt begrüßte. Im Innenhof trocknet Wäsche. Die Studenten werden alle in den Kursen sitzen, drüben im „Auslandszentrum“, das als einziges Gebäude der ganzen Chenggong-Daxue („Erfolgs-Universität“) Kunming über eine Heizung verfügen soll, falls es im Januar doch einmal unter 15 Grad kühl wird.
Der Heißwasserhahn ist meistens bei den Toiletten, die auch hier nicht schwer zu finden sind – obwohl man eigentlich überall und ständig mehrere Chinesen beflissen putzen sieht, muss man stets nur der Nase nach gehen. Vielleicht verwenden sie kein Reinigungsmittel. Oder die Beamten des Volkseigenen Betriebs, der es liefert, unterschlagen die Gelder für die entscheidenden Chemikalien. Auch Lao Pang sieht sie jetzt, von der anderen Seite des Rundgangs aus, im Hof um die Wäscheständer herum feudeln, sie grüßt ihn, aber der Alte schaut nur verständnislos zurück und winkt mit der Hand ab; dachte wohl, Kirke wollte etwas von ihm.
Sie stößt die richtige Tür auf, hinter der es zwei Durchgänge gibt; an einem ist mit roter Farbe das Zeichen für „Mann“ gemalt – wieder das Feld und die Hacke, nach rechts geht es zu den Frauen (Und Kirke nimmt sich fest vor, bald eine Chinesin zu fragen, ob sie weiß, was das Zeichen ursprünglich war und wie sie das findet, dass die Frau noch wie vor zweitausend Jahren vor einem Spinnrad abgebildet wird – und fragt sich sogleich, ob eine Chinesin diese Frage wohl verstehen würde.) Hier herrscht noch größerer Luxus als in dem Bad, das sie im Erdgeschoss bereits inspiziert hatte: Alle drei Kabinen haben Türen. Ein Hahn auf halber Höhe, der in ein steinernes Becken tropft, muss der Heißwasserhahn sein. „Kai shui“, offenes Wasser, sagen die Chinesen zum abgekochten, das die meisten pur trinken, ohne Tee, wobei Kirke noch nicht herausgefunden hat, ob der Grund Sparsamkeit, Geschmack, Gesundheit oder sonst was ist. Sie stellt die Alukanne auf den nassen Stein und dreht den Hahn auf. Dampfendes Wasser schießt heraus. Ihre Reisebegleitung Martina war davon wie von vielem anderem in der ersten Woche begeistert: Wie praktisch, warum wir das nicht auch im Westen hätten, da sehe man mal. Weil das eine ungeheure Energieverschwendung ist, die nur deswegen sein muss, weil man das Wasser sonst nicht trinken kann und hier nicht jeder wie bei uns für 20 Mark einen sparsamen Wasserkocher kaufen kann. Aber sie hat nicht mit Martina gestritten, nicht in derer Euphoriephase am Anfang und auch nicht, als sich Martinas Begeisterung der Ankunft spätestens nach der Ratte im Hotel in Xian und der Wucherrechnung in einer Garküche (sie hatten erstmals vergessen, vorher nach dem Preis zu fragen und sollten prompt einen chinesischen Monatslohn für ein wenig Hühnerfleisch mit Reis und Bambussprossen zahlen) in eine Abneigung gegen das Land zu verwandeln begann, die so sehr wuchs, dass ihre überstürzte Abreise nach Vietnam einer Flucht glich. Kirke hat sie noch zum Busbahnhof gebracht. Es sollte ein sauberer Abschied werden, so sehr sich wohl nicht nur sie, sondern auch Martina darüber im Klaren war, wieviel Wert die gegenseitigen Einladungen waren. Wenn du mal in Brüssel bist – ja, dann gehen wir chinesisch essen. Aber ohne Ratten. Und fragen vorher nach dem Preis. Sauberer Abschied. Vielleicht kann man sowas ja üben. Vielleicht kann man alles lernen. Chinesisch und Abschiede ohne Bitterkeit. Und vielleicht sogar mit 40 besser als mit 20? Weil man es mehr will?
An den Instantkaffee hat sie sich schnell gewöhnt, halbherzige Versuche mit grünem Tee rasch abgebrochen. Sie trinkt Kaffee, seit Marie entwöhnt war, mit einer kurzen – und entbehrungsreichen! – Unterbrechung wegen Anna. Sie braucht weniger das Koffein. Es ist der Duft. Es genügt schon, dass sie die Nase über die dampfende Tasse hält, schon ist die Wirkung da: das Hirn wie ein frisch angespitzter Bleistift. Aber vielleicht ist sich das Gehirn auch nur sicher genug, gleich seinen Stoff zu bekommen und geht schon mal in Vorleistung. Es fehlen noch die Zeichen aus der 17. Lektion, die sie gestern schon durchgearbeitet hat. Sie geht den Text noch mal durch (eine Ananas bitte – zwei Kilo und drei Pfund – das macht 7 Kuai – das ist aber teuer! – es ist aber auch sehr gute Ware ...) schreibt fünfmal das Zeichen für Ananas auf das Schmierblatt, bis es akzeptabel aussieht, und malt es dann auf das Kärtchen – nicht so akkurat, wie es vielleicht perfekt wäre; auf ein Kärtchen, das auch nicht ganz gerade geschnitten ist. Sie ist sich noch nicht ganz sicher, ob ihr schwach ausgeprägter Genauigkeitssinn hilfreich oder hinderlich ist. Mag sein, die Karten ließen sich besser stapeln und bündeln, wenn sie alle sorgfältig gerade geschnitten wären, aber dazu hätte sie auch je Bogen eine Viertelstunde länger gebraucht, und das Kartenbasteln findet sie so schon lästig. Und mag auch sein, sie müsste eigentlich weniger Zeichen lernen und die dafür schöner schreiben. Aber sie ist eben, wie ihr Vater einmal zutreffend, wenn auch wenig nett gemeint, bemerkt hat, kurzgetaktet. (Ja, allerdings, hat sie erwidert, und wenn ich in allem deine langgetaktete Pedanterie hätte, kämen morgens die Kinder in Unterwäsche und ohne Frühstück zur Schule, aber mit tadellos sitzenden Socken. Und ich stände vor meinen Schülern und hätte bis auf den Einstieg nichts vorbereitet. Den aber perfekt.)
Sie legt die neuen Karten auf den niedrigen Stapel rechts, das sind die 30 dieser Woche, plus die vier Fehler aus der Wiederholung. Der Tag ist damit geschafft, um gerade mal 11 Uhr schon alle Pflicht erfüllt. Sie muss sich immer wieder dazu zwingen, darüber kein schlechtes Gewissen zu haben. Auch dies Teil des Versuchsaufbaus. Sie nimmt die Fotos. Marie, das ist Kirkes Abbild, das war klar etwa seit ihrem ersten Geburtstag, als aus dem Babygesicht die eigenen Züge sich frei zu schmelzen begannen. Das runde Kinn, die Stupsnase, später kamen sogar noch die Grübchen in den Wangen und die Sommersprossen, aber das wäre kaum nötig gewesen. Das flachsblonde Haar, das auch nach den ersten Kinderjahren nicht dunkeln wollte. Und die kurze Statur, die Marie in den Hunger trieb vor fünf Jahren. (Kann ich nicht einfach Papas Beine haben. Ohne Haare bitte – Die hat Anna schon. Mach lieber mehr Sport). Aber das ging ja gar nicht. Nicht nur weil sie nie schwitzen wollte – Marie duscht im Sommer bis zu drei Mal am Tag –, sondern auch, weil das Anna schon tat. Die kleine große Anna, die Marie schon eingeholt hatte, bevor sie zur Schule ging, und schneller lief beim Fangen, da war sie gerade drei. In der ihr Vater sich sah, nicht nur der langen Beine wegen, und unbeirrt blieb („doch doch, um die Augen herum, das ist, als ob ich mich selber ansähe“), obgleich niemand über höfliches Konzedieren hinaus ihm da zustimmen wollte. Nein, Anna, das war Kirke auch, nur in die Länge gezogen überall, auch die Brust schmaler und das Gesicht ovaler.
Sie schiebt die Fotos wieder in die linke obere Ecke, versucht, exakt die gleiche Position zu finden wie zuvor, als könne sie durch diesen Akt der Sorgfalt ihre Kinder noch vor irgendetwas behüten. Ihr Magen ist schon Chinese, will Punkt zwölf sein Mittagessen. Kirke legt die Geldtasche an, nimmt zuvor noch einen Hundert-Renminbi-Schein heraus, auf dem der junge Mao ernst in die Zukunft schaut. Wenn sie die Geldtasche um ihre Hüfte schlingt, muss sie immer an Cowboys und ihre Pistolengurte denken. Wenn die letzte Patrone verschossen ist – aber das Geld würde sogar für drei Monate China reichen, und in einem wird ihr Visum schon abgelaufen sein. Trotzdem überschlägt sie es, als sie die geweißte Betontreppe ins Erdgeschoss hinabsteigt und die Tür zum Büro der Ausländerabteilung, wie alle Türen, offenstehen sieht. Kirke ist sich immer noch unschlüssig, ob sie das typisch oder verblüffend finden soll; zur sprichwörtlichen Verschlossenheit der Chinesen will es nicht passen, dass die Türen überall in den Angeln hängen als wüssten sie nichts mit sich anzufangen: kaum je sieht sie eine verschlossen, kaum je eine auch nur angelehnt. Oder ist es gerade Ausdruck einer mangelnden Individualität, sich nie räumlich absondern zu wollen; oder gar Zeichen allgegenwärtiger sozialer Überwachung, dass immer alle sehen können, was du tust? Oder ist auch das viel banaler: fang bian nämlich, praktisch, wie die Chinesen zu vielem sagen, wenn sie es besonders loben wollen: weil so immer gute Luft in den Zimmern herrscht? Jedenfalls sieht man Josef, wie er sich nannte, am Schreibtisch in einem Ordner blättern. (Oder geht es wie bei den gläsernen Büros bei uns darum, unermüdliche Leistungsbereitschaft zu demonstrieren? Aber warum sind dann auch die Klos offen?) Seinen chinesischen Namen hat er entweder gar nicht erwähnt oder Kirke hat ihn gleich wieder vergessen. Ein kleines, listiges Männchen mit etwas übertriebenem Englisch, der in einem so unpersönlichen Büro saß, als losten die Beamten jeden Morgen aus, wer heute wo sitzt. An der Wand hinter dem Schreibtisch ein Porträt des Staats- und Parteichefs, ein Pferdegesicht, das sogar bleckend lächelt, mit der die Augen verrammelnden Hornbrille, ohne die man wohl nicht ins Politbüro darf. Links und rechts davon immerhin billige Reproduktionen altchinesischer Malerei, hingetupfte Berge, die sich hinter einer Flusslandschaft in einem ungefähren Horizont verlieren. Auf dem dunklen Schreibtisch nur Blätterstapel, ein Telefon mit Wahl scheibe und ein überquellender Aschenbecher, keine Blume, kein Bilderrahmen. Hinter den fast leeren Alugestellen für Aktenordner ideenlos die nackte Wand. Josef hat ihr die Konditionen erklärt: Ein Monat Kurs kostet 200 Dollar, bitte wirklich: Dollar. Dafür Unterkunft inklusive und freie Kurswahl nach Selbsteinschätzung des Niveaus, Kurs jeden Tag Montag bis Freitag von 8:00 bis 11:30. Verlängerung des Visums kein Problem, falls Kirke länger bleiben wolle, er werde sich darum kümmern, sie müsse ihm nur zwei Tage ihren Pass geben und 50 Dollar. Also überschlägt sie es, aber nur aus der Laune an der Freiheit, sich in ein paar Wochen hier oder woanders zu denken, es kann Vietnam sein oder Bangkok, sie weiß es einfach noch nicht; sie hat zu lange auf Monate im Voraus gewusst, wo sie auf Stunde und Minute genau sein würde.
2. Balu
Das Ausländerwohnheim ist umzäunt, das zweiflügelige Tor mit langen Eisenspitzen bewehrt. Ein grauer Igelkopf mit hängenden Tränensäcken, fleischigen Backen und einem Kugelbauch, den nur ein weißes Unterhemd überspannt, ist der Tagespförtner. In den Pranken hält er eine Teeschale, aus der er mit einem Schlürfen Kirkes freundliches Kopfnicken – sie weiß keine passende Floskel, und guten Tag hat sie ihm zuvor schon gewünscht – kommentiert. Dabei schließt er die Augen, was alles bedeuten kann, vielleicht sogar eine Erwiderung. Ein Flügel steht offen in die geteerte Gasse hinein, die abschüssig am Wohnheim vorbeiführt. Autos fahren nur selten, fast ausnahmslos Taxis, die sich ihren Weg mit kurzen Stoßhupen bahnen. Die Gasse belebt sich gerade, die Studenten werden jetzt aus ihren Vorlesungsräumen zum Essen gehen, einige tragen Blechnäpfe und Stäbchen bei sich. Manche Jungs gehen., was sie bereits weiter im Norden beobachtet hat, Arm in Arm, aber obwohl sie sich das noch niemanden zu fragen getraut hat, ist sie sicher, dass dies als normale Bekundung der Anhänglichkeit und Vertrautheit zwischen Studenten gilt, die zu acht ein Zimmer nicht viel größer als ihre Zelle bewohnen. (Oder doch Normalität als Tarnung des Unaussprechlichen? kommt auf die Liste: was ich eine chinesische Freundin fragen würde)
Am Kopf der Gasse, wo sie in die breitere Straße mündet, steht das Café, das der lonely-planet empfiehlt (Balu’s – go for the bear necessities! Als habe der Westen Stützpunkte im Niemandsland errichtet, Forts in der Prärie, so scheint es in jeder größeren chinesischen Stadt genau eines dieser Cafés zu geben; eingerichtet in einer Mischung aus chinesischen Accessoires und westlicher Grundausstattung, was den Kaffee und die Möbel betrifft; ausgestattet mit Büchern und Zeitschriften in verschiedenen europäischen Sprachen, je nachdem wer was dagelassen, getauscht, oder verloren hat. Bevölkert mit den durchreisenden Westlern, die Urlaub von der Reise nehmen wollen, und Chinesen, die eine Chance suchen – etwas zu verkaufen, englisch zu sprechen, zu heiraten. Die Korbstühle vor „Balu’s Café“ sind noch leer, auch Kirke biegt zunächst rechts in die „Straße der hundert Restaurants“. Die Restaurants sind eher Garküchen mit drei bis vier, maximal acht Plastiktischen und schnell gebratenen Gerichten, und es sind auch nicht hundert, aber sicher ein Dutzend, die ganze Straße entlang zu beiden Seiten. Es war bereits unten in der Stadt auffallend, sobald man den breiten Hauptstrom der Avenue verließ, die Kunming von West nach Ost durchzieht, und in die verwinkelten Nebenarme abbog: Ganze Straßenzüge geprägt von einem Handwerk oder einem Handelszweig, eine Straße mit Schuhläden, eine mit Obstständen, eine mit Haushaltswaren...als hätten sich Zünfte die Stadt aufgeteilt. Kirke ist den ganzen Tag gelaufen, seit sie Martina zum Bus gebracht hatte, die Avenue immer wieder kreuzend, bald links, bald rechts von ihr immer wieder in die Seitenstraßen abtauchend, den Hügel hinauf, an der ihre sechs Spuren sich verengen, bis das kolonialweiße Hauptgebäude der Universität durch die Platanen leuchtet, laut lonely-planet das Einzige, was neben der Bahnlinie nach Saigon und einer Bäckerei mit passablen Croissants von den Franzosen geblieben ist. Ihr Entschluss stand schon fest, als sie Josefs Büro betrat, und sie ist sich nicht sicher, wie gut sie das verbergen konnte – zumindest ein wenig, sonst wären es wohl 400 Dollar geworden. Sie ist dann bereits den Weg vom Ausländerheim zu den „Hundert Restaurants“ gegangen und hat das erste links genommen. Also ist heute das zweite links dran. Sie weiß, wie sehr sie dazu neigt, beim einmal gewählten zu bleiben, so es nur akzeptabel ist. In allen Dingen. Und dass sie damit vielleicht nicht so gut gefahren ist, wie sie lange geglaubt hat. Und auch wenn es einen Unterschied geben mag zwischen einem Mann und Nudeln mit Erdnüssen – sie verschreibt sich das Ausprobieren zum Prinzip, bei den Restaurants jedenfalls. Also einmal die Gasse rauf und runter. Beim Bestellen geht sie dosierter vor; Martina war gegen Ende zu gar keinen Experimenten bei der Bestellung mehr bereit (spätestens nach dem Huhn, das am Stück von Zeh bis Schnabel in Scheiben gehackt auf den Tisch kam), und Kirke geht den Mittelweg: Sie bestellt seit gestern ein Gericht, das sie kennt zum sicheren Sattwerden, und eines auf gut Glück. Den Kellner mit seinem penetranten „Ha-lou“ schickt sie wieder weg; sie muss erst mit ihrem „Kleinen Roten“, dem Handwörterbuch, das heutige Versuchsgericht entziffern. Huhn mit Erdnuss, dazu Reis ist die sichere Bank, „Gongbao Jiding“, die „Palastschatz-Hühnerwürfel“, das schmeckt überall. Als Gemüsegericht liest sie das erste auf der Karte nach langem Blättern als „Ameisen klettern den Baum hinauf“. Mag es stimmen oder nicht, sie bestellt es. Sie hat einen Platz in der Sonne gewählt und kann nun die schwarze Fließjacke ausziehen. Es ist Anfang November, aber nur die Morgenstunden sind kalt von der wolkenlosen Nacht und lassen die Höhe spüren. Die Sonne ist nah, sagen sie hier, und tatsächlich sieht sie in Kunming greifbarer aus als andernorts, was daran liegen mag, dass Kirke sie nicht mehr deutlich gesehen hat, seit der Zug die mongolische Steppe verließ. Der Himmel über Beijing war rußig, staubig, und stets voller Dampf aus den abertausend Küchen, die zu jeder Tages- und Nachtzeit etwas brieten, garten, schmorten, dünsteten und was man sonst noch mit Tieren und Pflanzen anfangen kann, bevor man sie verzehrt. Und seitdem war der Himmel nie aufgeklart, änderte die gigantische Wolke über dem Land nur ihre Konsistenz, trug mehr Kohlestaub in Xian und mehr Wasserdampf im subtropischen Chengdu, und die Sonne glomm immer bloß flächig, unkonturiert und matt in einem Himmelsviertel. Es mag mit der Sonne zusammenhängen, dass Kirke sich diesen Ort zum Bleiben ausgesucht hat. Das klare Licht fällt auf die weißen Flächen der Reklameschilder, ohne zu blenden. Schwarze Zeichen auf weißem Grund ist die vorherrschende Farbkombination, aber es gibt auch Gelb auf Rot, Rot auf Weiß. Wenn sie zu Hause im Zustand tranceartiger Müdigkeit war, hat sie sich oft dabei ertappt, wie ein Halbdebiler sinnlos im Vorbeigehen oder -fahren Schriftzüge halblaut zu lesen, „Currywurst jetzt nur 2,49“ – „Nächste Haltestelle: Pittlerstraße“ – „McGeiz-Wochen bei Schnäppchenshop“ und hatte sich zuweilen gewünscht, ein Analphabet zu sein, für den all die Striche und Bögen, die ihr in solchen Zuständen den Blick auf die Welt versperrten, nichts anderes wären als Formen, gleich dem Zweiggewirr einer kahlen Birke oder den Maserungen eines bewölkten windzerstobenen Oktoberhimmels. Und hier war dieser Wunsch in Erfüllung gegangen, nur dass es ihm erging wie allen erfüllten Wünschen – sofort ging sie gegen ihn an und suchte in den Zeichen, ob sie irgendein Wort darin erkennen könnte.
Das Essen kommt in Teilerfolgen; dass er den Reis sofort mitbringen soll, hat der Kellner verstanden, wahrscheinlich kennt er diese Eigenart von den Westlern (Chinesen, hat sie aus dem Handbuch gelernt, essen den Reis erst ganz zum Schluss, wenn es ums satt werden geht.). Was wieder nicht geklappt hat, ist die Portionen zu halbieren. Gleich morgen den Lehrer fragen, wie man das ausdrücken kann. Vermutlich zu absurd, dass jemand allein isst. Sie wird jeweils das halbe Palasthuhn und den halben Ameisenhaufen zurückgehen lassen müssen, und tröstet sich damit, dass hier sicher nichts weggeworfen wird; sie hat schon oft beobachtet, wenn sie deutlich nach der üblichen Mittagszeit essen ging, dass die Angestellten die Reste der Mittagstische nochmal in den Wok geschmissen haben. Kirke hat zwar seit Wochen keine Waage mehr gesehen (doch, eine gab es im Hotel in Xian, aber die ging nach dem Mond), aber sie spürt das gute Essen schon seitlich am Hosenbund. Und den Bewegungsmangel. Zu Hause ist sie zweimal die Woche gelaufen, mindestens (und seit Marie und Anna sich eher sporadisch sehen lassen, noch häufiger. Und seit sie so gut wie nicht mehr mit ihrem Mann schläft). In China hat sie noch keine zwanzig Meter Straße entdeckt, auf der man hätte geradeaus laufen können, ohne jemand umzurennen, und die Vorstellung, den Smog zu inhalieren, hat sie dazu auch nicht animiert. Aber sie hat schon gesehen, dass zum Unigelände ein Stadion mit einer Aschenbahn gehört. Auch wenn das Überwindung kosten wird, inmitten der chinesischen Studenten ihre Runden zu drehen – wahrscheinlich könnte sie sich jetzt ebenso gut hier auf den Tisch stellen und ein Lied schmettern.
Was auch immer „Ameisen erklettern den Baum“ wirklich heißt, wenn Ameisen drin sind, sieht man es nicht. Es sind lange Gemüsefäden, vielleicht sehen sie aus wie eine Ameisenstraße, die einen Baum hinaufwimmelt? Sie schmecken fade, aber sie findet fast alle Speisen in Kunming kaum gewürzt, was sicher daran liegt, dass sie sich in der vorigen Woche in Sichuan bei jedem Essen die Zunge verbrannt hat – auch wenn bu yao la – bitte nicht zu scharf – ihre meistverwendete Floskel wurde. Dafür schmecken die Palasthühnerwürfel zuverlässig. Kirke ist kein unsinnlicher Mensch (jedenfalls hat das noch keiner von ihr behauptet), aber zum Essen hat sie immer schon eine wenig poetische Haltung gehabt. Und sich in letzter Zeit ab und zu gefragt, ob sie das ändern sollte oder könnte. Nun, da Kochen nicht mehr eine Sache des Nährstofftransfers zu ihren Töchtern und Geschmack pure Strategie in diesem Stellungskrieg ist. Aber dass Kochen die Erotik des Alters sein soll, findet sie genauso dämlich wie Privat-Gourmets, die eine abendfüllende Unterhaltung über Saucen führen können und sich dabei aufspreizen, als seien sie Kunstkritiker. Dass unter Chinesen Essen das Lieblingsthema der meisten Konversationen ist, kann sie noch verstehen – in einem Land, in dem es noch vor zehn Jahren im Winter wenig mehr als Kohl zu kaufen gab – wie sie im Gespräch mit einem graumelierten französischen Handelsvertreter in einer Bar in Beijing erfahren hat, der wohl auch gerne zum Thema Erotik und Alter noch ausführlicher geworden wäre.
Kirke zahlt umgerechnet kaum zwei Mark für das Essen und schlendert noch bis zum Ende der Restaurantstraße. An vielen Tischen sitzen bereits andere Westler, die jetzt aus ihren Kursen gekommen sind. Auslandsstudenten, Anfang, allenfalls Mitte zwanzig. Alter. Noch vor wenigen Jahren hätte sie es albern gefunden, damit in Verbindung gebracht zu werden, als sei es eine seltene Krankheit, die man allenfalls hypothetisch bekommen könnte. Und wahrscheinlich ist es ja auch nur die kleine, nicht einmal so seltene Merkwürdigkeit ihres Lebenslaufs, die sie so empfinden lässt. Sie spürt an sich keine Veränderung; wenn sie beim Squash mal einen schlechten Abend erwischt und gegen Stina ständig einen halben Schritt zu spät ist, ist das nur ein Scherz: Komm du in mein Alter. Eine Woche später ist alles wieder normal, bloß ein schwacher Tag, wie man ihn auch mit 20 haben kann. Nein, der Geburtstag, der im nächsten Januar fällig ist, bezeichnet nichts, was mit Alter zu tun hätte. Nur eben: Endgültig auch nicht das Geringste mehr mit Jugend. In New York und in Quito ist es jetzt tiefe Nacht, Marie wird schlafen. Oder auch nicht. Der letzte Brief vor Kirkes Abreise hat angedeutet, dass sie auch dort eher nachtaktiv ist. Und Anna? Kann sie sich nicht anders vorstellen als in einem erholsamen Schlaf mit tiefen, regelmäßigen Atemzügen, nachdem sie den ganzen Tag in den Indiovierteln umhergezogen ist und der Projektleiterin die tragbare Tafel geschleppt hat. Sie wird nicht die Mittagsstunden in einem der Traveller-Cafés dahin driften lassen, die dort, wie sie schrieb, eine ganze Straße ausmachen („durch die Stadt verläuft ein unsichtbarer Zaun, und die Weißen sitzen unten in der schnieken Neustadt, schlürfen Ausbeuterkaffee und kaufen Indiokitsch, und in unsere Viertel kommen die nur wie in den Zoo“), während Marie wie in Flammen war von einem Café in Manhattan, in dem jeder zweite mit einem Laptop (einem Mini-Computer mit Bildschirm zum Aufklappen) oder einem Mobile Phone operierte („die haben hier so ganz kleine schicke, die sind nicht größer als ein Telefonhörer, nicht so’n Klotz wie das vom Herr Erzeuger“). Dass Kirke nun das Traveller-Café ansteuert, erscheint ihr – will ihr erscheinen – als nähme sie Marie an die rechte und Anna an die linke Hand, die beiden in eine Mitte, in Kirke selbst, zusammengeblendet: Der Reiz des Fremden, des Exotischen, das Anna in ihre eigene Form der Ferne gescheucht hat, und die Lust am behaglichen Sitzen inmitten einer umtriebigen Welt, das müßiggängerisch-geschäftige Vagabundieren Maries – hier kommt es zusammen.
Das Café hat keine Türen. Auf der Straße stehen zwei kleine runde Tische mit Stühlen aus Bambus. Man geht durch lehre Türrahmen hinein, zur rechten ein großer Tisch, links ein Bücherregal, dann führen drei breite Treppenstufen zu den Sitzecken, bunt durcheinander gewürfelte Sofas und Sessel, und eine kleine Bar in der Ecke. Eine Chinesin ihres Alters grüßt „Hello, welcome!“ und Kirke weiß nicht, ob sie besser chinesisch oder englisch zurückgrüßen soll. „Want coffee? Filtre Coffee!“ Kirke nickt. Der erste Filterkaffee seit einem Monat. Sie hätte ihn in jeder Stadt in einem der besseren Hotels trinken können, aber das verbot sich. Sie wäre sich vorgekommen wie eine alte Frau auf Kreuzfahrt. Aber hier stimmt es. Hier hat sie es sich verdient. Die Chinesin stellt einen Becher auf den Tisch, einen schweren mit dickem Henkel, auf dem „Pennsylvania State University“ steht. „Sugar? Milk?“ „Black.“ Die Chinesin nickt, als sei das lobenswert. Kirke kommt nicht dahinter, was an ihr sie irritiert, angenehm irritiert. Die Chinesin sieht anders aus als alle anderen, oder liegt es daran, dass ihre Gesten und Mimik anders sind? Ungezwungener. Kirke fragt: „Sie sprechen gut Englisch. Waren Sie schon mal im Ausland?“ Und die Chinesin antwortet in einem englisch, dass zwar brüchig ist, aber viel Übung und amerikanischen Umgang verrät: „Leider (sie muss die Silben von un-for-tu-nate-ly langsam aussprechen als balanciere sie auf Steinen) nicht, aber mein Mann ist Amerikaner.“ „Balu?“ Kirke meint es scherzhaft, aber die Chinesin nickt. Eigentlich heißt er anders, aber ich hab’s schon fast vergessen. Er vielleicht auch.“ Skurril. Kein Wunder, dass sie anders aussieht. „Und warum waren Sie noch nie in den USA. Fährt Ihr Mann denn nie hin?“ „Ich kenne ihn jetzt seit....“ sie schaut mit schmalen Augen in die Luft, als rechne sie „ drei Jahren?“ und schaut Kirke fragend an, als ob die Fremde die richtige Antwort wüsste. „Und in drei Jahren, fährt nie in die USA. Sagt, China gefällt ihm besser, was soll er in USA. Ich sage, bitte, möchte ich doch Schwiegermutter kennen lernen, sagt er, was willst du Schwiegermutter kennen lernen, sonst sind alle Frauen froh, wenn Schwiegermutter weit weg ist wie der Ozean, aber bitte, wenn du willst, nächstes Jahr, und nächstes Jahr sagt, ach, jetzt läuft Geschäft gerade so gut, nächstes Jahr...“ sie winkt mit der freien Hand ab, die andere lässt ein Putztuch über den Chrom wieseln. „Und Sie? Auch Amerikanerin?“ „Nein, Deutschland. Deguo.“ „Aaah, Sie lernen Chinesisch, sehr gut, sag ich immer wieder zu meinem Mann, lern endlich vernünftig chinesisch, aber er ist faul, kann nur „was kostet“ und „ein Bier bitte.“ „Viel mehr kann ich auch noch nicht.“ „Seit wann sind Sie in China?“ „Vier Wochen. Und in Kunming seit gestern. Morgen beginnt der Sprachkurs.“ Die Chinesin schenkt den Kaffee ein, den die Maschine unter Schnaufen frei gegeben hat, und schaut Kirke an wie einen Gaul auf dem Markt: „Studentin sind Sie aber nicht mehr.“ Selbst das findet Kirke sympathisch, nach vier Wochen Höflichkeit, die von kalkuliertem Geheuchel nicht immer zu unterscheiden war. „Sie haben Recht. Eigentlich bin ich Lehrerin. Aber jetzt hab ich Lust selber noch mal was zu lernen.“ Wieder nickt die Chinesin. „Und Ihr Mann? Oder haben Sie den dabei?“ Sie pocht mit dem Daumennagel auf ihren eigenen Ehering und schaut auf Kirkes. (Sie hatte vor Beginn der Reise einmal wenig entschlossen daran gezogen und beim ersten Widerstand abgelassen.) Kirke fällt zu dieser Frage zu viel ein, um auch nur ein Wort zu sagen. „Sorry, was geht mich das an.“ „Nein nein, das ist O.K. Es ist nur, ich weiß es nicht.“ „Ob Sie ihren Mann dabeihaben?“ „Ob ich einen habe. Oder haben will. Oder haben kann. Oder sollte. Oder einen anderen. Oder überhaupt einen.“ Die Chinesin sieht sie wieder an, diesmal aber nicht mit dem Gaul/Markt-Blick. Eher wie man eine bizarr-schöne Wolkenformation anschaut. „Ich heiße Dschung Dschung.“ „Ich bin Kirke – ich weiß, das ist unaussprechlich, weißt du nicht einen schönen chinesischen Namen für mich?“ „Dazu muss ich wissen, was dein Name bedeutet.“ „Kirke ist eine Figur aus einer sehr alten Geschichte, eine Zaubererin.“ „Eine böse oder eine gute?“ „Da sind die Meinungen geteilt.“ „Ich überleg mir was, so zwischen putzen und Sandwich machen wird das nichts. Kommst du heute Abend zum Bier? Sind dann fast immer alle hier.“ „Wer?“ „Die Westler. Ich habe dann den Namen für dich.“ „Danke.“ „Jetzt muss ich an die Sandwiches, gleich kommen sicher die ersten.“ „Oh, klar, ich setz mich rüber.“ „Wird nicht einfach.“ „Was?“ „Die Westler kriegen alle hübsche junge Chinesinnen, egal wie sie selber aussehen. Und die chinesischen Männer – na ja.“ „Ich suche ja gar nicht. Ich will glaube ich eher loswerden.“ Diesmal nickt Dschung Dschung nicht, sondern legt den Kopf schief. „See you later, Ki-Ki. Hol dir den Namen heut Abend!“ und verschwindet in der Küche.
Kirke steht nun allein in dem merkwürdig geschnittenen Raum, dem trotz seiner zurückhaltenden Ausstattung die zwei Ebenen etwas extravagant-Großzügiges verleihen. Sie setzt sich in den Sessel an der Balustrade, nippt am Kaffee und stellt ihn auf den langen niedrigen Glastisch, um den herum die zusammen gewürfelten Sofas und Sessel gestellt sind. Sie nimmt die einzige Zeitung zur Hand, die ausliegt. Es ist die International Herald Tribune. Vom Vortag! Kirke schämt sich fast für das Glücksgefühl, mit einer Tasse Filterkaffee und einer westlichen, so gut wie aktuellen Zeitung in einem Café zu sitzen, dem sie als erstem Ort seit der Teestube in St. Petersburg das Prädikat „gemütlich“ zusprechen würde. Die englischsprachigen Propagandablätter der KP, die in den Hotels auslagen, hat sie nur in den ersten Tagen gelesen, aus Pflichtgefühl, von der Neuen Welt alles zur Kenntnis zu nehmen. Die Nachrichten im Fernsehen hat sie zweimal angeschaut im frustrierenden Versuch, auch nur ein Wort ihres spärlichen Vokabulars darin wiederzuerkennen. Die Bilder ließen nur erahnen, worum es ging: Vor allem Fabriken, die vermutlich neue Jubelzahlen an Planerfüllung und Produktionssteigerung verkündeten; Einsätze der Volksbefreiungsarmee in irgendeinem entlegenen Katastrophengebiet Westchinas, wo die Männer Kaftane und Turbane trugen. Parteitage mit dösenden Gesichtern und Bonzen, die tonlos Manuskripte verlasen, sie erkannte nur das Pferdegesicht Jiang Zemins, des Staats- und Parteichefs. Die Werbung vor und nach den Nachrichten war aufschlussreicher gewesen: Westliche Models und Chinesen mit großen Augen und Nasen, die Frauen meistens mit hell gefärbten Haaren, lachten und flirteten in einer Glaswelt aus Wein, Autos und Villen mit Arkadengängen. Als sie es nach vier oder fünf Tagen aufgegeben hatte, sich zu informieren, stellte sich bald ein Behagen ein wie an einem Sonntagnachmittag, am dem sie zu Hause zuweilen das Telefon ausstöpselte und die Welt draußen vor dem Fenster ließ. Es bereitete ihr diebisches Vergnügen, fort zu sein: Als hätte sie sich davongestohlen.
Es geht ihr nun aber wie nach der Entschlackungskur, die sie zwischen den beiden Schwangerschaften mal gemacht hat: Als nach ein paar Tagen die Erinnerung an das Essen verblasste und der Hunger normal wurde, vermisste sie nichts mehr, jedenfalls solange sie niemanden essen sah; und erst mit dem ersten Biss Zwieback nach drei Wochen fiel der Hunger ein wie ein Feind aus dem Hinterhalt. Kaum dass sie die erste Schlagzeile überflogen hat, verfällt sie der Weltneu gier und beginnt die Zeitung zu lesen, wie ein Buch: von vorn bis hinten. Nicht einmal den Artikel über die Dürre in Südfrankreich lässt sie aus. Es geht ihr überhaupt weniger um Nachrichten aus der Heimat, wie weit gefasst die auch sein mag: Dass Kohl sich für eine europäische Zentralbank mit Sitz in Frankfurt ausspricht, interessiert sie nicht mehr oder weniger als die Putschgerüchte in Kambodscha. Im Gegenteil: Wie mit den Artikeln Länder und Kontinente an ihr vorbeiziehen als drehe sie einen Globus immer schneller, macht das Faszinosum dieser Zeitung aus, die keinen eigenen geographischen Schwerpunkt zu kennen scheint. in ihrem global gerecht verteilten Interesse.
Als sie nach der Asienseite wieder zu ihrem Kaffee greift, bemerkt sie den Mann, der sich in den Sessel ihr schräg gegenüber niedergelassen hat und sie betrachtet. Er schaut nicht im Mindesten ertappt oder verlegen, als Kirke seinen Blick retourniert. „Wollte Sie nicht stören. Sie waren so vertieft“, sagt er. Amerikaner, aber nicht der breit quäkende Texassound. Eher Ostküste, britisch kultiviert. „Die erste Zeitung seit Wochen.“ sagt Kirke, als müsse sie sich entschuldigen. „Nur zu. Wenn Sie nur so freundlich wären und mir den Sportteil reichten?“ („I just wonder if You would mind ...“ – kein Brite, aber er spricht so). Nach Sport sieht er nicht aus, obwohl er groß ist und kräftig, aber es ist nicht nur das kleine Bäuchlein, das sich unter dem Hemd abzeichnet, auch die Art wie der dasitzt, ohne Körperspannung, dem Sitzen wie einer Beschäftigung nachgehend (er tat ja auch in der Tat nichts, als auf die Zeitung zu warten, ab und zu einen Schluck aus dem dünnen Glas mit Eiswasser zu trinken – und eben: zu sitzen.) Ein fast kahl rasierter, mächtiger Schädel, helle Barstoppeln; er ist ein Mann, der sich das leisten kann; im inneren Kreis seines Gesichts, umgeben von so viel Männlichkeit, ist er weich: verschmitzte kleine Augen, eine drollige, breite Nase, volle Lippen; sähe man nur seine Augen und den Mund, könnte man ihn auch für eine Frau halten. Kirke will wissen, ob seine Ruhe Phlegma ist oder tiefer geht: „Wenn Sie das am meisten interessiert – bitte.“
Er lupft eine Augenbraue. „Wissen Sie, was ich am Sport gut finde? Die Ergebnisse. Keine Interpretation wer gewonnen hat. Aber Sie haben Recht“, er klopft sich auf das Bäuchlein, „ ich bin der, der zuschaut (I am the one who watches – und den unterbödigen Sinn dieser Selbstbeschreibung verstand sie erst viel, viel später).
„Ich wollte Sie nicht beleidigen.“
„Keine Sorge“, er lächelt unverstellt, – „das ist ziemlich schwierig. Man nennt mich hier Balu.“
Kirke verstand nicht gleich, was das eine mit dem anderen zu tun haben sollte. „Ihr chinesischer Name?“
„Sozusagen. Hat mir meine Frau verpasst. Die Chinesen lachen drüber, aber mir gefällt er. Meistens.“
„Ich hoffe, Ihre Frau ist nicht Dschung Dschung.“
„Das hoffe ich auch manchmal. Nein, doch, das heißt wieso hoffen Sie das nicht, Sie bringen den guten Balu ja ganz durcheinander.“
„Weil sie mir heute Abend auch einen chinesischen Namen geben will, und ich möchte nicht, dass die Chinesen über ihn lachen.“
„Keine Sorge, um der Wahrheit die Ehre zu geben, sie hat mich so erst nur im Vertrauen genannt, entre nous, aber irgendwann hat sie mich bei dem Namen auch aus der Küche gerufen, und so haben andere den Namen aufgeschnappt, und zack! heiße ich jetzt für ganz Kunming Balu. War der erste Disney-Film, der in China lief, vor drei Jahren. Gerade, als ich Dschung Dschung kennen lernte.“
„Sie scheinen aber auch nicht viel dagegen zu haben, der gute Balu zu sein.“
„Nein, nicht das geringste. Und wie heißen Sie?“
„Kirke.“ Sie buchstabiert es. „Wie Captain Kirk plus e.“
„Waren Ihre Eltern Trekkies?“
„Nein, Altphilologen. Kennen Sie die Odyssee?“
„Ist das ein Hollywoodfilm? Sie müssen entschuldigen, ich bin doch Amerikaner.“ Sie tastet ihn ab, aber da ist nicht die Spur von Ironie zu entdecken, weder in der Miene noch im Tonfall, obwohl sie sicher ist, dass sie da sein muss, weniger weil es so ganz unglaubhaft wäre, einen Amerikaner anzutreffen, der so antwortet, aber sie beginnt hier bereits zu ahnen, dass dieser Mann ein Spiegelkabinett ist. „Eine alte Geschichte. Kirke ist eine Zaubererin, die die Soldaten des Helden in Schweine verwandelt, ihm aber dann letztlich doch hilft.“
“Männer in Schweine. Geht der Zauberspruch auch umgekehrt?“ „Offenbar, Sie gibt den Soldaten ja auf Bitten Odysseus ihre Gestalt zurück.“
„Da muss man sich bei Ihnen ja vorsehen. Mal sehen was Dschung Dschung aus ihrem Namen macht, vielleicht haben Sie ja mehr Glück als ich. Wenn Sie hier demnächst als „Schweine-Hexe“ rumlaufen sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Bleiben Sie lange?“ „Bezahlt habe ich für einen Monat. Dann läuft mein Visum aus.“
„Aber das Fuchsgesicht im Ausländerbüro hat Ihnen doch sicher nicht nur das Geld abgeknöpft, sondern auch gleich zu verstehen gegeben, dass sich alles regeln lässt, wenn Sie länger bleiben und sich noch mehr Geld abknöpfen lassen wollen?“
„Josef? Ja, er hat sowas angedeutet.“
„Der heilige Josef. Gut vernetzt. Sein Cousin ist bei der Polizei und sein Schwager bei der Meldebehörde. Wenn Sie länger bleiben wollen, kein Problem.“
„Genau seine Worte. Sie sind ja auch schon länger da.“
„Tja, da sehen Sie, ich dachte auch erst, bleiben wir mal ein paar Tage, und das ist draus geworden. Drei Jahre.“
„Und Sie waren in all der Zeit nie wieder in den USA? Sagt Dschung Dschung.“
„Nein, was soll ich da, da war ich schon so lange, und irgendwann gehe ich zurück, dann bin ich da wieder lange. Nein, jetzt ist China der richtige Ort für mich („the place to be“).
„Und warum? Wegen des Geschäfts?“
„Auch. Sehen Sie, darum verstehen wir uns mit den Chinesen eigentlich ganz gut: Wir haben kein inneres Problem damit, Geld zu verdienen. Mag sein die Europäer kommen alle wegen Konfuzius und der tollen Gedichte im Klassischen Chinesisch – bitte, jeder so wie er mag. Sind Sie wegen Konfuzius hier?“
„Auch. Darum verstehen wir uns mit den Chinesen nämlich auch ganz gut. Keine inneren Probleme mit Kultur.“
Balu sieht sie an wie der Schwergewichtschampion den lange unterschätzten Gegner, dessen Jab er zugelassen hat. Sie hat es härter ausgesprochen, als sie es gemeint hat – der gleiche Satz, etwas abgemildert durch Koketterie im Unterton, einen Schimmer weiblicher Konzilianz, hätte weit besser ausgedrückt, was sie Balu mitteilen wollte: Dass sie ihn interessant genug findet, um mit ihm zu streiten. Auch deshalb hat sie das Sabbatjahr nehmen wollen: Weil sie diese zweite Haut auf ihrem Gesicht, die ihr vor der Klasse und im Kollegium Härte verleihen sollte, nicht mehr so leicht abstreifen kann wie sie immer dachte. An der sie gearbeitet hat seit ihrem ersten Praktikum, in dem ihr ein feist-stattlicher Endfünfziger mit gepflegtem weißen Backenbart und Jackett im freundlichsten Ton riet, sie solle sich einen anderen Beruf suchen, weil sie mit ihrem „niedlichen Puppengesicht“ und dem „zarten Figürchen“ nie die nötige Autorität vor den Schülern werde aufbauen können. Das Schlimmste war: Er hatte recht gehabt, nicht mit der anmaßenden Prognose, aber mit dem Grund für ihr Scheitern in den ersten Monaten: Und sie verbot sich, im Klassenzimmer zu lachen oder auch nur zu lächeln. Mit den Jahren lernte sie, ihr Gesicht zu handhaben; Mienen zu wählen wie der Chirurg das Messer mit der exakt passenden Schärfe. Aber seit ein paar Jahren hat sie das Gefühl, dass diese Masken sie eher dominieren als dass sie noch die Kontrolle über sie hätte. „Mama, guck nicht wie ’ne Lehrerin!“ Aber noch ehe sie einlenken kann, fängt Balu das Gespräch auf: „Womit wir die Stereotype schon mal durch wären. Verzeihen Sie, dumm von mir. Macht das Exil. „Die und wir“ und so’n Zeug. Man sieht nicht mehr den Menschen.“
„Ich fürchte, ich habe mit dem Unsinn angefangen. Und kann mich nicht mal auf drei Jahre Exil rausreden.“
„Eins müssen Sie mir noch verraten, ehe Dschung Dschung mich gleich zum Brotschneiden verdonnert: Wie kommt es, dass Sie so gut englisch sprechen?“
„Sehr nett von Ihnen.“
„War gar nicht nett gemeint. Eher neugierig.“
Einen Moment ist Kirke versucht, ein Spiel daraus zu machen, sich zu umschreiben, ihn raten zu lassen, oder etwas völlig Abwegiges zu erzählen. Zwar hindert sie sowohl das klare Bewusstsein, eine ganz miserable Lügnerin zu sein ebenso wie die Tatsache, dass sie zuvor Dschung Dschung schon gesagt hat, was sie ist – aber genau das ist es, wogegen sie sich sträubt, das in einem Wort sagen zu können. Als ob mit ihrem Beruf alles wesentliche zu der Frage, wer sie ist, gesagt sei. Heraus kommt, zögerlich: „Ich habe lange als Englischlehrerin gearbeitet.“
„Sie sagen dass, als müsste man sich dafür schämen.“
„Keineswegs. Es ist nur – ich hätte manchmal lieber Latein unterrichtet. Keiner mehr da, der’s besser kann als man selbst, verstehen Sie?“ „Keine Sorge. Ich habe bestimmt schon fünf Grammatikfehler gemacht, seit wir uns unterhalten, und wenn ich erst mitgeschrieben hätte ...“
„Das war jetzt aber nett gemeint, oder? Gesicht geben und so.“ „Zugegeben. Machen diese ewig lächelnden Schlitzaugen, nach drei Jahren sagt man einer neuen Bekannten nicht mehr ins Gesicht, dass sie einen furchtbaren deutschen Akzent hat und man sich fragt, wie man sowas auf Kinderohren loslassen kann. Oder ist es holländisch?“ „Deutsch stimmt schon.“
„Nett ist doch besser, oder?“
„Am liebsten ist mir ehrlich.“
„Ich bin nett, ehrlich! Und Ihr englisch ist gut, basta.“
„Und Sie? was haben Sie gemacht, bevor Sie nach China gekommen sind?“
„Ach dies und das, nicht weiter...“
„Balu! Sandwiches!“
„Ich komme schon, mein Glöckchen!“ Und zu Kirke:
„Hübsch, nicht? Das bedeutet ihr Name. Aber Balu, warum nur Balu? Hätte es nicht Shir Khan sein können?“
„Mir gefällt Balu auch.“
„Sieh dich vor, Schweinehexe! Manchmal denke ich, man sollte seinen Namen niemandem verraten. Was die Menschen alles daraus machen! Bis dann.“