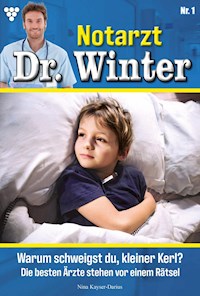Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kurfürstenklinik
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Mit den spannenden Arztromanen um die "Kurfürstenklinik" präsentiert sich eine neue Serie der Extraklasse! Diese Romane sind erfrischend modern geschrieben, abwechslungsreich gehalten und dabei warmherzig und ergreifend erzählt. Die "Kurfürstenklinik" ist eine Arztromanserie, die das gewisse Etwas hat und medizinisch in jeder Hinsicht seriös recherchiert ist. "Mein letzter Tag bei Ihnen, Herr Dr. Winter!" sagte Miriam Fechner und sah den jungen Notaufnahmechef der Kurfürsten-Klinik in Berlin-Charlottenburg betrübt an. "Ich wäre gern noch länger geblieben, das wissen Sie ja – aber als nächstes werde ich in Ihrer Neurochirurgie eingesetzt. Ich soll das ganze Haus kennenlernen." "Sie waren uns eine große Hilfe, Schwester Miriam", erwiderte Dr. Adrian Winter lächelnd. "Wir sind froh, daß Sie wenigstens eine Zeitlang unser Team verstärkt haben."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 107
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Kurfürstenklinik –17–
Schwester Janines Traumhochzeit
Als in der Kurfürstenklinik ein Märchen wahr wurde
Roman von Nina Kayser-Darius
Die Operationslampen warfen ihr grelles schattenloses Licht auf den Tisch, ermöglichten es Dr. Winter, auch die kleinste Kleinigkeit zu entdecken.
Und es war wichtig, daß der Chirurg nichts übersah. Gesundheit und Leben hingen davon ab, wie präzise er arbeitete, wie sorgfältig er versuchte, den Krebsherd herauszuschälen.
Dr. Adrian Winter trat einen kleinen Schritt vom Tisch zurück und wandte sich einer unsterilen Schwester zu, die sich im Hintergrund aufhielt und nur eine Aufgabe hatte: sie sollte dem Operateur den Schweiß von der Stirn wischen, wenn es nötig wurde.
Und es war notwendig! Seit vier Stunden operierte Adrian jetzt schon, und noch immer war kein Ende abzusehen. Zuerst hatte er einen Notfall behandeln müssen – Milzriß bei einem Zwölfjährigen, der sich beim Rennrad-Fahren so schwer verletzt hatte.
Dann hatte er einen Herzschrittmacher eingesetzt, und nun lag Dr. Peter Steinhausen vor ihm. Adrian kannte den Kollegen noch von der Studienzeit her. Sie waren stets gut miteinander ausgekommen, hatten sich jedoch in den letzten zehn Jahren aus den Augen verloren gehabt, denn Peter hatte lange Zeit in Amerika gelebt und gearbeitet.
Bis vor einer Woche. Da hatte Peter ganz plötzlich in der Ambulanz der Kurfürsten-Klinik gestanden. Abgemagert, graugesichtig, sichtlich von seiner Krankheit gezeichnet.
»Du mußt mich operieren, Adrian«, hatte er nach der Begrüßung gesagt. »Nur deshalb bin ich noch einmal nach Berlin zurückgekehrt.«
»Aber du hast am Sinaii-Hospital in New York gearbeitet«, hatte Dr. Winter eingeworfen, »das weiß ich noch genau. Da hast du bestimmt kompetentere Kollegen als mich. Ich bin doch nur…«
»Du bist der einzige Arzt, dem ich voll und ganz vertraue. Und du bist der einzige, bei dem ich sicher sein kann, daß er mir hinterher die Wahrheit sagt.« Peter Steinhausen hatte den Studienfreund fast flehend angesehen. »Nimm dir meinetwegen noch ein oder zwei Kollegen als Assistenz, ich habe nichts dagegen. Aber ich will, daß du mir diesen verdammten Krebs aus dem Körper schneidest.«
Was gab es da noch zu sagen? Widersprechen konnte Dr. Winter nicht, das ließ ihre Freundschaft nicht zu. Und außerdem – er hatte schließlich nicht umsonst einen exzellenten Ruf als Operateur.
Also hatte er den Kranken eingehend untersucht und ihn so gut wie möglich auf den schweren Eingriff vorbereitet.
Jetzt waren schon mehr als zwei Stunden verstrichen, und der Eingriff näherte sich dem Ende. Adrian Winter hatte den ganzen Magen entfernen müssen, dazu noch die Milz und Teile des Zwölffingerdarms, denn sie waren schon mit Metastasen durchsetzt gewesen. Allzu gut sah es nicht aus, und Dr. Winter hatte jetzt schon Angst vor den Fragen, die ihm der Freund und Kollege bald stellen würde.
Was konnte er sagen? Daß es nur noch einen ganz vagen Hoffnungsschimmer gab? Daß Peter eine harte, kräftezehrende Therapie würde durchstehen müssen, um die Heilungschancen zu erhöhen?
Das wußte er bestimmt alles selbst, und Adrian Winter wurde den Verdacht nicht los, daß Peter Steinhausen heimgekehrt war, weil er wußte, daß er nicht mehr lange leben würde.
Aber – daran durfte er jetzt gar nicht denken. Er wollte für den Kranken tun, was in seinen Kräften stand.
»Der Blutdruck fällt ab!« meldete der Anästhesist. »Sie müssen sich beeilen!«
Adrian nickte nur. Noch einmal kontrollierte er den gesamten Bauchraum, bis er sicher sein konnte, keine entartete Geschwulst übersehen zu haben. Ob das aber ausreichte, konnte er nicht entscheiden. Das war ja gerade das heimtückische an der Krebserkrankung, daß man die ersten befallenen Zellen nicht erkennen konnte.
Endlich konnte Dr. Winter den Eingriff beenden.
»Der Patient kommt auf Intensiv«, ordnete er an. »Ich möchte, daß Sie sich ganz besonders um ihn kümmern.«
Dr. Ullmann, der für zwei Wochen Dr. Roloff vertrat, nickte zustimmend. Otto Ullmann war ein sehr erfahrener Anästhesist, der sich nach fast zehn Jahren im Entwicklungsdienst nun wieder in Deutschland etablieren wollte. Für die erste Zeit arbeitete er an der Kurfürsten-Klinik, was vor allem Dr. Roloff zu schätzen wußte, denn so konnte der Chefanästhesist endlich mit seiner Frau die Kreuzfahrt machen, von der diese schon so lange träumte.
Adrian Winter fühlte sich erschöpft und ausgelaugt, als er sich im Waschraum den Mundschutz abnahm und aus der befleckten OP-Kleidung schlüpfte.
Dankbar nickte er Schwester Janine zu, die ihm die Kleidungsstücke abnahm und nach draußen trug.
Erst als er geduscht hatte und wieder seinen weißen Visitenmantel trug, fühlte sich Adrian besser.
»Ich gehe kurz in die Kantine und esse einen Happen!« rief er Janine zu, die im Vorbereitungsraum den Sterilisator einräumte.
»Geht in Ordnung. Ich wünsche Ihnen guten Appetit.« Sie lächelte ihm zu, und unwillkürlich fühlte sich Adrian besser. Janine und ihr Lächeln… es sei die reinste Medizin, hatte erst vor ein paar Tagen eine alte Patientin zu ihm gesagt.
Dr. Winter konnte diese Aussage nur bestätigen. Überhaupt – Janine war ein Glücksfall für die Kurfürsten-Klinik. Sie war eine hervorragende Krankenschwester, die eine besonders glückliche Hand im Umgang mit den Patienten hatte. Außerdem hatte sie eine Zusatzausbildung als OP-Schwester gemacht, so daß sie immer wieder dort einspringen konnte, wenn mal ein Engpaß herrschte. Und das kam leider immer wieder vor.
Normalerweise arbeitete Janine auf der Chirurgie, und Adrian Winter war froh, sie in seinem Team zu haben.
»Hast du auch Hunger?« Dr. Julia Martensen kam gerade aus dem Lift und schloß sich ihrem Kollegen an. »Ich habe außer einer Pampelmuse zum Frühstück noch nichts gegessen.«
»Dann komm mit mir. Ich wollte gerade was gegen mein Magenknurren tun.« Er lächelte der dunkelhaarigen Internistin zu. »Ich lade dich sogar ein, es wird für Wochen die letzte gescheite Mahlzeit sein, die du bekommst.«
Dr. Martensen lachte. »Das behauptest du! Ich liebe die thailändische Küche, und vor allem fernab der Touristenzentren kann man sie kennenlernen.«
»Du bist das reiselustigste Geschöpf, das ich kenne!«
»Danke, ich nehme es als Kompliment.«
Sie hatten die Kantine erreicht und ließen sich an der Theke etwas zu essen geben. Da sie recht spät dran waren, war die Auswahl gering – außer Schnitzel konnte die Bedienung noch Erbsensuppe und Rahmgulasch anbieten.
Julia Martensen nahm das Schnitzel und Adrian schloß sich ihr an.
Als sie endlich saßen, kam er auf das Thema Urlaub zurück. Er wußte, daß die Kollegin, die allein lebte, schon fast die ganze Welt bereist hatte. Dabei legte sie Wert darauf, nicht als Pauschaltourist zu reisen, sondern ihre Ferien waren stets Abenteuerreisen, bei denen Julia Martensen Land und Leute wirklich kennenlernen wollte.
Diesmal stand Thailand auf dem Programm, und sie freute sich schon darauf, denn es war ihr dritter Aufenthalt in diesem Land, und sie hatte schon einige gute Bekannte dort.
Während sie aßen, redeten sie über ihre Ferien, die gemeinsamen Bekannten – und letztendlich auch wieder über die Patienten, die ihnen gleichermaßen am Herzen lagen. »Wie ich hörte, hast du heute einen Studienfreund operiert«, sagte Julia.
Dr. Winter nickte. »Magenkrebs. Und Metastasen in der Milz und am Zwölffingerdarm. Ich weiß nicht, ob er’s schafft.«
Julia nickte. »Warum kommen Ärzte oft so spät zu ihren Kollegen zur Behandlung? Kannst du mir das erklären? Sie müßten doch die ersten Symptome genau erkennen können.«
»Ich weiß es nicht. Aber ich habe mir diese Frage auch schon oft gestellt«, entgegnete Adrian. »Bei Peter ist es wohl so, daß er viel zu beschäftigt war, um…«
»Ach was, das sind doch Ausreden«, fiel ihm Julia ins Wort. »Er hatte Angst – so, wie all die anderen auch, die den Kopf in den Sand stecken, statt das Übel so rasch wie möglich mit der Wurzel auszurotten.« Sie schob ihren Teller ein wenig von sich. »Ich könnte mich aufregen, wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen wir retten könnten, wenn sie nur rechtzeitig zum Arzt gingen.«
»Du hast ja recht«, meinte Dr. Winter besänftigend. »Wollen wir hoffen, daß ich Peter helfen konnte.«
Julia lächelte schon wieder. »Ich drücke die Daumen – euch beiden. Und jetzt mußt du mich entschuldigen, ich muß noch mal kurz ins Labor. Morgen dann…«
»Bist du eine beneidenswerte Frau!« Adrian stand auf und umarmte die Kollegin und Freundin. »Ich wünsche dir gute Reise – und komm gesund zurück. Wir brauchen dich hier.«
»Danke für die Blumen!« Julia strich ihm kurz über den Arm, dann ging sie rasch davon.
Adrian Winter überlegte gerade, ob er sich zum Dessert noch ein Stück Apfelkuchen gönnen sollte, als sein Piepser ertönte. Der Arzt wurde dringend in der Ambulanz gebraucht!
*
Es war still auf den Fluren der Kurfürsten-Klinik. Die Besucher waren schon vor Stunden gegangen, die Patienten lagen wohlversorgt in ihren Betten, und vor gut zwei Stunden hatte Schwester Janine ihren Nachtdienst angetreten.
»Es scheint nicht viel los zu sein heute«, meinte Lernschwester Bea, die ihr in dieser Schicht zugeteilt war.
Janine mochte die kesse Kollegin, die zwar ein lockeres Mundwerk hatte, aber im Umgang mit den Patienten sehr viel Geschick bewies und auch Herz zeigen konnte, wenn’s angebracht war.
»Beschrei es nur nicht«, winkte Janine lächelnd ab. »Wenn eine Nachtschicht so ruhig beginnt, kommt gern das dicke Ende nach.«
»Ich wußte gar nicht, daß du abergläubisch bist.«
»Bin ich auch nicht. Aus mir spricht die Erfahrung.«
Bea lachte. »Jetzt tust du, als wärst du mindestens fünfzig Jahre älter als ich.«
»Um Himmels willen, das wäre ja furchtbar!« Auch Janine mußte lachen. Gleich darauf aber wurden beide Pflegerinnen ernst, denn auf Zimmer neun ging der Notruf.
»Das ist bestimmt die alte Frau Neumann«, flüsterte Bea. »Sie war gestern schon so elend dran.«
Janine nickte nur und eilte los. Frau Neumann war über neunzig, eine liebenswerte alte Dame, deren weißes Haar ein zartes, aber immer noch schönes Gesicht umrahmte. Sie war freundlich, dankbar für die kleinste Handreichung und immer gut gelaunt. Nie klagte sie, obwohl den Schwestern klar war, daß sie Schmerzen erleiden mußte.
Vor drei Wochen war Frau Neumann gestürzt und hatte sich einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Leider heilte die Bruchstelle nicht gut, und Dr. Winter und seine Kollegen beobachteten den Fall voller Sorge.
Schwester Janine betrat leise das Zimmer der alten Dame. »Guten Abend«, grüßte sie. »Was kann ich für Sie tun, Frau Neumann?«
Die Kranke lächelte matt. »Nicht mehr viel, mein Kind. Aber wenn Sie ein paar Minuten Zeit hätten…«
»Für Sie doch immer.« Janine beugte sich über ihre Patientin und sah sie forschend an.
Frau Neumann lächelte. »Sie brauchen keine Angst zu haben, ich… mir geht’s gut. Ich habe auch keine Furcht vor dem Tod. Ich möchte nur nicht allein sein.« Sie streckte bittend die Hand aus. »Bleiben Sie ein bißchen bei mir, Janine, ja?«
»Natürlich.« Die junge Pflegerin tastete gewohnheitsmäßig nach dem Puls ihrer Patientin. Er ging flach, war kaum noch zu tasten. »Ich hole Ihnen ein kreislaufstärkendes Mittel, Frau Neumann«, sagte Janine. »Und vielleicht ist es besser, wenn ich auch einen Arzt rufe.«
Aber die alte Dame schüttelte den Kopf. »Das brauche ich alles nicht«, sagte sie leise. »Ich spüre, daß meine Zeit gekommen ist. Und das ist gut so. Ich gehe gern, denn ich weiß, daß ich nun bald wieder mit meinem Hermann vereint sein werde. Ich danke Ihnen, Schwester Janine. Sie waren immer so lieb zu mir…« Ihre Stimme wurde leiser und leiser. Janine hielt die schmale Hand der alten Frau, streichelte sanft über die welke Haut.
Sie fühlte, daß es besser war, keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr einzuleiten. Frau Neumann spürte ihr Ende, und sie ging ruhig und zufrieden in eine andere Welt. Warum sie noch an Apparate und Geräte anschließen, die ihr nur Angst machen würden? Warum sollte sie nicht in Würde und Frieden sterben?
Janine beugte sich noch ein wenig vor. »Sollen wir vielleicht zusammen beten, Frau Neumann?« fragte sie. »Wenn Sie möchten, sprechen wir das Vaterunser.«
»Ich bin schon mit meinem Herrgott im reinen«, flüsterte die Kranke. »Aber ich danke Ihnen, Kind. Leben Sie wohl.«
Noch ein paar Atemzüge, ein letzter Blick auf Janine, dann hatte Frau Neumann ausgelitten.
Janine blieb noch eine Weile bei ihr sitzen, hielt die schlaffe Hand und sah in das Altfrauengesicht, das so viel Frieden und Heiterkeit im Tod ausstrahlte, wie Janine es noch nie gesehen hatte.
Als sich die Tür leise öffnete, drehte Janine sich um. Bea stand da und sah die Kollegin fragend an. »Was ist? Brauchst du Hilfe?«
»Nein. Frau Neumann braucht jetzt nichts mehr. Sie ist ganz friedlich eingeschlafen. Würdest du den diensthabenden Arzt verständigen?«
Bea nickte und warf einen letzten Blick auf die Tote. »So schnell ging das«, flüsterte sie.
Janine nickte. »Sie hat es gefühlt. Und sie wollte nicht, daß wir noch irgend etwas unternehmen.«
»Kann ich verstehen«, nickte Bea. »Ich rufe dann Dr. Schäfer.«
»Dank dir.« Janine schloß die Augen der Verstorbenen, legte ihre Hände übereinander und zog die Decke ein wenig höher. Sie war erleichtert, daß Dr. Schäfer heute Dienst hatte. Der junge Chirurg war sehr sympathisch und hatte viel Verständnis für seine Patienten. Er würde auch sicher verstehen, daß Janine in den letzten Minuten allein mit der Patientin geblieben war und keine Hilfe geholt hatte.
Dr. Bernd Schäfer kam schon wenig später herein. Er war sehr groß, hatte braunes Haar und gutmütig dreinblickende Augen.