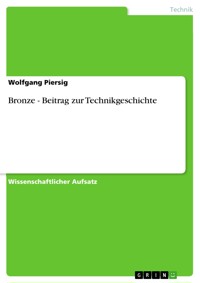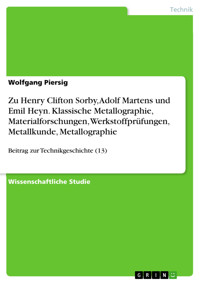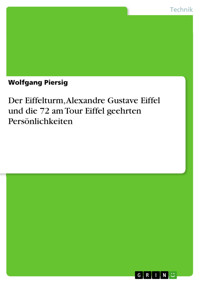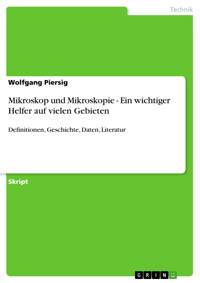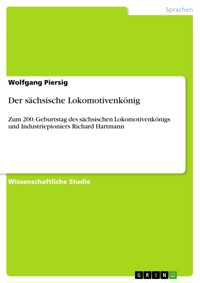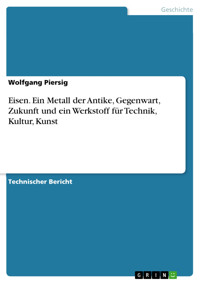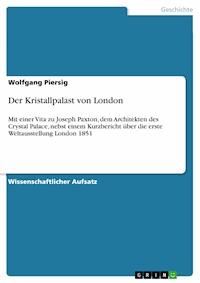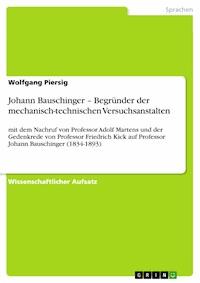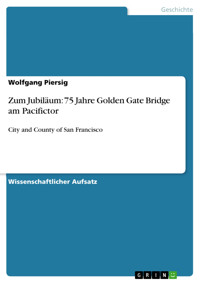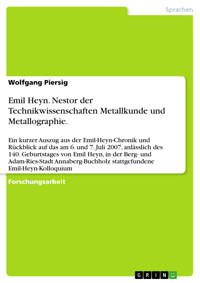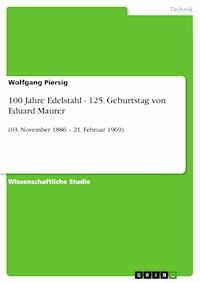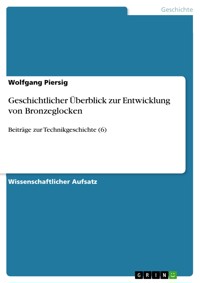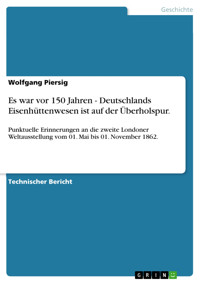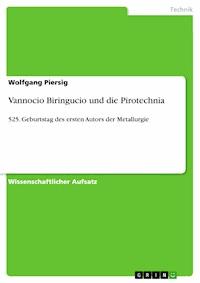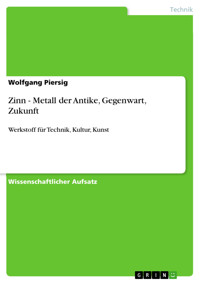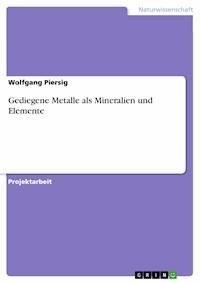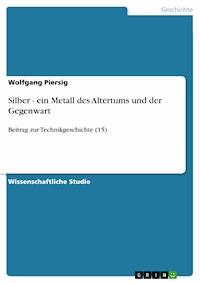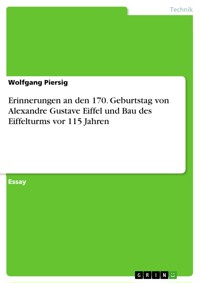Kurzgefasstes zum Bergbau, Montan- und Hüttenwesen, zur Bergmannssprache, montanen Kulturlandschaft Erzgebirge/Krušnohoří und mehr E-Book
Wolfgang Piersig
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Projektarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Ingenieurwissenschaften - Bergbau, , Sprache: Deutsch, Abstract: In der Arbeit geht es um ausgewählte Themen des Bergbaus, Montan- und Hüttenwesens, den Wortlaut des Bergmannsliedes, den Inhalt, die Wurzeln und Geschichte des über 400 Jahre alten schönen Bergmannsgrußes Glück auf sowie die berufsspezifische Bergmannssprache, die zu den ältesten Fachsprachen gehört und schon aus dem 13. Jh. mit Ausdrücken belegt ist. Eingebunden sind auch Lexika zum Bergbau, Montan- und Hüttenwesen sowie Sammlungen von bedeutenden Begriffen der Abbautechnik, des Hüttenwesen, der Metallurgie. Dazu gibt die (nur unvollständig erarbeitbare) Aufstellung von stillgelegten Bergwerken in Deutschland einen historisch-regionalen Überblick über ehemalige bedeutungsvolle deutsche Bergwerke. Überdies zeigen Listen sowohl die aktiven (aktuell fördernden) Bergwerke in Deutschland wie auch die in Betrieb befindlichen Schaubergwerke. Vermittelt wird, dass die Bergstädte städtische Siedlungen sind, deren Entwicklung mit dem Bergbau in Verbindung steht und, dass es bereits im hohen Mittelalter Städte gab, deren Aufschwung mit dem Abbau von Bodenschätzen in Verbindung stand, beispielsweise Goslar (Rammelsberg seit 968), Freiberg in Sachsen (seit 1168/70) sowie Iglau und Kuttenberg (seit dem 12. Jh.) in Böhmen. Auch die Bergheiligen des Bergbaus finden eine reichliche Erwähnung und opulente Erläuterung. Dazu mit einbezogen sind Angaben über die sächsisch-böhmischen Bestrebungen zur Erlangung des UNESCO-Welterbetitels für die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří, eine in über 800 Jahren entstandene Industriekulturlandschaft in der Grenzregion zwischen Sachsen und Nordböhmen. In mehreren Abschnitten wird genannt, wie diese montane Region von einer Vielzahl historisch weitgehend erhaltener Denkmäler und zahlreicher mit dem Montanwesen in Verbindung stehender Einzeldenkmale und Sachzeugnisse geprägt ist. Damit wird die weltweit einzigartige Identität und Authentizität dieser Erzgebirgsregion beiderseits der deutsch-tschechischen Grenze mit herausgestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis.
Einleitung.
Das Bergmannslied: >Glück auf< [1].
Die Themengebiete des Bergbaus.
Charakteristisches zum Bergbau [1-20].
Der Bergmannsgruß Glück auf [nach 1 bis 17, s. S. 7].
Das Montanwesen.
Das Lexikon des Montanwesens.
Zusammenstellung von bedeutenden Abbautechnikbegriffen [1].
Die Montanindustrie.
Signifikante Begriffe des Hüttenwesens.
Bezeichnende Begriffe der Metallurgie [1].
Definition für eine Bergstadt (privilegierte Bergbausiedlung) [1, 2].
Verzeichnis bekannter historischer Bergstädte geordnet nach Ländern [1, 3].
Zusammenstellung allgemeiner Bergbaubegriffe.
Aufstellung über alte Erzbezeichnungen [1, et al.]
Die Bergmannssprache.
Das Bergmannssprache ABC.
Die Bergmannswerkzeuge.
Bergbau - Werkzeuge des Bergmanns. Werkzeuge, Ausrüstung, Fördermittel, Ausbaumaterialien [↑1].
Montane Kulturlandschaft Erzgebirge/Krušnohoří.
Silberstadt Freiberg – Lebendige Bergbautradition und kulturelle Schätze.
Bergstadt Annaberg-Buchholz.
Bergstadt Marienberg.
Bergstadt Schneeberg.
Kurzer Abriß über die Verehrung von Bergbauschutzpatronen [1].
Schutzpatrone für Berufe [1].
Weiterführende Literatur.
Abkürzungen.
Vita des Autors.
Die Veröffentlichungen des Autors.
Abstract.
Einleitung.
In der Arbeit geht es um ausgewählte Themen aus den Gebieten Bergbau, Montan- und Hüttenwesen. Eingebunden sind auch der Wortlaut des >Bergmannsliedes< sowie der Inhalt des Bergmannsgrußes >Glück auf<.Dabei aufgezeigt ist, dass der Ausspruch >Glück auf< zwischen 1556 und 1611 entstand und seine Wurzeln im erzgebirgischen Silberbergbau liegen, von wo aus der nun schon über 400 Jahre alte schöne Gruß Eingang nicht nur in alle Zweige des deutschen Bergbaus und Hüttenwesens fand, sondern sich auch außerhalb des deutschen Sprachraumes etablierte. Ebenso aufgenommen wurden Lexika zum Bergbau, Montan- und Hüttenwesen. Außerdem gehören die Zusammenstellungen von bedeutenden Begriffen der Abbautechnik, des Hüttenwesen sowie der Metallurgie dazu.
Daneben gibt die (nur unvollständig erarbeitbare) Aufstellung von stillgelegten Bergwerken in Deutschland einen historisch-regionalen Überblick über ehemalige bedeutungsvolle deutsche Bergwerke. Aufgenommen ist auch eine vollständige Liste der aktiven (aktuell fördernden) Bergwerke in Deutschland, d.h. Untertageanlagen zur Gewinnung mineralischer Bodenschätze. Ebenso eingebunden ist ein Verzeichnis von Schaubergwerken, die sich noch in Betrieb befinden.
Berichtet wird auch über die Bergmannssprache, eine berufsspezifische Bergbausprache, die zu den ältesten Fachsprachen gehört, welche schon aus dem 13. Jh. mit Ausdrücken belegt ist. Ein Bergmannsprache-ABC und eine sprachliche Zeitreise informieren über ihren Inhalt sowie ihre Entwicklung bis ins 19. bis 21. Jh.
Vermittelt wird außerdem, dass Bergstädte städtische Siedlungen sind, deren Entwicklung in Verbindung mit dem Bergbau steht, die also aufgrund von Bodenschatzfunden gegründet oder umgestaltet wurden.Genannt ist auch, dass es bereits im hohen Mittelalter Städte gab, deren Aufschwung mit dem Abbau von Bodenschätzen in Verbindung stand, beispielsweise Goslar (Rammelsberg seit 968), Freiberg in Sachsen (seit 1168/70) sowie Iglau und Kuttenberg (seit dem 12. Jh.) in Böhmen.
Angesprochen ist ebenso, dass der technische Fortschritt seit dem 15. Jh. und die gestiegene Nachfrage nach Edel- und Halbedelmetallen seit dem 16. Jh. zahlreiche Städteneugründungen mit sich brachte, wie die Städte Schneeberg, Annaberg sowie Marienberg im sächsischen Erzgebirge, Andreasberg im Oberharz, Clausthal im Landkreis Goslar. Sie alle sind deutliche Beispiele für die erste Blütephase des Bergbaus mit ca. 180 bis 200 Bergstädten in Mittel- und Ostmitteleuropa. Obendrein finden die Bergheiligen des Bergbaus eine reichliche Erwähnung und opulente Erläuterung.
Das Bergmannslied: >Glück auf< [1].
Glück auf, Glück auf ! Der Steiger kommt,
und er hat sein helles Licht bei der Nacht,
und er hat sein helles Licht bei der Nacht
schon angezündt, schon angezündt.
Hat’s angezündt, ´s wirft seinen Schein,
und damit so fahren wir bei der Nacht,
und damit so fahren wir bei der Nacht
ins Bergwerk ein, ins Bergwerk ein.
Ins Bergwerk ein, wo die Bergleut‘ sein,
die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht,
die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht
aus Felsgestein, aus Felsgestein.
Der eine gräbt das Silber, der andere gräbt das Gold.
Und dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht,
und dem schwarzbraunen Mägdelein bei der Nacht
dem sein sie hold, dem sein sie hold.
Ade, Ade! Herzliebste mein!
Und da drunten in dem tiefen, finstren Schacht bei der Nacht,
und da drunten in dem tiefen, finstren Schacht bei der Nacht,
da denk ich dein, da denk ich dein.
Und kehr‘ ich heim zur Liebsten mein,
dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht:
dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht:
Glück auf, Glück auf !!! Glück auf, Glück auf !
Wir Bergleut‘ sein, kreuzbrave Leut‘,
denn wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht,
denn wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht
und saufen Schnaps, und saufen Schnaps!
Die Themengebiete des Bergbaus.
Das Kapitel beinhaltet dreizehn Themengebiete des Bergbaus und zwar die Gebiete:
Charakteristisches zum Bergbau.
Der Bergmannsgruß Glück auf
Zusammenstellung bedeutender Abbautechnikbegriffen.
Das Montanwesen.
Lexikon des Montanwesens.
Montanindustrie.
Signifikante Begriffe des Hüttenwesens.
Bezeichnende Begriffe zur Metallurgie.
Bergstadt.
Die historischen Bergstädte geordnet nach Ländern.
Zusammenstellung der Bergbaubegriffe.
Aufstellung der allgemeinen Begriffe des Bergbaus.
Erfassung der alten Erzbezeichnungen.
Nennung und Erläuterung der alten Maße des Bergbaus.
Die Bergmannssprache.
Angaben zum Bergrecht und zur Ordnung.
Aufzählung der Bergbauberufe.
Nennung und Beschreibung der Werkzeuge des Bergmanns.
Aufstellung von ausgewählten Besucherbergwerken.
Der erste bisher bekannt gewordene Bergbau entstand um 6000 BC, welcher in der Vorzeit ausschließlich dem Abbau von Feuerstein diente. Nachfolgendend wurden zahlreiche Bergbaue zum Gewinnen sowohl nützlicher Gesteine und Mineralien wie auch Erze errichtet.
Charakteristisches zum Bergbau [1-20].
Der Bergbau ist ein Teil der Montanindustrie [1]. Als Gewinnung [2] im Bergbau [1] gilt das Herauslösen von nutzbaren Rohstoffen [3], also unverarbeiteter natürlicher Ressourcen [3], aus festem Gebirge [4] einer Lagerstätte [2, 5] mittels technischer Anlagen und Hilfsmittel [1]. Österreich bezeichnet das Gewinnen nützlicher Mineralien [6] auch als >Erobern< [7].
Im Bergbau und in der Geologie [8] markiert Exploration [9] die Suche oder die Erschließung (genaue Untersuchung) von Lagerstätten [10] und Rohstoffvorkommen [11] in der Erdkruste [12]. Die Explorationsgeologie ist ein Teilbereich der Lagerstättenkunde [13] innerhalb der Geowissenschaften [14]. Aus historischer Sicht ist Exploration einer der relevanten Vorläufer der geologischen Forschung, da schon seit der Vorzeit eine Vielzahl an Bodenschätzen [15] mehr oder weniger systematisch erschlossen und ausgebeutet wurde. Haupterkundungen der Explorationsgeologie sind Lagerstätten und Vorkommen (zunehmend in der Tiefsee) von: Erdöl, Erdgas, Kohle, Erz, Geothermie [16] wie auch die Grundwassererschließung [9].
Die Lagerstätte [10] ist ein Begriff aus der angewandten Geologie und dem Bergbau für bestimmte Bereiche der Erdkruste [12], in denen sich natürliche Konzentrationen von festen, flüssigen oder gasförmigen Rohstoffen befinden, deren Abbau sich wirtschaftlich lohnt (bauwürdige [17] ist), oder zukünftig sich lohnen könnte (nutzbare Lagerstätte). Vorkommen nutzbarer Erze, Mineralien, Gesteine, deren Abbau unwirtschaftlich ist, sind Vorkommen, juristisch betrachtet Bodenschätze [15]. Besteht Bauwürdigkeit, so wird aus dem Vorkommen eine Lagerstätte. Definiert ist sie in der 1958er >Bergbaukunde< von Fritz Heise, Friedrich Herbst, Carl Hellmut Fritsche: „Bauwürdig ist eine Lagerstätte, wenn ihr Abbau wirtschaftlich möglich ist, d. h. wenn sich das betriebsgebundene Kapital angemessen verzinst“ [18].
Heutzutage gehören zum Bergbau das Markscheidewesen, die Bewetterung, Wasserhaltung, Knappschaftskassen, Spezialausbildung (Bergakademien), Bergaufsichtsbehörden.Geregelt ist er in Deutschland im Bundesberggesetz, Österreich: Montanbehörde, Schweiz: Kantonen.Er besitzt mit der Bergmannssprache wohl eine der ältesten Fachsprachen mit eigenen oder abgewandelten Termini, die Mitte des 19. Jhs. über 10.000 Wörter hatte. [19], [20].
[1] Bergbau.https://de.wikipedia.org/wiki/Bergbau. [2] Gewinnung (Bergbau). https://de.wikipedia.org/wiki/Bergbau Gewinnung (Bergbau). [3] Rohstoffe.https://de.wikipedia.org/wiki/Rohstoff. [4] Gebirge (Bergbau),https://de.wikipedia.org/wiki/Gebirge_(Bergbau). [5] Bischoff, W.; Bramann, H. (1988): Das kleine Bergbaulexikon. Essen: Verlag Glückauf GmbH. [6] Mineral.https://de.wikipedia.org/wiki/Mineral. [7] Scheuchenstuel, C.v. (1856): IDIOTICON der öst. Berg- u. Hüttensprache. Wien: HBH Wilhelm Braumüller. [8] Geologie.https://de.wikipedia.org/wiki/Geologie. [9] Exploration (Geologie).https://de.wikipedia.org/wiki/Exploration_(Geologie). [10] Lagerstätte.https://de.wikipedia.org/wiki/Lagerstätte. [11] Rohstoffvorkommen.https://de.wikipedia.org/wiki/Rohstoffvorkommen. [12] Erdkruste.https://de.wikipedia.org/wiki/Erdkruste. [13] Lagerstättenkunde.https://de.wikipedia.org/wiki/Lagersttätenkunde. [14] Geowissenschaften.https://de.wikipedia.org/wiki/Geowissenschaften. [15] Bodenschatz..https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenschatz. [16] Geothermie.https://de.wikipedia.org/wiki/Geothermie. [17] Bauwürdigkeit (Bergbau).https://de.wikipeia.org/wiki/Bauwürdigkeit_(Bergbau). [18] Heise, F.; Herbst, Fr.; Fritzsche, C. H. (1958): Lb. Bergbaukunde. B. GÖ. HD: Springer. [19] Bergmannssprache.https://de.wikipedia.org/wiki/Bergmannssprache. [20] Bergmannssprache. Wörterbuch von A-Z. historischer Bergbau. Bergmännische Fachausdrücke.http://www.miner-sailor.de/bergmannssprache.htm.
Der Bergmannsgruß Glück auf [nach 1 bis 17, s. S. 7].
Eigentlich ist der Gruß „Glück auf!“ ist mehr als „Viel Glück!“ oder „Good luck!“ [1]. So ist er im deutschen Bergbaubereich bzw. Sprachgebiet dieser alte Bergmannsgruß „Glückauf“ alltäglich und üblich. Mit ihm grüßen sich in diesen Regionen nicht nur Bergakademisten, sondern er wird oft auch von anderen Berufsgruppen benutzt. Dazu wird er auch zu offiziellen Anlässen und als schriftliche Grußformel verwendet. Der Gruß ist jedoch nicht so alt wie andere bergmännische Gepflogenheiten. Sein Ursprung liegt noch nicht sicher belegt im 16. Jahrhundert im sächsischen Erzbergbau, dem wohl mit ältesten und wichtigsten europäischen Bergbaugebiet, als da der Bergbau auf Silber in Blüte stand [2], [3 mit 10 bis 14]. Schriftlich erwähnt wurde dieser Gruß zuerst 1575 im sächsisch-erzgebirgischen Eibenstock. Gemeint war damit „Das Glück tue sich dir auf!“ wie auch später „Mit Glück wieder herauf“ mit gesunder Heimkehr aus dem finsteren Schacht [1]. Als Zeugnis gilt, dass sich da schon die Bergleute „Glückauf“ zugerufen haben eine Bergpredigt vom Prediger Christian Mann, die von ihm am 3. Trinitatis-Sonntag 1615 in Eibenstock gehalten wurde. Er selbst war da seit 1589 amtierender Pfarrer dieses Ortes. Er kannte bereits zu dieser Zeit den Bergmannsgruß „Glück auf“ als bergmännischen Ausruf der Eibenstocker Bergleute und hat diesen in seiner Predigt benutzt. Ebenso erwähnt er in dieser Predigt eine Luther-Anekdote. Danach haben im Jahre 1542 zwei Brüder aus Sankt Joachimsthal (heute: Jáchymov, CZ) den Reformer in Wittenberg besucht. Dabei erwähnten sie u.a. ihre schwere Schuldenlast, die beim Zechen entstanden war. Darauf sagt Martin Luther (1483-1546), der theologische Urheber der Reformation und Theologieprofessor, sinngemäß zu ihnen, dass sie am glücklichsten wären (d.h. keine Schulden machen könnten), wenn sie am ärmsten seien. Das klang in damaliger Sprache folgendermaßen: „Ihr lieben Bergleute / euer Glück / das jhr jimmer ausschreit / blühet am besten, wenn jhr am ärmsten seys …“. „Luther hat also den Bergleuten das Glückauf zugeschrieben und hat damit ist nachgewiesen, dass es bei den erzgebirgischen Bergleuten schon im 16. Jh. üblich war, das „Glückauf“ auszurufen“ [3 mit 10 bis 14]. Als evident gilt auch das vom Freiberger Bergstudenten Theodor Körner (1791 bis 1813) stammende „Glück auf der guten Sache“, der damit wohl an den Kampf für die Freiheit gedacht hat, wofür er 1813 sein Leben ließ [1]. Der deutsche Rechtswissenschaftler und Ökonom Professor Simon Petrus Gasser (1676 bis 1745) berichtet über die Verwendung vom „Glück auf!“ [4]. Zurzeit des berühmten Montangelehrten des Mittelalters Georgius Agricolas (1494/1555) ist in seinem berühmten Werk „De re metallica“ (1556) zum „Glückauf“ noch nichts zu finden [16]. Als Grußwort wird es 1670 zum Gregoriusfeste in Freiberg verwendet [2]. 1678 taucht es anlässlich eines bergmännischen Aufzuges in Schneeberg auf. In Marienberg war „Glück auf“ damals auch üblich. Belegt ist, dass es 1672 in Johanngeorgenstadt und im Freiberger Revier in Anwendung stand. Vom Erzgebirge aus breitete es sich schnell auch auf andere Länder und Bergbaugebiet aus, wie im Harz als Grubennamen (1680) und in Thüringen als Gruß (1681).
Einige Antworten zur Bedeutung von „Glückauf“ gibt u.a. das bekannte „Bergbuch“ [5] vom Freiberger J. U. Doctore Bergassessor Christoph Herttwig aus dem Jahre 1734, in dem er schreibt: „Glück auff! ist der Bergleute gewöhnlicher Gruß. Und würden sie sehr übel empfinden, wenn einer sagen wolte: Glück zu. Indeme die Klüffte und Gänge sich nicht zu, sondern auffthun müssen.“ [5], [6. §. 1.] sowie „Bißweilen gebrauchen sich die Bergleute bey ihren Zusammenkunfften auch wohl dieses Grusses: Glück auff! Alle mit einander, Bergmeister, Geschworne, Steiger, Schlegel, Gesellen, wie ihr hier versammlet seyd. Mit Gunst bin ich auffgestanden, mit Gunst setze ich mich wieder nieder, grüssete ich das Gelag nicht, so wäre ich kein ehrlicher Bergmann nicht.“ [5], [6. §. 2], [7 i. 6] [8 i. 6].
Es gibt aber auch andere Deutungen, nämlich: „Glück! Tu’ mir den Gang auf!“ sowie „Bergmann! Ich wünsche Dir Glück, der Gang tue sich Dir auf!“ bzw. „Ich wünsche Dir viel Erfolg und dass Du bei Deiner Arbeit auf reiche Erze stoßen mögest.“
Als Fazit gilt sowohl:
„Dieser schöne und nun über 400 Jahre alte Gruß fand Eingang in alle Zweige des Bergbaus und des Hüttenwesens. Das „Glückauf“ halt sich weltweit nicht nur im Bergbau sowie im Hüttenwesen und in der Metallurgie als Gruß etabliert, sondern auch in der Erdölindustrie ist er zur ständigen Gussform geworden. Erwähnenswert ist aber auch, dass in der 1. H. des 18. Jhs. „Glückauf“ neben „Weidmannsheil“ auch als Jägergruß Verwendung fand. Obwohl „Glückauf“ schon frühzeitig auch im barocken höfischen Umkreis in Sachsen gebraucht wurde, hat es sich später jedoch ganz überwiegend nur im Bergbau-Umfeld bis auf den heutigen Tag behauptet.“ [2] wie auch:
„Glück auf!“ ist der beständige, zu jeder Tageszeit ausgesprochene Bergmannsgruß bei der Arbeit, beim Ein- und Ausfahren, beim Begegnen der Vorgesetzten und der Bergleute etc. und bei sonstigen Gelegenheiten, demnach sagt der Bergmann statt guten Morgen, guten Tag, guten Abend bloß: „Glück auf!“. Weiter wird da dazu ausgeführt: „Das „Glück auf" des einfahrenden Knappen, und das: „Komm gesund wieder!" des Dankenden, der „über Tag" bleibt, das „Macht gesund Schicht!" des von der Arbeit Abgelösten, und der Wunsch des Andern: „Fahre gesund aus"! finden sich überall in den deutschen Bergrevieren [9].
[1] „Glück auf!“ ist mehr als „Viel Glück!“ oder „Good luck!“.http://tu-freiberg.de/universitaet/ressourcen-universitaet. [2 u.w., s.S. __] Heilfurth, G. (1958): Glückauf! Geschichte, Bedeutung und Sozialkraft des Bergmannsgrußes. E: Glückauf.[3] Hiery, K.: Damals – Grube Jägersfreude.Wir sagen „Glückauf“ von Klaus Hiery (*1946), Präsident d. Landesverbandes Saar der Berg-, Hütten- u. Knappschaftsvereine des SL e.V.Rodēna Heimatkundeverein Roden e.V.https://www.facebook.com/RodenaHeimat/posts[...].[4] Gasser, S. P. (1729):Einleitung zu den oeconomischen, politischen u. Cameral-Wissenschaften nebst einem Vorbericht von der Fundation der neuen oeconomischen Profession. S. 269. HAL (a.S.): Buchhandlung des Waysenhauses.[5] Herttwig, Chr. (1734):Neues u. Vollkommenes Berg-Buch, Bestehend in sehr vielen u. raren Berg-Händeln, Und Bergwercks-Gebräuchen, Absonderlich aber über 200. vorhin noch nicht edirten und ans Licht gegebenen Berg-Urtheln u. Abschieden ..., S. 187. DD. L: V bey Joh. Christ. Zimmermañs sel. Erben, und J. N. Gerlachen.[6] §. 1. Eisenhart, J. (1690): De regali metallifodinarum argentaria. cap. 1. §. 3. i. [5]. L: [7] Meltzer, Chr.(1680): Dissertatio de Hermundurorum Metallurgia Argenentaria. part. spec. cap. 1. §. 23. i. [6], S. 39 f., S. 221.L: Johannis Georgi [8] Berward, Chr. (1673): Interpres phraseologiæ metallurgicæ F.a.M.: Verlegung: Johann David Zunners. 41. i. [6]. [9] Erklärendes WB (1869) der im Bergbau: in der Hüttenkunde u. in Salinenwerken vorkommendentechnischenKunstausdrücke u. Fremdwörter. S. 69 u. 172/176. Burgsteinfurt: Verlag der Falkenberg’schen Buchhandlung.[10 i. 3] Bersch, W. (1898, Reprint 1985): Wien. Pest. L: A. Hartleben u. Reprint. D: VDI-Verlag. [11 i. 3] Heilfurth, G (1958): „Glückauf! Geschichte, Bedeutung u. Sozialkraft des Bergmannsgrußes“. E: Glückauf. [12 i. 3] Kube, E (1960): „Der bisher früheste Beleg für Bergmännisches Glückauf“. DD: Henschel Verlag. [13 i. 3] Piersig, W. Drum sagen wir: „Glückauf! [14 i. 3] Kasig, W.: Zur Herkunft des Bergmannsgrußes „Glückauf“. AC. [15] Kohnen, R. (2007): Glückauf ist unser Bergmannsgruß. Bergmännisches Lesebuch zum Aachener Steinkohlenrevier. BBM Wurmrevier.[16]Knappenverein Glückauf-Südkamen 1901.Der Bergmannsgruß.http://www.glueckauf-suedkamen.de/gruss.shtml.[17] Kutzsche, K. (1988): Der Ursprung des Bergmannsgrußes. StuE. 22/88.
Das Montanwesen.
Das Montanwesen bezeichnet den wirtschaftlichen und technologischen Sektor, der sich mit der Erdkruste, ihren Ressourcen, natürlichen Gegebenheit beschäftigt. Montanistisch werden alle bergbaubezogene Sachverhalte bezeichnet: Berg-, Hütten-, Gesteinshüttenwesen, ebenso dazu gehört die Erdwärmegewinnung (Geothermie) [1-3]. Nach [2] hat es folgenden Umfang: „Zum Montanwesen gehören das Bergwesen (Angelegenheiten des Arbeitens mit Gestein), Hüttenwesen (als Gewinnung und Verarbeitung der Erze, Erden und Salze) und Gesteinshüttenwesen (Gewinnung und Verarbeitung sonstiger nichtmetallischer mineralischer Rohstoffe
das traditionelle Berg- und Hüttenwesen als Teil der Schwerindustrie, in Überschneidung zur Verfahrenstechnik wie auch technischen Chemie, im Speziellen der Metallurgie
die Gewinnung von mineralischen Rohstoffen, also den klassischen Bergbau der Lagerstätten, inklusive der Salzgewinnung (Salinenwesen) und dem Abbau von Erden, Sanden, Schotter und Kiesen und anderen Baustoffen, sowie deren primäre Verarbeitung;die über und untertägigen Abbauverfahren für andere feste, flüssige und gasförmige Rohstoffe, einschließlich der Gewinnung der Energierohstoffe Erdöl und Erdgas (Erdölwesen) wie auch Erdwärme (Geothermie); die Gewinnung von Wasser aus Lagerstätten
das industrielle und nichtindustrielle Aufspüren und Gewinnen von Bodenschätzen wie Schmuck- und Edelsteinen, das Steinsammeln und Sammeln von Fossilien zu wissenschaftlichen und gewerblichen Zwecken
den Tunnelbau und Bau unterirdischer Anlagen im Gestein (Kavernenbau, Hohlraumbau) als Fachbereich des Tief- und Grundbaus
das militärische Mineur- und Sappeurwesen, als Truppengattung der Pioniere
das Deponiewesen und die Technologie unterirdischer Speicher aller Art
die gesamten Grundlagen der Montanwissenschaften (Montanistik), vom Markscheidewesen über Montankartographie bis zu den Werkstoffwissenschaften, als interdisziplinäres Fachgebiet der theoretischen und angewandten Geowissenschaften mit den technischen Wissenschaften
die gesamte Rechtsmaterie des nationalen und internationalen Bergrechts, die einschlägige Rohstoffpolitik und die Montanraumordnung
die Montangeschichte als Kulturgeschichte des Berg-, Hütten- und Salinenwesen“.
[1] Das Montanwesen. Wikipedia.https://de.wikipedia.org/wiki/Montanwesen