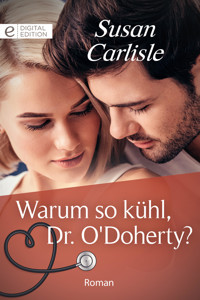2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Digital Edition
- Sprache: Deutsch
Scheich Tariq Al Marktum hat noch nie eine Frau so begehrt wie die schöne Dr. Laurel Martin. Er spürt genau, sie ist die richtige Ärztin für sein Land. Ein Grund mehr, sie in seinem Wüstenreich zärtlich zu verwöhnen. Aber dann macht Tariq einen schweren Fehler …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
IMPRESSUM
Küss mich, meine Wüstenbraut! erscheint in der HarperCollins Germany GmbH
© 2019 by Susan Carlisle Originaltitel: „The Sheikh Doc’s Marriage Bargain“ erschienen bei: Mills & Boon Ltd., London Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l.
© Deutsche Erstausgabe in der Reihe JULIA PRÄSENTIERT ÄRZTE ZUM VERLIEBENBand 139 - 2020 by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg Übersetzung: Susanne Albrecht
Umschlagsmotive: LanaStock/Ghulam Hussain/Stoiushko/GettyImages
Veröffentlicht im ePub Format in 03/2021 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.
E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783751506274
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, JULIA, ROMANA, HISTORICAL, TIFFANY
Alles über Roman-Neuheiten, Spar-Aktionen, Lesetipps und Gutscheine erhalten Sie in unserem CORA-Shop www.cora.de
Werden Sie Fan vom CORA Verlag auf Facebook.
1. KAPITEL
Sorgfältig stellte Dr. Laurel Martin ein Teströhrchen in das Gestell, wobei ihr Pulsschlag sich vor gespannter Erwartung beschleunigte. Das könnte er sein – der Durchbruch, dem sie ihr gesamtes Berufsleben gewidmet hatte. Ein Prozess, um die Mutation des Faktor-IX-Gens im X-Chromosom zu verhindern. Wenn man ihn schon während der Schwangerschaft testen und korrigieren könnte, würde dies Tausende von Leben verändern, wenn nicht sogar retten. Der Schlüssel lag darin, das Bindeglied zu entdecken.
Um die Lösung zu finden, brauchte Laurel Fördermittel. An solche Gelder kam man nicht so leicht heran. Man hatte ihr bereits mitgeteilt, dass ihre Mittel bald ausliefen. Aber sie hatte sich für weitere Zuschüsse beworben und sollte diesbezüglich bald Bescheid bekommen.
Die Erforschung der Hämophilie war zu ihrer Lebensaufgabe geworden. Während des Medizinstudiums hatte sie schnell gemerkt, dass sie sich im Kontakt mit Patienten und ihren Angehörigen nicht besonders wohlfühlte. Es fiel ihr schwer, schlechte Nachrichten zu überbringen. Da sie ohnehin eher introvertiert war, hatte sie sich der Forschung zugewandt, was ihr mehr Sicherheit gab.
Da klopfte jemand ans Laborfenster. Laurel schob ihre Schutzbrille hoch. Stewart, der Labordirektor, stand auf der anderen Seite der Glasscheibe. Obwohl mittelgroß, wirkte er im Vergleich zu dem hochgewachsenen, schlanken Mann neben ihm eher klein.
Laurels Herz schien kurz auszusetzen, ehe es sich wieder beruhigte. Der Fremde sah umwerfend aus. Eine solche Reaktion hatte sie seit Jahren bei keinem Mann mehr gespürt. Zumindest nicht mehr seit dem College, seit sie ihren Exfreund Larry zum ersten Mal gesehen hatte. Als College-Football-Spieler war er ebenfalls unglaublich attraktiv gewesen. Doch Laurel hatte auf die harte Tour lernen müssen, dass gutes Aussehen nicht unbedingt bedeutete, dass derjenige auch ein guter Mensch war.
Der Mann neben Stewart schien aus dem Mittleren Osten zu stammen. Seine Haut besaß einen warmen, bronzefarbenen Ton, als wäre er oft der Sonne ausgesetzt. Seine stolze Haltung verlieh ihm die gebieterische Ausstrahlung eines Mannes, der seinen Platz in der Welt kannte. Das schwarze, maßgeschneiderte Jackett, unter dem man breite Schultern erkannte, passte zu seinem Haar und dem ebenso dunklen, makellos gepflegten Bart. Seine gesamte Erscheinung war ein Ausdruck von Reichtum und Macht. Er sah Laurel direkt an.
Erstaunlicherweise waren seine Augen nicht tintenschwarz, sondern kastanienbraun. Es erinnerte sie an die Farbe eines Rennpferdes, das sie als Mädchen mal gesehen hatte. Der Unbekannte hob leicht die geschwungenen Augenbrauen, als wüsste er von seiner Wirkung auf Frauen, sodass Laurels Reaktion ihn nicht überraschte.
Während sein Blick sich in ihren zu bohren schien, kam sie sich plötzlich wie eine ihrer Laborproben unter dem Mikroskop vor. Das Gemeine daran war, dass er der Typ Mann war, zu dem sie sich schon immer hingezogen gefühlt hatte. Der Typ, der immer an ihr, dem unscheinbaren, allzu ernsthaften und viel zu intelligenten Mädchen vorbeigeschaut hatte. Und stattdessen zu einer großen Blondine mit vollen Brüsten, langen Beinen und einem verführerischen Kichern, die genau hinter ihr stand.
Männer bemerkten Laurel im Allgemeinen gar nicht. Das einzige Mal, als es doch geschah, war für sie traumatisch verlaufen. Larry hatte sie so tief verletzt, dass sie geschworen hatte, sich nie wieder auf einen Kerl einzulassen, und diesen Schwur auch zehn Jahre lang durchgehalten hatte. Lange genug, um sich derart in ihre Arbeit zu vertiefen, dass sie kaum ein eigenes Leben außerhalb des Labors führte. Energisch schüttelte sie diese Gedanken ab. All das hatte nicht das Geringste mit dem Mann hier vor ihr zu tun.
Als Stewart ihr mit einer Handbewegung bedeutete, dass sie aus dem Labor kommen sollte, lenkte dies ihre Aufmerksamkeit von dem eindrucksvollen Fremden ab. Laurel kontrollierte die Teströhrchen noch einmal und schob dann das Gestell etwas weiter von der Tischkante weg, ehe sie ihren Stuhl zurückrollte. Sobald sie den Raum verließ, schloss sich mit einem leichten Zischen der Luftschleusendichtung die Tür hinter ihr. Im Vorraum nahm sie die Schutzbrille ab und rückte ihre eigene Brille zurecht. Danach streifte sie Maske, Handschuhe und Kittel ab, bis sie in einem schlichten T-Shirt und Jeans dastand.
Als sie in einen frischen Laborkittel schlüpfte, berührte Laurel kurz ihren Nackenknoten, um sicherzugehen, dass er richtig saß. Wie ihr ein Blick über die Schulter zeigte, hatte der Fremde sie nicht aus den Augen gelassen. Unwillkürlich stieg Hitze in ihr auf, was sie nur noch mehr durcheinanderbrachte. Was mochte der Mann sehen oder denken?
Rasch verdrängte sie diese seltsame Reaktion und ging weiter zum Hauptlabor. Erst als sie die Männer erreichte, bemerkte sie die zwei großen Gestalten ein paar Schritte hinter dem Unbekannten. Wie hatten ihr diese einschüchternden Typen entgehen können? Nur deshalb, weil ihre Reaktion auf den Mann davor sie so in Beschlag genommen hatte. Die beiden anderen waren größer, breitschultriger und besaßen einen noch grimmigeren Gesichtsausdruck. Die Finger vor sich verschränkt, hatten sie die Beine leicht auseinander gestellt, um sofort einsatzbereit zu sein, falls nötig. Wer sind diese Leute, und was wollen sie von mir? fragte sich Laurel.
Schnell steckte sie ihre bebenden Hände in die Kitteltaschen und sah Stewart fragend an.
„Laurel, dies ist Prinz Tariq Al Marktum. Er möchte gerne mit dir reden.“ Stewart sprach den ungewohnten Namen so sorgfältig aus, als hätte er ihn vorher geübt, um nicht ins Stocken zu geraten.
Was konnte denn ein Prinz von ihr wollen? Von einer Laborratte, wie ihre Geschwister sie häufig bezeichneten.
„Worüber?“, fragte sie daher verblüfft.
„Das würde ich gerne unter vier Augen besprechen“, antwortete Prinz Tariq in einer tiefen, samtweichen Stimme, die jedoch einen stählernen Unterton enthielt.
Argwöhnisch krauste Laurel die Nase. „Stewart, worum geht es hier?“
„Der Prinz wird es dir erklären. Komm, wir gehen in mein Büro.“ Er wandte sich ab und strebte auf die Schwingtür zu, die das Hauptlabor von den Büroräumen trennte.
Da ihr der Prinz den Vortritt ließ, ging Laurel ihm steif voran. An der Schwingtür trat er schnell vor sie, um ihr eine Seite aufzuhalten. Laurel warf ihm einen raschen Seitenblick zu, doch seine undurchdringliche Miene verriet nicht das Geringste. Mit so jemandem würde sie nur ungern täglich zu tun haben. Woher sollte sie jemals wissen, was er dachte oder fühlte?
Auf dem Weg durch den gefliesten Korridor verursachten ihre flachen Schuhe ein leises Geräusch, doch hinter sich hörte sie gar nichts. Wie konnten sich so große Männer mit einer solchen Geschmeidigkeit bewegen? Ein unbehaglicher Gedanke.
Mit seiner Karte öffnete Stewart sein Büro und stieß die Tür auf. Laurel ging hinein, in der Annahme, dass er ihr folgen würde. Stattdessen kam lediglich Prinz Tariq herein, der die Tür hinter sich schloss. Durch seine Anwesenheit schien der ohnehin schon kleine Raum noch mehr zu schrumpfen. Die Hände in den Kitteltaschen, sah Laurel ihn an und wappnete sich innerlich.
„Bitte, Dr. Martin, nehmen Sie Platz.“
„Nein, danke. Ich muss so schnell wie möglich wieder ins Labor zurück.“ Dort fühlte sie sich wenigstens sicher. „Wie kann ich Ihnen helfen?“
„Bitte setzen Sie sich.“ Der Tonfall des Prinzen ließ ihr keine Wahl.
Zögernd folgte sie der Aufforderung, und er nahm auf dem anderen Stuhl Platz.
Die Hände auf dem Schoß, wartete Laurel ab.
„Dr. Martin, ich würde Sie gerne nach Zentar mitnehmen.“
„Was?“ Sie sprang auf. Hatte dieser Kerl den Verstand verloren? Wieso hatte Stewart einen Verrückten ins Labor gelassen?
Der Prinz hob die Hand. „Hören Sie mich erst einmal an. Bitte.“
Fassungslos sank Laurel wieder auf ihren Stuhl zurück und warf einen beunruhigten Blick zur Tür.
„Ich versichere Ihnen, Ihnen wird nichts geschehen. Ich wollte damit nur sagen, dass ich Ihnen gerne eine Stelle anbieten würde“, erklärte der Prinz. „Eine Chance, Ihre Forschungen fortzusetzen.“
Verständnislos schüttelte sie den Kopf. Sie hatte bereits einen Ort für ihre Forschung, bei der sie kurz vor dem Durchbruch stand. Ihre Familie lebte in der Nähe. Laurel führte ein geordnetes, verlässliches Leben und hatte kein Interesse daran, irgendwo anders zu arbeiten. „Danke, aber ich habe hier bereits eine Stelle.“
„Meinen Informationen zufolge sind Sie die führende Forscherin auf dem Gebiet der Hämophilie. Ich bin der Gesundheitsminister von Zentar und habe ein Labor nach den allerneuesten technischen Standards bauen lassen“, erwiderte er. „Ich möchte, dass mein Land mit an vorderster Stelle daran beteiligt ist, eine Heilung für diese Erkrankung zu finden.“
Ach ja? Damit hatte er Laurels Neugier geweckt.
„Ich habe Erkundigungen über Sie eingezogen und die allerbesten Empfehlungen für Sie bekommen.“
„Vielen Dank, aber ich habe keine Ahnung, wer Sie sind“, entgegnete sie. „Ich schätze Ihr Vertrauen in mich, doch ich bin hier sehr zufrieden. Ich weiß nicht mal, wo sich Zentar befindet.“
Auf einmal blitzte Stolz in seinen dunklen, durchdringenden Augen auf. „Es ist eine Insel im Arabischen Meer. Wir haben herrliche weiße Strände und hohe karge Berge. Wir sind ein unabhängiges, wohlhabendes Land und in vielerlei Hinsicht sehr fortschrittlich. Mein Bruder, der König, hat hart dafür gearbeitet. Dennoch sind wir in gewisser Weise auch noch sehr traditionell.“
„Das klingt schön, aber meine Arbeit ist hier“, sagte Laurel.
Prinz Tariq beugte sich vor. „Ich kann Ihnen alles bieten, was Sie sich nur wünschen. Die allerbeste Ausstattung, Assistenten sowie unbegrenzte finanzielle Mittel.“
„Aber wieso gerade ich? Wieso gerade Hämophilie?“
Er senkte den Blick so lange, bis ihr erneut unbehaglich zumute war. „Ich habe meine Gründe.“ Sein Tonfall klang abweisend.
Sie wollte aufstehen.
Sein Ausdruck wirkte düster, als er sie wieder ansah. „In meinem Land ist Hämophilie ein großes Problem.“
„Ich verstehe.“
Er schien sie mit seinen Augen zu durchbohren. „Da bin ich nicht sicher. Die Anzahl der Kinder, die mit dieser Erkrankung geboren werden, steigt bei uns unaufhörlich an. Als Gesundheitsminister muss ich den Grund dafür herausfinden. Und Sie können mir dabei helfen.“
Offenbar ging der Prinz davon aus, dass Laurel sein Angebot akzeptieren würde, doch das kam für sie nicht infrage. Allein die Vorstellung, in ein Flugzeug zu steigen, ließ sie schaudern. „Das geht nicht.“
„Hält Sie irgendetwas hier?“ Er zog die Brauen zusammen.
„Nein.“
„Also warum dann nicht?“
„Ich fliege nicht.“
Sekundenlang musterte er sie schweigend. „Nie?“
„Nein, nie.“
„Sie würden in meinem Privatflugzeug fliegen, wo Ihnen alle Annehmlichkeiten zur Verfügung stehen“, gab er zurück. „Ich bitte Sie nur darum, dass Sie mitkommen und sich unsere Einrichtung ansehen. Danach können Sie sich entscheiden.“
Als Laurel aufstand, tat er dasselbe. „Vielen Dank für das Angebot, aber ich kann es nicht annehmen. Deshalb sollte ich auch Ihre Zeit nicht länger vergeuden. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss zurück ins Labor.“
Der Prinz presste die Lippen zusammen, und seine Augen wirkten wieder vollkommen unbewegt. Sie hatte einen Mann zurückgewiesen, der es offensichtlich gewohnt war, seinen Willen durchzusetzen. Obwohl es sie große Willenskraft kostete, machte Laurel einen Schritt vorwärts, zwischen die beiden Stühle. Dabei nahm sie einen Hauch seines Zitrus-Aftershaves wahr. Rasch eilte sie zur Tür, wobei ihr unwillkürlich ein Schauer über den Rücken lief. Sie wusste nicht recht, ob dies eine Reaktion auf die Nähe des Prinzen oder auf dessen unmissverständliche Verärgerung war.
„Dr. Martin.“
Sie wandte sich um.
In einem gedämpften, gleichmütigen Ton erklärte er: „Ich habe es mir zum Prinzip gemacht, immer das zu bekommen, was ich will.“
An diesem Abend schenkte Tariq sich in seiner Hotelsuite einen Whisky ein. Ratlos fragte er sich, an welcher Stelle sein Gespräch mit Dr. Martin schiefgegangen war. Sie hatte sich als jemand herausgestellt, der unverblümt seine Meinung äußerte. Das gefiel ihm. Nur wenige Menschen in seiner Umgebung verfolgten keine eigenen Ziele und sagten offen, was sie meinten. Mit ihrer Direktheit hatte Dr. Martin ihn beeindruckt. Und sie hatte es sogar gewagt, ihn zurückzuweisen.
Zu allem Überfluss hatten ihn auch ihre grünen Augen mit dem scheuen Blick in den Bann geschlagen. Groß und klar hinter der Brille mit Silberrand, wirkten sie, als wäre darin niemals irgendein Geheimnis verborgen gewesen. Ansonsten war Dr. Martin eine kleine, unscheinbare Frau. Er war zugleich verärgert und fasziniert. In seiner Welt würde ihm niemand außer dem König jemals etwas verweigern. Doch ein Mauerblümchen, das den größten Teil seines Lebens in einem gläsernen Labor verbrachte, hatte genau das getan.
Auf seinem Sessel streckte Tariq die Beine aus und schwenkte nachdenklich die kupferfarbene Flüssigkeit in seinem Glas hin und her. Es war ihm nicht einmal in den Sinn gekommen, dass diese Frau sein Angebot ablehnen könnte. Welcher Wissenschaftler hätte denn nicht gerne sein eigenes Labor und außerdem noch Zugang zu allen Geldern, die er dafür benötigte? Anscheinend hatte er in Bezug auf Dr. Martin irgendetwas Wichtiges übersehen. Noch hatte er keinen Plan B, aber das war nur eine Frage der Zeit. Er wollte Dr. Martin nach Zentar holen, und das würde ihm auch gelingen.
Nach dem Unfalltod seines Bruders hatte Tariq die Aufgabe übernommen, für das Wohlergehen seiner Schwägerin und seines kleinen Neffen Roji zu sorgen. Tariq hätte alles dafür gegeben, dass Roji mit seinem Vater aufwachsen könnte. Doch das war nicht mehr möglich. Aber kein anderer aus seiner Familie sollte Rojis Schicksal teilen. Die zukünftigen Mitglieder der königlichen Familie würden von Hämophilie frei sein. Irgendwo da draußen gab es ein Heilmittel, und er hatte extra ein Labor gebaut, um es zu finden. Jetzt brauchte er nur noch die richtige Leiterin für dieses Labor, und das war nun mal Dr. Martin.
Obwohl Tariq der einzige Mann in der Familie war, der den Gendefekt nicht besaß, wollte er keine eigene Familie gründen. Er würde keine Frau und kein Kind in dieselbe Situation bringen wie Zara und Roji. Als Mediziner wusste er, dass das Gen über die weibliche Linie vererbt wurde. Was wäre, wenn er sich die falsche Frau aussuchte? Er schleppte ohnehin schon genug Schuldgefühle mit sich herum.
Als kleiner Junge hatte er mitbekommen, was sein Bruder hatte durchmachen müssen. Ständig hatte er nach einer Verletzung Injektionen mit dem fehlenden Gerinnungsfaktor benötigt. Dennoch hatte ihm dies nicht geholfen, als man die Blutung nach dem Autounfall nicht hatte stoppen können. Selbst mit seinem großartigen Harvard-Abschluss war Tariq nicht imstande gewesen, das Leben seines Bruders zu retten. Und mit jedem Tag schien die Last schwerer zu wiegen.
Die bisherigen medizinischen Fortschritte gingen ihm nicht schnell genug. Roji bekam jetzt den intravenös gespritzten Gerinnungsfaktor prophylaktisch alle drei Tage. Trotzdem sollte ein Junge in der Lage sein, problemlos herumzurennen und zu spielen. Das wünschte sich Tariq für seine Familie ebenso wie für andere, die auch unter der Krankheit litten. Dafür brauchte er Dr. Martin. Er musste eine Möglichkeit finden, sie zu überzeugen. Ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnte. Außerdem, wenn er sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, akzeptierte er grundsätzlich kein Nein.
Zwei Tage später griff Laurel beim zweiten Klingeln nach dem Telefon in ihrem Labor.
„Laurel, ich müsste dich mal in meinem Büro sprechen“, erklärte Stewart.
War der Prinz wieder da? Seit dessen Besuch konnte sie an kaum etwas anderes denken. Aus irgendeinem Grund war er ihr im Gedächtnis geblieben. „Gut, dann bin ich in zehn Minuten da.“
Sie klopfte leicht an, bevor sie das Büro betrat. Stewart und sie hatten ein gutes freundschaftliches Verhältnis, seitdem Laurel vor fünf Jahren in sein Labor aufgenommen worden war. Er hatte sie immer ihre Arbeit machen lassen, was sie sehr an ihm schätzte.
„Was ist los?“ Laurel war erleichtert, aber zugleich auch enttäuscht, dass der Prinz nicht hier war. Sie setzte sich, und diesmal wirkte der Raum weniger eng, denn Stewart hatte nicht diese ungeheure Ausstrahlung, die der Prinz besaß.
„Ich fürchte, ich habe keine guten Nachrichten für dich. Die Bewilligung der Fördermittel wurde abgelehnt.“
Laurel erschrak.
„Deine Arbeit war eine Ergänzung für das Labor. Es tut mir leid, aber du kannst nicht weitermachen“, fuhr Stewart mitfühlend fort.
Sie konnte kaum atmen. Ihr Lebenswerk. Was sollte sie jetzt tun? Der Durchbruch war so nahe. „Aber warum, Stewart?“, stieß sie hervor. „Ich habe die Antwort schon fast gefunden. Meine Forschung ist wichtig.“
Stewart nickte. „Ich weiß. Aber die Arbeit von anderen ist genauso wichtig. In der Forschung ist Geld eben immer ein Thema.“
„Gibt es denn keine andere Lösung?“ Es musste doch eine Möglichkeit geben. Es ging schließlich um Menschenleben. „Ich kann jetzt nicht aufhören. Ich bin zu nah dran.“
„So ungern ich das auch sage, aber in unserem Labor wird das nicht passieren“, meinte er bedauernd.
Laurel beugte sich vor. „Das ist einfach nicht richtig! Was ist mit den Menschen, die ich zu retten versuche?“
„Ich wünschte, ich könnte dir etwas anderes sagen, aber damit würde ich dir nur falsche Hoffnungen machen. Vielleicht solltest du das Angebot des Prinzen doch annehmen. So wie ich es verstanden habe, war es sogar ein ziemlich beeindruckendes Angebot. Mit etwas Glück ist es noch nicht zu spät dafür“, antwortete Stewart.
Misstrauisch sah Laurel ihn an. „Der Prinz hatte nicht zufällig was damit zu tun, oder?“
„Nicht, dass ich wüsste. Aber er kennt sicher einige Leute im Finanzausschuss. Die meisten Forscher wären froh über eine so wunderbare Gelegenheit“, sagte er.
„Ich will nicht umziehen. Ich weiß nichts über Zentar oder Prinz Tariq. Ich bin ein häuslicher Typ.“
„Möglicherweise wäre es für dich an der Zeit, aus deiner Komfortzone rauszukommen“, gab Stewart zurück. „Denk doch nur, was du mit all den Forschungsgeldern machen könntest, die dir dann zur Verfügung stehen. Eine solche Chance kriegt man höchstens einmal im Leben.“
Wenn man es so ausdrückte, konnte sie nichts dagegen einwenden. Wenn es nur nicht so weit weg wäre! Und der Prinz nicht diese verheerende Wirkung auf sie ausüben würde! Was ihn betraf, musste Laurel sich schützen, da sie nicht die Absicht hatte, ihre früheren Fehler zu wiederholen. „Ich mag es so, wie es gerade ist.“
„Das verstehe ich. Aber vielleicht ist es wirklich mal Zeit für eine Veränderung, damit du aus dem Labor rauskommst und ein paar Abenteuer erlebst“, stellte Stewart fest. „Das könnte deine große Chance sein. Manchmal haben Veränderungen auch etwas Gutes.“
„Ich will keine Veränderung und kein Abenteuer. Ich brauche bloß eine Möglichkeit, Blutern zu helfen.“
Über den schwarzen Rand seiner Brille sah Stewart sie an. „Dir ist aber schon klar, dass der Prinz dir genau dazu die Gelegenheit bietet, oder? Du könntest ja auch so lange nach Zentar gehen, bis hier neue Gelder bewilligt werden.“
Im Grunde blieb ihr keine andere Wahl. Laurel warf ihm einen langen Blick zu, ehe sie resigniert seufzte. „Weißt du, wie ich den Prinzen erreichen kann?“
Tariq hatte Dr. Martins Anruf erwartet. Seit gestern wusste er, dass sie keine weiteren Fördermittel erhalten würde. Er hatte zwar nichts damit zu tun, war jedoch durchaus erfreut darüber. Allerdings hatte er die Nachricht verbreitet, dass sie ihre Forschungsarbeit aus anderen Quellen finanzieren konnte, damit niemand anders einsprang und sie sich daher an ihn wenden musste.
„Mr. Al Marktum … Äh … Prinz, hier ist Dr. Laurel Martin.“
„Ja?“
Sie klang etwas atemlos. „Ich … Na ja … Ich habe mich gefragt, ob Sie noch immer einen Leiter für Ihr Labor suchen.“
„Ja, das tue ich.“ Er wartete ab.
„Vielleicht wäre ich doch interessiert. Ich würde mich gerne mit Ihnen treffen, um die Sache zu besprechen“, sagte sie schnell.
„Da ich gleich morgen früh zurückfliege, sollten wir uns heute Abend treffen.“
„Dann werde ich das so einrichten.“ Sie wirkte unsicher, als wollte sie es sich womöglich wieder anders überlegen.
Das durfte Tariq nicht zulassen. Er lehnte sich auf seinem Sessel zurück. „Ich wohne im Chicago Hotel. Kommen Sie hoch in die Präsidenten-Suite. Hier wird uns niemand stören.“
Schweigen trat ein.
Machte es sie nervös, mit ihm allein zu sein? „Ich würde sonst die Bar vorschlagen“, sagte er daher, „aber ich glaube, dass es dort sehr laut sein wird. Und ich kenne mich in dieser Gegend nicht gut genug aus, um einen anderen Ort zu empfehlen. Mein Assistent wird bei mir sein, sodass Sie sich sicher fühlen können.“
„Ich brauche keinen Aufpasser. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zu sprechen.“
Tariq lächelte ein wenig. „Wenn Sie das sagen.“
„Dann sehen wir uns in einer Stunde.“
„Mit dem größten Vergnügen, Dr. Martin.“
Sie hielt Wort, und einer seiner Bodyguards kündigte an, dass sie pünktlich auf die Minute eintraf. Allein das nahm Tariq schon für sie ein.
Er empfing seine Besucherin an der Tür und begleitete sie zu einem der beiden Sofas mitten im Raum. Sie war ein zierliches Persönchen. Nicht hochgewachsen und langbeinig wie die Frauen, die er normalerweise attraktiv fand. Aber hier ging es um eine geschäftliche Besprechung. Dr. Martin sollte sein Labor leiten, mehr nicht. Die Farbe ihrer Augen oder die Länge ihrer Beine spielten dabei keine Rolle.
„Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?“, erkundigte sich Tariq.
„Nein danke.“ Sie hielt ihre große Tasche wie einen Schutzschild vor sich.
„Bitte nehmen Sie Platz.“
Mit einem schüchternen Nicken setzte sie sich dicht an die Armlehne des Sofas. Tariq hingegen ließ sich auf dem gegenüberliegenden Sofa nieder. „Sie möchten also über mein Angebot sprechen?“
„Ja. Ich wollte fragen, ob Sie bezüglich der angebotenen Stelle eventuell einen Kompromiss in Erwägung ziehen würden.“
„Ich höre.“ Aufmerksam betrachtete er seine Gesprächspartnerin.
Das Haar hatte sie wieder zu einem straffen Knoten zusammengefasst, und die Brille war ihr über die Nase gerutscht. Sie trug unauffällige Kleidung und überhaupt keinen Schmuck. So, als wollte sie möglichst unbemerkt bleiben. „Ich habe meine Forschungsmittel verloren. Und ich dachte, Sie wären vielleicht bereit, dem Labor hier ein paar Gelder zukommen zu lassen, damit ich meine Arbeit fortsetzen kann. Mit der Vereinbarung, dass Ihr Land als Erstes Zugang zu all meinen Erkenntnissen hätte.“
Sofort schüttelte Tariq den Kopf. „Das genügt mir nicht. Ich will, dass jemand in meinem Land und mit meinem Volk arbeitet.“
„Aber das geht nicht.“ Dr. Martins Stimme klang gepresst und fast verzweifelt.
„Warum? Ich werde Ihnen eine Unterkunft zur Verfügung stellen. Außerdem einen Fahrer und alle Annehmlichkeiten, die Sie benötigen.“ Er beugte sich vor und musterte sie eindringlich. Sie besaß tatsächlich interessante Augen, mit kleinen goldenen Pünktchen darin.
„Ich kann nicht einfach an irgendeinen Ort fliegen, den ich nicht kenne“, wandte sie ein.
„Darüber haben wir bereits gesprochen. Ich biete Ihnen die Chance, Ihre Forschung fortzusetzen. Und ich denke, Sie werden von unserem Labor nicht enttäuscht sein“, erklärte Tariq. „Wollen Sie denn nicht weiter forschen?“
Sie hielt ihre Tasche noch enger an sich gedrückt. „Doch, natürlich. Diese Arbeit ist wichtig. Und ich stehe kurz vor einem Durchbruch. Wenn Sie mir die nötigen Fördermittel nicht zur Verfügung stellen wollen, werde ich woanders welche finden“, erwiderte Laurel.
„Ich würde ja gerne, aber meine Gelder sind die meines Volkes. Ich selbst kann Ihnen nichts geben.“
„Sie haben keine privaten Mittel, die man dafür einsetzen könnte?“
„Nein. Die sind in den Bau des Labors geflossen. Sie sollten es sich noch einmal überlegen, ob Sie nicht doch mit nach Zentar kommen möchten.“
Finster sah sie ihn an. Warum wollte er sie denn einfach nicht verstehen? „Ich kann nicht. Das habe ich Ihnen doch schon erklärt.“
„Bisher habe ich bloß Ausreden gehört“, entgegnete Tariq. „Ich habe, was Sie brauchen. Sie haben hier kein Labor mehr für Ihre Arbeit, und ich biete Ihnen eins an. Ich verstehe das Problem nicht. Vielleicht ist Ihnen diese Forschung doch nicht so wichtig, wie Sie behaupten.“
Damit war er eindeutig zu weit gegangen. Laurel sprang auf und fuhr ihn an: „Wie können Sie es wagen?“
„Weil ich Sie als Leiterin für mein Labor brauche. Es gibt wichtige Arbeit zu tun.“