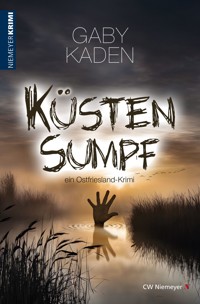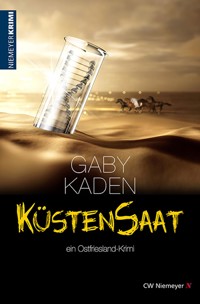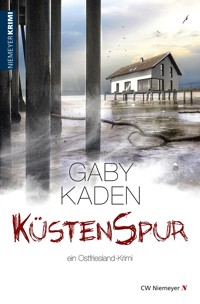7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
"KOMM, KOMM ZU MIR", LOCKTE ER HEISER, "KOMMST DU NICHT, WERDE ICH STERBEN …" Die Liebesnacht am Strand wird für Sanna zur Hölle. Ihr Geliebter hängt aufgespießt an einem Strandwagen, ein langer Holzstiel ragt aus seiner Brust. Tage später wird der Anführer von "Thorgodins Kindern", einer sektenartigen Verbindung, tot aufgefunden. In seinem Kopf klafft ein riesiges Loch. Als kurz darauf in einem Windpark zwei der Ungetüme umfallen, ist Tomke und ihren Kollegen klar: Das war kein Unfall. Schon lange kämpfen Bürgerinitiativen gegen die "Götter des Windes" … Das Ermittlerteam von der Küste ist gefordert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Unglaublich
Einige Tage zuvor ...
Sonnwende
Einige Stunden später, am frühen Morgen
Im Kapitänshaus
In der Nacht zuvor
Alte Zeiten
Rohes Fleisch – der Morgen nach dem Mord
Zwei Tage später
Drei Tage Horror und kein Ende
Strippen ziehen
Annar
Besuch bei Söderpiet
Rachegedanken reifen
Spargelessen
Wehrlos in der Nacht
Satt!
Ende des Grauens?
Ruhelos
Blutige Küste
Verschwunden
Gedankenpuzzle
Das Leben geht weiter
Unfähig
Besuch im Eissalon
Zurück im Kommissariat
Auferstehung
Vernehmung
Asgeirs Plan
Buttermilchsuppe am nächsten Tag
Auf dem Revier
Vorbereitungen
Warten
Am nächsten Tag
Showdown am Tag zuvor
Durchsuchung
Befragung am Abend
Götterfall
Elefantenrunde
Versammlung
Eine weitere Versammlung
Erwachen
Trümmerfeld
Götter des Windes
Verschleppt – in der Nacht zuvor
Fahndung
Verschleppt
Durchsuchung
Gefangen
Die Besichtigung
Wer andern eine ...
Omas Verhaftung
Am nächsten Morgen
Einige Stunden zuvor – Verloren auf der Insel
Überraschung
Schweigen
Auf dem Kommissariat
Weg, alles weg!
Am nächsten Morgen
Neue Erkenntnisse
Der Fund
Sannas Verhör, Teil 2
Der Kampf des alten Mannes
Unglaublich
Der nächste Tag ...
Das alte Wasserwerk ...
Das Haus in Harlesiel
Rundlesen ohne Tomke
Eingesperrt
Funde und noch mehr Funde
Drei Tage später
Beerdigung
Der große Schreck zum Schluss
So ein kleiner Nachsatz geht noch
Maries Lieblings-Weihnachtslied up Platt ut Clinsiel
Gaby Kaden
Küstengötter
Die Geschehnisse, sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de© 2017 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.comEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8333-0
Gaby Kaden
Küstengötter
Gaby Kaden lebte über 50 Jahre in Hessen, hat einen erwachsenen Sohn und zog 2011 mit ihrem Mann an die Nordsee, nach Carolinensiel. „Veränderungen sind wichtig, nur sie bringen mich weiter, machen mich offen. Stillstand ist Rückschritt“, sagt sie. In der alten Heimat arbeitete sie im kaufmännischen Bereich, war Betriebsrätin, Schiedsfrau und folgte zusätzlich ihrer Berufung, der spirituellen Arbeit mit Menschen. Nach Kurzgeschichten und Meditationen veröffentlichte sie 2010 ihr erstes Buch „Schluss mit Angst und Panik“.Obwohl schriftstellerische „Spätzünderin“, hat sie mit ihren beiden Küstenkrimis „Die Tote im Siel“ und „Küstenhaie“ schnell auf sich aufmerksam gemacht. Sie sammelt wahre, dem Volk vom Munde abgeschaute Geschichten, die mit Erfundenem, Humor und ein wenig „Lokalkolorit“ verschmelzen. Gaby Kaden ist ehrenamtlich im „Deutschen Sielhafenmuseum“ in Carolinensiel tätig und seit 2015 Mitglied im „SYNDIKAT“.Mehr über Gaby Kaden unter: www.gaby-kaden.de
Der Stolz der Ostfriesen ist weithin bekannt.Ostfriesland, du stolzes, herzliches Land. Gib die Freiheit nicht aus der Hand. Dir widme ich dieses Buch.
Vorwort
In Ostfriesland entstehen die Geschichten meiner Bücher. Mit Liebe, Herz und viel Lokalkolorit.
Danke Ostfriesland, dass ich hier leben darf.DANKE an Euch alle, liebe Krimifreunde und Krimifreundinnen. Euer Feedback inspiriert mich zu neuen Taten, spornt mich an. Nur so konnte auch Krimi Nummer 5 entstehen.
Dass ich wieder einige Protagonisten mit wirklichem Namen erwähnen durfte, ist zu einer guten Tradition geworden. Ob Menschen aus Carolinensiel, von der Insel Spiekeroog, oder woher auch immer. Ich danke Euch dafür.
Ein ganz besonderer Dank geht an die Familie von Hans „Bank“ Janßen (verstorben im März 2016), die mir gestattet, dass ich ihn und das von ihm geschriebene Weihnachtslied:
„Wiehnacht up Siel“
hier erwähnen und abdrucken durfte.
Danke an Kerstin und Irina – wie gehabt, an das wunderbare Team des CW Niemeyer Verlages, an Carsten Riethmüller für das geniale Cover.Danke an meine Familie für die Unterstützung und für das, was bald kommen darf. Ich freue mich riesig.Natürlich ist in diesem Buch wieder alles frei erfunden, und nichts, aber auch gar nichts zur Nachahmung empfohlen – alle Taten sind meiner Fantasie entsprungen.
... und trotzdem:Keine Macht den KÜSTENGÖTTERN
Der Wind gehört zu Ostfriesland wie Ebbe und Flut, wie das Watt, wie die Weite, wie das wunderbare Klima und die Menschen.
Unglaublich
Hochspannung lag über der Landschaft. Hochspannung und bedrohliche Stille. Es schien, als seien die Vögel plötzlich verstummt. Die Luft knisterte wie elektrisiert. Was in der Ferne geschah, war faszinierend, surreal und durfte eigentlich nicht passieren. Das, was sich vor seinen Augen abspielte, konnte nicht wahr sein. Niemals würde er dieses Ereignis vergessen, niemals würde er es aber auch wirklich in Worte fassen können.Vor einer knappen halben Stunde verließ der Fahrer des weißen Lieferfahrzeuges die Landstraße, um abseits der stark befahrenen Hauptverkehrswege auf einem kleinen Feldweg die Mittagspause zu verbringen. „Heiner’s hessische Spezialitäten“ stand in großen Buchstaben rechts und links an seinem Sprinter. Heiner liebte diese Stelle hier im ostfriesischen Hinterland besonders. Immer wenn er auf Liefertour in Ostfriesland war, nahm er die Gelegenheit wahr, an diesem Platz zu rasten. Der Blick auf das riesige Feld von Windrädern war atemberaubend. Windräder, wohin das Auge blickte. Doppelt so hoch wie der Kölner Dom, vermutete er. Stolz und stark. Der Mann mochte diese monströsen Dinger, die wie riesige Spargel aus der Erde wuchsen, und auch das zischende Geräusch, das ihre Flügel verursachten. Im Laufe der Zeit, so hatte er mit Bewunderung festgestellt, ragten diese Anlagen höher und höher in den Himmel, wurden die Flügel immer größer.
Doch nun erlebte er mit Entsetzen, was in der Ferne geschah.
Der letzte Tropfen Kaffee war getrunken, Heiner drehte die rote Thermoskanne wieder sorgfältig zu, als vor ihm das Unglaubliche passierte. Langsam, nur ganz vage wahrnehmbar. Er hielt in seiner Bewegung inne, kniff die Augen zusammen und stutzte, denn innerhalb dieses riesigen Windparks kam Bewegung auf. Dabei handelte es sich nicht um das übliche Drehen der Rotorblätter. Nein, es war anders, ganz anders. Zwei dieser Türme bewegten sich, kaum merklich und im Zeitlupentempo, aufeinander zu. Extrem langsam und im ersten Moment fast nicht zu erkennen. Darum glaubte der Mann auch, dass es sich hier um eine Sinnestäuschung handelte. Gebannt schaute er nach vorne, fixierte die Türme ganz genau. „Nein!“, schrie er außer sich auf. „Nein!“ Doch es war keine Täuschung, sie veränderten ihre Lage. Zuerst einer, ganz langsam, Momente später der Nachbarturm. Sie bewegten sich gegeneinander, weiter und weiter, um dann, wie in Zeitlupe, mit den Flügeln aneinanderzuprallen und in sich zusammenzufallen. Heiner war geschockt. „Das träume ich doch!“, rief er aus, warf die Thermoskanne auf den Beifahrersitz und sprang aus seinem Fahrzeug. Konzentriert richtete er den Blick nach vorne und beobachtete fassungslos, dass die Ungetüme auf dem Boden aufschlugen. Alles geschah wie in Superzeitlupe. Das dumpfe Geräusch der aufschlagenden Riesen glaubte er bis zu seinem Standort zu hören, das Beben unter den Füßen zu spüren. Nun begrub eine riesige Staubwolke alles unter sich. Wie festgewachsen stand er da und konnte den Blick nicht abwenden.
Als sich die Staubwolke gelegt hatte, sah er, dass dort, wo noch vor einer Minute ein geordnetes Feld an Türmen mit drehenden Flügeln zu sehen war, nun ein hässliches Loch klaffte. Ein Loch, das die Symmetrie des Bildes störte. Nichts war mehr wie vorher. Nachdem er sich ein wenig gefasst hatte, für ihn fühlte es sich an, als seien Stunden vergangen, griff er nach seinem Handy und wählte den Notruf. Nur stotternd und in Wortfetzen, unfähig, einen klaren Satz zu formulieren, konnte er der Notrufzentrale seine Beobachtungen mitteilen.
Einige Tage zuvor ...
Sonnwende
Nur ein leichtes Lüftchen, das in dieser eigenartigen Nacht wie der Hauch eines Federstriches zu vernehmen war, regte sich an der sommerlichen Küste. Ideal für einen nächtlichen Spaziergang in der Sonnwendnacht, mitten im Juni. Doch der Strand schien leer. Gespenstisch ruhig und leer, wie ausgestorben. Fast. Jemand saß auf der Bank direkt an der Küste.
Trotz der Sommerwärme trug der Mann die verschlissene Kappe, unter der grau melierte Haare hervorschauten, tief ins Gesicht gezogen. Den Kragen der braunen Arbeitsjacke hatte er ungeachtet der Temperaturen heute hochgeschlagen.
Seit fünf Tagen kam er jetzt hierher. Abend für Abend. Nacht für Nacht. Den Kopf nach vorne gebeugt, das bärtige Kinn auf der Brust, saß er auch heute bereits einige Stunden auf dieser Bank am Strand. Zwischen seinen Beinen klemmte ein Gehstock, den knochige Hände fest umklammerten. Schlief er? Wartete er auf etwas, auf jemanden? Oder war er tot? Regungslos, wie er dasaß …?
Der Himmel wuchs tiefschwarz aus der See, über und über mit Sternen bedeckt. Der Mond schien zum Greifen nah. Rot wie ein leuchtender Feuerball erhellte er den Strand, trotz seiner ungewöhnlichen Farbe, so, dass man, obwohl tiefste Nacht, genug sehen konnte. Wellen schlugen sanft plätschernd an das Ufer, immer sachter werdend, da die Flut sich schon langsam zurückzog.
Aus der Ferne näherten sich kurze schnelle Schritte. Das Klacken dünner Absätze war zu hören, zuerst verhalten, dann immer lauter werdend. Eine Frau kam auf die Bank zu. Der Mann hörte sie, regte sich aber nicht. Die Schritte näherten sich, wurden langsamer, verharrten kurz, um dann vorbeizuhuschen.
„Bist du das?“, kam es kaum hörbar von der Bank. „Bist du da? Komm zu mir! Komm, komm, komm“, lockte er dann heiser und starrte in die dunkle Nacht. „Komm, gib mir etwas von deinem Leben. Du kannst das, nur du!“
Angst lag in der Luft, verflog aber, je weiter sich die Schritte entfernten. Der Mann drehte den Kopf, schaute der schlanken Gestalt nach. Ihr leichtes Sommerkleid schimmerte gespenstisch, angestrahlt vom einzigartigen Mond, der nur heute, in dieser einen Nacht, in solcher Farbe am Himmel stand. Rot wie Blut. Der Mann hörte, wie die Schritte schneller und dann leiser wurden, die Gestalt in der Dunkelheit verschwand. Nun war es kein Gleichmäßiges Klack, Klack, Klack mehr. Schwer atmend setzte er sich auf.
„Komm!“, rief er nun laut, stützte die rechte Hand auf dem Gehstock ab. „Komm zurück! So wie jedes Jahr!“ Der Mann stand auf, schaute zum nächtlichen Horizont und wiederholte: „Komm, komm zu mir!“
Sein Blick schwenkte nach rechts, dann bedächtig in die entgegengesetzte Richtung, dorthin, wo die Schritte in der dunklen Nacht verschwunden waren. Schwer fiel er wieder auf die Bank zurück, wandte sich nach vorne zur ablaufenden See. Lange saß er so und schaute auf das Schwarz.
„Bist du da?“, kam es nach einer Weile gequält und mit rauer Stimme nochmals von der Bank. „Es ist zu spät, du wirst es nicht schaffen. Du kannst es nicht schaffen. Das Wasser geht und du mit ihm.“ Ein bitteres, unnatürliches Lachen drang aus seiner Kehle.
Müde erhob sich der Mann, schlurfte quer über den Strandweg zum Deich und nach Hause. Später wollte er erneut versuchen, sie zu treffen.
*
Einige Hundert Meter entfernt, hatte sie seine Rufe gehört. Miriam schreckte hoch, lauschte vorsichtig in die Dunkelheit. Die Stimme bereitete ihr Angst.
Sie wollte mit Stevan die kürzeste Nacht des Jahres direkt vorne an der Küste verbringen. Als die beiden jungen Leute am Strand ankamen, war es nach 22 Uhr, aber noch fast taghell. Sie schoben zwei Strandkörbe als Blickschutz zusammen, breiteten ihre Decken dahinter aus. In einer Kühlbox hatten sie Getränke mitgebracht.
Um diese Zeit war die Sonne noch als leuchtender Feuerball zu sehen, um sich dann langsam am westlichen Horizont in die sanft auflaufende Nordsee zu schieben. Später, so hatte Stevan ihr versprochen, würde sie vom ebenso roten Mond abgelöst werden.
Die beiden jungen Leute wollten am Abend gemeinsam einen romantischen Sonnenuntergang erleben, um danach den angekündigten Erdbeermond zu genießen. Sie waren nicht alleine. Einige Menschen fanden in dieser Nacht den Weg zum Strand, um die Sonnwende zu beobachten, lagen wie Miri und Stevan auf Decken hinter den Strandkörben. Man konnte sie nicht sehen, nicht hören, nur ahnen. Alle waren besonders still in dieser besonderen Nacht.
„Glaube mir, Miri, das ist ein seltenes, fast einmaliges Ereignis“, beteuerte Stevan, wie schon die Tage zuvor wieder und wieder.
Jetzt lagen sie hier und genossen die Sommernacht. Inzwischen war es dunkel geworden. Die beiden jungen Leute hatten einige Flaschen Bier getrunken, sich geliebt, waren zwischenzeitlich kurz eingeschlafen. Jung und unbekümmert, wie Küstenkinder eben.
Nun aber schreckte Miri hoch. „Stevan, was ist das?“, rief sie angstvoll. Sie sprang auf, griff nach ihrem Rock. „Komm, lass uns gehen, da ist jemand!“, forderte sie ihren Freund auf. Doch der versuchte sie zu beruhigen.
„Ich höre nichts. Das war ein Betrunkener, bleib, es ist so schön hier.“ Sanft zog er sie zurück auf die Decke, küsste sie zart und strich ihr über das Haar. „Schau, der Mond ist ein ganzes Stück weitergewandert, bald wird er verschwunden sein.“ Weiterhin unruhig, immer wieder lauschend, kuschelte Miri sich an ihn. Nach einiger Zeit hatten beide den Vorfall vergessen und schliefen ein.
Einige Stunden später, am frühen Morgen
Die Schreie waren weit über den Strand zu hören. Erbärmliche, kreischende Schreie. Wirklich verstehen konnte er sie nicht, aber es war klar, dass es Hilferufe sein mussten. Lang gezogen, schrill. Eindeutig!
Piet Södermann hörte sie sofort.
Wie jeden Tag, war er mit seinem kleinen Elektromobil an die Küste gekommen, um hier mit den ersten Lichtstrahlen, wenn die Sonne im Osten auftauchte, den Strand nach Unrat, Abfällen, zerrissenen Fischernetzen sowie weiteren Utensilien abzusuchen. Piet ließ sich durch nichts abhalten, bei Wind und Wetter führte ihn sein Weg hierher.
Angefangen hatte es damit, dass es ihn als aktiven Umweltschützer immer wieder aufbrachte, was an Hinterlassenschaften am Strand angespült wurde. Doch irgendwann machte er aus der „Sauerei“, wie er es nannte, ein einträgliches Hobby und zauberte aus den Fundstücken maritime Collagen. Diese waren inzwischen sehr begehrt und brachten ihm ein schönes Zubrot zu seiner kargen Rente und den paar Euros, die er als Wattführer verdiente. Nach der windstillen Nacht hatte er zwar wenig Hoffnung, viel brauchbares Material zu finden, aber die frühen Stunden am Strand waren für ihn zu einer guten Gewohnheit geworden. So hob er auch heute den kleinen Hänger von seinem Fahrzeug, um damit, und mit dem ablaufenden Wasser, hinaus in das Watt zu wandern.Nun aber stutzte er und horchte auf. Das konnte weder der Wind noch eine frühe Möwe sein, das waren Schreie, weit draußen im Wasser.
Er richtete seinen Blick in die Richtung, aus der die Hilferufe vermutlich kamen. In der tiefen Dunkelheit war allerdings nichts zu erkennen, ihm aber sofort klar, hier brauchte jemand Hilfe.
‚Söderpiet‘, wie sie ihn in der Gegend nannten, zögerte nicht lange, zog das Handy aus der Brusttasche und tippte die Nummer seines Freundes Fokko ein.
„Was soll ich den Umweg über den Notruf gehen, die holen dann sowieso Fokko aus den Federn“, überlegte er. Es dauerte nicht lange, da meldete sich auch schon eine verschlafene Stimme.
„Kumm up!“, forderte Söderpiet den Freund, ohne seinen Namen zu nennen, auf und fuhr dann fort: „Im Watt steckt jemand und schreit kräftig nach Hilfe. Ihr müsst raus.“
„Söderpiet, bist du das? Was ist los? Ich schlafe noch“, kam es brummig aus dem Handy.
„Im Watt schreit jemand um sein Leben. Die brauchen dich und deine Leute, komm up!“, rief er noch mal ins Telefon.
„Hast du die Leitstelle informiert?“, fragte Fokko, noch immer schläfrig.
„Was soll ich die Feuerwehr alarmieren, wenn ich deine Nummer habe? Bist du der Chef der Truppe oder wer? Du wirst schon das Richtige tun. Also komm endlich up und spring in deine Schuhe!“
Der Feuerwehrchef wuchtete die Beine über die Bettkante und stöhnte: „Ik bin up. Also was, wann, wo?“
Fokko Adams war jetzt hellwach und dienstbereit.
Söderpiet informierte den Freund sachlich klar darüber, was er gehört hatte, wo er sich gerade befand und versprach, dort auch auf die Einsatzkräfte zu warten.
Inzwischen hatten sich seine Augen an die noch immer herrschende Dunkelheit gewöhnt. Der Mann konnte aber draußen im Watt, so sehr er sich auch anstrengte, nichts erkennen.
Für kurze Zeit war es ruhig gewesen, doch nun waren die grellen Schreie wieder zu hören.
Piet erkannte auch, dass es sich nicht nur um eine einzige, sondern augenscheinlich um zwei Stimmen handelte. Zwei sehr unterschiedliche Stimmen. Eine kräftig und laut, die andere leiser, feiner, eher wie die eines Kindes. Kamen sie ihm bekannt vor? „Nein“, schnell wischte er den Gedanken weg. „Quatsch“, schalt er sich selbst.
„Mein Gott, da draußen befindet sich auch ein Kind!“, durchfuhr es Söderpiet gleichzeitig eiskalt. „Dass ich aber auch so gar nichts tun kann.“ Er griff sich entsetzt an den Kopf. „Wenn es nur ein wenig heller wäre, würde ich rausgehen, aber so!“ Er zuckte hilflos mit der Schulter. „So, bei dieser Dunkelheit, ist es unverantwortlich. Am Ende müssen Fokko und seine Leute auch noch mich aus dem Watt retten.“ Als ausgebildeter Wattführer erkannte er genau, wann man an seine Grenzen kam. Hier war es so.
Erneut vernahm er die Schreie.
Was waren das für Töne? Er verstand: „Hiiilllffeeee“. Grell!
Dann wieder „Höööööjjjjöööö, Höööööfööööö?“, unverständlich, fast gurgelnd, als würde jemand ersticken, ertrinken. Die feine, die vermutliche Kinderstimme, konnte er nun nicht mehr hören. Piet schaute sich suchend um. Wenn nur die Rettungskräfte endlich kämen. Verzweifelt lief er nun doch ein ganzes Stück hinaus. Bis zum Bauchnabel stand er im ablaufenden Wasser und spürte die Strömung, die hier gefährlich an ihm zog. „Hallo, haaallooo“, schrie er und nochmals: „Haaallooo, ist da jemand? Hören Sie mich?“ Aber er bekam keine Antwort. Enttäuscht drehte er ab und stapfte zurück.
Ganz langsam war am östlichen Horizont ein zarter Lichtstreifen zu sehen, der brachte allerdings noch nicht viel. Bis man draußen etwas erkennen kann, wird noch eine halbe Stunde vergehen, schätzte er.
Im Kapitänshaus
Zu Hause in dem kleinen, verwitterten Backsteinhaus warf der alte Mann seine Kappe, ohne den Blick zu heben, an den Garderobenhaken. Sie landete an der gleichen Stelle, wie jeden Tag. Den Gehstock lehnte er in die Nische neben der Tür. Mit schweren Schritten schlurfte er über den steinigen Boden der Diele in die Küche, die Geräusche seiner Holzschuhe waren bis vor das Haus zu hören. Obwohl Sommer, war der Herd geheizt und das Wasser im seitlichen Schiffchen heiß. Er nahm die verbeulte Kelle vom Haken, füllte einen kleinen Topf, schürte den Ofen kurz und wartete, bis das Wasser kochte. Die grau-blaue Teekanne stand wie immer bereit. Müde gab er eine Handvoll Teeblätter hinein, goss wenige Minuten später das Wasser darüber. Kurz zu Hause ausruhen, Kraft sammeln mit einigen Tassen Tee, einem Stück Butterstuten. Schwer atmend ließ er sich auf den Stuhl neben dem alten hölzernen Küchentisch fallen. Die dunkle Lampe über dem Tisch erhellte den Raum nur schwach.
Heißer Tee, ein paar Stücke Stuten, anschließend wollte er wieder hinaus, trotz der tiefen Nacht. Sie kam jedes Jahr um die Sonnwende, er wartete so dringend darauf. Mehr als dieses einmalige Erlebnis hatte er das Jahr über nicht. „Ich darf sie nicht verpassen. Sie zu treffen, zu berühren, ihre Kraft zu spüren, wird mir noch ein Jahr geben“, hoffte er. Ein ganzes Jahr, nur sie kann es. Verzweifelt spürte der alte Mann: „Kommt sie nicht, werde ich sterben!“
*
Fokko und seine Feuerwehrleute waren inzwischen vor Ort. Ebenso zwei Polizeistreifen von der nahen Kreisstadt, eine Mannschaft der DLRG und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Die Männer und Frauen suchten ein etwa zwei Quadratkilometer großes Areal draußen im Watt und dem ablaufenden Wasser ab. Ohne Erfolg. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera flog während der Dunkelheit immer wieder über das Gebiet, und das angeforderte Seenotrettungsboot suchte von der Seeseite, soweit es genug Wasser unterm Kiel hatte. Unterdessen war es hell geworden, die Sonne aufgegangen. Doch finden konnten die Suchmannschaften nichts.
*
Der alte Mann war, nachdem er seinen Tee getrunken hatte, sofort zurück zum Strand gelaufen. Im Osten erschienen die ersten Lichtstrahlen auf der dunklen See. Die Sonne tauchte am Horizont auf. Er wusste, dass es nun passieren musste, wollte den Moment nicht verpassen. Wenn, dann jetzt. Jetzt oder nie mehr! Ob sie wohl alleine kommen würde? Das Klack, Klack, Klack in der Nacht hatte ihn nervös gemacht, aufhorchen, hoffen lassen, – auch von ihr kannte er diese Geräusche –, bis er dann feststellte, dass sie es nicht war. „Klack, klack, klack, wie meine Schuhe. Klack, klack, klack.“
Oben auf dem Deich angekommen, blieb der Alte verwundert stehen. Er traute seinen Augen nicht. Was wollten die vielen Menschen hier? Ufer, Watt und Strand waren von Scheinwerfern erhellt, die Ruhe dahin. Polizei, Feuerwehr, Rettung konnte er erkennen. Was war hier passiert?
Sie werden unsere Verabredung stören, das erkannte er sofort. Es gab nur diese einmalige Chance in den Tagen der Sonnwendzeit. Jahr für Jahr. Das Einzige, was er noch hatte, was ihn leben ließ, Jahr für Jahr. An diesem Ort. Heute Nacht oder nie, doch nun war es vorbei. Unter solchen Umständen würde sie nicht kommen, befürchtete er.
„Ich werde sie nie mehr treffen. Nun muss ich sterben, die nächste Sonnwende erlebe ich nicht.“ Müde griff er sich an die Stirn. „Was wollt ihr hier?“, rief er dem Söderpiet zu, den er schon als kleinen Jungen kannte. Drohend hob er seinen Stock.
„Geh nach Hause, Hermi!“, meinte Söderpiet. „Das ist nichts für dich. Es hat jemand um Hilfe geschrien, wir suchen eine hilflose Person, draußen im Watt.“
Söderpiet nahm den Alten am Arm und führte ihn zu einer Bank.
„Ruh dich aus und dann lauf zurück nach Hause. Das ist doch alles viel zu …“ Doch der Alte wehrte sich.
„Lass mich los. Ich bin doch nicht tüdelig. Wen sucht ihr da draußen?“, wollte er noch wissen.
„Da hat jemand um Hilfe geschrien, Hermi. Geh nach Hause, du kannst hier nichts machen.“ „Um Hilfe? Quatsch, sie war da. Sie ...“ Aber Söderpiet hatte sich schon wieder abgewandt und konzentrierte seinen Blick auf das Watt.
Hermi, wie Söderpiet den alten Mann genannt hatte, erhob sich schwerfällig von der Bank. Er war sich sicher, dass sie dort draußen nichts finden würden, er wusste, wer gerufen hatte.
„Sie war da“, stammelte er leise „und ihr habt sie vertrieben.“
Immer wieder schlug er sich mit der Hand gegen die Stirn. „Ihr habt sie vertrieben. Ihr habt sie vertrieben, ihr Idioten …“, stammelte er unaufhaltsam.
Als einer der Feuerwehrleute ihn so verzweifelt und aufgeregt auf dem Strandweg stehen sah, winkte er einem Sanitäter zu, sich um den Alten zu kümmern. Aber Hermi wehrte ab.
„Ich brauch dich nicht, es ist vorbei, sie wird nicht kommen. Ein Jahr umsonst, alles umsonst. Alles aus!“
Der Sanitäter schaute ihn verständnislos an.
Müde wandte sich Hermi ab, ging mit schweren Schritten über den Deich nach Hause. Was sollte er jetzt noch hier? „Es wird nie wieder geschehen“, war er sich sicher. Niemals wieder. „Oder soll ich morgen doch noch einen Versuch unternehmen? Wenn der Erdbeermond vergangen, der Silbermond am Horizont steht? Einen letzten Versuch, dieses einmalige, intensive Glück nochmals zu erleben?“ Ein Stöhnen drang aus seiner Brust. Der Silbermond über dem Wasser und sie, mein Leben. „Mein Leben ist bald vorbei“, murmelte er leise auf seinem Nachhauseweg. „Lange habe ich nicht mehr, doch einmal noch dieses Gefühl, diese Zuneigung spüren, sie berühren und dann … Ich muss es aufschreiben, alles notieren“, beschloss er. „Wenn ich nicht mehr bin, sollen sie es alle wissen. Alles sollen sie wissen. Aber erst dann, nicht vorher ... Der Erdbeermond ist schuld“, beruhigte er sich selbst, „der Erdbeermond.“
*
Gegen 10 Uhr am Vormittag brachen die Rettungsmannschaften die Suche erfolglos ab.
„Entweder du hattest gestern Abend einen Schluck zu viel und dir das Ganze nur eingebildet, oder die Person wurde mit dem ablaufenden Wasser hinaus in die Nordsee getrieben. Wenn das der Fall ist, wird die Strömung sie irgendwann anspülen. Ich würde mir, auch wenn die Aktion mit hohen Kosten verbunden war, das Erstere wünschen.“ Fokko Adams klopfte Söderpiet auf die Schulter. „Geh nach Hause und nimm ’ne Mütze Schlaf. Du siehst aus, als hättest du es nötig.“
Kopfschüttelnd schaute Söderpiet seinem Freund nach und rief: „Das habe ich mir nicht eingebildet. Ich habe die Schreie ganz deutlich gehört. Und nicht nur eine Stimme, sondern zwei! Ganz sicher.“ Aber Fokko winkte nur ab. Das Einzige, was sie gefunden hatten, war ein Sommerkleid. Nass und voller Sand. Wie lange es am Strand lag, konnte keiner sagen. Vorsichtshalber packte Fokko es in eine Tüte und übergab diese den Streifenbeamten. „Wir wollen nichts versäumen“, erklärte er. „Man weiß ja nie!“
In der Nacht zuvor
Ob Ost, ob Süd, ob West, ob Nord
Thorgodin jagt Unheil fort.
Schützt Hus und Diek, ob binnen oder buten,
vor Feuer, Sturm und hohen Fluten.
Singsang und Trommeln verschmolzen, unaufhörlich wiederholten sich die Zeilen.
Die Sonnwendfeier dauerte, wie in jedem Jahr, bis in die frühen Morgenstunden. Sie begann mit dem Sonnenuntergang, der mit dem Aufgang des Mondes einherging, und sollte mit dem erneuten Aufgang des neuen Feuerballes enden. Meist jedoch schliefen alle vom Alkohol berauscht irgendwann in der Nacht ein. Die Mitglieder von Thorgodins Kindern tranken sonst keinen Alkohol, nur zur Sonnwendfeier im Sommer wie im Winter, darum waren sie ihn auch nicht gewohnt. Noch trommelten die Männer und Frauen am großen Sonnwendfeuer immer und immer den Rhythmus, monoton und gleichmäßig. Die Lieder, die sie dazu sangen, konnte kein Außenstehender nachvollziehen. Die Gruppe hatte ihre eigene Sprache. Der Refrain klang wie: „Thoorgoodin, go do gin. Thoorgoodin, go do gin.“ Weitere unverständliche Laute reihten sich in den Singsang ein, der weit über die Felder zu hören war.
Sie tranken Met, manche auch einfach nur Schnaps aus traditionellen Hörnern. Je später es wurde, umso betrunkener waren alle. Der Singsang ging in ein Lallen über, bis er erlosch, einer nach dem anderen am Feuer einschlief. Männer wie Frauen. Irgendwann erlosch auch die Glut.
Sanna schlief nicht. Sie musste lange warten, bis sie sich erheben und mit dem alten, verrosteten Fahrrad heimlich in der dunklen Nacht verschwinden konnte. Erst als das rhythmische Trommeln langsam leiser wurde, wagte sie, den Kopf zu heben. Die junge Frau wusste, dass Annar sie die ganze Zeit beobachtete, und war vorsichtig. Dann allerdings hatte der Alkohol das Seine getan und ihn, genau wie alle anderen auch, schläfrig werden lassen. Nun lagen sie zusammengesunken oder einfach rückwärts umgefallen am gestorbenen Sonnwendfeuer. Bis auf Sanna.
„Annar!“, lachte sie spöttisch auf, während sie durch die dunkle Nacht lief, das Fahrrad schiebend, da die Pedalen quietschten. Erst nach einigen Hundert Metern durfte sie aufsteigen.
Eigentlich hieß ihr Mann Norbert. Aber seitdem er sich Thorgodins Kindern angeschlossen und diesen germanischen Spleen hatte, nannte er sich Annar, was so viel hieß wie: ‚Vater‘ oder ,Herr der Welt‘. „Und so führst du dich auch auf, du Spinner“, flüsterte Sanna böse, während sie, so leise wie möglich, den Weg vor zum Deich nahm. Immer wieder schaute die Frau sich ängstlich um. Folgte ihr jemand? Die Nacht war dunkel, wenn auch ein wenig durch den roten Mond erhellt, aber für Sanna zu dunkel.
Bernd hatte darauf bestanden, dass sie sich in dieser Nacht noch trafen. Morgen stand eine wichtige Verhandlung an und er wollte vorher unbedingt wissen, was die Gruppe plante, damit er ihnen einen Schritt voraus war. Telefonieren konnten sie nicht. Annar duldete nur ein einziges Handy. Dieses trug er bei sich und kontrollierte es ständig. Der Hausanschluss war ebenso tabu, da er alleine ihn nutzen durfte. Also mussten sie sich treffen. Kontakt hatten sie nur, wenn Sanna ihren spärlichen Freiraum von Einkäufen und sonstigen Erledigungen ausnutzen konnte. Dann suchte sie eine der wenigen noch vorhandenen Telefonzellen auf und verabredete sich mit ihm. Es war gefährlich, das Risiko groß. Aber sie ging es ein, um ihn sehen, fühlen, berühren, lieben zu können. Für heute hatten sie sich am Strand an ihrem alten Platz verabredet.
„Bald ist alles vorbei, mein Liebling“, versprach er ihr wieder und wieder, „dann hole ich dich dort heraus und wir bleiben für immer zusammen. Aber jetzt musst du noch etwas ausharren, sonst kann ich das große Projekt nicht vollenden. Danach bekomme ich den Job in Brasilien und wir beide verschwinden von hier.“
Sanna glaubte ihm, harrte aus, was blieb ihr denn außerdem an Hoffnung? Das Leben mit Annar – oh, wie sie diesen Namen hasste –, das Leben mit Norbert, war inzwischen zu einer Katastrophe geworden. Der anfangs so liebenswerte, vernünftige Mensch war zum Fanatiker mutiert, nachdem er in diese Gruppe geraten, nein sie regelrecht gekapert und deren Aktivitäten noch ausgeweitet hatte. Thorgodins Kinder, wie sie sich nannten, lebten nach einem germanischen Ritus, zurückgezogen und, wie Sanna fand, weltfremd, ließen die Außenwelt nicht an sich heran. „Germanisch?“, fragte sie sich zweifelnd. „Wirklich germanisch? Oder war das alles ein ‚zusammengewürfeltes Etwas‘?“ Sie trugen allesamt die gleiche Kleidung, lebten von Wurzeln, Obst, Gemüse und Tieren, die sie selbst großzogen und schlachteten. Sanna entzog sich dem immer wieder, was ihr die Abneigung der Mitglieder, aber vor allem den Zorn ihres Mannes einbrachte. In stummen Protestmärschen prangerten Thorgodins Kinder immer wieder an, was nach Fortschritt, Moderne und Technik aussah.
Jetzt, da Annar hier das Sagen hatte, waren sie noch extremer geworden und gegen alles. Allerdings nun nicht mehr stumm. Annar radikalisierte die Gruppe immer mehr. Jedes einzelne Gruppenmitglied musste sich den selbst ernannten Gesetzen unterwerfen. Mittlerweile hatte das Ganze sektenhafte Züge angenommen und Sanna erkannte, dass sie alle von ihm einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Mehrmals unternahm sie in den letzten Jahren den Versuch auszubrechen, aber Annar holte sie immer wieder zurück. Brutal, entsetzlich zynisch und radikal. Nun war Sanna so voller Angst, dass sie es nicht mehr wagte, länger als ein paar Stunden der Gruppe fernzubleiben. Wo sollte sie auch hin? Ohne Geld, ohne Wohnung?
Anfangs war sie sehr glücklich darüber, dass Norbert sich, wie sie selbst auch, für die Umwelt und den Umweltschutz interessierte. Sie kämpften gemeinsam gegen die Massen an Windrädern, die hier in der Gegend aus dem Boden gestampft wurden. Hatten sich hierbei auch kennengelernt. Protestierten gegen den übermäßigen Abbau an Kies, der im Hinterland ganze Dörfer verschwinden ließ, für den Küstenschutz, gegen zu viele strahlende Handymasten und mehr. Damals zusammen mit anderen Organisationen und Bürgerinitiativen aus der Gegend. In einer von ihnen, einer Initiative, die sich Gegen den Wind nannte, waren sie einige Zeit sehr aktiv. Sanna als Achtzehnjährige, Norbert, der wunderbare, liebenswerte Norbert, zehn Jahre älter als sie und ihr großes Vorbild. Doch seit Thorgodins Kindern hatte ihr Mann sich verändert. Norbert wurde zu Annar, hatte sich in kürzester Zeit zum Anführer dieser Gruppe gemacht und sie total radikalisiert. „Jetzt“, so kündigte er damals an, „tun sich ganz andere Welten auf. Ich werde das Leben hier an der Küste verändern“, tönte er mit breiter Brust. Seitdem hieß er nicht nur Annar, führte sich auf wie der ‚Vater der Welt‘, sondern trug auch einen Vollbart, hatte diesen, wie auch seine Haare, rot gefärbt. Die meisten der Männer in der Gruppe folgten ihm auch hier. Ab sofort bestimmte Annar über alles und jeden. Vor allem über Sanna. Sie lebten nicht mehr in ihrem schönen kleinen Haus am Sommerdeich, sondern in einer Erdhöhle, die ihr Mann tief in diesen Deich gebaut hatte. Nach und nach kaufte Norbert dann einige tausend Quadratmeter an brachliegendem Nachbarland dazu. Auch das Land, das Thorgodins Kinder zuvor von einem Bauer gepachtet hatten. Anschließend überredete er Gruppenmitglieder, die Haus und Hof besaßen, ihr Eigentum zu verkaufen und sich ebensolche Wohnhöhlen in den Deich zu bauen. Da das auf seinem Grund und Boden geschah, mussten sie ihn dafür bezahlen. Der restliche Erlös aus den Verkäufen kam in einen großen Topf, die Kasse von Thorgodins Kindern. Diese Gelder verwaltete Annar gemeinsam mit seinem Stellvertreter, der jedoch nur sporadisch Mitspracherecht besaß. „Hunderttausende müssen das sein“, schätzte Sanna, „wo das Geld wohl war?“ Alle Mitglieder der Gruppe hatten mit ihren Freunden gebrochen, Sanna und Norbert auch, ein hoher Zaun wurde um das Grundstück gezogen und alle, außer Thorgodins Kindern, zu Feinden erklärt. Sanna lief ein Schauer über den Rücken, wenn sie an den Verlauf der Entwicklung dachte. „Diese Typen sind genauso bekloppt wie er“, fand sie und wusste, dass nur Bernd ihr helfen konnte, hier auszubrechen.
Ihr Mann nahm sie alle aus wie die Weihnachtsgänse. So besaßen Thorgodins Kinder inzwischen kein Eigentum, kaum persönliches Barvermögen mehr und folgten ihm wie die Lämmer.
Sanna vermutete, dass Annar noch ganz andere Pläne hatte. Allerdings konnte sie nichts beweisen. Pläne, von denen die Mitglieder der Gruppe keine Ahnung hatten. Zutrauen würde sie es ihrem Mann. Immer wieder hatte sie Telefongespräche belauscht, in denen er augenscheinlich jemanden bedrohte oder Geschäfte abschloss, von denen keiner der anderen etwas ahnte. Von Geld und von Übergabe war sogar manchmal die Rede. Scheinbar ging der Gesprächspartner nicht auf Annars Forderung ein, und so hörte sie noch, wie ihr Mann einmal: „Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt“, schrie und das Telefon auf den Boden warf.
Sie hatte es Bernd erzählt. Seitdem ließ der ihr keine Ruhe mehr. Bei jedem Treffen löcherte er sie mit der Frage, was sie wohl Neues über Annars Vorhaben wisse.
„Aber das wird ja bald alles ein Ende haben. Ich verschwinde mit Bernd. Sollen sie doch weiterspinnen.“
Sanna musste auf dem Weg zum Strand daran denken, wie sie und Bernd sich kennengelernt hatten. Es war ein großer Zufall, nein ein Glücksfall in ihren Augen. Er stand mit seinem Wagen am Ende des schmalen Feldweges, als sie zu Einkäufen auf dem Weg in die Stadt war. Offensichtlich hatte sich eine Wespe in seinem Wagen verirrt, die er versuchte herauszuwedeln. Sanna hatte angehalten und gefragt, ob er Hilfe brauche. Als sie in seine Augen sah, war es um die junge Frau geschehen. Gemeinsam suchten sie den Wagen ab, von der Wespe war allerdings nichts mehr zu sehen. „Zum Glück“, hatte Bernd damals gestöhnt, „ich bin nämlich allergisch gegen Wespen-stiche.“ Er hatte sich tausendmal bedankt und sie anschließend zu einem Kaffee eingeladen, erinnerte sie sich nun mit einem zärtlichen Lächeln.
Je mehr sie sich von ihrem verhassten Zuhause entfernte, umso leichter wurde ihr, obgleich sie sich immer wieder ängstlich umschaute. Plötzlich ließ ein leises Zischen sie aufhorchen. Im ersten Moment befürchtete die ängstliche Frau jemanden hinter sich, bis sie feststellte, dass ihr altes Fahrrad einen Plattfuß hatte. Leise fluchend warf sie es seitlich ins hohe Gras, griff sich vom Gepäckträger ihr dünnes Sommerkleid, das sie heimlich trug, wenn sie Bernd traf, und tauschte es gegen die Standardkleidung von Thorgodins Kindern aus. Vor allem an solchen Festtagen wie heute bestanden alle auf diesem Outfit aus grober Baumwolle. Nun musste sie zu Fuß weiter.
Bernd wird mich aufmuntern, freute sie sich. „Drei Stunden haben wir.“ Sanna spähte nach vorn, ob er schon zu sehen war. „Drei Stunden, dann muss ich zurück.“ Sie wollte kein Risiko eingehen. Die Gefahr, dass Norbert aufwachte, war einfach zu groß. Der Weg zurück ohne Fahrrad war allerdings ein Handicap, an das sie im Moment nicht denken wollte. Leise klackten ihre Schuhe auf dem gepflasterten Strandweg. In einiger Entfernung saß jemand auf der Bank. Bernd? Er wartet schon auf mich, ein freudiger Schauer durchlief die junge Frau. Dann jedoch verlangsamten sich ihre Schritte. Das war nicht Bernd. Der rote Mond fiel auf eine dunkle Gestalt, die zusammengesunken auf dieser einsamen Bank saß. Sanna zuckte zusammen. „Das ist nicht Bernd“, flüsterte sie angstvoll. „Das ist Annar ..., Norbert, egal, ist er es?“ Das konnte nicht sein. Noch vor Kurzem lag er doch schlafend am Lagerfeuer, aber ihm war alles zuzutrauen. Hatte er sich, wie sie selbst auch, nur schlafend gestellt? Ihre Gedanken rasten wild durcheinander. Hatte er den Schlafenden nur gespielt und sie dann verfolgt? Aber wie konnte er dann schon hier sein? Sanna schaute sich um. „Nein“, mahnte sie sich zur Ruhe, „das kann nicht sein, obwohl?“ Ihr Herz klopfte bis zum Hals. Mit vorsichtigen Schritten näherte sie sich der Bank und erkannte, dass es sich bei der Gestalt um einen alten Mann handelte. Langsam und mit einem erleichterten Seufzer ging sie vorbei, um nach einigen Metern ihre Schritte zu beschleunigen. Die Gestalt war ihr nicht geheuer. „Klack, klack, klack“ machten ihre Schuhe auf dem gepflasterten Strandweg. Dieser kurze Moment des Schreckens hatte ihr den Angstschweiß auf die Stirn getrieben, und nicht nur dort. Sanna merkte, dass sie am ganzen Körper klatschnass war. Nach knapp einhundert Metern verließ sie den Weg, um quer durch den Sand auf einen Strandwagen, der den Rettungsschwimmern als Station diente, zuzulaufen. Dort hatten sie sich verabredet, so wie immer. Das war ihr Platz! Noch während sie auf den Wagen zulief, zog sie ihr Kleid über den Kopf. Außer einem winzigen Slip trug sie nun nichts mehr am Körper. Gleich würde sie auch diesen ausziehen. Bernd wartete bestimmt schon sehnsüchtig. Sanna war sich sicher, wenn sie ihn nicht hätte, wenn sie nicht genau wüsste, dass durch ihn bald alles vorbei sein würde, wäre dieses Leben nicht zu ertragen. „Liebster, das muss schnellstens ein Ende haben, sonst drehe ich durch“, klagte sie, wenn sie in seinen Armen lag.
Bernd stand am Wagen und wartete ebenso sehnsüchtig auf Sanna. Er wusste nicht, dass in dieser Nacht noch etwas anderes auf ihn warten würde. Die Hölle ...
Alte Zeiten
Beide Fenster des Schlafzimmers waren weit geöffnet, während Tomke schlafend und nackt auf dem Bett lag. Die dünne Bettdecke, welche Hajo ihr in der Nacht übergelegt hatte, befand sich inzwischen zerknäult am Fußende des Bettes. Sie schlief sehr unruhig, ihr Kopf bewegte sich wie in einem wilden Traum, unkontrolliert nach rechts und links.
Frau Kommissarin Tomke Evers, Sie werden schlafen, schlafen, schlafen, Sie werden sterben, sterben, sterben. Dann hole ich mir Ihr Baby ...
„Neeeiiin!“ Mit einem Schrei fuhr sie hoch.
Sofort war der Traum gegenwärtig. Nicht nur der der letzten Nacht, dieser Traum quälte Tomke häufig. Vor einiger Zeit noch Nacht für Nacht, nun wurde es langsam weniger. Los wurde sie ihn allerdings nicht.
Hajo, der ebenfalls schlafend neben ihr gelegen hatte, war sofort hellwach. Sanft nahm er sie in den Arm. „Ist gut, mein Schatz, ist gut, alles gut. Es war dieser Traum.“
Tomke schaute ihn entgeistert an, bis sie verstand. „Ja, ich habe es schon wieder geträumt. Oh Hajo, nimmt das denn kein Ende?“
„Doch, langsam, ganz langsam. Du brauchst Geduld, wir brauchen Geduld. Wir schaffen das, gemeinsam. Komm her.“ Zärtlich streichelte er ihr über den Rücken und erschrak.
„Du bist klitschnass und kalt. Tomke, du wirst dir den Tod holen. Nackt bei offenem Fenster schlafen und dann diese schweißtreibenden Albträume. Das ist nicht gut.“
„Ich weiß, Hajo. Aber in manchen Nächten halte ich es einfach nicht anders aus und gerate in Panik. Heute Nacht war es auch so, gegen zwei Uhr bin ich aufgestanden und habe Fenster und Türen weit geöffnet. Ich hatte das Gefühl zu ersticken.“
„Ich weiß, mein Schatz, ich weiß. Komm her, ich wärme dich.“
Hajo legte eine Decke um Tomke und zog sie an sich.
„Sag nicht wieder Schatz zu mir, oder habe ich etwa eine quietschgrüne ...“
„Nein“, unterbrach er sie lachend. „Du hast keine quietschgrüne Hose an“, bestätigte er in Erinnerung an einen alten Fall. „Aber schön, dass du wieder an etwas anderes denken kannst.“
Hajo küsste sie sanft und meinte nach ein paar Minuten: „Lass uns aufstehen. Ich mache das Frühstück und du gehst ganz schnell unter die warme Dusche, sonst holst du dir noch eine Lungenentzündung.“
„Okay, Chef!“, salutierte Tomke und stand auf. Er hatte ja recht. Auch wenn es ein sommerlicher Tag werden würde, so verschwitzt und nackt bei geöffnetem Fenster, das war nicht gesund.
„Ich springe unter die Dusche und erwarte dann ein ,Fünf-Sterne-Frühstück‘, mein Lieber“, rief sie in die Küche und verschwand im Bad.
Tomke stieg in die Dusche und drehte den Wasserhahn auf. Wie ein warmer Sommerregen prasselte nun das Wasser auf ihren Kopf. Sie nahm ihn allerdings nicht wahr. In Gedanken war sie weit weg. Ihr nächtlicher Traum und der Fall vom letzten Jahr verfolgten sie. Gleichzeitig das Nurdachhaus. Es war duster und sie kam auf dem Boden liegend zu sich. Jemand flößte ihr etwas ein. Sie wehrte sich ..., dann wurde es dunkel. Alles was danach geschah, war aus ihrem Gedächtnis verschwunden. Sie hatte einen Filmriss von mehreren Tagen.
„Erst an das Krankenhaus kann ich mich wieder erinnern“, besann sie sich, während das warme Wasser noch immer über ihren Kopf, über ihren Körper lief. Trotzdem fröstelnd, drehte sie das Warmwasserventil höher.