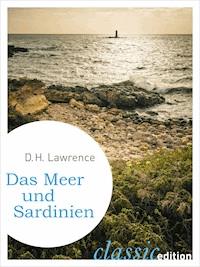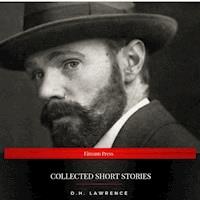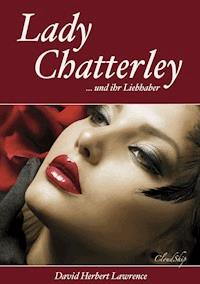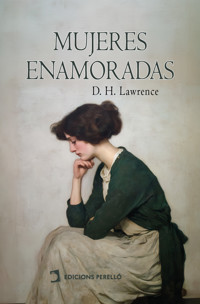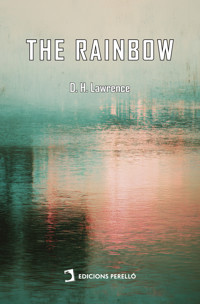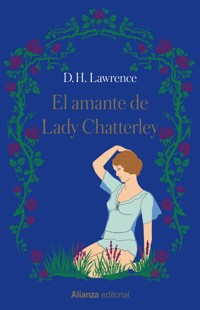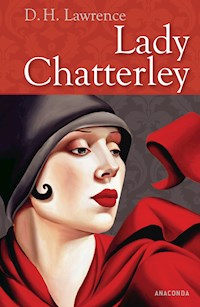
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die 'Chatterley' ist der berühmteste Roman des englischen Schriftstellers D. H. Lawrence: Aus der erdrückenden Enge ihrer Ehe mit dem verbitterten Clifford flieht die junge und schöne Titelheldin in eine leidenschaftliche Affäre mit dem lebensklugen Wildhüter Mellors. Bei allen Skandalen, die Lawrence’ offenherzig-freizügige Schilderung der Beziehung seiner beiden Hauptfiguren auslöste, bleibt das große und entscheidende Thema des Romans die Erfüllbarkeit ihres Wunsches nach Warmherzigkeit und wahrer Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
D. H. Lawrence Lady Chatterley
David Herbert Lawrence
LADY CHATTERLEY
Aus dem Englischen von Tom Roberts
Mit einer Einleitung von Helmut Werner
Anaconda
Titel der englischen Originalausgabe: Lady Chatterley’s Lover
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe 2009 Anaconda Verlag GmbH, Köln Alle Rechte vorbehalten. Umschlagmotiv: Catherine Abel (geb. 1966), »Autumn Zephyr« / Private Collection / bridgemanart.com Umschlaggestaltung: dyadesign, Düsseldorf, www.dya.deISBN 978-3-86647-375-1eISBN [email protected]
EINLEITUNG
Lady Chatterley und ihr Liebhaber, ein Werk des englischen Romanschriftstellers D. H. Lawrence (1885–1930), gehört zu den Skandalbüchern dieses Jahrhunderts. Noch 1960 mußte ein englischer Verlag vor Gericht gehen, um sich gegen den Vorwurf zu verteidigen, ein »pornographisches« Buch veröffentlicht zu haben. Man warf dem Autor sogar vor, er habe dieses »obszöne« Werk aus reiner Gewinnsucht geschrieben. Die Editionsgeschichte der Lady Chatterley und die sich anschließende Diskussion ist zugleich ein Stück Geschichte der erotischen Literatur und der sich wandelnden Einstellung zur Sexualität.
1929 begann Lawrence in Italien mit den Arbeiten an diesem seinem letzten Roman. Schon 1927 lag die erste, noch sehr kurze Fassung vor, die 1944 unter dem Titel The First Lady Chatterley (deutsch Die erste Lady Chatterley) publiziert wurde. Kurz danach arbeitete er den Roman erneut um. 1927 legte er die zweite Fassung auf Italienisch vor: La seconda Lady Chatterley, von der auch eine deutsche Übersetzung mit dem Titel ]ohn Thomas und Lady Jane erschien. Da der Autor mit keiner der bisherigen Varianten des Romans zufrieden war, schrieb er eine dritte und letzte Fassung: Lady Chatterley’s Lover, die er 1928 zuerst seinen Freunden als Privatdruck zugänglich machte. Dieser Roman wurde dann rasch ohne Genehmigung des Autors in Europa und den USA nachgedruckt, so daß sich Lawrence genötigt sah, 1929 eine »Volksausgabe« zu veröffentlichen. Auch in Deutschland erschienen ab 1930 offizielle und heimliche Übersetzungen des Romans. Lawrence teilt damit das Schicksal aller bedeutenden Autoren von erotischen Romanen wie beispielsweise Pierre Louÿs, Mac Orlan etc., deren Werke heimlich ins Deutsche übersetzt wurden. Bei diesen limitierten Privatdrucken wurde natürlich der Autorenname weggelassen und zum Teil sogar der Titel verändert. Diese heimlichen Übersetzungen, die teilweise sogar den fleißigen Bibliographen der deutschen erotischen Literatur unbekannt sind, haben gegenüber den offiziellen Editionen den entscheidenden Vorzug, daß sie wortgetreu sind und vor allem die obszönen Passagen korrekt wiedergeben. Selbst die mit Beginn der 60er Jahre verstärkt publizierten Erotika, die oft als »Neuübersetzungen« solcher Werke aus den 30ern ausgegeben wurden, konnten sich diese Freiheit nicht erlauben, weil Rücksichten auf »Prüfstellen« etc. genommen werden mußten.
Die Lady Chatterley, ein hervorragend und stellenweise in einer geradezu poetischen Sprache geschriebener Roman, muß man eigentlich nicht neu entdecken. Wie alle großen Romane der erotischen Weltliteratur ist er zeitlos, da er einen grundlegenden Aspekt der menschlichen Sexualität behandelt. Er ist geradezu modern, ohne daß er wie in den 30er Jahren einen Sturm von Entrüstung hervorruft. Viele Menschen teilen heute nämlich die Grundeinsicht von Lawrence, daß die zivilisierte Gesellschaft sinnlos ist und die Industriegesellschaft zur Verödung und Entmenschlichung führt. Um seine Gegenposition zu verdeutlichen, wollte der Autor seinen Roman ursprünglich Zärtlichkeit nennen.
Seine Kulturkritik, die zugleich auch eine Auseinandersetzung mit der englischen Gesellschaft und ihren ausgeprägten »Klassen« ist, entwickelt Lawrence an einer sehr einfach strukturierten Handlung, einer Liebesaffäre der beiden Romanhelden, deren Ausgang für den Leser offenbleibt.
Lady Chatterley, die vitale und lebensfreudige Frau eines aristokratischen, infolge einer Kriegsverletzung gelähmten und völlig impotenten Grubenbesitzers, beginnt ein intimes Liebesverhältnis mit dem Förster ihres Mannes, Oliver Mellors. Allein der Umstand, daß sich eine Frau der höheren Gesellschaftsschicht in einen einfachen Mann verliebt, ist eine Provokation. Aber nicht genug! Sie wird schwanger, bekennt sich zu ihrem außerehelichen Verhältnis mit Folgen und reicht die Scheidung ein. Man kann verstehen, daß Lawrence an mehreren Fassungen arbeitete, weil es ungemein schwierig war, eine solche Romanhandlung überzeugend zu motivieren und zu entwikkeln. Dem äußeren Anschein nach ist das Verhalten der Lady Chatterley sehr provokativ, aber bei näherem Betrachten ist es doch nur das ganz normale Verhalten einer liebenden Frau, was auch Lawrence bewußt war. Um nicht in die üblichen Trivialitäten der Gesellschaftsromane abzugleiten, stattet er ihren Ehemann Clifford mit einem recht großzügigen Charakter aus. So erlaubt er seiner Frau gelegentlich sexuelle »Ausflüge« und ist sogar bereit, ein Kind von einem Liebhaber zu akzeptieren, wenn er aus einem standesgemäßen Haus käme. Kurzum, er erlaubt ihr alles, was ihm aufgrund seiner gesellschaftlichen Stellung möglich ist, ohne sein Gesicht zu verlieren. Den Interpreten des Romans scheint bisher entgangen zu sein, daß Clifford Chatterley mit dieser Geisteshaltung selbst aus dem Rahmen der englischen Gesellschaft fällt. Fortschrittliche Literaten, Pädagogen und Sexualreformer vertraten in den 30er Jahren unter scharfen Anfechtungen von konservativer Seite eine solch großzügige Einstellung, die die Ehe an sich in Frage stellt. So propagierte Dora Russel den Geschlechtsverkehr ohne Fortpflanzungsabsichten mit der Losung »The right to be happy« (Das Recht, glücklich zu sein). Bertrand Russels setzte sich 1929 in seinem bekannten Buch »Marriage and Morals« (Ehe und Moral) für eine grundlegende Ehereform und eine Neubewertung der »freien Liebe« ein. In dem Buch »Do what you will« vertrat Aldous Huxley, der Lawrence übrigens bei der Veröffentlichung der dritten Fassung des Romans behilflich war, ähnliche Ideen. Daß Clifford am Ende des Romans diese großzügige Einstellung aufgibt und in einer geradezu kindisch anmutenden Szene seine Pflegerin Mrs. Bolton sexuell belästigt, macht ihn als Romanfigur nur glaubwürdiger.
Lady Chatterley nimmt sich zuerst den Dramatiker Michaelis als Liebhaber, der ihr aber auch nicht die ersehnte sexuelle Erfüllung verschaffen kann. Ihre Situation beschreibt sie so: »Ihr Körper wurde bedeutungslos, wurde glanzlos, undurchsichtig, nur eben ein Stück nutzloser Substanz. Das verursachte ihr ein Gefühl unendlicher Bedrücktheit und Hoffnungslosigkeit. Welche Hoffnung gab es? Sie war alt, alt mit siebenundzwanzig, ohne ein Schimmern, ohne einen Glanz in ihrem Fleisch. Alt durch Vernachlässigung und Versagung. Ja, Versagung. Modische Frauen erhielten durch äußere Sorgfalt ihre Körper schimmernd wie Porzellan. Innen in dem Porzellan war nichts; aber sie schimmerte nicht einmal auf diese Art. Das geistige Leben! Sie haßte es plötzlich mit einer jäh aufsteigenden Wut, haßte den Schwindel.«
Dies ändert sich mit einem Male, als sie nach dem verschrobenen und intellektuellen Michaelis den Förster Mellors kennenlernt. Er ist ein Mann aus einfachen Verhältnissen, der vor Lebenskraft nur so strotzt und gegenüber seinem impotenten Herrn darauf verweist, was er »zwischen den Beinen« hat. Er ist ein Außenseiter oder besser Aussteiger aus der Gesellschaft. Abgeschieden von der Gesellschaft und getrennt von seiner Ehefrau lebt er in einem Forsthaus im Wald. Seine Abneigung gegen die Zivilisation drückt Mellors auch dadurch aus, daß er nicht die Hochsprache gebraucht, sondern sich eines derben Dialektes bedient. Dieser Umstand führt bei der Übersetzung zu oft sehr schwer lösbaren Problemen, die von den bisherigen Ausgaben durch Kürzungen bzw. Weglassung des Textes gelöst wurden. Die vorliegende Ausgabe bemüht sich auch bei diesen Passagen um Vollständigkeit und Texttreue.
Schon nach ihrem ersten Zusammentreffen fühlt sich Lady Chatterley von diesem Mann, der für sie der Inbegriff der männlichen Sexualität ist, angezogen. Mit großem psychologischem Einfühlungsvermögen schildert Lawrence das Zusammentreffen von Standesschranken und gesellschaftlichen Vorurteilen mit der Sexualität, die für das eigentliche Leben steht. Je mehr diese künstliche Welt mit all ihren Vorurteilen zusammenbricht, desto freier kann sich die gehemmte und unterdrückte Sexualität der Lady Chatterley entfalten. Die anfänglich knappen Koitusschilderungen werden mit dem Erwachen ihrer Sexualität immer umfangreicher. Ihre gehemmte Einstellung zu allem Sexuellen äußert sich zunächst in einer ablehnenden, distanzierten und ironischen Einstellung zum männlichen Glied. Wie sehr sie auch auf ihre Freiheit bedacht ist und nicht zur »Sklavin« eines Mannes werden will, erliegt sie doch der Faszination ihres Liebhabers, dem es gelingt, sie beide nach anfänglichen Mißerfolgen zum gemeinsamen Orgasmus zu bringen. Seine »obszöne« Sprache beim Sexualakt und danach hat eine geradezu therapeutische Wirkung und stellt eine entspannte und sexualfremde Atmosphäre her. Diese »obszönen« Wörter, die man Lawrence so sehr vorgehalten hat, haben die Funktion, die Tabuisierung des Sexuellen in der Sprache aufzuheben. Durch diese Direktheit der Sprache, die durch den Dialekt noch verstärkt wird, verliert Lady Chatterley ihre Hemmungen und findet zu einer wichtigen Grundrealität des Lebens, der lustvollen Sexualität, zurück. Zu dieser Enttabuisierung des Sexuellen durch Obszönität gehört auch der Koitus im Freien und im Regen, wodurch Lady Chatterley sehr beschmutzt wird. Seit den Tagen des Marquis des Sade gehören solche »Besudelungen« zum eigentlichen Wesen des Obszönen. In diesen Zusammenhang reihen sich auch die zahlreichen analerotischen Passagen ein, in denen Mellors den Po seiner Geliebten lobt: »Du hast den schönsten Frauenhintern, den es gibt.« Eine gewisse Steigerung in dieser Richtung kann man in den Anspielungen auf die Notdurft und der damit verbundenen gleichzeitigen Berührung der »geheimen Stellen« sehen. Die in die Koitusszenen eingeflochtenen kulturkritischen Erörterungen über die Sinnlosigkeit des Geldverdienens, über die körperlichen Gebrechen der Menschen infolge der Arbeit und der widersinnigen Mode rufen gelegentlich Erinnerungen an de Sade wach. Aber sicherlich ist es maßlos übertrieben, wenn Clifford den Liebhaber seiner Frau als einen »Marquis de Sade« beschreibt, der im Forsthaus sein Unwesen mit den Frauen treibt.
Dieses intime Verhältnis hätte unbeschränkt fortgesetzt werden können, wenn nicht Lady Chatterley den Wunsch verspürte, von ihrem nicht-standesgemäßen Liebhaber ein Kind zu haben. Daraus folgt die Trennung von ihrem Mann, die sie auch erfolgreich in die Tat umsetzt. Damit ruft sie bei ihrem Liebhaber, der sich wegen seiner kritischen und ablehnenden Einstellung zur Zivilisation fürchtet, Kinder in die Welt zu setzen, zunächst Verblüffung und Ablehnung hervor. Zugleich aber distanziert sich auch der Autor mit dem beharrlichen Kinderwunsch seiner Titelheldin von den Sexualreformen seiner Zeit, die einen »Geschlechtsverkehr um der reinen Lust wegen« propagierten. Im Roman selbst wird diese Haltung mit Connies veränderter Einstellung zur Sexualität begründet. Unmittelbar nach einem Liebesakt mit Mellors beschreibt Lawrence ihr neues Körpergefühl und ihre veränderte Haltung gegenüber der Sexualität so:
»Ein anderes Ich war in ihr lebendig, brannte geschmolzen und weich in ihrem Leib und ihren Eingeweiden, und mit diesem Ich betete sie ihn an. Sie betete ihn an, bis ihre Knie weich wurden im Dahinschreiten. In ihrem Leib und ihren Eingeweiden zerfloß sie nun und war lebendig und verwundbar und hilflos in ihrer Anbetung für ihn wie die allernaivste Frau. ›Es ist, als fühlte ich ein Kind‹, sagte sie sich, ›als fühlte ich ein Kind in mir‹. Und so war es auch. Als hätte ihr Schoß, der fest verschlossen gewesen, sich geöffnet und mit neuem Leben erfüllt, beinah eine Last und doch wonnevoll.«
Daß der Kinderwunsch einer Frau eng mit der sexuellen Befriedigung durch ihren Partner zusammenhängt, ist eine bekannte Tatsache der Sexualwissenschaft. Eine solche Frau empfindet nämlich das männliche Glied als den »Keim« ihres ersehnten Kindes. Es gehört sicherlich zu den großartigsten Leistungen von Lawrence, mit geradezu wissenschaftlicher Akribie den Prozeß der Entfaltung der Sexualität der Lady Chatterley dargestellt zu haben.
H. Werner
ERSTES KAPITEL
unser Zeitalter ist dem Wesen nach tragisch, daher weigern wir uns, es tragisch zu nehmen. Die Katastrophe ist eingetreten, wir stehen inmitten des Trümmerhaufens, wir beginnen, neue kleine Wohnstätten zu bauen, neue kleine Hoffnungen zu hegen. Es ist eine recht schwere Arbeit. Es führt keine glatte Straße in die Zukunft. Aber wir machen Umwege, wir klettern über Hindernisse. Wir müssen leben, ganz gleich, wieviele Himmel eingestürzt sein mögen.
In dieser Lage befand sich mehr oder weniger auch Constance Chatterley. Der Krieg hatte ihr das Dach über dem Kopf zum Einstürzen gebracht, und sie hatte begriffen, daß man im Leben nie auslernt.
Sie heiratete Clifford Chatterley, als er im Jahre 1917 einen Monat auf Urlaub daheim war. Ihre Flitterwochen währten einen Monat. Dann ging er zurück nach Flandern – und wurde sechs Monate später wieder nach England verfrachtet, mehr oder weniger in Stücken. Constance, seine Frau, war damals dreiundzwanzig Jahre alt, er selbst war neunundzwanzig.
Sein Lebenswille war erstaunlich. Er starb nicht, und die Stücke schienen wieder zusammenzuwachsen. Zwei Jahre lang blieb er in den Händen der Ärzte. Dann wurde er für geheilt erklärt und konnte ins Leben zurückkehren, die untere Körperhälfte, von den Hüften abwärts, für immer gelähmt.
Das war 1920. Das Paar bezog Clifford Chatterleys altes Heim, Wragby Hall, den »Familiensitz«. Da sein Vater gestorben war, war Clifford nun ein Baronet, Sir Clifford, und Constance war Lady Chatterley. Sie begannen ihren Haushalt und ihr Eheleben auf dem recht verlassenen Stammsitz der Chatterleys mit einem kaum ausreichenden Einkommen. Cliffords einzige Schwester war weggezogen. Andere nahe Verwandte waren nicht vorhanden. Der ältere Bruder war im Kriege gefallen. Für immer ein Krüppel, der wußte, daß er nie Kinder haben werde, kam Clifford heim ins rauchige Mittelengland, um den Namen der Chatterleys lebendig zu erhalten, solange er konnte.
Er war nicht wirklich niedergeschlagen. Er konnte sich in einem Rollstuhl umherfahren, und er besaß einen Krankensessel mit einem anmontierten kleinen Motor, und so konnte er langsam durch den Garten und den schönen schwermütigen Park kutschieren, auf den er in Wirklichkeit sehr stolz war, obgleich er tat, als wäre ihm nichts an ihm gelegen.
Er, der so viel gelitten, hatte bis zu einem gewissen Grad die Fähigkeit zu leiden verloren. Er blieb seltsam heiter und fröhlich, ja beinahe vergnügt, möchte man sagen, mit seiner rosigen, gesunden Gesichtsfarbe, seinen blaßblauen, herausfordernd glänzenden Augen. Seine Schultern waren breit und stark, seine Hände sehr kräftig. Er war kostspielig gekleidet und trug elegante Krawatten aus der Bond Street. Doch in seinem Gesicht war der wachsame, aber ein wenig leere Blick des Krüppels.
Er war so nahe daran gewesen, sein Leben zu verlieren, daß, was davon übrig blieb, ihm wundervoll köstlich erschien. Der gierige Glanz seiner Augen verriet, wie stolz er war, nach der großen Erschütterung noch am Leben zu sein. Aber er war so verwundet worden, daß irgend etwas in ihm zugrunde gegangen, daß einige seiner Gefühle verschwunden waren. Irgendwo war eine Lücke, eine leere, empfindungslose Stelle.
Constance, seine Frau, war ein rotwangiges, ländlich aussehendes junges Weib mit weichem braunem Haar, kräftigem Körper und langsamen Bewegungen voll ungewöhnlicher Energie. Sie hatte große, verwunderte Augen und eine weiche sanfte Stimme und schien eben aus ihrem Heimatdorf gekommen zu sein. Dem war keineswegs so. Ihr Vater war das einst wohlbekannte Mitglied der königlichen Akademie der Künste, der alte Sir Malcolm Reid. Ihre Mutter war in den schönen Tagen der Präraffaeliten eine jener kultivierten Fabierinnen gewesen. Inmitten von Künstlern und kultivierten Sozialisten genossen Constance und ihre Schwester Hilda eine, wie man sie nennen könnte, ästhetisch unkonventionelle Erziehung. Sie waren, um Kunst einzuatmen, nach Paris, Florenz und Rom und, in der anderen Richtung, auch nach Den Haag und Berlin zu großen Sozialistenkongressen mitgenommen worden, wo Redner in allen Kultursprachen sich hören ließen und niemand sich Zurückhaltung auferlegte.
Die beiden Mädchen waren daher von frühester Jugend an weder durch Kunst noch ideale Politik eingeschüchtert. Die waren ihr natürliches Element. Sie waren Kosmopoliten und Provinzler zugleich, von jenem kosmopolitischen Provinzlertum der Kunst, das Hand in Hand mit reinen sozialistischen Idealen geht.
Im Alter von fünfzehn Jahren waren sie nach Dresden geschickt worden, unter anderm der Musik wegen. Und sie hatten es sich dort gut gehen lassen. Sie lebten ein freies Leben mit den Studenten, sie führten lange Wortgefechte mit den Männern über philosophische, soziologische und künstlerische Dinge, sie waren ebenso gut wie die Männer selbst – nur noch besser, weil sie Frauen waren. Und so zogen sie mit stämmigen Jünglingen, die Gitarren trugen – pling, pling! –, los in die Wälder. Sie sangen Wandervogellieder und waren frei. Frei! Das war das große Wort. Draußen in der offenen Welt, draußen in den morgendlichen Wäldern, mit frischfröhlichen, stimmkräftigen Kameraden, waren sie frei zu tun, was ihnen beliebte, und – vor allem – zu sagen, was ihnen beliebte. Die Gespräche waren es, auf die es in erster Linie ankam, der leidenschaftliche Austausch von Gesprächen. Die Liebe war nur eine nebensächliche Begleitung dazu!
Hilda und Constance hatten beide, ehe sie achtzehn waren, ihre versuchsweisen Liebesaffären hinter sich. Die jungen Männer, mit denen sie so leidenschaftlich redeten und so lustig sangen und unter den Bäumen in solcher Freiheit kampierten, wollten natürlich ein Liebesverhältnis. Die Mädchen waren im Zweifel; aber schließlich, es wurde über die Sache so viel geredet, sie wurde für so wichtig gehalten … Und die Männer waren so demütig und lechzten so sehr danach. Warum sollte ein Mädchen nicht großmütig sein wie eine Königin und sich als Geschenk geben?
So hatten sie sich denn als Geschenk gegeben, eine jede dem Jüngling, mit dem sie die verzwicktesten und vertraulichsten Gespräche geführt hatte. Die Gespräche, die Wortgefechte, waren die Hauptsache; die Liebe und die Liebesbeziehung waren nur eine Art primitiven Rückschlags, eine kleine Ernüchterung. Man war nachher weniger verliebt in den Jungen und ein bißchen geneigt, ihn zu hassen, als wäre er unbefugt in das verbotene Gebiet des Privatlebens und der inneren Freiheit eingedrungen. Denn da man ein Mädchen war, bestand die ganze Würde und Bedeutung, die man im Leben besaß, in der Erlangung einer unbedingten, einer vollkommenen, einer reinen und edlen Freiheit. Was sonst bedeutete das Leben eines Mädchens, wenn nicht das Abwerfen der alten und niedrigen Bindung und Knechtungen?
Und wieviel sentimentales Zeug man darüber auch reden mochte, diese sexuellen Dinge war eine der urältesten, niedrigsten Bindungen und Knechtungen. Die Dichter, die sie verherrlichten, waren zumeist Männer. Frauen hatten stets gewußt, daß es noch etwas Besseres, etwas Höheres gebe. Und nun wußten sie es bestimmter denn je. Die schöne reine Freiheit des Weibes war unendlich wundervoller als irgendeine geschlechtliche Liebe. Das einzige Unglück war nur, daß die Männer darin so weit hinter den Frauen zurückblieben. Sie waren auf dieses sexuelle Zeug erpicht wie die Hunde.
Und einer Frau blieb nichts anderes übrig, als nachzugeben. Ein Mann mit seinen Gelüsten glich so sehr einem Kind. Eine Frau mußte ihm überlassen, was er wollte, sonst würde er wie ein Kind wahrscheinlich unartig werden und davonlaufen und verderben, was eine sehr angenehme Beziehung gewesen war. Aber eine Frau konnte sich einem Manne hingeben, ohne ihr inneres freies Ich aufzugeben. Das schienen die Dichter und die großen Redner über Sexualität nicht genügend in Betracht gezogen haben. Eine Frau konnte einen Mann nehmen, ohne sich selbst herzugeben. Sicherlich konnte sie ihn nehmen, ohne sich in seine Macht zu begeben. Da konnte sie eher diesen sexuellen Kram dazu benützen, Macht über ihn zu haben. Denn sie brauchte sich im geschlechtlichen Verkehr bloß zurückhalten und ihn zu Ende kommen und sich verausgaben zu lassen, ohne selbst bis zum entscheidenden Augenblick zu gelangen; und dann konnte sie das Zusammensein verlängern und ihren eigenen Orgasmus und Höhepunkt erreichen, während er bloß ihr Werkzeug war.
Beide Schwestern hatten ihre Erfahrungen in der Liebe bereits gemacht, als der Krieg ausbrach, und beide wurden eilends heimgerufen. Keine war je in einen jungen Mann verliebt gewesen, ohne daß er und sie einander in Worten sehr nahe gewesen währen, daß heißt, ohne daß sie zutiefst interessiert miteinander geredet hätten. Die erstaunliche, die tiefgehende, die unglaubliche Sensation, die darin lag, leidenschaftlich mit einem wirklich gescheiten jungen Mann stundenlang zu reden, Tag für Tag, durch Monate hindurch, wieder von neuem zu beginnen – die hatten sie sich nie vergegenwärtigt ehe sie wirklich eintrat. Die paradiesische Verheißung »Du sollst Männer haben, um mit ihnen zu reden«, war nie verkündet worden. Sie ging in Erfüllung, ehe sie wußten, welch eine Verheißung das war.
Und wenn nach der erregten Vertraulichkeit dieser lebhaften und seelisch erleuchteten Diskussionen das Sexuelle mehr oder weniger unvermeidlich wurde, dann nahm man es eben hin. Es bezeichnete das Ende eines Kapitels. Es besaß auch seinen eigenen Reiz: ein seltsamer bebender Schauer innen im Körper, ein letzter Krampf von Selbstbehauptung wie das letzte Wort, aufregend und sehr ähnlich der Reihe von Sternchen, die man setzen kann, um das Ende eines Abschnittes oder eine Unterbrechung im Thema anzuzeigen.
Als die Mädchen in den Sommerferien 1913 heimgekommen waren – Hilda war damals zwanzig und Connie achtzehn Jahre alt gewesen – hatte ihr Vater deutlich sehen können, daß sie ihr Liebeserlebnis gehabt hatten.
Die Liebe war dahingegangen, wie jemand es ausgedrückt hatte. Aber er war selbst ein Mann von Erfahrung und ließ das Leben seinen Lauf nehmen. Die Mutter dagegen, eine nervöse Schwerkranke in den letzten paar Monaten ihres Lebens, wollte bloß, daß ihre Mädchen »frei« seien und »ihre Persönlichkeit verwirklichten«. Sie selbst war nie imstande gewesen, sich vollkommen zu verwirklichen; es war ihr versagt geblieben. Der Himmel mochte wissen, warum, denn sie war eine Frau, die eigenes Vermögen besaß und der man stets ihren Willen gelassen hatte. Sie gab ihrem Manne die Schuld. Aber der wirkliche Grund war, daß sie einen alten Eindruck von Autorität, der sich ihrem Geist oder ihrer Seele eingeprägt hatte, nicht loswerden konnte. Er hatte nichts mir Sir Malcolm zu tun, der seine nervös feindselige, reizbare Frau in ihrem eigenen Hühnerstall herrschen ließ, während er seiner Wege ging.
So waren die Mädchen also »frei« und kehrten nach Dresden zu ihrer Musik, zur Universität und ihren jungen Männern zurück. Sie liebten ihre betreffenden jungen Männer, und ihre betreffenden jungen Männer liebten sie, mit der ganzen Leidenschaft geistiger Anziehung. All die wundervollen Dinge, die die jungen Männer dachten, zum Ausdruck brachten und schrieben, dachten, sprachen und schrieben sie für die jungen Weiber. Connies Jüngling war musikalisch, Hildas Jüngling technisch begabt. Aber sie lebten einzig für die Mädchen. Im Geiste und in ihren geistigen Erfahrungen, heißt das. Anderswo waren sie ein wenig abgeschreckt, aber sie wußten es nicht.
Auch an ihnen war klar zu sehen, daß die Liebe durch sie hindurchgegangen war, daß heißt, das körperliche Erlebnis. Es ist sonderbar, welch eine kaum merkliche, aber unverkennbare Veränderung es im Körper sowohl des Mannes als auch der Frau bewirkt: die Frau ist blühender, feiner gerundet, die jungen Eckigkeiten sind geglättet, und ihre Miene wird entweder ängstlich oder triumphierend; der Mann ist viel ruhiger, mehr nach innen gekehrt, sogar die Form seiner Schultern und seiner Hinterbacken ist weniger selbstbewußt und unsicherer.
Im eigentlichen, körperlich empfundenen geschlechtlichen Erschauern erlagen die Schwestern beinahe der seltsamen männlichen Gewalt. Aber rasch faßten sie sich wieder, nahmen den Schauer als eine Sensation hin und blieben frei. Wogegen die Männer, in Dankbarkeit gegen die Frauen für das sexuelle Erlebnis, ihnen ihre Seelen entgegenbrachten. Und nachher fast so dreinsahen, als hätten sie einen Schilling verloren und ein Sechspencestück gefunden. Connies Freund konnte bisweilen ein wenig mürrisch sein und Hildas Freund ein wenig höhnisch. Aber so sind die Männer eben! Undankbar und nie zufrieden. Wenn du sie nicht nimmst, hassen sie dich, weil du nicht willst, und wenn du sie nimmst, hassen sie dich auch – aus irgendeinem anderen Grund. Oder aus gar keinem Grund, außer daß sie unzufriedene Kinder sind und nicht zufrieden sein können, was immer sie bekommen – mag eine Frau tun, was sie will.
Jedoch es kam der Krieg, und Hilda und Connie wurden wiederum nach Hause zurückgehetzt, nachdem sie bereits im Mai zum Begräbnis ihrer Mutter daheim gewesen waren. Noch vor Weihnachten 1914 waren ihre beiden jungen Deutschen tot, worauf die Schwestern weinten und ihre jungen Männer leidenschaftlich liebten, aber unter dieser Liebe vergaßen. Sie waren nicht mehr da. Beide Schwestern lebten in ihres Vaters, in Wirklichkeit ihrer Mutter Haus in Kensington und verkehrten in dem jungen Cambridger Kreis, dem Kreis, der für »Freiheit« eintrat und durch Flanellhosen und am Halse offene Flanellhemden und eine wohlerzogene Art gefühlsmäßiger Anarchie, eine flüsternde, diskret murmelnde Stimme und eine überempfindliche Art des Benehmens gekennzeichnet war. Hilda jedoch heiratete plötzlich einen um zehn Jahre älteren Mann, ein älteres Mitglied dieses selben Cambridger Kreises, einen Mann mit ansehnlich viel Geld und einem bequemen, in seiner Familie beinahe erblichen Posten in einem Ministerium; auch schrieb er philosophische Essays. Sie lebte mit ihm in einem kleinen Haus in Westminster und bewegte sich in jener guten Gesellschaft hoher Staatsbeamter, die nicht ganz zu den Spitzen gehören, die aber die wirklich intelligente Kraft der Nation sind oder sein wollen; Leute, die wissen, wovon sie reden, oder reden, als ob sie es wüßten.
Connie betätigte sich ein wenig in der Kriegshilfe und verkehrte mit den flanellbehosten Cambridger Intransigenten, die soweit alles und jedes sanft bespöttelten. Ihr bester Freund war ein gewisser Clifford Chatterley, ein junger Mann von zweiundzwanzig, der aus Bonn heimgeeilt war, wo er die technischen Einzelheiten des Kohlenbergbaus studiert hatte. Zuvor hatte er zwei Jahre in Cambridge verbracht. Nun war er Leutnant in einem vornehmen Regiment, und so stand es ihm in Uniform noch besser an, alles zu bespötteln.
Clifford Chatterley stammte aus höheren Kreisen als Connie. Connie gehörte der wohlhabenden Intelligenz an, er aber der Aristokratie. Nicht von der ganz feudalen Art, aber immerhin. Sein Vater war ein Baronet, und seine Mutter war die Tochter eines Viscount gewesen.
Aber Clifford war, obgleich von besserer Abstammung als Connie und mehr zu »Gesellschaft« gehörend, in seiner Art provinzhafter und schüchterner. Er bewegte sich unbefangen in der engen »großen Welt«, das heißt, der landbesitzenden Aristokratie, aber er war scheu und nervös in jener anderen großen Welt, die aus den ungeheuren Horden des Mittelstandes und der unteren Klassen und der Ausländer besteht. Die Wahrheit zu sagen: Er empfand sogar ein klein wenig Angst vor der mittelständischen und proletarischen Menschheit und vor Ausländern, die nicht seiner Klasse angehörten. Auf eine gewisse lähmende Art war er sich seiner eigenen Wehrlosigkeit bewußt, obwohl ihm alle Bollwerke des Bevorrechtetseins zur Verfügung standen. Eine sonderbare, aber allgemeine Erscheinung unserer Zeit.
Daher fesselte ihn die besondere, sanfte Selbstsicherheit eines Mädchens wie Constance Reid. Sie war in jener äußeren Welt des Chaos so viel mehr Herr ihrer selbst als er.
Nichtsdestoweniger war auch er ein Rebell; er rebellierte sogar gegen seine Kaste. Oder Rebell ist vielleicht ein zu starkes Wort; viel zu stark. Er wurde nur mit hineingerissen in die allgemeine, beliebte Auflehnung der Jungen gegen Konventionen und gegen jede Art wirklicher Autorität. Väter waren lächerlich; sein eigener, eigensinniger ganz besonders. Und Regierungen waren auch lächerlich; die abwartende und teetrinkende Art der Engländer ganz besonders. Und die Armee war lächerlich und alte Pfuscher von Generalen überhaupt, der rotgesichtige Kitchener vor allen. Sogar der Krieg war lächerlich, obwohl er eine ganz hübsche Menge Leute umbrachte.
In der Tat war alles ein wenig oder sogar sehr lächerlich; sicherlich war alles, was mit Autorität zusammenhing, ob im Heer oder in der Regierung oder an der Universität, in gewissem Grade lächerlich. Und soweit die herrschende Klasse irgendwelche Ansprüche machte zu herrschen, war auch sie lächerlich. Sir Geoffrey, Cliffords Vater, war außerordentlich lächerlich, wie er so seine Bäume zerhackte und Männer aus seinem Bergwerk ausjätete, um sie in den Krieg zu schubsen, und selber dabei so schön in Sicherheit und patriotisch war. Aber auch mehr Geld für sein Land verschwendete, als er besaß.
Als Miß Chatterley – Emma – aus den Midlands nach London kam, um sich als Pflegerin zu betätigen, redete sie in einer stillen Art sehr witzig über Sir Geoffrey und seinen entschlossenen Patriotismus. Herbert, der ältere Bruder und Erbe, lachte laut heraus, obgleich es seine Bäume waren, die gefällt wurden, um als Stützpfosten für die Schützengräben zu dienen. Clifford aber lächelte nur ein wenig unbehaglich. Alles war lächerlich, ganz recht. Aber wenn es einem zu nahe kam und man selber auch lächerlich wurde …? Leute aus einer anderen Klasse, wie zum Beispiel Connie, waren wenigstens in einem ernst. An eines glaubten sie.
Sie waren recht ernst, wo es um die Tommies ging und die drohende allgemeine Wehrpflicht und den Mangel an Zucker und an Karamellen für die Kinder. In allen diesen Dingen begingen die Behörden selbstverständlich lächerliche Fehler. Aber Clifford konnte es sich nicht zu Herzen nehmen. Für ihn waren die Behörden von Anbeginn lächerlich. Nicht wegen der Bonbons oder der Tommies.
Und die Behörden kamen sich selbst lächerlich vor und benahmen sich auf eine recht lächerliche Art, und das Ganze war ein großes Narrenhaus. Bis die Dinge drüben auf dem Festland sich entwickelten und Lloyd George kam, um herüben die Situation zu retten. Das überstieg sogar die Grenzen dessen, was lächerlich gemacht werden konnte, und die kecken jungen Leute lachten nicht mehr.
1916 fiel Herbert Chatterley, und so wurde Clifford der Erbe. Sogar das machte ihn ängstlich. Seine Wichtigkeit als Sohn Sir Geoffreys und als Kind von Wragby war ihm so eingefleischt, daß er ihr nicht entrinnen konnte. Und doch wußte er, daß auch dies in den Augen der riesigen brodelnden Welt lächerlich sei. Nun also war er der Erbe und für Wragby verantwortlich. War das nicht schrecklich? Und auch herrlich? Und doch vielleicht unsinnig?
Sir Geoffrey ließ die Unsinnigkeit nicht gelten. Er war blaß und angespannt in sich selbst zurückgezogen und hartnäckig entschlossen, sein Land und seine eigene Stellung zu retten, mochte nun Lloyd George oder sonst wer am Ruder sein. So abgesondert war er, so abgeschnitten von dem England, das wirklich England war, so völlig unfähig, die wahre Lage der Dinge zu begreifen; Sir Geoffrey trat ein für England und Lloyd George, wie seine Vorfahren eingetreten waren für England und St. George; und er erkannte nie den Unterschied. Sir Geoffrey fällte Nutzholz und trat ein für Lloyd George und England, England und Lloyd George.
Und er wollte, daß Clifford heiratete und einen Erben zeuge. Clifford hatte das Gefühl, daß sein Vater ein hoffnungsloser Anachronismus sei. Aber worin war er selbst auch nur einen Schritt weiter, außer in einem zaghaften Gefühl für die Lächerlichkeit von allem und jedem und die überragende Lächerlichkeit seiner eigenen Stellung? Denn wohl oder übel nahm er seine Adelswürde und Wragby bitter ernst.
Die fröhliche Erregung war aus dem Krieg entschwunden … tot. Zu viel Tod und Greuel. Ein Mann brauchte Trost und Stütze. Ein Mann mußte einen Anker in einer sicheren Welt haben. Ein Mann brauchte eine Frau.
Die Chatterleys, zwei Brüder und eine Schwester, hatten, auf Wragby miteinander eingeschlossen, ungeachtet aller ihrer Verbindungen merkwürdig isoliert gelebt. Ein Gefühl des Isoliertseins verstärkte die Familienbande, ein Gefühl der Schwäche ihrer Stellung, ein Gefühl der Wehrlosigkeit, trotz oder auch wegen des Titels und Grundbesitzes. Sie waren abgeschnitten von jenem industriellen Mittelengland, in dem sie ihr Leben verbrachten. Und sie waren abgeschnitten von ihrer eigenen Klasse durch die grübelnde, eigensinnige, verschlossene Natur Sir Geoffreys, ihres Vaters, über den sie sich lustig machten, obwohl sie doch so empfindlich waren in allem, was ihn betraf.
Die drei hatten erklärt, sie wollten immer beisammen leben. Aber nun war Herbert tot, und Sir Geoffrey wollte, Clifford solle heiraten. Sir Geoffrey erwähnte es kaum; er sprach sehr wenig. Aber seine schweigende, grübelnde Beharrlichkeit machte es Clifford sehr schwer, sich dagegen zur Wehr zu setzen.
Emma jedoch sagte: Nein! Sie war zehn Jahre älter als Clifford, und sie fühlte, daß seine Heirat eine Fahnenflucht wäre, ein Verrat an allem, wofür die jungen Mitglieder der Familie eingetreten waren.
Clifford, nichtsdestoweniger, heiratete Connie und verlebte seinen Monat Flitterwochen mit ihr. Es war das schreckliche Jahr 1917, und sie waren so vertraut miteinander wie zwei Leute, die auf einem sinkenden Schiff stehen. Er war unberührt gewesen, als er heiratete; und das Sexuelle an der Ehe bedeutete ihm nicht viel. Auch von dem abgesehen, waren sie einander so nahe, er und sie. Und Connie empfand diese Intimität, die jenseits des Geschlechtlichen, jenseits der »Befriedigung« eines Mannes lag, als einen kleinen Triumph. Clifford jedenfalls war nicht gerade erpicht auf seine »Befriedigung«, wie so viele Männer es zu sein schienen. Nein! die Intimität war tiefer, war persönlicher als das, und das Sexuelle war bloß etwas Zufälliges oder eine Zutat: einer dieser merkwürdigen, dumpfen organischen Vorgänge, die sich in ihrer Plumpheit beharrlich erhielten, aber nicht wirklich notwendig waren. Connie jedoch wollte Kinder haben, wenn auch nur, um ihre Stellung gegenüber ihrer Schwägerin Emma zu stärken.
Aber zu Anfang des Jahres 1918 wurde Clifford zusammengeschossen heimtransportiert, und es war kein Kind da. Und Sir Geoffrey starb vor Verdruß.
ZWEITES KAPITEL
Connie und Clifford kamen im Herbst 1920 nach Wragby heim. Miß Chatterley, noch immer entrüstet über ihres Bruders Verrat, war weggezogen und lebte in einer kleinen Wohnung in London.
Wragby Hall war ein langgestrecktes niedriges altes Gebäude aus braunen Ziegeln, um die Mitte des 18. Jahrhunderts begonnen und später vergrößert, bis es einem Kaninchenbau glich und wenig Vornehmheit aufwies. Es stand auf einer Anhöhe in einem sehr schönen alten Park von Eichen, aber leider konnte man in geringer Entfernung den Schornstein der Tevershall-Zeche mit seiner Wolke von Dampf und Rauch erblicken und in der feuchten dunstigen Ferne den Hügelrücken mit den zerstreuten Häusern des Dorfes Tevershall, eines Dorfes, das beinahe am Parktor begann und sich in völlig hoffnungsloser Häßlichkeit eine lange greuliche Meile weit hinzog. Häuser, ganze Reihen elender, kleiner, verrußter Ziegelhäuser mit schwarzen Schieferdächern als Deckel darauf, mit scharfen Ecken und von einer gewollten trostlosen Trübseligkeit.
Connie war Kensington gewohnt oder die schottischen Berge oder die Hügel von Sussex: das war ihr England. Mit dem Stoizismus der Jugend erfaßte sie auf den ersten Blick die völlige, seelenlose Häßlichkeit des Mittelengland der Kohle und des Eisens und ließ es dabei bewenden. Die Häßlichkeit war so unglaublich und so, daß man gar nicht an sie denken konnte. Von den recht unfreundlichen Räumen in Wragby aus hörte sie das Gerassel der Kohlensiebe um die Schachtöffnung, das Puffen der Dampfwinde, das Klicken der hin und her verschobenen Loren und die heiseren kurzen Pfiffe der Bergwerkslokomotiven. Die Halden um den Tevershall-Schacht brannten, hatten seit Jahren gebrannt, und es würde Tausende kosten, sie zu löschen. Also mußten sie brennen. Und wenn der Wind aus jener Richtung wehte, was oft geschah, war das Haus erfüllt vom Gestank dieser schwefeligen Verbrennung des Exkrements der Erde.
Aber selbst an windstillen Tagen roch die Luft nach etwas Unterirdischem: Schwefel, Eisen, Kohle oder Säure. Und sogar auf den Christrosen setzte sich der Ruß beharrlich fest, unglaubhaft, wie schwarzes Manna vom Himmel des Weltuntergangs.
Nun ja, so war es eben: vom Schicksal bestimmt wie alles andere! Es war fürchterlich, aber warum dagegen strampeln? Man konnte es nicht wegstrampeln. Es nahm eben seinen Fortgang – das Leben wie alles übrige auch! Auf dem niedrigen, dunkle Wolkengebälke brannten des Nachts rote Flecke und zitterten schwellend und sich zusammenziehend wie Brandwunden, die schmerzten. Das waren die Hochöfen. Anfangs fesselten sie Connie mit einer Art von Entsetzen; sie hatte ein Gefühl, als lebte sie unterirdisch. Dann gewöhnte sie sich. Und an den Vormittagen regnete es.
Clifford behauptete, Wragby sei ihm lieber als London. Die Landschaft habe einen zähen eigenen Willen, und die Leute hätten Mut. Connie fragte sich, was sie sonst noch hätten: sicherlich weder Augen noch Gehirne. Die Menschen waren hohlwangig, ungestalt und trübselig wie die Landschaft und ebenso unfreundlich. Nur war da etwas in ihrem breiten Verschleifen der Mundart und dem Geklapper ihrer grobgenagelten Werkschuhe, wenn sie in kleinen Gruppen auf dem Heimwege von der Arbeit über den Asphalt dahinzogen, das entsetzenerregend war und ein wenig rätselhaft.
Es hatte keine Begrüßungsfeier für den heimkehrenden Grundherrn gegeben, keine Festlichkeiten, keine Deputation, nicht einmal eine einzige Blume. Nur eine naßkalte Fahrt in einem Automobil, eine dunkle, feuchte Allee entlang, die sich durch düstere Bäume wühlte, hinaus auf den Abhang des Parkes, wo graue, nasse Schafe weideten, auf die Kuppe hinauf, wo das Haus seine dunkelbraune Fassade ausbreitete und die Haushälterin und ihr Mann schemenhaft, gleich unsicheren Bewohnern auf dem Angesicht der Erde, warteten, bereit, ein Willkommen zu stammeln. Es bestand keine Verbindung zwischen Wragby Hall und Tevershall, gar keine. Es wurden keine Hände an die Mützen gehoben, es wurden keine Knickse gemacht. Die Bergleute starrten bloß; die Ladenbesitzer lüfteten die Mützen vor Connie wie vor einer Bekannten, und Clifford nickten sie verlegen zu, das war alles. Eine unüberbrückbare Kluft, und auf beiden Seiten eine stille Art von Abneigung. Anfangs litt Connie unter dem stetigen Geriesel von Feindseligkeit, das aus dem Dorfe sickerte. Später verhärtete sie sich dagegen, und es wurde eine Art Anregungsmittel, etwas, dem man sich gewachsen zeigen konnte. Nicht, daß sie und Clifford unbeliebt gewesen wären; sie gehörten bloß einer ganz anderen Spezies an als die Bergleute. Eine unüberbrückbare Kluft, ein unbeschreiblicher Riß, wie er vielleicht südlich des Trent nirgends vorhanden, in Mittelengland aber und im industriellen Norden ein unüberschreitbarer Abgrund ist, über den hinweg es keine Verbindung geben kann. Du bleibe auf deiner Seite, und ich will auf der meinen bleiben! Ein seltsames Verneinen des gemeinsamen Pulsschlags der Menschheit.
Aber das Dorf sympathisierte mit Clifford und Connie in einem abstrakten Sinne. Im Fleische war es, hüben und drüben: Laß du mich in Ruhe!
Der Pfarrer war ein netter Mann von ungefähr sechzig, ganz von seiner Pflicht erfüllt und persönlich beinahe zur Unbedeutendheit, zu einer Null herabgedrückt durch das schweigende »Laß du mich in Ruh!« des Dorfes. Die Frauen der Bergleute waren fast alle methodistisch. Die Bergarbeiter waren gar nichts. Aber selbst das bißchen offizielle Uniform, das der Geistliche trug, genügte, um vollständig die Tatsache zu verdunkeln, daß er ein Mann wie irgendein anderer war. Nein, er war der Mista Ashby, eine Art automatischer Gebet- und Predigtunternehmung.
Dieses verstockte, instinktive: »Wir halten uns für ebenso gut, wie du bist, wenn du unbedingt Lady Chatterley sein willst!«, war für Connie anfangs äußerst verblüffend und rätselhaft. Die seltsame, argwöhnische, falsche Liebenswürdigkeit, mit der die Bergarbeiterfrauen ihren Annäherungsversuchen begegneten, der seltsam beleidigende Unterton dieses »Du meine Güte, jetzt bin ich wirklich wer, wenn die Lady Chatterley mit mir redet; aber sie braucht deswegen noch lange nicht zu glauben, daß ich nicht ebensogut bin wie sie«, das sie stets aus den halb schmeichlerischen Stimmen der Weiber näseln hörte, war etwas Unmögliches. Es war nicht darum herumzukommen. Es war hoffnungslos und beleidigend nonkonformistisch.
Clifford ließ die Leute in Ruhe. Connie lernte es, ein Gleiches zu tun; sie ging einfach vorbei, ohne sie anzusehen, und die Weiber glotzten, als wäre sie eine wandelnde Wachsfigur. Wenn Clifford mit ihnen zu tun hatte, war er recht hochmütig und verachtungsvoll; man konnte es sich nicht länger leisten, freundlich zu sein. Ja, er war im Ganzen eher überheblich und voll Verachtung gegen jeden, der nicht seiner Klasse angehörte. Er behauptete seinen Platz ohne einen Versuch zur Aussöhnung. Und er war weder beliebt noch unbeliebt bei den Leuten. Er gehörte einfach mit zu allem andern. Wie die Kohlenhalden und Wragby selbst.
Aber Clifford war in Wirklichkeit äußerst scheu und leicht verlegen, nun, da er gelähmt war. Er haßte es, irgend jemand in seiner Nähe zu sehen, außer den Leuten zu seiner persönlichen Bedienung, denn er mußte in einem Rollstuhl oder einer Art Krankensessel sitzen. Trotzdem war er von seinem alten teuren Schneider genau so sorgfältig gekleidet wie nur je, und er trug die sorgfältig ausgewählten Krawatten aus der Bond Street genau so wie zuvor. Und in der oberen Hälfte sah er genau so elegant und eindrucksvoll aus wie immer. Er war niemals einer von diesen modernen, femininen jungen Männern gewesen; er hatte eher etwas Bukolisches mit seinem geröteten Gesicht und seinen breiten Schultern. Aber seine sehr ruhige, zögernde Stimme und seine zugleich herausfordernden und furchtsamen Augen, die selbstbewußt und auch wieder unsicher blickten, enthüllten seine wahre Natur. Sein Benehmen war oft beleidigend überheblich und dann wieder bescheiden und unaufdringlich, beinahe ängstlich.
Connie und er waren einander sehr zugetan, auf die distanzierte moderne Art. Er war durch den großen Schock seiner Gelähmtheit viel zu sehr im Innersten verletzt, um unbefangen und leichtlebig zu sein. Er war etwas Verwundetes, und weil er das war, hielt Connie leidenschaftlich zu ihm.
Aber sie konnte sich eines Gefühls der Verwunderung nicht erwehren, wie wenig Verbindung er in Wirklichkeit mit Menschen hatte. Die Bergarbeiter waren in einem gewissen Sinne seine eigenen Leute; aber er sah sie mehr als Objekte denn als Menschen, mehr als Teile der Kohlengrube denn als Teile seines Lebens, mehr als rohe, ungeformte Erscheinungen denn als Mitmenschen, mit denen er etwas Gemeinsames hatte. Auf eine gewisse Art fürchtete er sich vor ihnen; er konnte es nicht ertragen, wenn sie ihn, der nun gelähmt war, anblickten. Und ihr wunderliches, rohes Leben schien ihm so unnatürlich wie das Leben von Igeln.
Er zeigte ein entferntes Interesse – aber wie ein Mensch, der durch ein Mikroskop hinunter oder durch ein Teleskop hinaufblickt. Er war nicht in Fühlung. Er war mit niemand in tatsächlicher Berührung, außer überlieferungsgemäß mit Wragby und, durch das enge Band der familiären Solidarität, mit Emma. Darüber hinaus berührte ihn im Grunde nichts. Auch Connie fühlte, daß sie selbst ihn nicht wirklich, nicht wirklich berührte; vielleicht gab es bei ihm letzten Endes nichts, an das man gelangen konnte, sondern bloß eine Verneinung menschlichen Kontakts. Und doch war er unbedingt abhängig von ihr. Er bedurfte ihrer jeden Augenblick. So groß und stark er war, er war hilflos. Er konnte sich in einem Rollstuhl umherfahren, und er besaß eine Art von Krankensessel mit einem eingebauten Motor, in dem er langsam im Parke rundum puffen konnte. Allein aber war er wie etwas Verlorenes. Er bedurfte Connies, damit sie da sei, damit sie ihm versichere, er existiere überhaupt.
Dennoch war er ehrgeizig. Er hatte begonnen, Novellen zu schreiben; sonderbare, sehr persönliche Geschichten von Leuten, die er gekannt hatte. Gescheit, recht gehässig und doch auf irgend eine rätselhafte Art bedeutungslos. Sie zeigten eine außerordentliche und eigenartige Beobachtungsgabe. Aber es war keine Berührung da, kein tatsächlicher Kontakt. Es war, als würde sich das Ganze in einem luftleeren Raum abspielen. Und da das Gefilde des Lebens heute größtenteils eine künstlich erleuchtete Bühne ist, wurden die Novellen dem modernen Leben seltsam gerecht, der modernen Psychologie, heißt das.
Clifford war, was diese Novellen betraf, beinahe krankhaft empfindlich. Er wollte, daß jedermann sie für gut halte, für das Allerbeste in dieser Art, für das Höchste. Sie erschienen in den allermodernsten Magazinen und wurden wie üblich gelobt und getadelt. Aber für Clifford war der Tadel Qual – Messer, die ihn stachen. Es war, als wäre sein ganzes Ich in diesen Geschichten.
Connie half ihm, soviel sie konnte. Anfangs war sie begeistert. Er besprach alles mit ihr, besprach es eintönig, eindringlich, beharrlich, und sie mußte mit aller Kraft darauf eingehen. Es war, als müßte ihre ganze Seele und ihr Leib und Geschlecht sich erheben und in diese, seine Geschichten eingehen. Das packte sie und beschäftigte sie völlig.
An physischem Leben lebten sie sehr wenig. Connie hatte das Hauswesen zu überwachen. Aber die Haushälterin hatte Sir Geoffrey viele Jahre gedient, und die vertrocknete, betagte, in höchstem Maße korrekte Person – man konnte sie kaum eine Kammerzofe oder auch nur Frau nennen –, die bei Tische aufwartete, war seit vierzig Jahren im Hause. Selbst die Hausmädchen waren nicht mehr jung. Es war entsetzlich. Was konnte man mit solch einem Haus anfangen, außer es nicht betreten! Alle die vielen, endlosen Zimmer, die niemand benützte, all dies mittelenglische tägliche Einerlei, die mechanische Reinlichkeit, die mechanische Ordnung! Clifford hatte darauf bestanden, eine neue Köchin aufzunehmen, eine erfahrene Frau, die schon in seiner Junggesellenwohnung in London bei ihm gedient hatte. Im übrigen schien das Anwesen mit mechanischer Anarchie geleitet zu werden. Alles ging in bester Ordnung vor sich, in peinlichster Reinlichkeit, genauester Pünktlichkeit; sogar in peinlichster Ehrlichkeit. Und doch war es für Connie eine methodische Anarchie. Keine Wärme des Gefühls verband es organisch. Das Haus erschien so trübselig wie eine nicht mehr benützte Straße.
Was konnte sie anderes tun, als es lassen, wie es war? Also ließ sie es, wie es war. Miß Chatterley, mit ihrem aristokratisch schmalen Gesicht kam bisweilen und triumphierte, da sie nichts verändert fand. Sie würde Connie nie verzeihen, daß sie sie aus ihrer Bewußtseinseinheit mit dem Bruder verdrängt hatte. Sie, Emma, war es, die mit ihm diese Novellen, diese Bücher schreiben müßte, – die Chatterley-Novellen, etwas Neues in der Welt, das sie, die Chatterleys, hervorgebracht hatten. Es gab keinen Maßstab zum Vergleich, keine organische Verbindung mit früheren Gedanken und Ausdrucksformen. Es gab nur etwas in der Welt: die Chatterley-Bücher, etwas ganz Persönliches. Wenn Connies Vater zu vorübergehendem Besuch auf Wragby war, sagte er im Vertrauen zu seiner Tochter: »Cliffords Geschreibe ist ja recht gescheit, aber es ist nichts dahinter. Es wird nicht bleiben!« Connie blickte den kräftigen schottischen »Ritter von« an, der es sich sein ganzes Leben lang hatte gut gehen lassen, und ihre Augen, ihre großen, stillverwunderten blauen Augen bekamen einen verschwommenen Blick. Nichts dahinter! Was meinte er mit »Nichts dahinter«? Wenn die Kritiker es lobten, und Cliffords Name beinahe berühmt war, und es ihm sogar Geld einbrachte … Was meinte ihr Vater da, wenn er sagte, es sei nichts an dem, was Clifford schrieb? Was sonst sollte daran sein?
Denn Connie hatte sich die Richtschnur der Jungen zu eigen gemacht: Was der Augenblick enthielt, das war alles. Und die Augenblicke folgten einander, ohne notwendigerweise zueinander zu gehören.
Es war während ihres zweiten Winters auf Wragby, daß ihr Vater zu ihr sagte: »Ich hoffe, Connie, du wirst dich durch die Umstände nicht zwingen lassen, eine Demi-vierge zu sein?«
»Eine Demi-vierge?« erwiderte Connie unsicher. »Warum? Warum nicht?«
»Außer natürlich, es paßt dir!« sagte ihr Vater hastig. Zu Clifford sagte er dasselbe, als die beiden Männer allein waren. »Ich fürchte, es ist nicht ganz das Geeignete für Connie, eine Demi-vierge zu sein.«
»Eine Halbjungfrau!« erwiderte Clifford, sich den Ausdruck übersetzend, um sicher zu sein.
Er dachte einen Augenblick nach und wurde dann sehr rot. Er war verärgert und beleidigt.
»In welcher Weise ist es nicht das Geeignete?« fragte er steif.
»Sie wird mager, eckig. Es entspricht nicht ihrer Art. Sie ist nicht diese Sardinenart von schmächtigem kleinen Mädel. Sie ist eine muntere schottische Forelle.«
»Ohne die Flecken natürlich« sagte Clifford.
Er wollte später Connie etwas über diese Demi-Vierge-Sache sagen – diesen halbjungfräulichen Zustand der Dinge. Aber er konnte es nicht über sich gewinnen. Er war zu vertraut mit ihr und doch nicht vertraut genug. Er war so sehr eins mit ihr in seinem und ihrem Geiste. Aber körperlich waren sie füreinander nicht vorhanden. Und keines konnte es ertragen, das Beweisstück hereinzuzerren. Sie waren so vertraut und völlig außer Fühlung.
Connie erriet jedoch, daß ihr Vater etwas zu Clifford gesagt hatte, was dem nun im Kopfe herumging. Sie war überzeugt, daß ihm nichts daran läge, ob sie Halbjungfrau oder Halbweltdame sei, solange er es nicht unbedingt sicher wüßte und man ihn nicht darauf hinwiese. Was das Auge nicht sieht und das Hirn nicht weiß, ist nicht vorhanden.
Connie und Clifford lebten nun seit beinahe zwei Jahren auf Wragby, ein unbestimmtes Leben des Aufgehens in Clifford und seiner Arbeit. Ihre Interessen hatten nie aufgehört, über seinem Werk zusammenfließen. Sie redeten und rangen in den Wehen literarischen Schaffens und hatten das Gefühl, als ob irgend etwas geschähe, wirklich – im leeren Raume – geschähe.
Und so weit war es ein Leben: im Leeren. Im übrigen war es ein Nichtdasein. Wragby war da, und die Dienerschaft war da – aber geisterhaft, nicht wirklich existierend. Connie unternahm Spaziergänge im Park und in den Waldungen, die an den Park stießen, und genoß die Einsamkeit und das Geheimnisvolle, stieß die braunen Blätter des Herbstes mit dem Fuße vor sich her und pflückte die Primeln des Frühlings. Aber es war alles ein Traum, oder vielmehr, es war wie das Abbild der Wirklichkeit. Die Eichenblätter waren für sie wie Eichenblätter, die man im Spiegel sich regen sieht. Sie selbst war eine Gestalt, von der jemand gelesen hatte, und pflückte Primeln, die bloß Schatten waren oder Erinnerungen oder Worte. Weder sie noch irgend etwas hatte Substanz – keine Fühlung, kein Kontakt! Nur dieses Leben mit Clifford, dieses endlose Spinnen von Hirngespinsten, von Aufzeichnungen des Bewußtseins, diese Geschichten, von denen Sir Malcolm sagte, es sei nichts an ihnen und sie würden nicht bleiben. Warum sollte etwas an ihnen sein? Warum sollten sie bleiben? Für den Tag genügt des Tages Übel. Für den Augenblick genügt der Anschein der Wirklichkeit.
Clifford hatte eine ganze Anzahl von Freunden, oder vielmehr Bekannten, und er lud sie nach Wragby ein. Er lud alle möglichen Leute ein, Kritiker und Schriftsteller, Leute, die helfen würden, seine Bücher zu loben. Und sie waren geschmeichelt nach Wragby eingeladen zu werden, und sie lobten. Connie durchschaute das alles vollkommen. Aber warum nicht? Dies war eines der flüchtigen Muster im Spiegel. Was war denn Schlimmes daran?
Sie war die Hausfrau für diese Leute – zumeist Männer. Sie war auch die Hausfrau für Cliffords gelegentlich auftauchende aristokratische Verwandte. Da sie ein weiches, rotwangiges, ländlich aussehendes Geschöpf war, das zu Sommersprossen neigte, große blaue Augen, gelocktes braunes Haar, eine weiche Stimme und recht starke weibliche Hüften hatte, wurde sie für ein wenig altmodisch und »fraulich« gehalten. Sie war kein kleiner Sardinenfisch mit flacher Knabenbrust und kleinen Hinterbäckchen. Sie war zu feminin, um ganz modern zu sein.
Also waren die Männer, besonders die nicht mehr ganz jungen, wirklich sehr nett zu ihr. Aber da sie wußte, welche Qual der arme Clifford beim leisesten Anzeichen, daß sie flirte, empfinden würde, ermutigte sie sie in keiner Weise. Sie blieb still, ruhig und unbestimmt, sie hatte keine Fühlung mit ihnen und beabsichtigte nicht, sie zu haben. Clifford war außerordentlich stolz auf sich.
Seine Verwandten behandelten sie recht freundlich. Sie wußte, daß diese Freundlichkeit Mangel an Furcht anzeigte und daß diese Leute keine Achtung vor einem hatten, wenn man sie nicht ein wenig in Furcht versetzen konnte. Aber auch hier hatte sie keinen Kontakt. Sie ließ sie freundlich und leise verachtungsvoll sein. Sie ließ sie fühlen, daß sie es nicht nötig hatten, den Dolch in Bereitschaft zu halten. Sie hatte keine wirkliche Verbindung zu ihnen.
Die Zeit ging dahin. Was immer sich ereignete, es ereignete sich nicht, weil sie so wunderschön außer Kontakt war. Sie und Clifford lebten in ihrer beider Ideen und seinen Büchern. Sie sah Gäste bei sich – es waren immer Leute im Haus. Die Zeit ging weiter wie die Uhr. Es wurde halb neun statt halb acht.
DRITTES KAPITEL
Connie war sich allerdings einer zunehmenden Ruhelosigkeit bewußt. Ihrer Unverbundenheit entspringend, ergriff eine Unruhe von ihr Besitz wie ein Wahn. Ihre Gliedmaßen zuckten, wenn sie nicht wollte, daß sie zucken sollten, es riß ihr Rückgrat empor, wenn sie sich gar nicht mit einem Ruck aufsetzen wollte, sondern es vorgezogen hätte, bequem zu ruhen. Es durchfuhr ihren Körper, ihren Schoß, bis sie das Gefühl hatte, sie müsse ins Wasser springen und schwimmen, um davon wegzukommen. Eine wahnsinnige Unrast. Sie verursachte ihr ohne Grund heftiges Herzklopfen, und sie magerte ab.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!