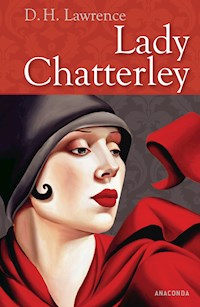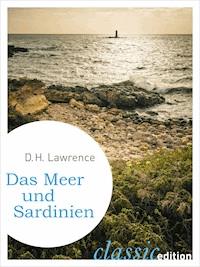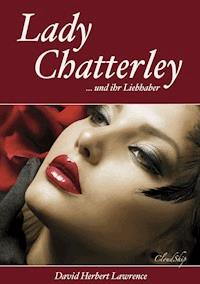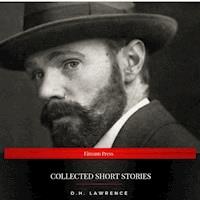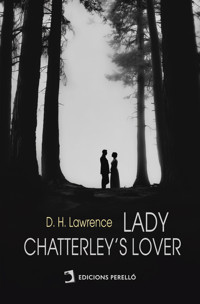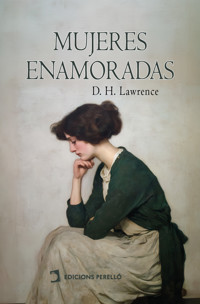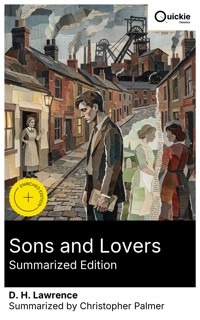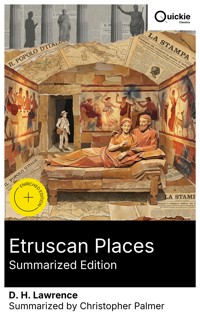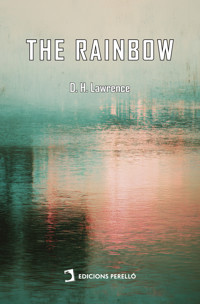Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EClassica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
D. H. Lawrence: Söhne und Liebhaber | Für die eBook-Ausgabe neu editiert, in aktualisierter Rechtschreibung. Mit eBook-Inhaltsverzeichnis und zahlreichen verlinkten Fußnoten | Ein Motiv, das in diesem grandiosen Werk stets unterschwellig mitschwingt, aber nie ausgesprochen wird, ist der Inzest zwischen Mutter und Sohn. Wenn man die Seelenqualen des Protagonisten Paul Morel im Roman verfolgt, wenn man erfährt, wie gestört sich sein Verhältnis zu Frauen gestaltet, wie schwer er sicheren Halt im Leben findet, so erinnert das stark an die Biographien Betroffener, die man heute in wissenschaftlichen Studien findet: Durch das Erleben der Mutter als Sexualpartner, egal ob der Beischlaf vollzogen wurde oder nicht, entsteht eine derart exzessive Bindung, dass andere Beziehungen dagegen chancenlos bleiben und zerbrechen. // ›Söhne und Liebhaber‹ gilt als bester Roman des kühnen englischen Literaten D. H. Lawrence.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 843
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Innentitel
Klappentext
ERSTER TEIL
Erstes Kapitel – Ehefrühling der Morels
Zweites Kapitel – Pauls Geburt und neue Kämpfe
Drittes Kapitel – Morel abgeschüttelt – William ins Herz geschlossen
Viertes Kapitel – Pauls Jugend
Fünftes Kapitel – Pauls Eintritt ins Leben
Sechstes Kapitel – Der Tod im Kreise der Hausgenossen
ZWEITER TEIL
Siebtes Kapitel – Jungens- und Mädchenliebe
Achtes Kapitel – Liebeszwist
Neuntes Kapitel – Miriams Niederlage
Zehntes Kapitel – Clara
Elftes Kapitel – Miriams Erprobung
Zwölftes Kapitel – Leidenschaft
Dreizehntes Kapitel – Baxter Dawes
Vierzehntes Kapitel – Die Erlösung
Fünfzehntes Kapitel – Verlassen
Impressum
Fußnoten
Klappentext
Ein Motiv, das in diesem grandiosen Werk stets unterschwellig mitschwingt, aber nie ausgesprochen wird, ist der Inzest zwischen Mutter und Sohn. Wenn man die Seelenqualen des Protagonisten Paul Morel im Roman verfolgt, wenn man erfährt, wie gestört sich sein Verhältnis zu Frauen gestaltet, wie schwer er sicheren Halt im Leben findet, so erinnert das stark an die Biographien Betroffener, die man heute in wissenschaftlichen Studien findet: Durch das Erleben der Mutter als Sexualpartner, egal ob der Beischlaf vollzogen wurde oder nicht, entsteht eine derart exzessive Bindung, dass andere Beziehungen dagegen chancenlos bleiben und zerbrechen.
In einem Brief an seinen Lektor skizziert Lawrence selbst den Kern des Romans so: »... als ihre Söhne heranwachsen, erwählt sie sie als Geliebte – erst den älteren, dann den zweiten ... als sie das Mannesalter erreichen, vermögen sie nicht zu lieben, weil ihre Mutter die stärkste Macht in ihrem Leben ist und sie festhält.« – Wie wörtlich der Ausdruck »Geliebter« hier zu nehmen ist, lässt der Autor offen.
›Söhne und Liebhaber‹ gilt als bedeutendster Roman des kühnen englischen Literaten D. H. Lawrence – steht aber, was die Bekanntheit betrifft, im Schatten des sexuell expliziteren Werkes ›Lady Chatterley‹. Die Modern Library in New York platzierte in ihrer Liste der hundert wichtigsten englischsprachigen Romane ›Söhne und Liebhaber‹ auf Rang neun.
Über den Autor: David Herbert Lawrence (1885–1930) war ein englischer Schriftsteller. – Der Sohn eines Bergmanns und einer Lehrerin studierte Pädagogik und nahm in London eine Stelle als Lehrer an. 1911 erkrankte er an Tuberkulose und musste den Schuldienst quittieren. Er begann ein Verhältnis mit der Ehefrau eines ehemaligen Lehrers und heiratete sie später. Das Paar bereiste Europa, Mexiko, Australien und die Vereinigten Staaten, wo sie im Tausch gegen ein Manuskript eine Ranch in New Mexico erwarben. Als Autor war Lawrence hochproduktiv. Neben Romanen schrieb er Gedichte, Essays, Reiseberichte und Theaterstücke. Ein Großteil seines Schaffens thematisiert die Beziehung zwischen den Geschlechtern. – Als sich die Tuberkulose wieder verschlimmerte, kehrten er und seine Frau im Jahr 1920 nach Europa zurück, wo sie sich in Italien niederließen. Im Alter von nur 44 Jahren starb D. H. Lawrence am 2. März 1930 während eines Kuraufenthalts in der Nähe von Cannes.
© Redaktion eClassica, 2017
ERSTER TEIL
Erstes Kapitel – Ehefrühling der Morels
Nach dem ›Höllengang‹ kam der ›Grund‹. Der Höllengang war eine Reihe strohgedeckter, ganz geräumiger Häuschen, die auf Greenhill-Lane am Bach entlang standen. Bergleute lebten darin, die in den kleinen, zwei Felder breiten entfernten Gruben arbeiteten. Der Bach lief unter Erlenbüschen dahin, nur wenig durch diese kleinen Gruben verschmutzt, deren Kohle Esel zutage förderten, die müde im Kreise um ein Spill herumliefen. Und ebensolche Gruben lagen über die ganze Landschaft verstreut; ein paar von ihnen waren bereits zu Zeiten Karls des Zweiten in Betrieb gewesen, die mit ihren wenigen, sich ameisengleich in die Erde hineinwühlenden Bergleuten und Eseln sonderbare Hügel und kleine schwarze Flecken zwischen den Kornfeldern und Wiesen bildeten. Und die Häuschen dieser Bergleute, in Gruppen von zweien und mehr, gelegentlich mit einem Hof oder einer Behausung der über das Kirchspiel1 verstreuten Strumpfwirker2 zusammengeschlossen, bildeten das Dorf Bestwood.
Dann aber machte sich vor etwa sechzig Jahren eine große Veränderung bemerkbar. Die kleinen Gruben wurden von den großen Bergwerken der Geldleute beiseite geschoben. Das Kohlen- und Eisenfeld von Nottinghamshire und Derbyshire wurde entdeckt. Carston, Waite & Co. erschienen. Unter gewaltiger Aufregung eröffnete Lord Palmerston feierlich den ersten Schacht der Gesellschaft zu Spinney Park, am Saum des Sherwood-Forstes.
Um diese Zeit brannte der wohl bekannte ›Höllengang‹, der sich mit zunehmendem Alter einen üblen Ruf erworben hatte, nieder, und damit wurde viel Schmutz beiseite geräumt.
Carston, Waite & Co. fanden, dass sie einen guten Griff getan hatten, und so wurden das ganze Tal entlang von Selby und Nuttall neue Schächte niedergetrieben, bis bald sechs Gruben in Betrieb standen. Von Nuttall her, hoch oben zwischen den Wäldern auf dem Sandstein, führte eine Eisenbahn hinter den Trümmern der Kartäuserabtei und an Robin Hoods Brunnen vorüber nach Spinney Park hinab und von dort weiter nach Minton, alles ein großes Bergwerk zwischen lauter Kornfeldern; von Minton lief sie zwischen den Gutshöfen an der Talseite entlang nach Bunkershill, bog von dort nach Norden ab auf Beggarlee und Selby zu, von wo man nach Crich und den Hügeln von Derbyshire hinübersieht; sechs Bergwerke, gleich schwarzen Kuppen in der Landschaft, verband die Eisenbahn durch einen feinen Kettenstrang.
Um die Scharen der Bergleute unterzubringen, bauten Carston, Waite & Co. die ›Gevierte‹, große Vierecke von Häusern am Hange von Bestwood, und darauf in der Bachniederung an Stelle des früheren ›Höllenganges‹ den ›Grund‹.
Der ›Grund‹ bestand aus sechs Blöcken von Bergmannshäusern, zwei Reihen zu je drei, wie die Punkte auf dem Sechs-Null-Dominostein, mit je zwölf Häusern in einem Block. Diese doppelte Häuserreihe lag am Fuße des ziemlich steilen Abhanges von Bestwood und übersah, wenigstens von den Bodenfenstern aus, den sanften Anstieg des Tales auf Selby zu.
Die Häuser selbst waren dauerhaft und anständig. Man konnte rund um sie herumgehen und fand dabei kleine Vorgärten mit Aurikeln und Steinbrech in den Schattenlagen des tiefsten Blockes, und mit Bart- und anderen Nelken in dem sonnigen vorderen; nette Vorderfenster, kleine Vorbauten, kleine Ligusterhecken, und Dachfenster für die Bodenräume. Das war aber nur die Außenseite, das war nur ein Blick auf die unbenutzten guten Stuben der Bergmannsfrauen. Der eigentliche Wohnraum, die Küche, lag auf der Rückseite des Hauses, mit dem Ausblick auf den Innenraum des Blockes, auf einen verkommenen Hintergarten und weiterhin die Aschengrube. Und zwischen den Häuserreihen, zwischen den langen Reihen der Aschengruben lief der Gang entlang, wo die Kinder spielten, die Frauen klatschten und die Männer rauchten. So waren die tatsächlichen Lebensbedingungen im ›Grund‹, der so gut angelegt war und so nett aussah, ganz übel, weil die Leute in der Küche leben mussten und die Küchen auf diesen ekligen Gang zwischen den Aschengruben hinausgingen.
Wenn Frau Morel von Bestwood aus hinunterkam, war sie gar nicht darauf versessen, in den ›Grund‹ überzusiedeln, der nun bereits zwölf Jahre alt und auf dem Abstieg war. Aber es war doch wohl das Beste, was sie tun konnte. Zudem hatte sie ein Eckhaus in einem der oberen Blöcke, und somit nur einen Nachbarn; und außerdem noch einen besonderen Streifen Garten. Und durch den Besitz dieses Eckhauses erfreute sie sich einer Art Erhabenheit über die übrigen Frauen in den ›Zwischen‹-Häusern, weil ihre Miete fünf und eine halbe Mark betrug anstatt nur fünf Mark die Woche. Aber diese Erhabenheit ihrer Lebenslage war Frau Morel doch nur ein schwacher Trost.
Sie war einunddreißig Jahre alt und acht Jahre verheiratet. Eine ziemlich kleine Frau von zartem Äußern, aber entschlossener Haltung, schreckte sie zuerst ein wenig vor der Berührung mit den ›Grund‹-Frauen zurück. Im Juli zog sie hinunter und erwartete im September ihr drittes Kind. Ihr Mann war Bergmann. Sie waren erst drei Wochen in ihrem neuen Hause, als die Kirchweih oder der Jahrmarkt begann. Sie wusste, dann würde Morel blaumachen. Am Montagmorgen, dem Tag des Jahrmarkts, ging er früh fort. Die beiden Kinder waren mächtig aufgeregt. William, ein Junge von sieben, sauste gleich nach dem Frühstück von dannen, um auf dem Marktplatz herumzustrolchen, und ließ Annie, die erst fünf war, zu Hause; die quäkte nun den ganzen Morgen, sie wollte auch hin. Frau Morel hatte zu tun. Sie kannte jedoch ihre Nachbarn kaum erst und wusste nicht, wem sie das kleine Mädchen hätte anvertrauen können. Daher versprach sie ihr, sie nachmittags mit auf den Markt zu nehmen.
William erschien um halb eins. Er war ein sehr beweglicher Junge mit hellem Haar und Sommersprossen und einem Stich ins Dänische oder Norwegische.
»Kann ich mein Essen kriegen, Mutter?« rief er, mit der Mütze auf dem Kopf ins Zimmer sausend. »Weils doch um halb zwei losgeht, der Mann hats selbst gesagt.«
»Du kannst dein Essen kriegen, wenn’s fertig ist«, erwiderte die Mutter.
»Ists denn noch nicht fertig?« rief er, sie mit seinen blauen Augen ärgerlich anstarrend. »Denn geh ich ohne los.«
»Das tust du nicht. In fünf Minuten ists fertig. Es ist erst halb eins.«
»Sie fangen aber an«, rief der Junge halb brüllend.
»Und wenn auch, davon stirbst du nicht«, sagte die Mutter; »außerdem ists erst halb eins, sodass du noch eine volle Stunde hast.«
Hastig begann der Junge den Tisch zu decken, und dann setzten die drei sich sofort hin. Sie aßen Mehlpudding mit Fruchtmus, als der Junge plötzlich vom Stuhle aufsprang und völlig regungslos stehenblieb. Sie konnten in einiger Entfernung das erste Gequäke eines Karussells hören und das Tuten eines Horns. Sein Gesicht begann zu zucken, während er seine Mutter ansah.
»Ich sagt’s dir ja!« rief er und lief an die Anrichte nach seiner Mütze.
»Nimm deinen Pudding mit – und es ist erst fünf Minuten nach eins, du musst dich also geirrt haben – du hast ja deine zwei Pence noch nicht«, rief die Mutter alles in einem Atem.
Bitterlich enttäuscht kam der Junge zurück, um sich seine zwei Pence zu holen; dann zog er ohne ein Wort los.
»Ich will auch hin, ich will auch hin«, sagte Annie und fing an zu weinen.
»Na ja, schön, du sollst auch hin, du jämmerliche kleine Heultriene!« sagte die Mutter, und später am Nachmittag trottete sie dann mit dem Kinde an der hohen Hecke entlang den Hügel hinan. Von den Feldern wurde das Heu eingefahren, und das Vieh wurde auf das Grummet3 hinausgelassen. Es war so warm und friedlich.
Frau Morel konnte den Jahrmarkt nicht leiden. Zwei Arten Karussells waren da, eins mit Dampf, und eins, das von einem Pony gedreht wurde; drei Drehorgeln ertönten, und hin und wieder konnte man einen Pistolenschuss hören sowie das gräuliche Gekrächze der Knarre des Kokosnussmannes, laute Rufe aus der Ballwerf-Bude und das Geschrei der Guckkastendame. Die Mutter sah ihren Jungen ganz verzückt vor der Bude des Löwen Wallace stehen und die Bilder dieses berühmten Löwen anstarren, der einen Schwarzen umgebracht und zwei Weiße auf Lebenszeit zu Krüppeln gemacht hatte. Sie ließ ihn stehen und zog weiter, um Annie eine Lutschstange zu erstehen. Mit einem Male stand der Junge ganz wild vor Aufregung vor ihr.
»Du hast ja gar nicht gesagt, dass du auch kämest – is da nicht ‘ne Menge los? – der Löwe da hat drei Menschen umgebracht – meine beiden Pence habe ich schon ausgegeben – und guck mal.«
Er holte zwei Eierbecher aus der Tasche, mit rosa Moosrosen drauf.
»Die hab ich in der Bude gekriegt, wo man die Marmeln in so ‘ne Löcher trudeln muss. Un die beiden hab ich mit zwei Malen gekriegt, jedes Mal einen Halben – mit Moosrosen drauf, sieh. Die wollte ich grade gern haben.«
Sie wusste, er wollte sie für sie haben.
»Hm!« sagte sie, voller Freude. »Die sind aber auch hübsch!«
»Willst du se wohl tragen? Ich bin so bange, ich mach se kaputt.«
Er lief fast über vor Aufregung, nun sie auch dabei war, führte sie auf dem ganzen Platze herum und zeigte ihr alles. Vor der Guckkastenbude erklärte sie dann die Bilder in einer Art Geschichte, auf die er wie verzaubert lauschte. Er konnte sie nicht mehr lassen. Die ganze Zeit über klammerte er sich an sie, strahlend in seinem Jungenstolz. Denn keine der anderen Frauen sah so wie eine Dame aus wie sie in ihrem kleinen schwarzen Hut und ihrem Umhang. Sie lächelte, wenn sie andere Frauen traf, die sie kannte. Als sie müde war, sagte sie zu ihrem Jungen:
»Na, kommst du jetzt schon mit, oder erst später?«
»Willst du denn schon weg?« rief er mit vorwurfsvollem Blick.
»Schon? Es ist doch nach vier, soviel ich weiß.«
»Warum willst du denn schon weg?« jammerte er.
»Du brauchst ja noch nicht mit, wenn du noch nicht willst«, sagte sie.
Und langsam ging sie mit dem kleinen Mädchen fort, während der Junge ihr mit den Blicken folgte, das Herz zerrissen, dass er sie gehen lassen müsste, und doch unfähig, den Markt schon zu verlassen. Als sie den freien Platz vor dem ›Mond und Sterne‹ überschritt, hörte sie Männer schreien und roch das Bier, und sie begann ihre Schritte ein wenig zu beschleunigen in dem Gedanken, ihr Mann werde wohl auch in der Kneipe sein.
Etwa um halb sieben kam ihr Junge heim, recht müde nun, und blass und etwas bekümmert. Er fühlte sich so jämmerlich, obwohl ihm das nicht zum Bewusstsein kam, weil er sie hatte allein gehen lassen. Seit sie fort war, hatte er keinen Spaß mehr an dem Marktleben gefunden.
»War Vater schon hier?« fragte er.
»Nein«, sagte die Mutter.
»Er hilft ausschenken im ›Mond und Sterne‹. Ich sah ihn durch die schwarzen Blechdinger mit den Löchern drin am Fenster mit aufgekrempelten Ärmeln.
»Ha!« rief die Mutter nur kurz. »Er hat kein Geld. Und wenn er nur Freibier kriegt, ist er auch schon zufrieden, ob sie ihm nun etwas mehr geben oder nicht.«
Als es stärker dämmerte und Frau Morel nicht mehr beim Nähen sehen konnte, stand sie auf und ging zur Tür. Überall erscholl aufregender Lärm, die Ruhelosigkeit des Festtages, und sie wurde zuletzt auch davon angesteckt. Sie trat in den Seitengarten hinaus. Frauen kamen vom Markt heim, ihre Kinder drückten ein weißes Lamm mit grünen Beinen ans Herz oder ein hölzernes Pferd. Gelegentlich strich ein Mann vorbei, fast so voll, wie er nur eben laden konnte. Zuweilen kam auch mal ein guter Hausvater mit den Seinen vorüber, ganz friedlich. Aber gewöhnlich waren Frauen und Kinder allein. Die zu Hause Gebliebenen standen plaudernd an den Ecken der Gänge, die Arme unter der weißen Schürze gefaltet, während das Zwielicht immer tiefer herniedersank.
Frau Morel war allein, aber daran war sie gewöhnt. Ihr Junge und das kleine Mädchen schliefen oben; so kam es ihr vor, als liege ihr Heim ruhig und sicher hinter ihr. Aber sie fühlte sich elend des kommenden Kindes wegen. Die Welt kam ihr nur noch traurig vor, und für sie konnte es nichts mehr in ihr geben – wenigstens nicht, bis William erwachsen sein würde. Für sie selbst aber nichts als dies traurige Hinhalten – bis die Kinder herangewachsen sein würden. Und die Kinder! Sie konnte sich dies dritte nicht leisten. Sie wollte es gar nicht. Der Vater schenkte Bier aus in einer Kneipe und spülte sich selbst bei der Gelegenheit voll. Sie verachtete ihn und fühlte sich doch an ihn gefesselt. Dies Kind, das da kam, war zu viel für sie. Wäre es nicht um Williams und Annies Willen gewesen, sie hätte es übergehabt, dies Ringen mit Armut und Hässlichkeit und Gemeinheit.
Sie ging in den Vorgarten, da sie sich zu schwer fühlte, um auszugehen, und doch unfähig, im Hause zu bleiben. Die Hitze erstickte sie. Und wenn sie voraussah, brachte der Ausblick auf ihr zukünftiges Leben ihr ein Gefühl von Lebendigbegrabensein bei.
Der Vorgarten war ein kleines Viereck mit einer Ligusterhecke. Da blieb sie stehen und versuchte sich an dem Blumenduft und dem schwindenden schönen Abend zu beruhigen. Ihrer kleinen Pforte gegenüber war der Übergang, der den Hügel hinan führte, unter der hohen Hecke entlang, in der brennenden Glut der geschnittenen Weiden. Der Himmel ihr zu Häupten bebte und pulste vor Licht. Die Glut schwand rasch von den Feldern; Erdboden und Hecken versanken im Dunst der Dämmerung. Sobald es dunkel wurde, brach oben auf dem Hügel ein rötlicher Schimmer hervor, und aus diesem Schimmer die etwas verringerte Bewegung des Jahrmarktes.
Zuweilen torkelten durch die dunkle Rinne, die der Pfad unter den Hecken bildete, Männer verstohlen nach Hause. Ein jüngerer Mann kam auf dem abschüssigen unteren Ende des Pfades ins Rennen und fuhr mit einem Krach gegen den Übergang.
Frau Morel schauerte zusammen. Er raffte sich unter widerlichen, fast leidenschaftlichen Flüchen wieder auf, als dächte er, das Gatter hätte ihm absichtlich wehgetan.
Sie trat ins Haus und fragte sich, ob die Dinge denn nie anders werden würden. Allmählich begann sie sich darüber klar zu werden, sie würden es nie. Ihre Mädchenzeit kam ihr so fern vor, sie wunderte sich, dass dies ein und dasselbe Wesen sein sollte, das hier so schwerfällig den Hintergarten im ›Grund‹ hinanstieg, und das vor zehn Jahren noch so leicht über den Wellenbrecher in Sheerness dahingeflogen war.
»Was habe ich denn damit zu schaffen?« sagte sie bei sich. – »Was habe ich mit alledem zu schaffen? Selbst mit dem Kinde, das ich nun kriege! Ich werde scheinbar gar nicht mitgezählt.«
Zuweilen packt das Leben einen, reißt den Leib mit fort, bringt eine ganze Geschichte zustande und wird doch niemals wirklich, sondern lässt uns stets in dem Gefühl, als wäre alles nur ganz verschwommen.
»Ich warte«, sagte Frau Morel bei sich; »ich warte, und was ich erwarte, kann nie eintreten.«
Dann brachte sie die Küche in Ordnung, zündete die Lampe an, stökerte das Feuer auf, suchte sich die Wäsche für den nächsten Tag zusammen und weichte sie ein. Hierauf setzte sie sich mit ihrer Näharbeit nieder. Lange Stunden hindurch blitzte ihre Nadel regelmäßig durch den Stoff. Gelegentlich seufzte sie einmal auf und bewegte sich, um sich zu erleichtern. Und die ganze Zeit über dachte sie darüber nach, wie sie ihr Hab und Gut um der Kinder willen am besten ausnutzen könnte.
Um halb zwölf kam ihr Mann. Seine Backen waren sehr rot und glänzten stark über dem schwarzen Schnurrbart. Der Kopf wackelte ihm etwas. Er war durchaus mit sich zufrieden.
»Oh, oh, wartst de auf mir, Mächen? Ick habe Antonen jeholfen, und wat meenste woll, hat er mich jejeben? Nischt als lausige zweieinhalb Schilling, jeder Penny jezählt ...«
»Er denkt wohl, den Rest hättest du in Bier verdient«, sagte sie kurz.
»Un det hab ick nich – det hab ick nich. Kannst mir jlooben, ick hatte sehr wenig heute, wenn ick überhaupt wat jehabt habe.« Seine Stimme wurde zärtlich. »Hier, da hab ick dir ooch en bisken Schnapsbontjen mitjebracht, un ‘ne Kokosnuss for die Kinder.« Er legte das Zuckerzeug und die Nuss, ein haariges Ding, auf den Tisch. »Na, hast woll noch nie in deinen Leben für irgendwas ›danke‹ jesagt, wat?«
Um ihm auszuweichen, nahm sie die Nuss auf und schüttelte sie, um zu sehen, ob Milch drin sei.
»’t is ‘ne jute, da kannste dein Leben druff wetten. Ick hab se von Bill Hodgkinson. ›Bill,‹ sage ick, ›du brauchst doch die drei Nisse nich, wat? Willste mich nich eine von abjeben for mein’n klein’n Jungen und Mächen?‹ ›Jewiss doch, Walter, mein Junge,‹ sagt er, ›nimm man, welche de willst.‹ Un da nahm ick denn eene und dankt ihm. Ick mocht se doch nu nich vor seine Oogen schütteln, aber da sagt er: ›Sieh man zu, dett se ooch jut is, Walt.‹ Un davon weeß ick, det se jut is, siehste. Det ‘s ‘n netter Kerl, der Bill Hodgkinson, ‘n netter Kerl is er!«
»Jeder Mann gibt alles her, solange er betrunken ist, und du bist ebenso betrunken wie er«, sagte Frau Morel.
»I, du jemeene kleene Hexe, wer is betrunken, mecht ick woll wissen?« sagte Morel. Er war ganz ungewöhnlich mit sich zufrieden wegen seiner heutigen Hilfsdienste im ›Mond und Sterne‹. Er schwatzte immer weiter.
Frau Morel, sehr müde und ganz übel von seinem Gebabbel, ging so rasch wie möglich zu Bett, während er noch das Feuer zudeckte.
Frau Morel kam von guten alten Bürgersleuten, berühmten Unabhängigen, her, die noch mit Oberst Hutchinson gefochten hatten und stramme Calvinisten geblieben waren. Ihr Großvater war mit seinem Spitzengeschäft zusammengebrochen, zu einer Zeit, als viele Spitzenmacher in Nottingham zugrunde gingen. Ihr Vater, George Coppard, war Maschinist gewesen – ein großer, hübscher, hochmütiger Mensch, stolz auf seine blauen Augen und seine helle Haut, aber mehr noch auf seine Unantastbarkeit. Gertrude ähnelte ihrer Mutter in ihrer kleinen Bauart. Aber ihr stolzes, unnachgiebiges Wesen hatte sie von den Coppards.
George Coppard litt bitterlich unter seiner Armut. Er wurde Obermaschinist am Hafen in Sheerness. Frau Morel – Gertrude – war seine zweite Tochter. Sie bevorzugte ihre Mutter, liebte ihre Mutter mehr als alle Übrigen; aber sie besaß die klaren, trotzigen Blauaugen der Coppards und ihre breite Stirn. Sie konnte sich noch erinnern, wie sie ihres Vaters hochfahrendes Benehmen gegen ihre sanfte, fröhliche, gutmütige Mutter gehasst hatte. Sie dachte noch daran, wie sie über den Wellenbrecher zu Sheerness gerannt war, wenn sie ihr Boot suchte. Sie dachte daran, wie sie von allen Männern geliebkost und verhätschelt wurde, wenn sie zum Hafen kam, denn sie war ein zartes, recht empfindliches Kind gewesen. Sie dachte an ihre putzige alte Lehrerin, deren Helferin sie geworden war, und der sie so gern in ihrer Schule beigestanden hatte. Und sie hatte immer noch die Bibel, die John Field ihr gegeben hatte. Sie pflegte mit John Field von der Kirche nach Hause zu gehen, als sie neunzehn war. Er war der Sohn eines wohlhabenden Krämers, hatte in London die Schule besucht und sollte sich selbst dem Geschäft widmen.
Sie konnte sich noch jede Einzelheit eines Sonntagnachmittags im September zurückrufen, als sie hinter ihres Vaters Haus unter den Weinreben gesessen hatten. Die Sonne brach durch die Zwischenräume zwischen den Weinblättern und machte wunderhübsche Muster, wie ein Spitzentuch, indem sie auf ihn und sie fiel. Einzelne der Blätter waren rein gelb, wie flache gelbe Blumen.
»Nun sitzen Sie mal still«, hatte er gerufen, »Ihr Haar jetzt, wahrhaftig, ich weiß nicht, was das eigentlich für ‘ne Farbe hat! Es glänzt wie Kupfer und Gold, rot, wie geschmiedetes Kupfer, und wo die Sonne drauf scheint, hat es Goldfäden. Und nun denken Sie bloß, sie sagen, es wäre braun. Ihre Mutter nennt es mausefarben.«
Sie hatte einen glänzenden Blick von ihm aufgefangen, aber ihr klares Antlitz verriet kaum die gehobene Stimmung, die in ihr emporstieg.
»Aber Sie sagen doch, Sie machten sich nichts aus dem Geschäft«, fuhr sie fort.
»Tue ich auch nicht! Ich hasse es!« rief er hitzig.
»Und möchten Sie nicht in den Kirchendienst gehen«, meinte sie halb flehend.
»Gewiss. Gern täte ichs, wenn ich dächte, ich würde einen Prediger erster Ordnung abgeben.«
»Aber warum tun Sie es denn nicht – warum tun Sie es denn nicht?« Ihre Stimme ließ etwas Trotziges durchtönen. »Wenn ich ein Mann wäre, mich sollte nichts abhalten.«
Sie hielt den Kopf hoch in die Höhe. Er fürchtete sich fast vor ihr.
»Aber mein Vater ist so steifnackig. Er will mich ins Geschäft stecken, und ich weiß, er tuts.«
»Aber Sie sind doch ein Mann?« hatte sie gerufen.
»Dass man ein Mann ist, ist noch nicht alles«, antwortete er und runzelte die Stirn, hilf- und ratlos.
Jetzt, wo sie im ›Grund‹ bei ihrer Arbeit sich regen musste, mit so mancher Erfahrung, was ein Mann sein heiße, verstand sie, dass es nicht alles bedeutete.
Mit zwanzig hatte sie Sheerness ihrer Gesundheit wegen verlassen. Ihr Vater war wieder nach Nottingham gezogen. John Fields Vater war zugrunde gerichtet; der Sohn war als Lehrer nach Norwood gegangen. Sie hörte nichts von ihm, bis sie nach zwei Jahren sich eigens nach ihm erkundigte. Er hatte seine Wirtin geheiratet, eine Frau in den Vierzigern, Witwe mit Vermögen.
Und doch hob Frau Morel John Fields Bibel noch auf. Sie hielt ihn jetzt nicht länger für ... Na ja, sie begriff jetzt ziemlich gut, was er hätte werden können und was nicht. So hob sie seine Bibel auf und verwahrte sein Andenken ihrer selbst wegen in ihrem Herzen. Bis an ihren Sterbetag, fünfunddreißig Jahre später, sprach sie nie wieder von ihm.
Als sie dreiundzwanzig Jahre alt war, hatte sie bei einer Weihnachtsfeier einen jungen Mann aus dem Erewash-Tale getroffen. Es war Morel. Er war damals siebenundzwanzig Jahre alt. Er war gut gewachsen, schlank und ein großer Pfiffikus. Er hatte welliges, glänzend schwarzes Haar und einen kräftigen schwarzen Bart, der noch nie geschoren war. Seine Backen waren rötlich, und sein feuchter roter Mund darum so auffallend, weil er so oft und herzlich lachte. Er besaß diese Seltenheit, ein reiches, klingendes Lachen. Gertrude Coppard hatte ihn wie verzaubert beobachtet. Er war so voller Farbe und Lebhaftigkeit, seine Stimme lief so ins Spaßhaft-Wunderliche über, er war so schlagfertig und scherzhaft gegen jedermann. Ihr Vater besaß ebenfalls einen reichen Schatz an Witz, aber der war spöttisch. Dieses Menschen Witz war ganz anders: weich, nicht aus dem Verstande geboren, warm, eine Art Hanswursterei.
Sie selbst war ganz anders geartet. Sie hatte eine neugierige, empfängliche Sinnesart, die viel Vergnügen und Unterhaltung darin fand, wenn sie andern Leuten zuhören konnte. Sie besaß eine besondere Art, die Leute zum Reden zu bringen. Sie liebte Gedankenaustausch und galt für sehr klug. Was sie am meisten liebte, war eine Erörterung über Religion, Philosophie oder Politik mit irgendeinem gut unterrichteten Manne. Dies Vergnügen genoss sie nicht häufig. So brachte sie die Leute immer dazu, ihr über sich selbst zu erzählen, und fand auf die Weise ihr Vergnügen.
Ihre Gestalt war ziemlich klein und zart, ihre Stirn breit, mit herabhängenden, braunen, seidenweichen Locken. Ihre blauen Augen sahen sehr geradeaus, ehrlich und forschend. Sie besaß auch die schönen Hände der Coppards. Ihre Kleidung war niemals auffallend. Sie trug dunkelblaue Seide, mit einer eigenartigen Kette aus silbernen Muscheln. Diese und eine schwere Vorstecknadel aus geflochtenem Golde waren ihr einziger Schmuck. Sie war noch gänzlich unberührt, von tiefer Frömmigkeit und voll einer schönen Aufrichtigkeit.
Walter Morel schmolz anscheinend vor ihr hinweg. Sie war für den Bergmann jenes geheimnisvolle, bezaubernde Wesen: eine Dame. Wenn sie zu ihm sprach, geschah es mit südlicher Betonung und in so reinem Englisch, dass ihn beim Zuhören jedes Mal ein Schauder durchfuhr. Sie beobachtete ihn. Er tanzte gut, als wäre ihm Tanzen ein angeborenes Vergnügen. Sein Großvater war ein französischer Flüchtling gewesen, der ein englisches Schenkmädchen geheiratet hatte – wenn es eine Heirat gewesen war. Gertrude Coppard beobachtete den jungen Bergmann während des Tanzens, dieses feine, wie ein Zauber wirkende Frohlocken in seinen Bewegungen und sein Gesicht, das rötlich strahlende, die Blüte seines Körpers, mit dem lockigen Schwarzhaar, stets lächelnd, ganz gleich, über welche Tänzerin er sich neigte! Sie fand ihn prachtvoll, da sie noch nie seinesgleichen getroffen hatte. Ihr Vater galt ihr als Vorbild aller Männer. Und George Coppard mit seiner stolzen Haltung, hübsch und doch streng, der als Lesestoff stets etwas Geistliches bevorzugte und seine Zuneigung nur einem Menschen widmete, dem Apostel Paulus; dessen Herrschaft im Hause so rau, dessen Vertraulichkeit selbst noch spöttisch war, der keinerlei sinnliches Vergnügen kannte – der war so ganz anders als der Bergmann. Gertrude selbst verachtete das Tanzen geradezu; sie besaß nicht die geringste Neigung zu dieser Kunst und hatte es selbst nicht einmal bis zu einem Roger de Coverley gebracht. Wie ihr Vater, gehörte auch sie zu den Puritanern, war auch sie hochgesinnt und durchaus ernst. Daher erschien ihr die dämmerige, goldene Weichheit der sinnlichen Lebensflamme dieses Mannes, die von seinem Fleische ausströmte wie die Flamme von einer Kerze, nicht durch Sinnen und Trachten zu Weißglut angefacht und aufgestachelt wie ihr eigenes Leben, sondern etwas Wundervolles, ihr ganz Fernstehendes.
Er kam und verbeugte sich vor ihr. Eine Wärme durchstrahlte sie, als habe sie Wein getrunken.
»Nu kommen Se doch un machen Se den da mal mit mich mit«, sagte er zärtlich. »Is janz leicht, wissen Se. Ick möchte Ihnen zu jerne mal tanzen sehen.«
Sie hatte ihm vorher erzählt, sie könne nicht tanzen. Sie bemerkte seine Demut und lächelte. Ihr Lächeln war sehr schön. Es berührte den Mann derart, dass er alles vergaß.
»Nein, ich tanze nicht«, sagte sie weich. Ihre Worte kamen klar und deutlich.
Ohne zu wissen, was er tat – manchmal tat er grade das Richtige rein gefühlsmäßig –, setzte er sich neben sie und neigte sich voller Verehrung zu ihr.
»Aber Sie dürfen Ihren Tanz nicht schießen lassen«, tadelte sie ihn.
»Ne, den will ick jar nich – aus den mache ick mich nischt.«
»Aber Sie forderten mich doch dazu auf.«
Darüber musste er herzlich lachen.
»Da ha ‘ck noch jar nich dran jedacht. Du brauchst aber ooch nich lange, um mich die Tolle auszukämmen.«
Nun war es an ihr, fröhlich aufzulachen.
»Sie sehen gar nicht so aus, als ob das viel nützen würde«, sagte sie.
»Ick bin wie so ‘n Schweineschwänzken, det krullt sich, weils sich nich helfen kann«, lachte er ziemlich geräuschvoll.
»Und Sie sind ein Bergmann!« rief sie voller Überraschung.
»Jawoll. Fuhr zuerst ein, als ick zehne war.«
Sie sah ihn an in Verwunderung und Bestürzung.
»Als Sie zehn Jahre waren! Und kam Ihnen das nicht sehr hart an?« fragte sie.
»Da jewöhnt man sich balde dran. Man lebt wie de Mäuse, un nachts krabbeln se denn mal wieder raus, um zu sehen, wat los is.«
»Da würde ich ganz blind«, runzelte sie die Stirn.
»Wie’n Mull!« lachte er. »Jawoll, un wat die welchen sind, die loofen ooch rum wie’n Mull.« Er stieß den Kopf vor, in der blinden, schnüffelnden Weise eines Maulwurfs, und schien nach der richtigen Gegend zu schnüffeln und zu blinzeln. »Janz jenau so machen se’s!« beteuerte er ganz aufrichtig. »So wat haste noch nie nich jesehen, wie die det machen. Aber ick muss dir mal mit runternehmen, un denn kannste’t ja alleine sehen.«
Erschreckt sah sie ihn an. Dies war eine ganz neue Lebensbahn, die sich da vor ihr eröffnete. Nun verstand sie das Leben der Bergleute, die zu Hunderten sich unter der Erde abmühen und abends erst wieder nach oben kommen. Er kam ihr erhaben vor. Täglich wagte er sein Leben, und mit Freuden. Mit etwas wie einer flehentlichen Bitte sah sie ihn an, in ihrer reinen Demut.
»Möchtst de nich mal mit?« fragte er sanft. »Vielleicht doch woll nich, würdest dir ja auch bloß schmutzig machen.«
Noch nie war sie auf diese Weise geduzt worden.
Nächsten Weihnachten wurden sie getraut, und für drei Monate war sie vollkommen glücklich: sechs Monate lang war sie sehr glücklich.
Er hatte sein Gelübde abgelegt und trug das blaue Kreuz der Schnapsgegner: er brüstete sich mächtig. Sie lebten, wie sie glaubte, in seinem eigenen Hause. Es war klein, aber ganz behaglich und nett eingerichtet, mit tüchtigen, ordentlichen Sachen, wie sie ihrer ehrlichen Sinnesart sehr zusagten. Die Frauen, ihre Nachbarinnen, waren ihr ziemlich fremd, Morels Mutter und Schwestern sehr geneigt, über ihr damenhaftes Benehmen die Nase zu rümpfen. Aber sie konnte sehr gut für sich allein fertig werden, solange sie ihren Mann für sich hatte.
Zuweilen, wenn sie des Kosens müde war, versuchte sie, ihm einmal ihr Herz ernstlich zu eröffnen. Sie merkte dann, wie er ihr voller Ehrerbietung zuhörte, aber ohne Verständnis. Das ertötete ihre Bestrebungen nach einer schöneren Vertraulichkeit, und manchmal blitzte Furcht in ihr auf. Zuweilen wurde er gegen Abend unruhig: das bloße Zusammensein mit ihr genügte ihm nicht, wurde ihr klar. Sie war sehr froh, als er anfing, sich mit allerlei Kleinigkeiten zu beschäftigen.
Er war ein ungewöhnlich geschickter Mensch, konnte alles selbst machen oder ausbessern. So sagte sie wohl einmal:
»Den Feuerhaken da bei deiner Mutter finde ich doch zu nett – so klein und zierlich.«
»Findst de, mein Kind? Schön, den hab ick selber jemacht, so eenen kann ick dich auch machen.«
»Was? der ist doch aber aus Stahl!«
»Un wenn schon! So ‘nen sollste auch haben, wenn nich jenau so ‘nen.«
Sie ließ sich die Schmiererei nicht anfechten, auch das Gehämmer und den Lärm nicht. Er war beschäftigt und glücklich.
Aber als sie im siebenten Monat mal seinen Sonntagsrock ausbürstete, fühlte sie Papiere in seiner Brusttasche, und von plötzlicher Neugierde ergriffen, zog sie sie hervor und las sie. Er trug den Gehrock, in dem er getraut war, nur sehr selten: und früher wäre es ihr nie eingefallen, Neugierde wegen dieser Papiere zu empfinden. Es waren die Rechnungen über ihren noch nicht bezahlten Hausrat.
»Sieh mal«, sagte sie abends, als er sich gewaschen und Abendbrot gegessen hatte. »Die habe ich in der Tasche deines Hochzeitsrockes gefunden. Hast du die Rechnungen noch nicht in Ordnung gebracht?«
»Ne, da bin ick noch nich zu jekommen.«
»Aber du erzähltest mir doch, es wäre alles bezahlt. Dann fahre ich doch besser Sonnabend nach Nottingham hinein und mache das mal ab. Ich mag nicht auf anderer Leute Stühlen sitzen und von einem unbezahlten Tische essen.«
Er antwortete nicht.
»Ich kann ja wohl dein Bankbuch kriegen, nicht wahr?«
»Det kannste, wenn de meenst, det nützt dir wat.«
»Ich glaubte ...«, begann sie. Er hatte ihr erzählt, er habe ein hübsches Stück Geld zurückgelegt. Aber sie merkte, Fragen hätten keinen Zweck. Sie saß starr vor Bitterkeit und Ärger. Am nächsten Tage ging sie zu seiner Mutter hinunter.
»Hatten Sie nicht die Einrichtung für Walter gekauft?« fragte sie.
»Jawoll, das habe ich«, sagte die alte Frau mürrisch.
»Und wieviel hat er Ihnen dafür gegeben?«
Die ältere Frau fühlte sich von leisem Ärger geprickelt.
»Achtzig Pfund, wenn Sie so scharf dahinterher sind«, erwiderte sie.
»Achtzig Pfund! Aber zweiundzwanzigeinhalb schuldet er doch noch drauf!«
»Kann ich doch nicht helfen.«
»Aber wo ist es denn bloß alles geblieben?«
»Sie werden wohl alle Papiere finden, glaube ich, wenn Sie mal nachsehen – außer zehn Pfund, die er mir noch schuldig ist, und sechs Pfund, die die Hochzeit hier unten gekostet hat.«
»Sechs Pfund!« wiederholte Gertrude Morel. Es kam ihr ungeheuerlich vor, dass, nachdem ihr Vater schon so viel für die Hochzeit bezahlt hatte, hier in Walters Elternhause auf seine Kosten noch sechs Pfund mehr für Essen und Trinken verjubelt sein sollten.
»Und wieviel hat er in seinen Häusern angelegt?« fragte sie.
»Seinen Häusern – was für Häuser?«
Gertrude Morel wurde weiß um die Lippen. Er hatte ihr erzählt, das Haus, in dem sie lebten und das nächste wären seine.
»Ich dachte, das Haus, in dem wir leben ...«, begann sie wieder.
»Mir gehören die beiden Häuser«, sagte die Schwiegermutter. »Und noch nicht mal ganz. Ich kann grade die Grundschuldzinsen bezahlen.«
Gertrude saß weiß und stumm. Nun war sie ganz ihr Vater.
»Dann müssten wir Ihnen doch Miete zahlen«, sagte sie kalt.
»Walter zahlt mir auch Miete«, erwiderte seine Mutter.
»Und wieviel?« fragte Gertrude.
»Sechseinhalb Schilling die Woche«, gab die Mutter zurück.
Das war mehr, als das Haus wert war. Gertrude hielt den Kopf hoch und sah stur vor sich hin.
»Sie können von Glück sagen«, sagte die ältere Frau beißend, »dass Sie einen Mann gekriegt haben, der Ihnen all die Geldsorgen abnimmt und Ihnen freie Hand lässt.«
Die junge Frau blieb stumm.
Zu ihrem Manne sagte sie nur sehr wenig, aber ihr Benehmen gegen ihn war ein anderes geworden. In ihrer stolzen, ehrenhaften Seele hatte sich etwas ausgeschieden, hart wie Fels.
Als der Oktober herankam, dachte sie nur noch an Weihnachten. Vor zwei Jahren hatte sie ihn zu Weihnachten getroffen. Letzten Weihnachten hatte sie ihn geheiratet. Diesen Weihnachten würde sie ihm ein Kind bescheren.
»Sie tanzen woll nich, Nachbarn?« fragte ihre nächste Nachbarin sie im Oktober, als es ein mächtiges Gerede gab über die Eröffnung einer Tanzstunde oben im Ziegel- und Backstein-Wirtshause in Bestwood.
»Nein – ich habe nie die geringste Neigung zum Tanzen besessen«, erwiderte Frau Morel.
»Denken Se bloß! Un wie putzig, dass Sie grade Ihren Meister geheiratet haben. Sie wissen doch, er is doch gradezu berühmt wegen seines Tanzens.«
»Ich wusste nicht, dass er deswegen berühmt wäre«, lachte Frau Morel.
»Jawoll! Is er aber! Wieso, der leitet doch schon über fünf Jahre die Tanzstunde im ›Bergmanns-Wappen‹.«
»Wirklich?«
»Gewiss doch.« Die andere wurde herausfordernd. »Alle Donnerstag war es ganz voll, un dienstags, un sonnabends – un da gings hoch her, heißt es.«
So etwas war bittere Galle für Frau Morel, und ein gehöriges Teil davon wurde ihr zugemessen. Die Frauen ersparten ihr zuerst gar nichts; denn sie war etwas Besseres als sie, wenn sie auch nichts dafürkonnte.
Er fing an, recht spät nach Hause zu kommen.
»Sie arbeiten jetzt sehr lange, nicht wahr?« sagte sie zu ihrer Wäscherin.
»Nich länger als immer, jlobe ick. Aber se halten denn eben noch mal an, um bei Ellens einen zu nehmen, un denn fangen se an zu reden, un da haben Se’s Essen eiskalt – geschieht se janz recht.«
»Aber Herr Morel trinkt nichts.«
Die Frau ließ ihre Wäsche fallen, sah Frau Morel an und fuhr dann ohne ein Wort zu sagen mit ihrer Arbeit fort.
Gertrude Morel war sehr elend, als der Junge geboren wurde. Morel war sehr gut gegen sie, von goldener Güte gradezu. Aber sie fühlte sich sehr einsam, meilenweit von den Ihren entfernt. Sie fühlte sich auch mit ihm einsam, und seine Gegenwart machte dies Gefühl nur schlimmer.
Der Junge war zuerst klein und gebrechlich, aber er machte sich bald heraus. Er war ein hübsches Kind, mit dunkelgoldenen Ringeln und dunkelblauen Augen, die bald in ein helles Grau übergingen. Seine Mutter liebte ihn leidenschaftlich. Er kam grade zu der Zeit an, als die Bitternis ihrer Enttäuschung ihr am härtesten zu tragen vorkam; als ihr Glaube ans Leben erschüttert war und ihre Seele sich traurig und einsam fühlte. Sie hielt große Stücke auf das Kind, und der Vater wurde eifersüchtig.
Schließlich verachtete Frau Morel ihren Mann. Sie wandte sich dem Kinde zu; von dem Vater wandte sie sich ab. Er hatte angefangen sie zu vernachlässigen; die Neuigkeit des eigenen Heims war für ihn vorüber. Er besäße keine Entschlussfähigkeit, sagte sie voller Bitterkeit zu sich selbst. Was er grade im Augenblick empfand, das war ihm alles. Er konnte nie bei der Sache bleiben. Es saß nichts hinter all seinem Getue.
Nun begann ein Kampf zwischen Mann und Frau – ein furchtbarer, blutiger Kampf, der erst mit dem Tode des einen endete. Sie kämpfte, um ihn seine eigene Verantwortlichkeit erkennen zu lehren, ihn seine Verpflichtungen erfüllen zu machen. Er war aber zu verschieden von ihr. Seine Veranlagung war eine rein sinnliche, und sie versuchte, ihn sittlich zu machen, gottesfürchtig. Sie versuchte, ihn zu zwingen, den Dingen ins Auge zu schauen. Das konnte er nicht aushalten – es brachte ihn um den Verstand.
Noch während das Kind ganz klein war, wurde die Stimmung des Vaters so reizbar, dass kein Verlass mehr darauf war. Das Kind brauchte nur ein wenig unruhig zu werden, so fing der Mann an, es zu quälen. Ein wenig mehr, und die harten Bergmannsfäuste schlugen das Kind. Dann ekelte es Frau Morel vor ihrem Manne, ekelte es sie vor ihm tagelang: und dann ging er aus und trank; und sie machte sich wenig daraus, was er trieb. Sie verletzte ihn auch bei seiner Rückkehr durch ihren Spott.
Die Entfremdung zwischen ihnen beiden veranlasste ihn, sie wissentlich oder unwissentlich auch da gröblich zu beleidigen, wo er es sonst nicht getan hätte.
William war erst ein Jahr alt, und seine Mutter war auf den hübschen Jungen sehr stolz. Ihre Verhältnisse waren jetzt nicht besonders, aber ihre Schwestern versorgten den Jungen mit Anzügen. Mit seinem kleinen weißen Hut mit einer gekräuselten Straußenfeder und seinem weißen Rock war es ihr eine Freude ihn anzusehen, mit seinem Lockenhaar, das ihm den Kopf umrahmte. Eines Sonntagmorgens lag Frau Morel und lauschte auf das Geplauder von Vater und Sohn unten. Dann schlummerte sie wieder ein. Als sie nach unten kam, glühte ein mächtiges Feuer auf dem Herde, das Zimmer war heiß, der Frühstückstisch unordentlich gedeckt, und in seinem Armstuhl dem Kamin gegenüber saß Morel, etwas verschüchtert; und zwischen seinen Knien stand das Kind – kahl geschoren wie ein Schaf, mit einer wunderlichen runden Tolle – und sah sie verwundert an; und auf einer Zeitung auf der Herdmatte lagen verstreut in dem rötlichen Feuerschein unzählige halbmondförmige Locken, wie die Blütenblätter einer Ringelblume.
Frau Morel stand regungslos. Dies war ihr erstes Kind. Sie wurde schneeweiß und konnte nicht sprechen.
»Wat meenste so von ihn?« lachte Morel unsicher.
Sie ballte beide Fäuste, hob sie und trat auf ihn zu. Morel wich zurück.
»Umbringen könnte ich dich, ja, wahrhaftig!« sagte sie. Sie erstickte vor Wut, mit hocherhobenen Fäusten.
»Du wolltst doch woll keen Mächen aus ihn machen«, sagte Morel in furchtsamem Tonfall und ließ den Kopf hängen, um seine Augen vor den ihren zu bergen. Der Versuch zu lachen war ihm vergangen.
Die Mutter blickte auf das zottelige, kahlgeschorene Haupt ihres Kindes. Sie legte die Hand auf sein Haar und streichelte ihm liebkosend den Kopf.
»Oh – mein Junge!« stammelte sie. Die Lippen zitterten ihr, ihr Gesicht brach zusammen, und das Kind in die Höhe reißend, barg sie ihr Gesicht an seiner Schulter und weinte schmerzerfüllt. Sie war eine jener Frauen, die nicht weinen können; denen es genau so weh tut wie einem Manne. Ihr Schluchzen war, als würde ihr etwas aus dem Leibe gerissen.
Morel saß da, die Ellbogen auf den Knien, die Hände verschränkt, bis die Knöchel weiß wurden. Er stierte ins Feuer und kam sich fast wie betäubt vor, als könne er nicht länger atmen.
Aber da war es auch zu Ende mit ihr, sie beruhigte das Kind und räumte den Frühstückstisch auf. Das Zeitungsblatt mit dem Lockengewirr ließ sie auf der Herdmatte liegen. Schließlich nahm ihr Mann es auf und steckte es ins Feuer. Sie ging mit geschlossenem Munde, sehr still, an ihre Arbeit. Morel war gebändigt. Voller Jammer kroch er umher, und seine Mahlzeiten waren ihm an diesem Tage ein wahres Elend. Sie sprach höflich mit ihm und machte keine Anspielung auf das, was er getan hatte. Aber er merkte, dass etwas zum Schlusse gekommen sei.
Später sagte sie, sie wäre albern gewesen, dem Jungen hätte das Haar über kurz oder lang doch geschnitten werden müssen. Schließlich brachte sie es sogar über sich, ihrem Manne zu sagen, es wäre doch recht gewesen, dass er damals den Haarschneider gespielt habe. Aber sie wusste doch, und Morel ebenso, jene Handlung hatte in ihrer Seele etwas Folgenschweres hervorgerufen. Ihr ganzes Leben lang erinnerte sie sich an den Vorgang als einen, unter dem sie besonders schwer gelitten hatte.
Dieser Ausbruch männlicher Tölpelhaftigkeit war der Speer durch die Seite ihrer Liebe für Morel. Früher, selbst während sie in bitterem Kampfe mit ihm lag, hatte sie sich um ihn gegrämt, wenn er einmal auf Abwege geriet. Jetzt hörte sie auf, sich nach seiner Liebe zu sehnen: er war ihr fremd geworden. Das machte das Leben viel erträglicher.
Trotzdem gingen ihre Kämpfe mit ihm weiter. Sie besaß immer noch ihr hohes Sittlichkeitsgefühl, ein Erbteil ganzer Geschlechterfolgen von Puritanern. Jetzt war es ihr Frömmigkeitsgefühl, und sie wurde fast zum Glaubensschwärmer an ihm, grade weil sie ihn liebte oder doch geliebt hatte. Sündigte er, so quälte sie ihn. Trank er und log, wurde er manchmal zum Prahlhans, gelegentlich auch mal zum Lumpen, so schwang sie unbarmherzig die Geißel.
Das Traurige war: sie war ihm zu unähnlich. Sie konnte sich mit dem Wenigen, was er darstellen konnte, nicht zufriedengeben; sie wollte ihn so hochbringen, wie er eigentlich hätte stehen müssen. So vernichtete sie ihn in dem Versuch, ihn zu etwas Edlerem zu machen, als er sein konnte. Sie verletzte und quälte und schund sich selbst auch, aber sie verlor nichts von ihrem Werte. Sie hatte ja auch die Kinder.
Er trank recht schwer, wenn auch nicht mehr als andere Bergleute, und nur Bier, sodass seine Gesundheit wohl litt, aber doch nicht untergraben wurde. Am Wochenschluss gings auf den Hauptbummel. Jeden Freitagabend, Sonnabend- und Sonntagabend saß er bis Feierabend im ›Bergmanns-Wappen‹. Montags und dienstags musste er aufstehen und, wenn auch widerwillig, gegen zehn Uhr losziehen. Mittwoch- und Donnerstagabend blieb er manchmal zu Hause oder ging nur auf ein Stündchen aus. Tatsächlich brauchte er nie des Trinkens wegen die Arbeit zu versäumen.
Aber obwohl er recht gleichmäßig arbeitete, ging sein Lohn doch zurück. Er war ein Plappermaul, ein Schwätzer. Aufsicht war ihm etwas Grässliches, daher konnte er über die Betriebsleiter auch nichts als schimpfen. So sagte er wohl mal in Palmerston:
»Kommt der Olle heute morjen in unsern Stollen runter und sagt: ›Weeste, Walter, so jeht det nich weiter. Wat is denn det fier ‘ne Zimmerung?‹ Un ick antwort ihm: ›Wieso denn, wo red’st de denn von? Wat is denn los mit die Zimmerung?‹ ›Die jeht nie nich, die da,‹ sagte er. ›Dich kommt eines schönen Tages det Dach auf’n Kopp,‹ sagt er. Un ick sag: ›Denn schtell dir man lieber da auf’n Klumpen Dreck un halts mit’n Kopp hoch.‹ Da wurde er mächtig jiftig un schimpft un flucht, un die andern mussten alle lachen.« Morel war ein guter Schauspieler. Er ahmte die fette, quäkige Stimme des Betriebsleiters nach und seinen Versuch, anständig Englisch zu sprechen.
»›Ick werd mir woll hieten, Walter. Wer verschteht denn woll mehr davon, du oder ich?‹ sagt er. ›Det Hab ick noch nie nich rausjefunden, wat du davon verschtehst, Alfred. Et langt villeicht jrade, dir in die Klappe un wieder rauszubringen.‹«
So fuhr Morel zum Vergnügen seiner Kneipbrüder fort. Und manches daran war auch wahr. Der Betriebsleiter war kein Mann von Bildung. Er war noch zur selben Zeit wie Morel Schlepperjunge gewesen, sodass sie beide, während sie sich nicht leiden konnten, sich doch als gegebene Größen hinnahmen. Aber Alfred Charlesworth vergab dem Steiger dies Kneipengeschwätz nicht. Obwohl Morel also ein tüchtiger Bergmann war und zur Zeit seiner Verheiratung manchmal bis an fünf Pfund in der Woche verdiente, geriet er in der Folge ganz allmählich in immer schlechtere und schlechtere Stollen, wo die Kohle dünn und schwer zu erreichen war und keinen Vorteil brachte.
Im Sommer waren die Gruben außerdem flau. An hellen, sonnigen Morgen kann man die Leute manchmal um zehn, elf oder zwölf haufenweise nach Hause ziehen sehen. Dann stehen keine leeren Hunde am Schachteingang. Die Frauen sehen vom Hügel herüber, während sie die Herdmatte am Zaun ausklopfen, und zählen die Wagen, die die Maschine das Tal hinunterschleppt. Und wenn die Kinder zur Essenszeit aus der Schule kommen, blicken sie über das Feld weg, und wenn sie die Räder auf den Fördertürmen stillstehn sehen, sagen sie:
»Minton hat gestoppt, Vatter wird zu Hause sein.«
Und über allen liegt eine Art Schatten, über Männern und Frauen und Kindern, weil das Geld am Wochenschluss knapp sein wird.
Morel sollte seiner Frau eigentlich dreißig Schilling wöchentlich geben für alles – Miete, Essen, Kleidung, Vergnügen, Versicherung, Arzt. Ging es ihm mal besonders gut, so gab er ihr fünfunddreißig. Aber diese Gelegenheiten hielten keineswegs denen die Waage, wo er ihr nur fünfundzwanzig gab. Im Winter konnte der Bergmann, wenn er einen anständigen Stollen hatte, fünfzig bis fünfundfünfzig Schilling die Woche verdienen. Dann war er glücklich. Freitagabend, Sonnabend, Sonntag war er freigebig wie ein König und wurde auf die Weise seine zwanzig Schilling oder so los. Und von alledem behielt er kaum so viel übrig, um den Kindern einen Penny zu geben oder ihnen ein Pfund Äpfel zu kaufen. Alles ging durch die Kehle. In schlechten Zeiten war es noch übler, aber er war nicht so häufig betrunken, sodass Frau Morel zu sagen pflegte:
»Ich weiß doch nicht, ob ich nicht lieber sehe, wenn es uns knapp geht; denn wenn er Geld hat, gibts keinen Augenblick Ruhe und Frieden.«
Wenn er vierzig Schilling empfing, behielt er zehn; von fünfunddreißig behielt er fünf; von zweiunddreißig vier; von achtundzwanzig drei; von vierundzwanzig zwei; von zwanzig anderthalb, von achtzehn behielt er einen Schilling, von sechzehn einen halben. Nie sparte er einen Penny und gab auch seiner Frau nie die Möglichkeit zu sparen; stattdessen hatte sie gelegentlich seine Schulden zu bezahlen; nicht Kneipschulden, denn die wurden nie auf die Frauen übertragen, aber Schulden, wenn er etwa einen Kanarienvogel gekauft hatte oder einen auffallenden Spazierstock.
Während des Jahrmarkts arbeitete Morel schlecht, und Frau Morel versuchte, etwas für ihre Wochen zu sparen. So war ihr der Gedanke, dass er seinem Vergnügen nachliefe, während sie abgehetzt zu Hause bliebe, ein gallenbitterer Trank. Der Rummel dauerte zwei Tage. Am Dienstagmorgen stand Morel früh auf. Er war guter Stimmung. Ganz früh, vor sechs, hörte sie ihn unten lustig drauflos pfeifen. Er hatte eine hübsche Art zu pfeifen, lebhaft und wohlklingend. Er pfiff fast stets Kirchenlieder. Bei seiner schönen Stimme war er Chorknabe gewesen und hatte im Dome zu Southwell sogar allein singen müssen. Das konnte man noch seinem morgendlichen Pfeifen anhören.
Seine Frau lag und hörte seinem Arbeiten im Garten zu, wo sein Pfeifen in das Gesäge und Gehämmere hineintönte. Ihn so in dem hellen frühen Morgen, glücklich bei seiner männlichen Beschäftigung zu hören, während sie noch im Bette lag und die Kinder noch nicht wach waren, gab ihr immer ein Gefühl von Wärme und Frieden.
Um neun Uhr, während die Kinder mit bloßen Füßen und Beinen auf dem Sofa spielten und die Mutter aufwusch, kam er von seiner Zimmermannsarbeit wieder herein, die Ärmel aufgekrempelt, die Weste offen hängend. Er war immer noch ein gut aussehender Mann, mit schwarzem lockigem Haar und einem mächtigen schwarzen Schnurrbart. Sein Gesicht war etwas zu sehr gerötet, und er hatte vielleicht etwas zu Empfindliches an sich. Aber augenblicklich war er doch fröhlich. Er ging stracks auf den Ausguss zu, an dem seine Frau aufwusch.
»Wat, da biste schon!« sagte er lärmend. »Mach mal hopp un lass mich mir erst mal waschen.«
»Du kannst wohl warten bis ich fertig bin«, sagte seine Frau.
»Oh, kann ick; wenn ick aber nich will?«
Diese gutmütige Drohung machte Frau Morel Spaß.
»Denn kannst du ja hingehn und dich in der Regentonne waschen.«
»Ha, kann ick, du verflixte kleene Hexe!«
Worauf er noch einen Augenblick stehenblieb und ihr zusah; dann aber ging er weg und wartete, bis sie fertig war. Wenn er nur wollte, konnte er immer noch richtig den Verliebten spielen.
Für gewöhnlich ging er am liebsten mit einem Tuch um den Hals aus. Nun aber zog er sich ordentlich an. Eine wahre Wollust schien in der Art und Weise zu liegen, wie er beim Waschen prustete und plantschte, eine wahre Heiterkeit darin, wie er zu dem Küchenspiegel fuhr und, indem er sich niederbeugte, weil er ihm zu tief hing, sein nasses schwarzes Haar so gewissenhaft scheitelte, dass es Frau Morel geradezu reizte. Er band einen Umlegekragen und eine schwarze Schleife um und zog seinen Sonntagsrock an. Darin sah er ganz flott aus, und was sein Anzug nicht vermochte, das besorgte sein eigenes Gefühl für sein gutes Aussehen.
Um halb zehn kam Jerry Purdy, um seinen Kumpel abzuholen. Jerry war Morels Busenfreund, und Frau Morel mochte ihn gar nicht. Er war ein langer, dünner Mensch mit einem richtigen Fuchsgesicht, jener Art Gesichtern, denen die Augenbrauen zu fehlen scheinen. Er ging mit steifer, spröder Würde einher, als stäke sein Kopf auf einer hölzernen Feder. Seine Veranlagung war kalt und schlau. Großmütig, wo es in seiner Absicht lag, schien er Morel sehr gern zu haben und ihn mehr oder weniger unter seine Obhut zu nehmen.
Frau Morel hasste ihn. Sie hatte seine Frau gekannt, die an der Schwindsucht gestorben war und die gegen ihr Ende hin eine so furchtbare Abneigung gegen ihren Mann empfunden hatte, dass es ihr schon schweren Blutverlust verursachte, wenn er nur zu ihr ins Zimmer kam. Woraus Jerry sich übrigens nichts zu machen schien. Und nun hielt ihm seine älteste Tochter, ein Mädchen von fünfzehn, einen jämmerlichen Haushalt und sorgte für die beiden jüngeren Kinder.
»Der dürre Schuft mit seinem verkümmerten Herzen!« sagte Frau Morel von ihm.
»Ick hab in mein Leben noch nich jesehen, det Jerry ‘n Schuft jewesen wäre«, hielt Morel ihr entgegen, »’n besseren Kerl mit ne offenere Hand kannste woll nirgends nich finden, so ville ick weeß.«
»Offene Hand gegen dich«, wandte Frau Morel dagegen ein. »Für seine Kinder ist seine Faust dicht genug – arme Dinger!«
»Un weswegen sin se denn arme Dinger, möchte ick woll wissen!«
Aber Frau Morel wollte sich über Jerry nicht beruhigen lassen.
Der Gegenstand ihrer Unterhaltung wurde sichtbar, indem er seinen dünnen Hals über den Spülküchenvorhang vorbeugte. Er traf Frau Morels Blick.
»Morjen, Frau! Is der Meester da?«
»Ja, da ist er.«
Jerry trat ungebeten ein und blieb im Kücheneingang stehen. Er wurde nicht aufgefordert, sich zu setzen, sondern blieb dort stehen, in Verteidigung der Menschen- und Gattenrechte.
»’n feiner Morjen«, sagte er zu Frau Morel.
»Ja.«
»Jroßartig heute draußen – jroßartig für’n Spazierjang.«
»Meinen Sie, Sie wollten heute spazierengehen?« fragte sie.
»Ja. Wir wollten mal nach Nottingham«, antwortete er.
»Hm!«
Die beiden Männer begrüßten sich, beide froh: Jerry indessen ganz selbstbewusst, Morel eher verkniffen, voller Angst, sich in Gegenwart seiner Frau zu froh zu zeigen. Aber rasch und voller Laune schnürte er sich die Schuhe.
Sie wollten zehn Meilen über Feld nach Nottingham gehen. Vom ›Grunde‹ aus den Hügel hinansteigend, zogen sie fröhlich in den Morgen hinaus. Im ›Mond und Sterne‹ nahmen sie zum ersten Mal einen, dann ging es weiter nach dem Alten Flecken. Dann fünf lange Meilen Durststrecke, die sie nach Bullwell hineinführte zu einem großartigen Halben Helles. Aber dann hielten sie sich wieder auf dem Feld bei Heumachern auf, deren Bierkrug noch voll war, sodass, als sie in Sicht der Stadt kamen, Morel müde war. Die Stadt stieg vor ihnen an, im flimmernden Dunst der Mittagsglut, in einer kühnen Zackenkrone nach Süden zu mit ihren Türmen und mächtigen Werkstätten und Schornsteinen. Auf dem letzten Felde legte Morel sich unter einen Eichbaum und schlief fest über eine Stunde lang. Als er aufstand, um weiter zu ziehen, fühlte er sich recht unbehaglich.
In der ›Weide‹ aßen sie zu Mittag bei Jerrys Schwester; dann zogen sie weiter in den ›Punschnapf‹, wo sie in die Aufregung eines Taubenwettfluges hineingerieten. Morel spielte nie in seinem Leben Karten, da er ihnen geheime, böswillige Kräfte beimaß – »Teufelsbilder« nannte er sie. Aber im Kegeln und Domino war er Meister. Er nahm die Herausforderung eines Mannes aus Newark zum Kegeln an. Sämtliche Männer in der alten, lang sich hinziehenden Kneipe schlugen sich auf die eine oder andere Seite und wetteten für oder gegen. Morel zog seinen Rock aus. Jerry hielt den Hut mit dem Gelde. Die Leute an den Tischen beobachteten sie. Einige standen mit ihren Krügen in der Hand da. Morel wog die dicke, hölzerne Kugel vorsichtig und ließ sie dann lossausen. Er richtete ein furchtbares Gemetzel unter den Kegeln an und gewann zweieinhalb Schilling, was seine Zahlungsfähigkeit wiederherstellte.
Gegen sieben Uhr waren beide in guter Stimmung. Sie erreichten noch den Halbacht-Uhr-Zug nach Hause.
Nachmittags war der ›Grund‹ unerträglich. Jeder zu Haus gebliebene Einwohner war vor der Tür. Die Frauen, zu zweien und dreien, barhäuptig und in weißen Schürzen, plauderten in dem Gange zwischen den Häuserreihen. Männer, die sich mal ein bisschen vom Kneipen ausruhten, hockten da und schwatzten. Das ganze Nest roch abgestanden; die Schieferdächer glitzerten in der trockenen Hitze.
Frau Morel brachte ihr kleines Mädchen hinunter an den Bach auf der nur etwa zweihundert Schritt entfernten Wiese. Das Wasser lief hurtig über Steine und zerbrochenes Geschirr. Mutter und Kind lehnten gegen das Geländer der alten Schafbrücke und passten auf. Oberhalb an der Schwemme, am andern Ende der Wiese, konnte Frau Morel die nackten Gestalten von Jungens um das tiefe, gelbe Wasser aufblitzen oder gelegentlich einen hellen Körper schimmernd über die stumpfschwarz erscheinende Wiese flitzen sehen. Sie wusste, William war mit an der Schwemme, und es war die Angst ihres Lebens, er könne dort ertrinken. Annie spielte unter der hohen, alten Hecke und las Erleneckern auf, die sie Johannisbeeren nannte. Das Kind erforderte viel Aufmerksamkeit, und die Fliegen waren eine reine Plage.
Um sieben wurden die Kinder zu Bett gebracht. Dann arbeitete sie noch ein Weilchen.
Als Walter Morel und Jerry in Bestwood ankamen, fühlten sie eine Last von ihren Gemütern sinken; keine Eisenbahnfahrt stand ihnen mehr bevor, und so konnten sie dem herrlichen Tage noch einen richtigen Abschluss geben. Mit der Zufriedenheit heimkehrender Reisender traten sie in den ›Nelson‹ ein.
Der nächste Tag war ein Arbeitstag, und der Gedanke daran legte sich wie ein Dämpfer über das Gemüt der Männer. Die meisten von ihnen hatten außerdem ihr Geld bereits ausgegeben. Einzelne trotteten schon missmutig heimwärts, um sich zur Vorbereitung für morgen auszuschlafen. Frau Morel, die ihrem trüben Gesang zugehört hatte, ging ins Haus. Neun Uhr wurde es, und zehn, und das »Paar« war immer noch nicht wieder da. Irgendwo auf einer Schwelle sang ein Mann laut und quäkend: »Führ’ uns, oh Licht.« Frau Morel ärgerte sich immer darüber, dass alle Betrunkenen grade dies Kirchenlied anstimmen mussten, wenn das graue Elend über sie kam.
»Als ob ›Genovefa‹ es nicht auch täte«, sagte sie.
Die Küche war erfüllt vom Geruch gekochter Kräuter und Hopfen. Auf dem Fender stand ein weiter Kessel und dampfte gemächlich. Frau Morel nahm einen irdenen Krug, einen großen Topf aus dickem rotem Ton, ließ einen Haufen weißen Zuckers hineinlaufen und goss dann die Flüssigkeit, sich unter der Last hochstemmend, darüber.
In dem Augenblick trat Morel ein. Er war im ›Nelson‹ sehr vergnügt gewesen, aber auf dem Heimweg hatte sich seine Stimmung verschlechtert. Er war noch nicht ganz über das Gefühl von Ärger und Schmerz hinweg, nach seinem Schlaf in der Hitze; und sein böses Gewissen plagte ihn, je näher er seinem Hause kam. Er wusste gar nicht, dass er ärgerlich war. Aber als die Gartentür seinen Versuchen, sie zu öffnen, widerstand, trat er mit dem Fuße dagegen und zerbrach die Klinke. Er trat grade ein, als Frau Morel den Kräutersud aus dem Kessel goss. Sanft torkelnd taumelte er gegen den Tisch. Die kochende Flüssigkeit spritzte über. Frau Morel fuhr zurück.
»Guter Gott«, rief sie aus, »kommt er wieder betrunken nach Haus!«
»Wie kommt er nach Hause?« knurrte er, den Hut auf ein Auge gedrückt.
Plötzlich geriet ihr Blut in Wallung.
»Sag auch noch, du wärest nicht betrunken!« blitzte sie hervor.
Sie hatte den Kessel wieder hingesetzt und rührte den Zucker in das Bier. Er ließ beide Hände schwer auf den Tisch fallen und stieß sein Gesicht gegen sie vor.
»›Sag ooch noch, du wärest nich betrunken‹«, wiederholte er. »Sicher, bloß so ‘n kleenes ekliges Dings wie du kann uff so ‘n Jedanken kommen.«
Er stieß sein Gesicht wieder gegen sie vor.
»Zum Saufen ist immer Geld da, wenn auch für nichts Anderes.«
»Keene zwee Schilling hab ick heute ausjejeben«, sagte er.
»Für nichts betrinkst du dich auch nicht wie ein Edelmann«, erwiderte sie. »Und«, rief sie in plötzlich ausbrechender Wut, »wenn du wieder mal deinen geliebten Jerry ausgepumpt hast, lass den doch lieber nach seinen Kindern sehen, denn die haben es nötig.«
»Det ‘s ‘ne Lüje, det ‘s ‘ne Lüje. Halt die Klappe, Weibsbild.«
Nun war der Kampf wieder auf dem Höhepunkt. Beide vergaßen alles über dem gegenseitigen Hass und ihrem Kampf. Sie war ebenso erhitzt und wütend wie er. So ging es weiter, bis er sie Lügnerin nannte.
»Nein«, rief sie in die Höhe fahrend, kaum imstande zu atmen. »Das sag nicht – du, der ekelhafteste Lügner, der je in Schuhleder lief.« Die letzten Worte brachte sie mit Mühe aus ihren erschöpften Lungen hervor.
»’ne Lüjnersche bist de!« schrie er gellend, mit einem heftigen Faustschlag auf den Tisch, »’ne Lüjnersche bist de, ‘ne Lüjnersche bist de!«
Mit geballten Fäusten straffte sie sich auf.
»Du beschmutzt ja das Haus!« rief sie.
»Denn mach doch, det de rauskommst – et jehört ja mich zu. Mach, det de rauskommst!« brüllte er. »Ick bringe doch woll dat Jeld an, nich du. ‘t is mein Haus, nich deins. Also raus mit dir – raus mit dir!«
»Und ich täts auch«, rief sie, plötzlich zu Tränen der Ohnmacht bewegt. »Ach wie gern, wie gern wäre ich schon lange gegangen, wäre es nicht wegen der Kinder. Ach, hats mich nicht gereut, dass ich nicht schon vor Jahren gegangen bin, als ich erst das eine hatte« – und dann plötzlich in Wut vertrocknend: »Glaubst du etwa, ich bliebe deinetwegen hier – glaubst du, ich bliebe deinetwegen auch nur eine Minute?«
»Denn jeh doch!« schrie er außer sich. »Jeh doch!«
»Nein!« Sie wandte sich ihm wieder zu. »Nein!« rief sie laut, »es soll nicht immer alles nach deiner Mütze gehen; du sollst nicht bloß tun, was du willst. Ich muss auf die Kinder passen. Wahrhaftig«, lachte sie, »das wäre was Schönes, wenn ich dir die überlassen wollte.«
»Raus!« schrie er undeutlich und hob die Faust. Er war bange vor ihr. »Raus!«
»Ich wäre ja nur zu froh. Ich müsste ja so lachen, so lachen, mein Herr und Gebieter, wenn ich nur von dir wegkönnte«, antwortete sie.