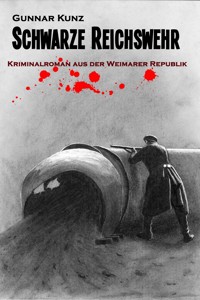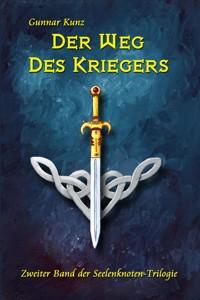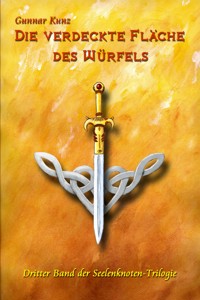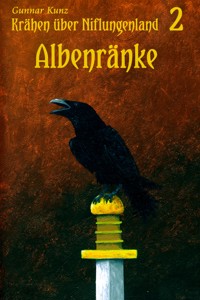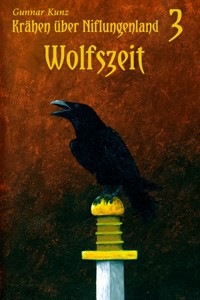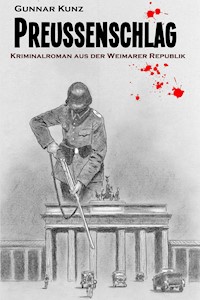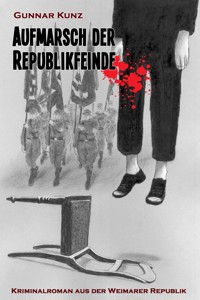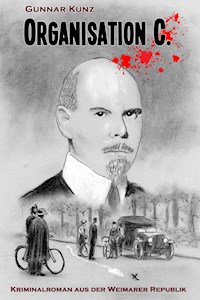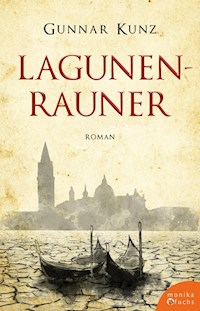
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Komm zu mir. Fürchte dich nicht. Widersetz dich nicht länger dem Flüstern der Lagune. Steig die versunkenen Stockwerke hinunter und sei bereit für das, was dich unten erwartet." Venedig im Jahr 1500. Schwarzer Nebel schlängelt sich durch die Lagune, schwarz wie der Lack einer Gondel, und bringt den Tod in die Stadt. Marco, Sohn eines Glasbläsers, und seine Freundin Chiara, die Maskenmacherin, versuchen gemeinsam mit dem Gelehrten Leonardo da Vinci, Venedig zu retten. Dabei müssen sie nicht nur gegen uralte Magie kämpfen, gegen Intrigen und Verrat, sondern sich auch den Schatten ihrer Vergangenheit stellen – und dem, was der Legende nach tief unter der Stadt haust. Lagunenrauner beschwört den Zauber Venedigs, dessen schillernde Persönlichkeit nicht in der Pracht der Fassaden liegt, sondern im Grenzbereich zwischen der Dunkelheit der Gassen und den lichtdurchtränkten Campi, da, wo Zwielicht herrscht, das die Augen narrt und einem Dinge vorgaukelt, die weder Wahrheit noch Lüge sind, sondern Möglichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Lagunenrauner
Gunnar Kunz
Impressum
www.verlag-monikafuchs.de
www.gunnarkunz.de
www.lagunenrauner.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
Unter der ISBN 978-3-947066-35-3 auch als Printbuch erhältlich
© 2021 Verlag Monika Fuchs | Hildesheim
Text: Gunnar Kunz
Cover-/Umschlaggestaltung: Buchgewand Coverdesign |
www.buch-gewand.de | Verwendete Grafiken/Fotos: tanshy – shutterstock.com
silverjohn – depositphotos.com; suprunvit – depositphotos.com
Layout und Satz: Die Bücherfüxin | Hildesheim | www.buecherfuexin.de
Alle Teile dieses Buches sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfätigungen, Abdrucke, Bearbeitungen, Verfilmungen etc. sind nur mit Erlaubnis der Rechteinhaber gestattet. Anfragen richten Sie bitte an den Verlag.
Das Venedig des Lagunenrauner
Inhalt
Prolog
I
1
2
3
4
5
II
6
7
8
9
10
III
11
12
13
14
15
16
17
IV
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
V
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Nachwort
Literaturhinweise
Glossar
Der Autor
Prolog
Eine Handbreit pro Jahr, das scheint auf den ersten Blick nicht viel. Nichts, was sich mit dem bloßen Auge wahrnehmen lässt. Wenn man abends nach Hause kommt, ist immer noch alles genau so, wie man es am Morgen verlassen hat. Die vertraute Silhouette des Gebäudes hat sich nicht verändert, die Fenster liegen in derselben Höhe, niemand stößt sich den Kopf am Türrahmen. Und doch bestimmt diese Spanne den Lebensrhythmus der Stadt: die Schmucklosigkeit der Fassaden, die Bestattungsrituale, das Improvisationstalent der Lagunenbewohner. Ein Venezianer kann sich mit allem arrangieren. Schließlich hat die Lagune ihre eigenen Gesetze, nicht wahr?
Eine Handbreit pro Jahr, das bedeutet: eine Mannslänge in zwanzig Jahren. Es bedeutet, dass jeder Venezianer dreimal in seinem Leben eine Etage aufstocken und in ein höhergelegenes Stockwerk umziehen muss, um im ständigen Wettlauf gegen den trügerischen Boden nicht zu unterliegen. Doch je mehr Stockwerke man aufbaut, desto schwerer werden die Gebäude, desto schneller sinken sie.
Marco zog seine Handschuhe aus und legte seine Hand an jene Stelle der feuchten Backsteinmauer, hinter der das Pflaster der Gasse verlief. Eine Handbreit, das hieß, im vergangenen Jahr hatte das Pflaster in Höhe seines Bauchnabels gelegen. Elf Handbreit tiefer, im Jahr seiner Geburt, war der Fußboden des Raumes ebenerdig verlaufen, parallel zur Gasse. Marco sah zur Decke. In zehn, zwölf Jahren würde das Haus verschwunden sein, vom eigenen Gewicht durch die Lehmschichten der Lagune gedrückt.
Er stellte sich auf die Zehenspitzen und spähte durch die obere Hälfte des Fensters, durch das er hereingekrochen war. Der untere Teil war zugemauert worden, um das Erdreich am Eindringen zu hindern, aber oben quollen Schmutz und Unrat herein, und Wurzelwerk arbeitete sich ins Zimmer vor. Warum die Bewohner das Haus aufgegeben hatten, wusste er nicht. Vielleicht hatten sie den ewigen Kampf gegen die Lagune satt und waren fortgezogen.
Mit dem Fuß schob Marco zerbrochene Dachschindeln beiseite, die durch ein Loch in der Decke hereingefallen waren, weniger um zu sehen, ob sich etwas Interessantes darunter befand, als vielmehr um den kostbaren Augenblick hinauszuzögern, in dem er mit der Erforschung der unteren Stockwerke begann. Raureif bedeckte den Boden. Eine angefressene Ratte lag in einer Ecke, hart gefroren und daher geruchlos. Vermutlich war das Haus das Revier streunender Katzen, obwohl er sich fragte, wie die wohl hierher gelangten. Ein Kanal trennte das Gebäude und den Platz, auf dem es stand, vom Rest Venedigs. Es gab keine Brücke, und eine Mauer riegelte die Insel hermetisch dorthin ab. Von der Landseite aus war sie daher unzugänglich, nur per Boot, von der offenen Lagune aus über die versteckte Bucht auf der Vorderseite, konnte man hergelangen.
Er nahm die mitgebrachte Laterne und entzündete die Kerze darin. Dann zog er an dem eisernen Ring zu seinen Füßen und öffnete die Falltür, die in das darunterliegende Geschoss führte. Marco leuchtete hinein. Kein Schlamm! Er hatte es gehofft, aber nicht wirklich daran geglaubt. Nur mit Mühe konnte er einen Freudenschrei unterdrücken.
Es gab Bewohner, die ihre Fenster zumauerten, ehe ein Stockwerk versank, um sich auf diese Weise Kellerräume zu sichern. Es wurde nicht gern gesehen, weil dadurch Erdreich verdrängt und in der Lagune hochgedrückt wurde, was bedeutete, dass der Kanal unentwegt von Ablagerungen befreit werden musste. Manche Venezianer machten es trotzdem. Häuser mit Keller waren weniger stabil als jene, deren versunkene Geschosse sich mit Schlamm füllten. Aber wenn die Mauern dick genug waren, konnten sie dem Druck jahrhundertelang standhalten.
Marco schwenkte die Laterne nach rechts und links. Das trübe Licht erhellte Boden und Wände. Bis auf eine verschimmelte Holzbank war der Raum leer. Ein Geruch nach feuchtem Lehm und Algen drang zu ihm herauf. Es hieß, die Lehmschicht der Lagune reiche viele hundert Stockwerke tief. Was darunter lag, darüber gab es zwar Legenden, aber Genaues wusste niemand. Weil noch niemand gewagt hatte, so weit hinabzusteigen. Ohnehin war es unmöglich, dazu müsste es schließlich Häuser geben, bei denen die Fenster sämtlicher Stockwerke seit Anbeginn der Besiedlung Venedigs zugemauert worden waren, ohne dass auch nur eine einzige dieser Mauern eingebrochen wäre. Die Lubriche hausten angeblich dort unten, die Glitschigen. Fischmenschen, die je nach Erzähler in unterirdischen Palästen aus purem Gold lebten oder sich als primitive Ungeheuer im Schlamm suhlten. Immer jedoch waren sie darauf aus, Menschen ins Verderben zu locken. Die Seelenlosen, nannten sie manche.
Marco testete die Stufen der hölzernen Treppe, die nach unten führte; sie hielten. Er stellte die Laterne auf den Boden und machte sich an den Abstieg.
Ein Geräusch ließ ihn innehalten. Es kam von draußen. Soldaten? Hatte ihn jemand dabei beobachtet, wie er am Ufer gelandet und in das Haus eingestiegen war? Marco war sich bewusst, dass er gegen mindestens ein halbes Dutzend Verordnungen des Senats verstieß. Er verhielt sich still und lauschte. In den Balken des Gebäudes knisterte es. Eine Stufe knarrte, als er sein Gewicht verlagerte. Draußen flüsterte die Lagune und brachte seine Haut zum Kribbeln.
So leise er konnte, stieg Marco wieder hinauf. Die obere Hälfte des Fensters, durch das er hereingeklettert war, jene Hälfte, die über dem Pflaster der Gasse lag, war von Unkraut überwuchert, doch die Gewächse zitterten, als schliche jemand dazwischen herum. Hastig blies Marco die Laterne aus.
Da war es wieder! Sand knirschte unter einem Schuh. Marco zog sich in eine dunkle Ecke zurück, wo er nicht zu sehen war. Geräuschlos hob er einen Ziegel auf. Eine armselige Waffe, aber wenn er das Überraschungsmoment ausnutzte …
Ein Schatten verdunkelte das Fenster, ein Körper schob sich in die Öffnung. »Marco?«
Erleichtert ließ er den Ziegel fallen. »Francesca! Du hast mich erschreckt.«
Seine Schwester kletterte behände durch die Öffnung und ließ sich zu Boden fallen.
Er half ihr auf die Beine. »Was machst du hier?«
»Ich bin dir nachgegangen. Ich will dein Geheimnis sehen.«
»Das ist nichts für dich. Dazu bist du noch zu klein.«
»Ich bin schon sieben.«
»Es ist gefährlich. Du solltest bei Tante Lucia bleiben.«
»Da ist es langweilig. Immer nur Gerede.«
Marco verstand seine Schwester nur zu gut. Er hatte dem Besuch auch nicht gerade mit Begeisterung entgegengesehen und sich heimlich davongestohlen, um mit der Gondel von Onkel Aldo die Gegend zu erkunden. Und dann war er auf die versteckte Bucht mit dem verfallenen Haus gestoßen, auf der anderen Seite des Canale di Cannaregio. Ohne das Boot hätte er die Bucht nie gefunden. Francesca musste ihn gesehen haben, als er zurückgerudert war, um die Laterne zu holen. »Wie bist du überhaupt hergekommen?«, wollte er wissen.
»Ich hab’ mich in der Gondel versteckt, unter der Plane.«
»Du hättest mich fragen sollen.«
»Dann hättest du mich nicht mitgenommen.«
»Es ist gefährlich«, wiederholte Marco.
»Du bist doch auch hier.«
»Aber ich bin älter als du.«
»Mir passiert schon nichts.« Francesca hängte sich an seinen Arm. »Du passt ja auf mich auf.«
Seine Schwester konnte eine echte Klette sein. Seit dem Tod ihrer Mutter im vorigen Jahr klebte sie auf Schritt und Tritt an seinen Fersen. Aber Marco brachte es nicht übers Herz, sie zurückzuweisen. Nicht einmal, wenn seine Freunde ihn deswegen verspotteten. Irgendwie fühlte er sich für sie verantwortlich. Manchmal wachte sie immer noch nachts auf und weinte nach ihrer Mama. »Aber nur ein Stockwerk, hörst du?«, sagte er. »Dann gehst du zur Gondel und wartest da.«
Sie nickte eifrig. Ihr Gesicht war rot vor Kälte, doch ihre Augen strahlten, weil ihr großer Bruder sie mitnahm.
Marco musste lächeln. Francescas Anwesenheit verdarb ihm das Abenteuer, aber er konnte ihr einfach nicht böse sein. Er würde mit ihr eines der versunkenen Stockwerke erkunden und sie dann zu Onkel Aldo und Tante Lucia bringen. Anschließend würde er noch einmal zurückkehren. Allein.
Er entzündete die Kerze in der Laterne mit Schwefelhölzchen und Zunderschwamm und machte sich an den Abstieg.
Francesca folgte ihm.
»Halt mich fest«, sagte sie.
Er half ihr die Stufen herunter. Jeder Schritt verursachte ein knarrendes Geräusch. Die Treppe war in einem guten Zustand, sicher gelangten sie unten an. Marco hielt die Laterne in die Höhe und sah sich um. Die verschimmelte Holzbank war tatsächlich der einzige Gegenstand im Raum, ansonsten herrschte gähnende Leere. Vielleicht gab es nebenan mehr zu sehen. Er näherte sich dem Durchgang. Eine Tür existierte nicht, aber das war zu erwarten. Holz war kostbar. Jeder Venezianer hängte die Türen aus, sobald ein Stockwerk aufgegeben werden musste, und verwendete sie in der neuen Wohnung.
Auch der Nebenraum war enttäuschend leer: ein Kachelofen, dessen Kacheln zum größten Teil zerbrochen waren, ein vergessener Besen, die Scherben einer Vase. In der gegenüberliegenden Ecke lagen ein paar verschüttete Körner, vermutlich Hirse. Das war alles. Marco durchsuchte sämtliche Räume, ohne etwas von Interesse zu finden. Francesca folgte ihm und hielt sich dabei an seinem Mantel fest.
Marco legte einen Arm um sie. »Hast du Angst?«
Sie schüttelte den Kopf. »Du bist doch bei mir.«
Das Stockwerk erwies sich als komplette Enttäuschung. Außer dem Abfall und Wachsflecken vom Kerzenmachen erinnerte nichts an die ehemaligen Bewohner des Hauses. Marco kehrte mit seiner Schwester in den ersten Raum zurück, in dem sich eine weitere Falltür befand. Bevor sie wieder nach oben gingen, wollte er wenigstens wissen, wie es unten aussah. Er stellte die Laterne ab und zog am Eisenring. Die Falltür klappte zurück.
Francesca drängte sich neben ihn, als er hinunterleuchtete.
Nichts. Alles leer. Nein, nicht ganz. Irgendetwas stand im Durchgang zum Nebenraum und warf seltsame Schatten.
»Warte hier, ich bin gleich zurück.«
Sie schüttelte den Kopf und folgte ihm auf die Treppe.
Marco seufzte, ließ ihr aber ihren Willen. Unten angekommen, wandte er sich dem Türrahmen zu. Die Schatten tanzten und gaukelten Bewegungen vor, wo keine waren. Francesca drückte sich enger an ihn. »Du hast doch Angst«, stellte er fest. Seine Stimme hallte im leeren Raum unnatürlich nach und klang dadurch fremd in seinen Ohren.
»Ein bisschen.«
»Dann bringe ich dich wieder hoch«, meinte er halbherzig.
»Ich will bei dir bleiben.«
Marco zuckte die Achseln und näherte sich dem Durchgang. Zu seiner Enttäuschung entpuppte sich der Gegenstand darin als verrosteter Vogelkäfig, der quietschte, wenn man ihn berührte.
Sie gingen daran vorbei nach nebenan. Weiße Wände reflektierten das Licht der Laterne. Zuerst glaubte Marco, jemand habe sie mit Kreide bemalt, ehe er erkannte, dass es sich um Eiskristalle handelte.
»Wie schön«, entfuhr es Francesca.
Zarte Eisblumen zierten das Mauerwerk, exotischen Blüten gleich. Sie schienen sich aus der Wand zu ranken und fächerförmig auszubreiten, manche ähnelten dem Rippenmuster von Farnen oder Miniaturbäumen. Es verlieh dem Raum etwas Entrücktes, Märchenhaftes. Francesca berührte eine der Blumen. Unter dem Einfluss ihrer Atemwolken bildete sich ein Tropfen auf der Wand.
Erst jetzt merkte Marco, wie kalt es war, viel kälter als oben. »Willst du meine Handschuhe?«
Seine Schwester nickte dankbar.
Er streifte ihr die Fäustlinge über, die viel zu groß für ihre Hände waren. Dann durchsuchte er die restlichen Zimmer, doch viel gab es nicht zu entdecken. In der Küche fand sich ein primitiver Herd, nichts weiter als eine lehmbestrichene Platte auf gemauertem Stein über einer offenen Feuerstelle. Ein Schemel, ein zerrissenes Fischernetz und ein Stück Tau waren die einzigen Gegenstände, die verrieten, dass hier einmal jemand gelebt hatte. Trotzdem: Der Gedanke, dass die Wände dieses Raumes den Atem von Menschen aus der Vergangenheit in sich bewahrten, hatte etwas Aufregendes. Auf diesem Schemel saß einst ein Fischer und knüpfte sein Netz, während die Rialtobrücke einstürzte und die Ca’ D’Oro erbaut wurde.
Das Flüstern der Lagune war zu einem undeutlichen Murmeln herabgesunken, dafür wurde ein anderes Raunen mit jedem Stockwerk stärker. Irgendwo unter ihnen musste sich Wasser befinden.
Wieder im ersten Raum angelangt, blieb Marco unschlüssig stehen. »Ein letztes Stockwerk noch«, sagte er, mehr zu sich als zu seiner Schwester, und öffnete die Falltür. Der Schein der Laterne erhellte einen leeren Raum. Marco begann zu befürchten, dass sich das ganze Gebäude als langweilig herausstellen würde. Er testete die Haltbarkeit der Leiter und stieg nach unten. Francesca folgte ihm.
Auch in diesem Stockwerk waren die Wände weiß von Frost. In einer Ecke lag ein verfaulter Fensterladen, daneben gab es einen geflochtenen Korb und Stoffreste. Im Raum nebenan fanden sich ein paar Tonschalen, ramponiertes Holzgeschirr und Spielzeug: eine Puppe ohne Kopf, ein Kreisel, eine grob geschnitzte Gondel. Im dritten Raum stand ein Badezuber. Eingetrocknete Farbreste verteilten sich über den Boden.
Marco kehrte in den ersten Raum zurück und blieb vor der Falltür stehen. Darunter war Wasser, er konnte es träumen hören.
Schweben, wisperte es träge. Dahingleiten.
Natürlich waren es nicht wirklich Worte, die er wahrnahm, eher Gefühle. Eine Art Präsenz, die ihn tagtäglich begleitete, meist unbemerkt, so unbemerkt wie das Fließen des Blutes durch seine Adern und nicht minder rhythmisch. Manchmal drängten sich die Träume des Wassers wuchtig in sein Bewusstsein wie eine Flutwelle und brachten Eindrücke mit, die ihn schneller atmen ließen und kribbelig machten. Dann musste er raus, durch die Gassen rennen, über die Märkte streifen oder den Schiffen beim Entladen zusehen, und dabei hielt er es nirgends lange aus. Sein Vater bezeichnete ihn in diesem Zustand immer als »zappeliger als ein Aal«.
Marco ließ zu, dass das Singen des Wassers ihn erfüllte wie süßer Traubensaft.
Schweben. Dahingleiten.
Er fühlte sich auf das Licht der Sonne zutreiben. Schwerelos. Selbstvergessen.
Das Prickeln der Haut und das Wispern begleiteten ihn, solange er denken konnte. Daheim, auf Murano, floss die Lagune direkt unter seinem Zimmer hindurch. Sie erzählte ihm Geschichten, jede Nacht. Von Dingen, die er noch nie gesehen oder gehört hatte, von Bergen, die den Himmel berührten, und dem Gesang der grauen Riesen, von seltsam geformten Schiffen und Tieren mit Beuteln am Bauch.
Sein Vater hatte ihn ausgelacht, als er davon erfuhr, und Angelo, sein großer Bruder, hatte ihm eins hinter die Ohren gegeben und ihn als Angeber beschimpft. Seitdem behielt Marco diese Dinge für sich.
Die Falltür war vereist, es brauchte mehrere Anläufe, bis er sie aufbekam. Krachend schlug die Klappe zurück.
Licht, flüsterte das Wasser.
Marco hielt die Lampe nach unten. Ein Teil des Fußbodens war eingebrochen, aber entlang der Wände gab es noch genug festen Grund. Die Mitte des Raumes wies ein kratergroßes Loch auf, darunter befand sich eine Eisdecke. Jetzt verstand Marco auch, warum die Gedanken der Lagune so schwerfällig waren: Der gefrorene Teil des Wassers machte sie träge.
Er setzte einen Fuß auf die Treppe.
Licht, sang es wieder von unten, diesmal kräftiger, als würde die Helligkeit der Laterne die Lagune aus dem Winterschlaf wecken.
Das Flüstern kam aus ungeheuren Tiefen. Anscheinend waren mehrere Stockwerke eingestürzt. Entweder hatte die Lagune die Wände durchbrochen, oder das Fundament des Hauses war auf eine unterirdische Wasserader gestoßen. Aber hätte der Druck das Wasser nicht bis zum oberen Stockwerk treiben müssen, auf eine Höhe mit dem Meeresspiegel?
Fiebrige Aufregung ergriff von Marco Besitz. Endlich ein Geheimnis, das zu lösen sich lohnte! Seine Füße berührten den Boden des Stockwerks. Er hielt sich an der Leiter fest und testete die Haltbarkeit des Holzes: Es schien in Ordnung. Er ließ die Leiter los, kniete nieder und legte seine Hände auf die Eisdecke.
Warm, wisperte es.
Marco spürte eine Strömung unter dem Eis. Auch wenn das Wasser an der Oberfläche träge schien, darunter war es lebendig. Es leckte hungrig an den Mauern, den Holzbohlen, dem lehmigen Grund der Lagune. Das Kribbeln, das der Gesang regelmäßig bei ihm hervorrief, wurde stärker.
Hinter ihm knarrte es. Francesca war ihm auf die Treppe gefolgt.
»Bleib oben, hier ist es nicht sicher.«
»Halt mich fest«, verlangte sie.
Marco verdrehte die Augen, ergriff aber ihren Arm und half seiner Schwester herunter.
Sie hockte sich neben ihn, nahm einen Handschuh ab, streckte ihren Zeigefinger aus und berührte das Eis. »Warum ist es hier so kalt?«, wollte sie wissen.
»Keine Ahnung.« Marco zog seine Schwester an der Schulter zurück. Es war wohl besser, sich wieder an den Aufstieg zu machen. Er traute dem Boden nicht, auch wenn das Eis ihm zusätzlichen Halt geben mochte.
Sein Blick fiel auf den Durchgang zum Nebenraum. Eine Linie aus verrotteten Algen zog sich über die Reste des Fußbodens, fast wie eine Schleifspur. Dazwischen blinkte etwas.
»Warte«, sagte er zu Francesca und schob sich, immer in der Nähe der Wand bleibend, an die Algen heran. Dort stellte er die Laterne ab und kniete nieder.
Schuppen. Was da so metallisch glitzerte, waren Schuppen. Perlmuttfarben, mit grünlichem Schimmer, einige rund und glattrandig, andere rau, mit gezähnten Graten bewehrt. Die rauen überzog eine eingetrocknete Schleimschicht. Alle jedoch waren handballengroß und mit blätterartigen Strukturen versehen. Unwillkürlich sog Marco den Atem ein.
»Was hast du da?« Francesca schaute ihm über die Schulter.
Er hatte gar nicht gemerkt, dass sie ihm gefolgt war. »Ich habe doch gesagt, du sollst warten.«
»Was ist das?«
Auch seine Schwester hielt den Atem an, und Marco erkannte, dass sie dasselbe dachte wie er. Kein Fisch besaß solche Schuppen. Mit dem Blick folgte Marco der Spur aus Algen. Je genauer er sie betrachtete, desto mehr ähnelte sie einer Fährte. Als wären menschenähnliche, algenbehängte Wesen durch diese Räume geschlurft.
»Lass uns gehen«, flüsterte Francesca.
»Gleich. Ich will nur sehen, was nebenan ist.«
»Nicht! Wenn sie dich entdecken, fressen sie dich.«
Sie glaubte es also auch. Lubriche. Fischmenschen. Kinderreime gingen Marco durch den Sinn, Ermahnungen von Generationen venezianischer Mütter: Sei brav, sonst holen dich die Lubriche. »Das sind doch bloß Ammenmärchen«, erwiderte er. Aber sein Herz klopfte bis zum Hals.
»Ich habe Angst.«
»Die Algen sind vertrocknet. Wenn sie hier waren, dann vor langer Zeit.«
»Wirklich?«
»Ja. Schau!« Er hob eine der Algen auf und hielt sie seiner Schwester hin.
Scheu berührte sie die Pflanze und löste damit ein raschelndes Geräusch aus. Francesca warf einen unsicheren Blick zum Durchgang. Dann lächelte sie. »Ich vertraue dir.«
»Pass auf«, sagte Marco, »ich lasse die Laterne hier stehen. Du bleibst bei der Treppe, ich sehe nur schnell nach nebenan.« Er war sich bewusst, dass er leichtsinnig handelte, aber er musste einfach herausfinden, was die Lubriche hier gemacht hatten. Vorsichtig, vor jedem Schritt den Untergrund prüfend, bewegte er sich auf den Nachbarraum zu und lauschte dabei auf jedes verdächtige Knacken im Holz.
Am Türrahmen angelangt schob er seinen Kopf um die Ecke. Das Licht der Laterne hinter ihm wurde von den Eiskristallen an den Wänden reflektiert und erhellte den Raum schwach. Auch hier war ein Teil des Fußbodens weggebrochen, den Rest überzog eine dicke Algenschicht. Möglicherweise hatten sich die Lubriche häufiger in diesem Raum aufgehalten. Es roch irgendwie fischig. Marco reckte sich, um einen besseren Überblick zu bekommen. Wenn man genauer hinsah, erkannte man, dass die Algen nicht ungeordnet auf dem Boden lagen, sondern in einem bestimmten Muster, als hätten ihre Besitzer festgelegte Bewegungen ausgeführt. Konnte das Zufall sein? Nein, die Überreste stammten zweifellos von Fischmenschen, nicht von Tieren. Ob sie hier zusammenkamen, um ihre Rituale abzuhalten?
Wieder weckte etwas Marcos Aufmerksamkeit. Die Algen liefen sternförmig auf ein Zentrum zu, und dort lag eine Muschel. Bauchig, spindelartig gedreht, mit einer seltsamen Maserung auf der geriffelten Kalkschicht und zahnartigen Vertiefungen am unteren Rand. Knotige Verdickungen überzogen die Oberfläche, Auswüchse, die an Hörner erinnerten. Eine solche Muschel hatte Marco noch nie gesehen. Er rutschte um die Ecke, schob sich darauf zu und hob sie auf. Die Schale fühlte sich pelzig an. Kühl. Er ließ seine Finger über die Riffelungen und Höcker gleiten. Der Weg hier runter hatte sich am Ende doch noch gelohnt. Befriedigt verstaute er die Muschel in einer Tasche seines Mantels. Besser, sie machten sich auf den Rückweg.
»Sieh mal, Marco, was ich kann«, lachte Francesca.
Marco schob sich zurück zum ersten Raum und drehte sich um.
Seine Schwester hatte sich auf das Eis gewagt und schlidderte von einer Seite zur anderen.
»Nicht!«, rief Marco. »Du weißt nicht, wie dünn das Eis ist.«
Warm, flüsterte der See.
»Es trägt, guck!« Francesca vollführte eine Drehung und quietschte vor Begeisterung.
Unter dem Eis bewegte sich das Wasser. Komm! Komm zu mir!
»Francesca, gib mir deine Hand.« Marco machte einen Schritt nach vorn. Das Holz zu seinen Füßen knirschte. Francesca jauchzte. Das Murmeln des Wassers schwoll zu vielstimmigem Singsang an. Und über allem hörte Marco ein feines, hauchdünnes Knacken, das Knacken von Eis. »Francesca!«
Ein jäher Riss durchzog die Eisfläche.
Tanzendes, Zappelndes. Komm zu mir!
Es krachte, das Eis gab nach. Francescas Jauchzen verwandelte sich in einen Schrei, und von einem Herzschlag auf den anderen war sie verschwunden.
Marco rief ihren Namen, warf sich auf den Bauch und robbte nach vorn. Er konnte die Strömung spüren, die unter dem Eis entlangstrich und seine Schwester erbarmungslos mit sich zog.
Kehre zurück zu deinem Ursprung! Werde ein Teil von mir!
Francesca kam auf ihn zu, er sah, wie sie versuchte, sich in das Eis zu krallen, sah ihre aufgerissenen Augen, ihren aufgerissenen Mund, und spürte zugleich wie sich das Wasser der Lagune in ihre Kehle drängte, gierig, hungrig, tiefer, tiefer.
Gib mir dein Zappeln! Gib mir deine Wärme!
Mit bloßen Fäusten schlug er auf die Eisdecke ein, ungeachtet der Gefahr, in die er sich selbst dadurch brachte, doch Francesca wurde von der Strömung unter ihm vorbeigezogen, in einer Kreisbewegung am Durchgang zum Nebenraum entlang und wieder zurück zur gegenüberliegenden Wand. Marco hörte das Geräusch ihrer Fingernägel unter dem Eis entlangschrammen, das vom Wasser gebremste Hämmern ihrer Fäuste, das schwächer und schwächer wurde, und gab jede Vorsicht auf; er schlug auf die Eisdecke ein, bis die Knochen seiner linken Hand splitterten, und selbst dann hörte er nicht damit auf.
Gib mir die Flamme, die du in dir trägst! Wehr dich nicht!
Er robbte hinter Francesca her, auf den Durchbruch zu. Das Knacken und Bersten wurde lauter, das Wispern des Wassers in seinem Kopf unerträglich. Unter seinem Körper brach der Untergrund, jäh stürzte er in eisige Kälte, die ihm die Luft aus den Lungen trieb. Instinktiv griff er nach dem Eisrand. Weitere Stücke brachen ab, die Strömung zerrte an seinen Beinen und drohte, ihn ebenfalls hinabzuziehen. Er schluckte Wasser, strampelte, kam hoch und krallte sich irgendwo fest. Scharfe Kanten zerschnitten seine Hände, das Eis färbte sich rot und barst.
Wieder drohte er zu versinken, Wasser zwängte sich in seine Luftröhre. Er hustete und spuckte, stieß plötzlich mit dem Knie gegen die Reste der alten Treppe und fand Halt. Mit letzter Kraft hielt er sich fest, während er einen Schritt nach oben machte und noch einen, bis die Strömung, die an ihm riss, schwächer wurde. Keuchend kroch er auf festen Untergrund und drehte sich um. »Francesca!«
Wieder und wieder rief er ihren Namen, ohne die Kälte zu beachten, die ihm die Kraft aus den Knochen saugte. Seine Stimme brach sich an den Wänden, wurde heiser und versagte schließlich. Bis auf das Knirschen von Eisschollen, die aneinanderrieben, war es still. Marco spürte, wie das Wasser zur Ruhe kam.
Etwas Dunkles trieb unter dem Eis hervor, dann gab die Strömung einen Körper frei. Satt und zufrieden räkelte sich die Lagune und schaukelte die leblose Hülle hin und her. Algen hatten sich in Francescas Haaren verfangen. Ihre Augen standen offen und schauten ungläubig nach oben. Warum sagte sie nichts? Warum hustete sie nicht oder weinte oder rief ihm zu: Halt mich fest?
Marco wimmerte und rührte sich nicht. Er saß nur da, zusammengekauert, und starrte auf den hin- und herschaukelnden Körper, bis seine Lippen blau angelaufen und seine Hände taub waren von der Kälte.
I
1
»Da braut sich was zusammen«, sagte Vincenzo Marzoli.
Sorgenvoll blickten die Fischer in den Himmel, der sich zusehends verfinsterte. Dicke Wolken zogen heran, schwarz, violett, blutrot, trafen über dem Zentrum von Venedig aufeinander und begannen zu kreisen, einem Maelstrom gleich. Eine solche Wolkenformation hatte Marco noch nie gesehen. Gleichzeitig schien sich die Luft aufzuladen, es knisterte wie getrocknete Blätter, die zusammengeknüllt wurden.
»Wir holen besser die Netze ein und kehren um«, meinte Vincenzo.
Ambrogio Cocchi und Paolo Accorsi, die sich an der Reling zusammengedrängt hatten, beeilten sich, der Aufforderung nachzukommen. Das Unwetter verursachte ihnen allen Unbehagen. Es zog schneller heran als die Bora, der kalte Fallwind aus Nordost, der mit Vorliebe um diese Jahreszeit in Venedig einfiel und verheerende Schäden anrichten konnte, und es sah auch anders aus. Düsterer. Bedrohlicher. Bösartiger.
Vincenzo machte sich am Ruder zu schaffen, Marco half den anderen, das Fischernetz einzuholen. Seine Haut prickelte, und er wusste nur zu genau, was das bedeutete. Er mied den Anblick des Wassers und konzentrierte sich auf das Seil in seinen Händen. Mit aller Kraft verweigerte er sich dem Sehnen aus der Tiefe und hielt die Luft an, bis das Kribbeln abklang.
Im Takt des ein- und auftauchenden Bootes zogen sie das Netz aus dem Wasser und ließen die Maschen innerbords vor ihre Füße fallen. Manchmal musste Marco die Zähne zusammenbeißen, weil seine linke Hand pochte. Die Knochensplitter waren schlecht zusammengewachsen, und wenn er die Hand falsch bewegte oder überanstrengte, fuhren ihm Feuerlanzen den Arm hinauf.
Schon konnte man die ersten Fische sehen, die sich gegen die Einschränkung ihrer Freiheit wehrten, doch es schienen nicht eben viele zu sein. Sobald das Netz längsseits des Schiffes schwamm, hievten sie es mit vereinten Kräften an Bord. Eine Brise drückte das Boot in eine Schräglage, Brecher stürzten aufs Deck. Im Nu waren alle bis auf die Haut durchnässt. Marco zuckte zusammen, als das Wasser ihn traf, und rutschte von der Reling fort zur Mitte des Bootes, das sich wieder aufzurichten begann.
Paolo öffnete den Knoten am offenen Ende des Netzes, und der Inhalt ergoss sich in die wassergefüllten Holzfächer an Deck. Die Beute fiel deprimierend gering aus. Von einer Handvoll Goldbrassen abgesehen, hatte sich kaum etwas in den Maschen verfangen. Sie hätten doch besser in der Lagune bleiben sollen, statt aufs offene Meer hinauszufahren.
Vincenzo ließ sich seine Enttäuschung nicht anmerken. »Falls das Wetter sich beruhigt, fahren wir später noch mal raus«, sagte er. »Jetzt sollten wir zusehen, das Boot in Sicherheit zu bringen.«
Marco kümmerte sich um den Fang, sortierte die Fische, die sich seinen Händen zu entwinden suchten, und warf den Beifang zurück ins Meer, während Paolo und Ambrogio das Netz ausspülten und so an die Bordwand legten, dass es beim nächsten Mal leicht ausgeworfen werden konnte. Viel war nicht zu tun. Die zappelnden Fische füllten die Holzfächer nicht mal zu einem Viertel. Trotz der Schmerzen war Marco im Nu mit seiner Arbeit fertig. Es tat ihm leid, dass Vincenzo mit nahezu leeren Händen heimkehren musste. Vor allem, weil er es hätte ändern können. Früher hatte er manchmal nachgeholfen. Früher … Aber darüber wollte er nicht nachdenken.
Unwillkürlich glitt sein Blick zum Himmel. Die Wolken verhielten sich mehr als seltsam. Obwohl sie in ständiger Bewegung waren, sich gegeneinander, umeinander, ineinander drehten, blieben sie innerhalb der Grenzen der Lagune und überschritten nirgends die Einfahrten zur Adria. Über dem Meer gab es ebenfalls dunkle Wolken, aber hier sah der Himmel längst nicht so bedrohlich aus wie über Venedig. Nein, das war kein gewöhnlicher Sturm. Marco wusste, wie sich die Bora anfühlte, die kalte, schwere Luft, die über die dalmatinischen und albanischen Küstengebirge floss und wie ein Wasserfall in die Tiefe stürzte. Das hier war anders. Sosehr die Venezianer die Bora auch fürchteten – verglichen mit dem, was da auf sie zukam, war sie nichts als eine sanfte Brise.
Immer öfter flog Gischt über das Deck des Bootes und traf Marco im Gesicht. Er schmeckte etwas Salziges und spuckte aus. Unter sich spürte er Fischschwärme: Goldbrassen, Aale, Makrelen. Sie huschten aufgeregt durcheinander, einige schwebten reglos am Meeresgrund und verhielten sich still, als wollten sie sich verstecken. Ein Teil von ihm wollte sie rufen und in die Netze locken – früher hatte er manchmal mit dem Wasser auch die Fische darin erreicht, sogar Quallen und Algen –, aber er unterdrückte den Impuls. Das ging ihn alles nichts mehr an. Er schnappte sich einen Besen und fing an, das Deck zu schrubben, damit die Besatzung auf den glitschigen Planken nicht ausrutschte.
Schäumen, fliegen, sang etwas in seinem Blut, schwoll an und schlug wie eine Welle über ihm zusammen.
Marco polterte absichtlich und stieß den Besen mit viel Lärm auf. Als das nichts half, als das Wispern in ihm stärker wurde, fing er an zu singen, laut und falsch, während er gegen den Besen trat.
»Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der singt und dabei kein bisschen fröhlich ist«, sagte Vincenzo.
Vielleicht. Aber der Gesang übertönte immerhin die Stimme des Meeres.
Sie näherten sich dem Porto di Lido und hatten Mühe, das Boot auf Kurs zu halten. In der Einfahrt, im Einflussbereich der Lagune, bockte das Wasser und bäumte sich auf. Unrat strömte ihnen entgegen, achtlos in die Kanäle geworfene Abfälle, die nun aufs offene Meer hinaustrieben. Die Bricole, die Pfähle, die die Fahrtrinnen markierten, waren im Sturm kaum auszumachen. Vincenzo musste all sein Können einsetzen, um zu verhindern, dass das Boot auflief. Die Untiefen um Venedig konnten tückisch sein. Die Flüsse aus den Bergen brachten Sand und Ablagerungen mit sich, die durch Strömungen im Meer zurückgespült wurden, und diese gegenläufigen Bewegungen sorgten dafür, dass sich Rückstände am Boden absetzten und die Durchfahrten verschlammten. So waren einst die Lidi entstanden, Sandbänke, die die Lagune vom Meer trennten.
Doch es war nicht das Wasser, das Marcos Aufmerksamkeit beanspruchte. Mit offenem Mund starrte er nach oben. Der Himmel war in Aufruhr. Die Wolken, schwarz und schwer, hingen über der Lagune, als wollten sie sich jeden Moment auf sie stürzen. Blitze zuckten herab, ohne von Donner begleitet zu werden. Wie ein Raubtier, das erwacht, dachte er.
Ein Warnschrei riss ihn aus der Erstarrung. Von rechts näherte sich der Bucintoro, die Staatsbarke des Dogen, eine prunkvoll ausgestattete Galeere, die eigentlich nur zu zeremoniellen Gelegenheiten benutzt wurde und hier draußen nichts zu suchen hatte. Die Fischer waren so damit beschäftigt gewesen, ein Kentern zu verhindern, dass sie die drohende Gefahr zu spät bemerkten. Denn statt zu warten, bis das Fischerboot den Mund von San Nicoló passiert hatte, hielt der Bucintoro rücksichtslos auf die Einfahrt zu. Vincenzo winkte verzweifelt, doch der Mann am Bug, der seine Leute anbrüllte und die Befehlsgewalt zu haben schien, sah über ihn hinweg, als wäre er nicht vorhanden. Marco erkannte ihn: Giacomo Querini, der Sohn des Dogen.
Unaufhaltsam näherte sich der Bucintoro. In der aufgewühlten Einfahrt gab es kaum Platz zum Manövrieren, jeden Augenblick würden sie gerammt werden. Die Fischer brüllten durcheinander, Marco klammerte sich am Heck des Bootes fest.
Vincenzo riss das Ruder herum und steuerte an einer Bricola vorbei aus der Fahrrinne. Wieder brüllten die Fischer: Unmöglich, zwischen den Sandbänken hindurchzunavigieren, nicht bei diesen haushohen Wellen, die ohne erkennbare Ordnung bald in diese, bald in jene Richtung schlugen. Marco sandte ein Stoßgebet zum Heiligen Markus, dessen Schutzsiegel die Stadt seit Jahrhunderten vor Katastrophen bewahrten.
Die Barke des Dogen schrammte an ihrer Seitenwand entlang, ein Ruck ging durch das Boot. Gischt spritzte über die Reling. Ein knirschendes Geräusch übertönte den Sturm, als sie über Sand schleiften. Marco schrie. Dann – waren sie über die Sandbank hinweg in der Lagune.
Die Fischer stießen Verwünschungen gegen den Bucintoro aus, der sich zügig Richtung San Marco entfernte. Offen die Faust zu schütteln, wagten sie nicht. Vincenzo wischte sich den Schweiß von der Stirn. Die anderen klopften ihm anerkennend auf die Schultern, Erleichterung im Gesicht.
In der Lagune schlugen die Wellen längst nicht so hoch wie an der Stelle, an der die Ausläufer der Wetterfront über Venedig mit den Wolken über der Adria zusammenprallten. Zudem klarte der Himmel auf. Die ersten Wolken begannen, sich aufzulösen. Nur das Wasser war braun und brackig vom aufgewirbelten Schlamm.
Vincenzo steuerte Cannaregio an, nicht durch den Canal Grande, sondern von der offenen Lagune her. Obwohl der Wind schlagartig nachließ, war der Himmel binnen Kurzem wie leer gefegt, als habe es nie auch nur das kleinste Wölkchen gegeben. Die Dächer der Häuser glitzerten in der Sonne.
»Das gefällt mir nicht«, murmelte Ambrogio.
»Ganz und gar nicht«, pflichtete Vincenzo ihm bei.
Auch Marco fühlte, dass etwas nicht stimmte. Eine unnatürliche Stille hing über der Stadt. Die Luft war bleischwer. Weder Fische noch Katzen noch Vögel ließen sich blicken, und ein Hund, der sich in einem an Land gezogenen Ruderboot versteckte, jaulte zum Gotterbarmen.
»Der Wasserspiegel sinkt«, stellte Ambrogio fest.
Tatsächlich: Die Bricole ragten weiter heraus als üblich.
»Für die Ebbe ist es noch zu früh.«
Das Wasser fiel so schnell, dass man dabei zusehen konnte. Eben noch waren die Spitzen der Bricole unter Wellenbergen kaum zu sehen gewesen, jetzt schimmerte hier und da bereits der Boden der Lagune hindurch.
Vincenzo beeilte sich, sein Boot in den Rio de la Misericordia zu bringen. Ein-, zweimal schürfte es über Grund, dann erreichten sie den Liegeplatz vor dem Haus des Fischers. Auch andere Boote bemühten sich, eine sichere Anlegestelle zu finden. Bunte Gondeln und Sandoli schnellten hierhin und dorthin und konnten einander oft nur mit Mühe ausweichen, Lastkähne mit Baumaterial schaukelten zwischen ihnen. Vincenzo band sein Boot an einer Palina fest, einem mit farbigen Streifen verzierten Pfahl. Marco und die anderen stiegen aus. Ohne sich abgesprochen zu haben, gingen sie die Fondamenta entlang, bis sie freien Blick auf die Lagune hatten. Hunderte anderer taten es ihnen gleich und säumten die Uferränder. Schweigend.
Nach kurzer Zeit schon gab das Wasser schlammigen Grund frei. Marco konnte sich nicht erinnern, je eine so rasch einsetzende Ebbe gesehen zu haben. Nicht einmal, wenn der Maestrale blies. Schon gar nicht bei Windstille.
Einige Boote hatten es nicht geschafft, rechtzeitig einen Ankerplatz zu finden, und waren gestrandet. Hier und da stiegen Seeleute aus, nur um knietief im Schlick zu versinken. Einer der Lastkähne hatte Schlagseite bekommen und war mitsamt seiner Ladung aus Steinen umgekippt. Die Ebbe gab achtlos fortgeworfene Abfälle frei, Essensreste, Eimer mit eingetrockneter Farbe, Putzlumpen. Fische zappelten im Schlamm und verendeten.
Es war ungewöhnlich ruhig. Niemand schimpfte, niemand machte seinen angestauten Gefühlen Luft. Die Stadt hielt den Atem an. Die Leute warteten, ohne zu wissen worauf. Alle schienen von derselben Ahnung ergriffen wie Marco, der Ahnung, dass die leeren Kanäle noch nicht das Ende waren, sondern Vorboten von etwas Schlimmerem.
2
Eine Gasse ist eine Gasse, überall auf der Welt, außer in Venedig. In Venedig ist sie eine Herausforderung, ein Geheimnis, ein Versprechen. Sie lockt, sie kokettiert, sie spielt mit der Erwartung des Ortsunkundigen. Sie zeigt sich mal prächtig und breit, mal unscheinbar und schmal, und bis zum letzten Schritt weiß man nicht, wohin sie einen führt. Prunkvolle Fassaden und großzügige Bauweise halten einen zum Besten und säumen doch nur einen Weg, der nach endlosen Windungen unwiderruflich an einer Mauer endet. Schmucklosigkeit und Enge gaukeln einem eine Sackgasse vor, doch gerade, wenn man denkt: Hier ist die Welt zu Ende, öffnet sich unerwartet ein Durchgang zur Rechten, und man stellt fest, dass die Gasse Teil einer pulsierenden Hauptverbindungsader der Stadt ist.
Verstärkt wird die Verwirrung durch eine unsichtbare Strömung, die von Zeit zu Zeit Gebäude mit sich reißt, um sie in einem anderen Stadtteil wieder an Land zu spülen wie Strandgut. Die meisten Häuser stehen fest an ihrem Platz, aber da, wo die Kraftlinien der Lagune aufeinandertreffen, ist Venedig in ständiger Bewegung. Die Venezianer haben sich daran gewöhnt. Sie finden ihr Ziel instinktiv, indem sie sich von der Strömung führen lassen und nicht gegen den Wirrwarr ankämpfen. Einige befestigen ihre Wohnungen mit magischen Ankern, aber das hilft nur gegen schwache Strudel. Und überhaupt: So ist nun mal das Leben, man kann nichts daran ändern. Die Lagune hat ihre eigenen Gesetze, nicht wahr?
Für Marco war das fließende Stadtbild einer der Gründe, weshalb er Venedig liebte. Nie wurde es ihm langweilig, durch die Gassen zu streifen, immer gab es etwas Neues zu entdecken, jeder Winkel wartete mit einer Überraschung auf. Seine vielfältigen Arbeiten brachten es mit sich, dass er sich in der Stadt besser auskannte als so mancher Erwachsene. Manchmal musste er im Salzlager an der Punta de la Dogana Säcke schleppen, manchmal ging er den Arbeitern beim Anlanden der Holzflöße zur Hand und half dann hinter der Kirche San Zanipolo beim Lagern. Oder er wurde auf der Werft im Arsenal eingesetzt. Seine Aufgaben führten ihn durch sämtliche Bezirke Venedigs, dadurch kannte er jede Gasse. Und eine dieser Gassen, irgendwo in der Stadt, barg die Lösung für das Rätsel um seinen verschwundenen Vater. Wenn er nur lange genug suchte, würde sie ihm eines Tages ihr Geheimnis offenbaren, er durfte sich nur nicht durch Fehlschläge entmutigen lassen.
Auf dem Campo Ruga, unweit der Isola di San Pietro, war sein Vater zuletzt gesehen worden. Am Brunnen hatte er angehalten, um seinen Mantel wegen der Kälte fester zu schließen und sich zu schnäuzen. Der alte Ambrogio Cocchi, der unter Schlafstörungen litt und deshalb ausgedehnte Nachtwanderungen unternahm, wechselte ein paar Worte mit ihm. Seither war Matteo Manardi spurlos verschwunden.
Marco hockte sich nieder und studierte die schmutzigen Pflastersteine, als könne er ihnen dadurch eine Information abtrotzen, die er bisher übersehen hatte. Doch der Platz blieb stumm, wie jedes Mal. Welchen Weg hatte sein Vater von hier aus eingeschlagen? Am Arsenal entlang zur Fondamenta de la Tana, in der ein entfernter Vetter von Tante Lucia wohnte? Über die Brücke zur Isola di San Pietro? Oder war er nach Sant’ Elena gegangen?
Marco bahnte sich einen Weg durch die knöcheltiefe Schicht aus Kot und Unrat, die den Boden der Salizada Streta bedeckte, und wünschte sich nicht zum ersten Mal, er trüge Trippen unter seinen Stiefeln, Stelzschuhe, wie die vornehmen Damen sie benutzten. Er betrat die hintere Brücke zur Isola di San Pietro, und blickte auf die Lagune hinaus, die nun wasserlos vor sich hinrottete. Nichts als Sandbänke und langsam trocknender Schlamm, bis zum Horizont. Ein erschreckendes Bild, weil es den Zentralnerv der Stadt freilegte und Venedig in seiner ganzen Verletzlichkeit zeigte. Wasser war seine Lebensader. Ohne Wasser war Venedig ein totes Sumpfloch.
Abfälle und verfaulende Fische verstärkten den Eindruck. Überall lagen gestrandete Boote im Morast. Zwei Möwen staksten über den Schlick auf der Suche nach Wattwürmern, aber sie wandten ständig den Kopf, als befürchteten sie Gefahr. Da vorn, an der dritten Bricola, war die Kappe seines Vaters gefunden worden. Sie trieb im Wasser und hatte sich an einem vorstehenden Nagel des Pfahles verfangen. Tod durch Ertrinken, lautete die offizielle Erklärung. Matteo Manardi war kein guter Schwimmer, das war allgemein bekannt. Und die Strömungen in der Lagune konnten tückisch sein. Anscheinend hatte es ein Handgemenge mit den Soldaten gegeben, die ihn verhaften sollten, dabei war er ins Wasser gestürzt. Der für den Bezirk Castello zuständige Herr der Nacht äußerte sich nicht dazu. Onkel Aldo hatte mehrfach bei ihm vorgesprochen, aber keine Antwort erhalten.
Marco schüttelte den Kopf. Sein Vater war nicht ertrunken. Mochten die anderen glauben, was sie wollten, für ihn stand fest, dass er hier irgendwo in der Stadt und am Leben war. Er musste nur gründlich genug suchen, dann würde er ihn auch finden.
Von den Plänen seines Vaters hatte er keine Ahnung gehabt, bis zuletzt nicht, als es mitten in der Nacht an die Tür klopfte. Draußen standen die Soldaten, um ihn abzuholen. Aber Matteo Manardi war nicht zu Hause gewesen. Was er in jener Nacht in Venedig gewollt hatte – Marco wusste es nicht. Vielleicht Lebensmittel organisieren, das Boot für die Flucht nach London, nach Paris oder Amsterdam vorbereiten. Die Geheimnisse der venezianischen Glasbläserkunst waren begehrt, sie wären überall mit offenen Armen aufgenommen worden. Deshalb hatten der Senat und der Rat der Zehn ein wachsames Auge auf ihre kostbarsten Bürger. Murano, die Glasbläserinsel, war nichts anderes als ein goldener Käfig, daran änderten auch die Privilegien der Glasbläser nichts. Und sein Vater hatte es noch nie ertragen, eingesperrt zu sein. Sicher, er liebte Murano, er liebte die Lagune, und solange Marcos Mutter noch am Leben gewesen war, hatte er nie daran gedacht, seine Heimat zu verlassen. Doch nach ihrem Tod war er rastlos geworden.
Was Marco am meisten schmerzte, war die Tatsache, dass die letzten Worte zwischen ihnen Worte des Zorns gewesen waren. Sein Vater konnte ihm Francescas Tod nicht vergeben. Er hatte sich bemüht, o ja. Er erwähnte sie nie in seiner Gegenwart und behandelte ihn nicht anders als seinen Bruder Angelo. Aber manchmal warf er ihm heimliche Blicke zu, die leicht zu deuten waren. Besser du wärst ertrunken statt deine Schwester, sagten sie. Marco machte ihm daraus keinen Vorwurf. Er wünschte es ja selber. Schon deshalb musste er ihn finden. Um ihm zu sagen, dass er mit Freuden für Francesca gestorben wäre. Das sprach ihn nicht frei von Schuld, aber wenigstens musste sein Vater doch verstehen, wie sehr er bereute, je in das unglückselige Haus hinabgestiegen zu sein.
Marco riss sich vom Anblick des Pfahls los. Angelo nannte ihn besessen. Du musst seinen Tod endlich akzeptieren, sagte er immer. Und Onkel Aldo hatte ihm verboten, weitere Nachforschungen anzustellen, weil er fürchtete, dass die Soldaten sonst die ganze Familie holen würden. Deshalb hängte Marco seine Suche nicht mehr an die große Glocke.
In den Gefängnissen des Senats wurde sein Vater nicht festgehalten, das hatte Onkel Aldo überprüft, damals, als alle noch hofften. Onkel Aldo war Schreiber in der Cancelleria Ducale, der Staatskanzlei, mithin nicht ohne Einfluss. Wie er es angestellt hatte, wusste Marco nicht – vielleicht mit Bestechungen –, jedenfalls war es ihm gelungen, einen Blick in jede Gefängniszelle der Stadt und in die Gefangenenbücher zu werfen. Ohne Ergebnis. Auch auf den Galeeren schien sein Vater nicht zu sein. Wo also dann?
Noch einmal warf Marco einen Blick auf den schlammigen Grund des Kanals. Die Lagune ohne Wasser – so etwas war noch nie vorgekommen. Für ihn war es ein Glücksfall. Die Fischer konnten nicht zum Fischen raus, so hatte er den Nachmittag frei, um seine Suche fortzusetzen. Er kehrte zum Campo Ruga zurück, schloss die Augen und stellte sich vor, es wäre November. Mitternacht. Der Vollmond tauchte die Gassen in bläuliches Licht. Es gluckerte, wenn die Lagune gegen das Ufer schlug. Und da war sein Vater, der sich mit einem Scherz von Ambrogio Cocchi verabschiedete und durch die Calle Ruga ging, um … irgendwas zu tun. Marco öffnete die Augen ein wenig, gerade so viel, dass er sehen konnte, wohin er trat, ohne die Vision zu verlieren.
Castello war der größte Stadtteil Venedigs, geprägt vom Werftkomplex des Arsenals und den planmäßig angelegten Arbeitersiedlungen der Umgebung. Hier wohnten die Schiffszimmerleute und Kalfater, die Seiler und Rudermacher. Marco stellte sich vor, wie Matteo Manardi vor ihm herging und am Campiello Correra in die Calle Tiepolo einbog. Achtlos aus den Fenstern geworfene Abfälle lagen in der Gasse und stanken um die Wette, Katzen stöberten darin herum. Weiter in die Seco Marina. Links eine Bäckerei für Schiffszwieback, deren Eingangstür so tief im Boden versunken war, dass Marco das Dach mit ausgestreckter Hand hätte erreichen können. Höchste Zeit, ein neues Stockwerk aufzusetzen. Gegenüber ein Schuhmacher und eine Drechslerwerkstatt, deren Fassaden tiefe Risse aufwiesen, weil die Gebäude unterschiedlich schnell sanken und die gemeinsame Mauer auseinanderbröckelte.
Seufzend öffnete Marco die Augen. Was hätte sein Vater nach Mitternacht bei einem Bäcker für Schiffszwieback oder einem Schuhmacher gewollt? Es hatte keinen Zweck. Wohl hundertmal war er diesem Weg gefolgt, und der einzige Ort, von dem er sich vorstellen konnte, dass sein Vater dorthin gegangen wäre, war das »La Colombina«. Das Wirtshaus gehörte Pasquino Campo, einem Freund seines Vaters, und wenn Matteo Manardi in Castello war, schaute er immer auf eine Ombretta, ein Gläschen Wein, herein.
Seine Beine trugen Marco von selbst zur Fondamenta Sant’ Isepo. Das »La Colombina« befand sich auf der gegenüberliegenden Seite direkt am Kanal. Es hatte erst vorletztes Jahr ein neues Stockwerk bekommen. Das alte schaute noch zu einem Drittel aus dem Boden, und man musste eine Holztreppe benutzen, um in die neuen Wirtsräume zu gelangen. Kein Lärm drang aus dem Inneren, was ungewöhnlich war. Normalerweise grölte immer ein Betrunkener vor sich hin, oder ein paar Seeleute sangen aus voller Kehle Sauflieder, egal zu welcher Tageszeit. Ob Pasquino geschlossen hatte?
Marco stieg die Stufen hinauf und betätigte probehalber den Drücker des Riegels: Es war offen. Er betrat die verräucherte Gaststube. Der Raum war voller Menschen, die sich halblaut unterhielten. Es fehlte das übliche Lachen und Prahlen, anscheinend drückte das unerklärliche Verhalten der Lagune auf die Stimmung.
Pasquino Campo stand hinter dem Schanktisch und spülte Gläser und Krüge. Trotz seines Bauches bewegte er sich flink. Als er Marco entdeckte, winkte er ihm zu. »Buon giorno, Marco.«
»Buon giorno, Signor Campo.« Marco ging zu ihm an den Schanktisch. »Habt Ihr etwas Neues von meinem Vater gehört?«
»Du weißt doch, ich würde dich sofort benachrichtigen, wenn ich etwas wüsste.«
»Eine Bemerkung von einem Eurer Gäste vielleicht?«
»Ich habe sie alle gefragt, glaub mir. Doch leider …« Der Wirt zuckte mit den Schultern. Er schien nicht ärgerlich, dass Marco jede Woche mit den immer gleichen Fragen vorbeikam, sondern stellte ihm unaufgefordert ein Glas verdünnten Wein hin und sagte: »Hier, stärk dich erst mal. Geht aufs Haus.«
»Danke.« Niedergeschlagen setzte sich Marco an einen freistehenden Tisch. Er hatte nicht wirklich damit gerechnet, etwas Neues zu erfahren, das machte die Enttäuschung jedoch nicht erträglicher.
Die Gespräche, die bei seinem Eintreten verstummt waren, setzten wieder ein, ein venezianischer Singsang, angereichert mit griechischen und deutschen, persischen und türkischen Satzfetzen. Die Männer stritten über die Ursache der Ebbe.
»Der Maestrale ist Schuld«, behauptete ein rotgesichtiger Kaufmann, »der macht uns ständig Ärger.«
»Unfug«, widersprach ein Albaner, »das war nie und nimmer ein natürlicher Sturm.«
»Es ist eine Mahnung Gottes. Die Überheblichkeit der Venezianer ist Ihm ein Dorn im Auge.« Der das sagte, war natürlich ein Fremder. Ein Friauler, dem Akzent nach. Er erntete einen Sturm der Entrüstung.
Marco hörte nicht weiter zu. Er sah aus dem Fenster zum Kanal, wo Kinder eine gestrandete Gondel eroberten.
Der Wirt brachte ihm einen Teller Linsen und Brot und zwinkerte ihm zu. »Du siehst halb verhungert aus.« Mit einem feuchten Lappen wischte er über die Tischplatte. »Dein Vater war ein guter Mann«, sagte er, ehe er geschäftig weitereilte.
War. Auch Pasquino Campo glaubte nicht, dass sein Vater noch lebte.
Marco fing langsam an zu essen. Was jetzt? Wo sollte er als Nächstes suchen? Überall war er schon gewesen: im Park, am Canale di San Marco, im Arsenal. Am vielversprechendsten schien ihm die Gegend um den Canale di San Pietro, da, wo die Kappe gefunden wurde. Aber die hatte ihn bisher auch nicht weitergebracht.
Ein merkwürdiges Geräusch riss ihn aus seinen Gedanken. Es musste schon eine Weile an sein Ohr gedrungen sein, ehe es den Weg in sein Gehirn fand. Es kam von draußen und klang, als würde ein Riese verhalten atmen. Dazwischen ächzte und stöhnte es wie auf einer Galeere, wenn der Wind gegen die Masten drückte.
Marco beugte sich aus dem Fenster.
Die Venezianer, die am Kanalufer standen, schauten nach rechts.
Marco folgte ihrem Blick. Was er sah, ließ ihn aufspringen und hinauslaufen.
Dickflüssiger Nebel kroch auf die Stadt zu, nicht gleichmäßig, sondern in Wirbeln, die einem unbegreiflichen Mechanismus zu gehorchen schienen. Er folgte dem Verlauf der Lagune, floss durch die leeren Kanäle und ergoss sich in jeden Seitenarm. Nahezu lautlos überschwemmte er die Ankerplätze, schluckte Schlamm, Bricole, gestrandete Boote, und gewann zusehends an Geschwindigkeit. Wie Wasser strömte er herbei, und im ersten Moment war man versucht zu glauben, das Meer käme zurück, wäre da nicht die unnatürliche Stille gewesen, die das Geschehen begleitete. Der Nebel wand sich durch die Schlingen und Krümmungen der Flussbetten und blieb dabei stets auf Wasserniveau, spülte nur hier und da einen dunklen Schwaden über die Ufer, wie es eine heranrollende Flut getan hätte. Er breitete sich aus wie Wasser, er verhielt sich wie Wasser – aber er war alles andere als das. Wo immer er hinkam, dämpfte er die Geräusche, bis man glaubte zu ertauben. Und er war schwarz, so schwarz wie der Lack von Onkel Aldos Gondel oder der Kadaver eines verrotteten Tieres.
Die anderen Gäste im »La Colombina« waren ebenfalls aus dem Wirtshaus gekommen. Stumm traten sie an den Rand des Ufers und sahen auf die Finsternis hinab, die wie eine ölige Flüssigkeit dahinwogte und nach ihren Füßen leckte.
»Da hol’ mich doch der Teufel«, brach der Friauler das Schweigen.
Ein kleiner Junge, nicht älter als vier oder fünf, näherte sich neugierig der Stelle, an der der Nebel immer wieder über das Ufer schwappte, und streckte seine Hand aus.
»Nicht!« Marco packte seinen Arm und riss ihn zurück. »Nicht anfassen!« Er wusste selbst nicht, was ihm solche Angst einjagte, aber sein Herz raste, als wäre er zu schnell gelaufen.
Erschrocken sah ihn der Junge an.
»Das ist einfach nur Nebel«, meinte der rotgesichtige Kaufmann. Doch er wich trotzdem einen Schritt zurück.
»Hast du schon mal so einen Nebel gesehen?«, fragte der Albaner. »Sieht aus, als wäre er der Hölle entwichen.«
»Ihr habt zu viel Fantasie«, brummte Pasquino Campo und stieß mit dem Fuß nach einer Schwade, die über den Uferrand kroch. Der Dunstschleier teilte sich, umströmte den Stiefel des Wirts, floss wieder zusammen. »Was ist das bloß für ein ekliges Zeug?« Pasquino bückte sich.
»Nicht!«, rief Marco wieder.
Aber da war es schon zu spät. Der Wirt griff nach dem feuchtkalten Dunst, tauchte darin ein, rührte darin herum. »Fühlt sich nach gar nichts an«, sagte er. Er betrachtete seine Hände und wischte sie an seinem Leinenhemd ab. »Gehen wir wieder rein, hier gibt’s nichts zu sehen.«
Er stieg die Stufen zum Wirtshaus hoch, gefolgt von den anderen Gästen. Aber den ganzen Weg über rieb er seine Hände an Hemd und Beinlingen, als ob etwas daran haftete, das er nicht loswurde.
3
Drei Soldi sieben Piccoli für die Maske für Benedetto Ruggieri, elf Piccoli für die Kindermaske für Filippo Latini, achtzehn Soldi vier Piccoli für die mit Blattgold versehene Maske für Signor Donati, rechnete Chiara. Damit konnte ihr Vater die Schulden beim Kerzenmacher und beim Korbflechter bezahlen, und es blieben sogar noch drei Piccoli übrig. Ein Tropfen auf dem heißen Stein. Übermorgen kam wieder eine Lieferung Safran, und Blattgold brauchten sie ebenfalls. Außerdem mussten die Kosten für das längst überfällige neue Stockwerk bedacht werden. Auch wenn die Arbeiten daran auf der Basis gegenseitiger Nachbarschaftshilfe funktionierte, so waren doch die Baumaterialien zu bezahlen: Holz, Tonziegel, Farbe, dazu das Essen für die Helfer, das Einweihungsfest … Und bei alledem waren die Schulden für die neue Gondel – fünfzehn Dukaten, so viel wie ein Arbeiter im Arsenal im ganzen Jahr verdiente – nicht mal berücksichtigt.
Eine Maske hatte sie noch auszutragen. Meister Uccello war allerdings dafür bekannt, dass er gern anschreiben ließ. Vermutlich würde er sich wieder schwerhörig geben, aber das verfing bei ihr nicht. Ohne Bezahlung würde sie nicht gehen, zumal er auf eine aufwändige Krakelierung und einen Besatz mit Edelsteinimitationen bestanden hatte. Wenn er sie vertrösten wollte, würde sie die Maske wieder mitnehmen. Sie mochte vielleicht erst vierzehn sein, aber dumm war sie deswegen noch lange nicht. Auf dem Rückweg konnte sie auch gleich bei Pietro Mosca vorbeischauen, der ihnen für den letzten Auftrag noch zwölf Soldi schuldete. Ihr Vater war einfach zu gutmütig. Immer wieder ließ er sich mit Ausreden hinhalten.
Chiara überquerte die mit Läden und Marktständen gesäumte Rialtobrücke, die einzige Brücke Venedigs mit Geländer. In der Mitte, wo die beiden schrägen Rampen in einer Zugbrücke zusammenliefen, blieb sie stehen und sog die Atmosphäre in sich auf. Sie mochte das Gewimmel, die unaufgeregte Geschäftigkeit, das bunte Treiben. Hier, bei der ehemaligen Insel Rivo Alto liefen alle wichtigen Verkehrsadern zusammen, Kanäle wie Fußwege. Hier, an der schmalsten Stelle des Canal Grande, trafen sich täglich die Kaufleute, tauschten Neuigkeiten über die Preisentwicklung aus und legten den Wechselkurs fest. Großmutter Antonia erzählte oft, wie die Brücke in ihrer Jugend unter dem Gewicht der Menschenmassen eingestürzt war, die den Hochzeitszug des Marchese von Ferrara sehen wollten.
Chiara sprang die Treppenstufen der Brücke herunter und bog in die Mercerie ein, die Geschäftsgassen, die das Handelszentrum Rialto mit dem politischen Zentrum San Marco verbanden. Hier gab es die Tuchhändler und die Pfeilmacher, die Schmiede und die Schwertmacher, die Hersteller von Truhen und Kisten und die Spiegelmacher. Zwei Berittene drängten sich durch die Menge, obwohl das Reiten in diesem Bezirk verboten war. Glöckchen am Zaumzeug ihrer Pferde warnten die Passanten, was allerdings nur dann einen Nutzen gehabt hätte, wenn genug Platz zum Ausweichen vorhanden gewesen wäre.
Die Gerüche der Bäckereien zogen durch die Gassen und machten ihr den Mund wässerig. Wie gern hätte sie etwas Feigen- oder Mandelgebäck gekauft. Aber das kam nicht infrage, sie hatten kein Geld für derartigen Luxus. Obwohl … Ihr Vater hätte sicher nichts dagegen, wenn sie sich für ihre Botengänge einen Krapfen holte. Trotzdem: nein. Wenn sie erwartete, dass ihre Familie sorgfältiger mit Geld umging, musste sie mit gutem Beispiel vorangehen. Chiara ignorierte den verführerischen Geruch nach Honig und Zimt und marschierte zielstrebig über den Campo San Salvador. Wenn sie wieder daheim war, konnte sie eine Scheibe Brot mit Käse und Oliven essen.
Drei Piccoli. Das reichte nicht mal für eine Mahlzeit. Das Gemüse, das Großmutter Antonia ihr beim letzten Besuch mitgegeben hatte, war auch längst aufgebraucht. Chiara blieb auf der Brücke über den Rio di San Salvador stehen und blickte in den Schlamm hinunter. Sie machte sich Sorgen. Wenn das Wasser länger ausblieb … Großmutter Antonia wurde langsam gebrechlich. Das Bücken fiel ihr schwer, ständig klagte sie über Gliederschmerzen. Erst neulich hatte sie sich verhoben und tagelang das Bett hüten müssen. Und sie lebte ganz allein auf ihrer namenlosen Insel. Wenn sie nun verhungerte? Aber nein, ihre Freunde auf Sant’ Erasmo, die sie mit Obst und Gemüse versorgten, würden notfalls durch den Schlick waten, um ihr das Notwendigste zu bringen.
Wie trostlos das leere Kanalbett wirkte! Ohne Wasser glich Venedig einem gestrandeten Wal. Die Lagune war das Herz der Stadt, und wenn das Herz zu schlagen aufhörte, siechte der Rest dahin.
Chiara musste daran denken, wie sie einmal mit Marco in der Dämmerung auf der Fondamente Nove gestanden und ins Wasser geblickt hatte. Es war im Sommer gewesen, sie konnte sich noch an jede Einzelheit erinnern: an die friedliche Stille, den aromatischen Geruch der Rosmarinsträucher, die Feuchtigkeit in der Luft, die ihnen die Kleider an den Leib klebte. Und dann waren Lichter aus der Tiefe aufgetaucht, zwei, drei, immer mehr, bis es Hunderte gewesen sein mussten. Medusen. Sie kamen von der offenen Lagune, Myriaden kleiner Sterne, und brachten das Wasser zum Leuchten: türkis, wo sie sich am dichtesten drängten, allmählich in ultramarin übergehend, bis die Farben mit der Schwärze der Nacht verschmolzen. Auf und ab tanzten die Quallen, knapp unterhalb der Wasseroberfläche, und die Lagune wirkte mit einem Mal so zerbrechlich wie Glas.
Nie zuvor hatte Chiara ein derart ungewöhnliches Verhalten beobachtet. Es lag an Marco, da war sie sicher. Irgendetwas in ihm lockte die Medusen an. Er hatte es halbherzig abgestritten, aber in seinen Augen konnte sie lesen, dass er darum wusste. In seiner Gegenwart geschahen ständig solche Dinge. Fischschwärme, die sich in die Netze der Fischer stürzten, als könnten sie es nicht abwarten, ihr Leben hinzugeben. Wellen, die sich zu Mustern formten. Aber das war vor der Sache mit seiner Schwester gewesen. Jetzt …
Chiara hob den Kopf. Etwas hatte sie aufgeschreckt, ein Geräusch, kaum mehr als ein Raunen. Zu Füßen der Brücke schlängelte sich etwas Dunkles zwischen Steinen und Schlick hindurch, griff mit substanzlosen Händen nach Pfählen und gestrandeten Booten und reckte sich empor, als wolle es nach ihr schnappen. Unwillkürlich trat Chiara einen Schritt zurück. Wie eine Raubkatze kroch ein kalter Nebel heran, bildete Wirbel und Strömungen und füllte den Kanal unaufhaltsam mit etwas Finsterem. Chiara spürte eine Erschütterung, als der Dunst die Bohlen der Brücke berührte – oder bildete sie sich das ein?
Der Nebel überspülte die Stufen der steinernen Treppe, die von einem Bootsanlegeplatz zu einem Haus hinaufführte. Eine Katze, die sich auf dem Absatz gesonnt hatte, wich fauchend zurück und schlug mit der Pfote nach dem Ungreifbaren, bis sie mit dem Rücken gegen die Tür stieß. In die Ecke gedrängt, entblößte sie ihre Fangzähne.
Menschen liefen am Ufer zusammen, aber niemand tuschelte oder debattierte, niemand kommentierte den Vorfall. Hatten eben
noch Gespräche und Zurufe die Gassen dominiert, so herrschte nun eine unnatürliche Stille.
Eine Möwe mit gebrochenem Flügel, die den Schlamm nach Muscheln und anderen Leckerbissen durchstöberte, war vom hereinströmenden Nebel überrascht worden. Mit einem klagenden Schrei hüpfte sie hin und her und bemühte sich, den Wirbeln auszuweichen. Als ihr das nicht gelang, versuchte sie zu fliegen, scheiterte jedoch kläglich und stürzte in den Dunst zurück. Die stummen Zeugen an den Ufern verfolgten, wie sie japste und nach Luft rang, während der Nebel sie einhüllte, mit rauchigen Fingern ihre Kehle streifte und sich in ihren Schnabel drängte. Kreischend taumelte sie auf eine Treppe zu und schleppte sich die Stufen hinauf. Zögernd, beinahe bedauernd ließ der Nebel sie los.
Mit letzter Kraft kroch die Möwe auf die Fondamenta. Und obwohl ihr, soweit man sehen konnte, nichts Schlimmes zugestoßen war, schrie sie ununterbrochen.