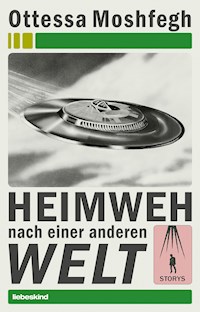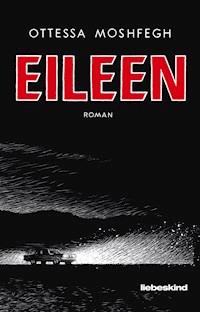Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Lapvona“ – Ottessa Moshfeghs Roman über menschliche Monstrosität, Ungleichheit, Korruption und Tyrannei. „Was für ein grauenvolles Meisterwerk!“ (Theresia Enzensberger)
Es riecht nach Kot und Verwesung, nach Blut, Vieh und Schlamm – das ist Lapvona, der gottverlassenste Ort der Romanwelt. Hier ist niemand vom Glück begünstigt, am wenigsten Marek, der missgestaltete Sohn des Schafhirten. Doch sein Elend birgt auch eine große Kraft: baldige Nähe zu Gott durch Entsagung und Erniedrigung. Als er von Villiam, dem irren Landvogt, aufs Schloss berufen und als neuer Fürstensohn eingeführt wird, glaubt Marek sich zu Höherem erkoren. Denn noch ahnt er nicht, wie grausam nicht nur die Not, sondern auch die Sättigung den Menschen macht. In ihrem neuesten Meisterwerk entwirft Ottessa Moshfegh ein höllisches Panoptikum menschlicher Monstrosität und trifft in der grotesken Darstellung von Ungleichheit, Korruption und Tyrannei den Nerv unserer Zeit erschreckend genau.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
»Lapvona« — Ottessa Moshfeghs Roman über menschliche Monstrosität, Ungleichheit, Korruption und Tyrannei. »Was für ein grauenvolles Meisterwerk!« (Theresia Enzensberger)Es riecht nach Kot und Verwesung, nach Blut, Vieh und Schlamm — das ist Lapvona, der gottverlassenste Ort der Romanwelt. Hier ist niemand vom Glück begünstigt, am wenigsten Marek, der missgestaltete Sohn des Schafhirten. Doch sein Elend birgt auch eine große Kraft: baldige Nähe zu Gott durch Entsagung und Erniedrigung. Als er von Villiam, dem irren Landvogt, aufs Schloss berufen und als neuer Fürstensohn eingeführt wird, glaubt Marek sich zu Höherem erkoren. Denn noch ahnt er nicht, wie grausam nicht nur die Not, sondern auch die Sättigung den Menschen macht. In ihrem neuesten Meisterwerk entwirft Ottessa Moshfegh ein höllisches Panoptikum menschlicher Monstrosität und trifft in der grotesken Darstellung von Ungleichheit, Korruption und Tyrannei den Nerv unserer Zeit erschreckend genau.
Ottessa Moshfegh
LAPVONA
Roman
Aus dem Englischen von Anke Caroline Burger
Hanser Berlin
Für Walter
FRÜHLING
Zu Ostern waren die Räuber wieder da. Dieses Mal töteten sie zwei Männer, drei Frauen und zwei kleine Kinder. Dem Schmied wurde Werkzeug gestohlen, aber kein Gold oder Silber, denn er hatte keins. Die Mutter der erschlagenen Kinder attackierte einen der Eindringlinge — sie spaltete ihm den linken Fuß mit der Axt. Die Nachbarn überwältigten den Räuber und schleppten ihn auf den Marktplatz, wo er verprügelt und an den Pranger gestellt wurde. Bis Einbruch der Nacht bewarfen ihn die Dorfbewohner mit Tierkot und Schlamm. Grigor, der Großvater der toten Kinder, konnte vor lauter Trauer nicht schlafen, also stand er mitten in der Nacht auf, ging mit einem Gartenmesser zum Marktplatz, schnitt dem Räuber das Ohr ab und warf es in einen der üppig blühenden Zitronenbäume. »Sollen es die Vögel fressen!«, schrie Grigor dem blutenden Mann ins Gesicht und humpelte schluchzend davon. Welche Gräueltaten der am Pranger stehende Räuber genau begangen hatte, konnte niemand sagen. Die restlichen Räuber waren geflüchtet und hatten sechs Gänse, vier Ziegen, sechs Käseräder und ein Fass Honig mitgenommen, zusätzlich zum Schmiedewerkzeug.
Lämmer wurden keine gestohlen, da der Lammhirte, Jude, auf einer Weide mehrere Kilometer von der Dorfmitte entfernt lebte und seine Lämmer in dieser Nacht wie immer sicher in ihrem Pferch schliefen. Die Weide lag am Fuß eines Hügels, auf dessen Kuppe Villiam, Lapvonas Fürst und Landvogt, in einem Schloss aus Stein residierte. Villiams Wachen standen bereit, ihn zu verteidigen, sollten je bedrohliche Individuen den Berg erklimmen. Als Jude in jener Nacht wach am Feuer lag, meinte er zwischen den Schreien, die vom Dorf herüberhallten, auch das Sirren der Darmsehnen an den Bögen der Wachen zu hören. Es war kein Zufall, dass Jude und sein Sohn Marek auf der Weide unterhalb des Schlosses lebten. Villiam und Jude waren blutsverwandt, sie hatten einen gemeinsamen Urgroßvater. Jude betrachtete Villiam als seinen Cousin, auch wenn die beiden Männer sich noch nie begegnet waren.
Am Montag ging Marek, dreizehn Jahre alt, ins Dorf, um beim Ausheben der Grube zu helfen, in der die Toten beigesetzt werden sollten. Er wollte behilflich sein, doch als man die Leichen auf dem dichten Gras des Friedhofs aufbahrte und die Männer die Schippen zur Hand nahmen, überlegte er es sich anders. Die Köpfe der Toten waren nur in dünnen Stoff gewickelt. Marek stellte sich vor, ihre Gesichter seien noch lebendig. Als eine sanfte Brise aufkam, sah es aus, als würden die Wimpern den Stoff berühren. Marek sah die Umrisse ihrer Lippen, und sie schienen sich zu bewegen, schienen zu sprechen und ihm zuzuflüstern, er solle sich besser aus dem Staub machen. Die toten Kinder sahen fast niedlich aus, wie steife Holzpuppen. Marek bekreuzigte sich und trat den Rückzug Richtung Dorfstraße an. Die Männer aus dem Dorf brauchten ihn sowieso nicht, sie hoben das Grab mühelos ohne ihn aus. Es scherte niemanden, dass Marek da gewesen und wieder verschwunden war. Für die anderen war er ein streunender Hund, der hin und wieder ins Dorf gelaufen kam. Er war ein Bankert, das wusste jeder.
Marek war klein für sein Alter, missgebildet und verwachsen. Seine Wirbelsäule war in der Mitte so schief, dass die rechte Seite des Brustkorbs aus dem Rumpf herausragte, was dazu führte, dass der rechte Arm halb angewinkelt vor dem Bauch ruhen musste. Der linke Arm hing lose im Schultergelenk. Marek hatte krumme Beine. Auch sein Schädel war missgestaltet, aber den versteckte er unter einer zerlumpten Strickmütze und seinem knallroten Haar, das noch nie gebürstet oder geschnitten worden war. Sein Vater hatte langes, braunes Haar und verurteilte Eitelkeit als Todsünde. In ihrer bescheidenen Hütte auf der Weide gab es keinen Spiegel, für so etwas hätten sie sowieso kein Geld gehabt. Jude war der älteste Junggeselle in Lapvona. Andere Männer nahmen ihre jüngeren Cousinen zur Frau, wenn sie eine brauchten — viele Frauen starben im Kindbett —, oder tauschten in einem Dorf im Norden ein paar Schafe oder Schweine gegen ein großgewachsenes Mädchen und heirateten das.
Jude konnte es nicht ertragen, sein Spiegelbild zu sehen, nicht mal in dem sauberen, eiskalten Bach, der durch das Tal floss, oder im See, in dem er sich ein paar Mal im Jahr badete. Er war außerdem davon überzeugt, dass Marek sich nicht selbst sehen sollte. Er war froh, dass er einen Sohn hatte und nicht eine Tochter, für die wäre die mangelnde Schönheit noch schlimmer gewesen. Marek war hässlich. Und schwach. Ganz und gar nicht wie Jude, dessen Knochen und Muskeln geschmeidig und glatt wie vom Ozean geschmirgelte Klippen waren, selbst wenn seine Haut dreckig und von Lämmermist verschmiert war. Von seinem Vater erfuhr Marek nicht, dass sein Gesicht unmögliche Proportionen hatte: Auf der hohen Stirn des Jungen traten die Adern stark hervor, er hatte eine krumme Kartoffelnase, dünne Lippen und ein Kinn, das übergangslos in einen runzligen, faltigen Hals mündete, an dem die Haut wie ein Vorhang über Kehle und Adamsapfel hing. »Schönheit ist der Schatten des Teufels«, sagte Jude.
Auf dem Rückweg vom Friedhof kam Marek am Pranger vorbei, wo der blutende, stöhnende Räuber in einer Sprache wehklagte, die er nicht kannte. Marek blieb stehen, um ein Gebet für seine Seele zu sprechen. »Gott, vergib ihm«, sagte er laut, aber der Räuber stöhnte weiter. Marek trat zu ihm. Niemand war in der Nähe. Vielleicht hatte der Gestank des Kots in der warmen Frühlingssonne die Leute vertrieben. Oder die anderen waren alle beim Begräbnis der Toten. Marek sah dem Räuber in die Augen. Sie waren grün, genau wie seine eigenen. Aber es waren grausame Augen, fand Marek. Wenn er noch dichter heranging, würde er vielleicht den Teufel in ihnen erkennen. Als er sich näherte, schrie der Räuber wieder laut auf, als ob ausgerechnet Marek ihm helfen könnte. Selbst wenn der Junge stark genug wäre, um den Stock des Prangers anzuheben und dem Räuber bei der Flucht in den Wald zu helfen, würde er das nicht tun. Gott sah zu.
»Gott vergebe dir«, sagte Marek zu dem Räuber.
Er kam noch näher und wagte es, eine Hand auf den Räuberarm zu legen. Marek sah, dass der Fuß des Mannes gebrochen war und schlaff herunterhing, dass sich ein Knochen durchs Fleisch gebohrt hatte und die Haut gelb und runzelig aussah. Der Atem des Mannes ging schnell und rasselnd. Die Fliegen saßen in Schwärmen auf ihm und ließen sich auch nicht von seinem unverständlichen Geschrei verscheuchen. Marek schloss die Augen und betete, bis der Räuber aufhörte zu heulen. Als er die Augen wieder öffnete, spuckte ihm der Räuber ins Gesicht. Marek wusste, dass er nicht wegzucken durfte, weil das seinen Ekel gezeigt hätte und Gott ihn dafür bestrafen würde. Stattdessen beugte er sich herunter und küsste den Räuber auf den Kopf, dann leckte er sich die Lippen, um den salzigen Schweiß des Mannes zu schmecken und das ranzige Fett, das sein rötliches Haar verklebte. Der Räuber krümmte sich und streckte Marek die Zunge heraus. Der machte einen Knicks, wandte sich ab und ging davon. Er war überzeugt, dass der Räuber jetzt nicht mehr vor Schmerzen oder schlechter Laune schrie, sondern im Rausch der Erlösung, auch wenn die Schreie genauso klangen wie vorher.
Marek verließ den Marktplatz und ging seelenruhig von dannen, ein Kitzeln im linken Arm; es war das Gefühl, gut zu sein. Er hatte sich Gottes Gnade erarbeitet, während das restliche Dorf jetzt für seine Beschimpfungen litt und die Toten zur letzten Ruhe bettete, die, im Gegensatz zu den Lebenden, ihren Frieden gefunden hatten.
Am Dorfausgang kam Marek an Villiams Wachen vorbei, die dort die Straße im Auge behielten. Der Junge lächelte und winkte ihnen zu. Sie beachteten ihn nicht. Die Wachen stammten aus dem Norden, waren groß und stark. Nordmänner waren für ihre kaltherzige Art bekannt. Körperlich waren sie den Einheimischen aus Lapvona überlegen, und stände ihnen der Sinn danach, könnten sie das Dorf in Schutt und Asche legen, Villiams Schloss stürmen und ihn mit einem scharfen Ellbogen ins Herz aus dem Weg räumen. Aber sie waren nach vielen Generationen der Leibeigenschaft so abgerichtet, dass sie Villiams Befehle fraglos befolgten, als gehörten sie ihm. Tatsächlich waren sie sein Eigentum, ebenso wie ihm alle Bediensteten im Schloss gehörten, das ganze Dorf und die Wälder und Bauernhöfe, die im Lehnsgut verstreut lagen. Villiam war der Besitzer von Judes Weideland und der kleinen Hütte, in der Jude und Marek wohnten. Das Weideland war umgeben von Wäldern, die ebenfalls Villiam gehörten.
Als Marek jetzt auf dem Heimweg durch den Wald ging, beschloss er, seinem Vater nicht zu erzählen, dass er den Räuber geküsst hatte. Jude verstand nichts von Vergebung. Vergebung kannte er nicht, nur Trauer und Missgunst. Sein böses Blut war das Einzige, was sein Herz am Schlagen hielt. Das erste große Unglück war ihm schon in seiner Jugend widerfahren — seine Eltern waren bei einem Unwetter im See ertrunken. Sie hatten nach Karpfen geangelt, und ihre kleine Nussschale war im Sturm zerbrochen. Gewitter dieser Art waren so selten, dass Jude überzeugt war, diese Tragödie gelte ihm persönlich, ein Pesthauch des Bösen, der aus der Hölle gekommen war, um ihm seine einzigen Verwandten zu nehmen. Das zweite Unglück war der Verlust von Agata, seiner Frau, Mareks Mutter. Sie war bei Mareks Geburt gestorben, erzählte Jude oft, vor der Feuerstelle auf dem Boden verblutet. Dreizehn Jahre später konnte man den Blutfleck immer noch sehen. »Da, guck, da ist es rot«, sagte Jude und zeigte auf die Stelle, wo der Lehmboden härter zusammengebacken schien. Marek konnte das Blut nicht sehen. »Du bist farbenblind, genau wie deine Mutter«, sagte Jude. »Deswegen.«
»Aber ich sehe doch meine roten Haare«, protestierte Marek.
Bei dem Schlag auf den Mund schnitt sich Marek die Zunge an den eigenen Zähnen auf. Das Blut aus seinem Mund tropfte auf genau die Stelle, wo seine Mutter angeblich gestorben war. Jude zeigte wieder auf den Boden.
»Siehst du’s jetzt? Da, da ist sie von mir gegangen und hat mich mit der Sorge um das Kind alleingelassen.«
Nicht dass Marek viel Sorge abbekommen hätte. Jude nahm ihn nie auf den Arm und tröstete ihn auch nicht. Sobald seine Frau ihn verlassen hatte, reichte er das Kind an Ina weiter, die es tagsüber betreute, während er mit seinen Lämmchen beschäftigt war. Ina war damals die Amme, eine Legende im Ort, eine Frau ohne Mann oder eigene Kinder, deren Brüste das halbe Dorf genährt hatten. Von manchen wurde sie als Hexe bezeichnet, weil sie blind und trotzdem sehr tüchtig war. Und weil sie sich gut mit Heilkräutern auskannte. Sie tauschte Pilze und Nesseln gegen Eier und Brot; die einen sagten, die Pilze bescherten ihnen Visionen von der Hölle, die anderen sagten, die Pilze bescherten ihnen Visionen vom Himmel. Aber ihre Gebrechen wurden geheilt, und zwar zuverlässig — niemand konnte Inas Kenntnis heilkräftiger Pflanzen bestreiten. Sie misstrauten ihrer Begabung, profitierten aber auch von ihrem Wissen. Ina lebte am Talgrund mitten im dunklen Wald, noch hinter Judes Weideland.
Ina war uralt, niemand konnte sich mehr erinnern, wie alt genau, und ihre Milch war mittlerweile versiegt. Aber Marek liebte Ina. Mit dreizehn besuchte er sie immer noch jede Woche. Sie war der einzige Mensch, der ihn streichelte und ihm hin und wieder ein freundliches Wort schenkte. Marek brachte ihr Blumen von der Wiese mit und Lämmermilch und Esskastanien, wenn sie gerade reif waren, und Brot und Käse, wenn sie etwas überhatten.
»Auch mitgegraben?«, fragte Jude, als Marek nach Hause kam. Er tauchte eine Tasse in das Wasserfass und hielt sie dem Jungen hin.
»Die haben mich nicht gebraucht«, erwiderte Marek. »Und ich hatte Angst vor den Toten. Ich hatte Angst, sie könnten noch leben.«
»Das waren gute Menschen, die da gestorben sind«, sagte Jude. »Nur die Bösen stecken in ihrem toten Körper fest. Das ist die ewige Strafe für die, die in der Hölle schmoren. Wer in den Himmel kommt, verschwindet einfach. Da bleibt keine Spur übrig. Wenn man gut ist, bleibt nichts von einem zurück. Wenn man böse ist, ist man ewig in der Erde in seinem verrotteten Körper gefangen.«
»Aber warum waren die guten Menschen dann noch Fleisch und Blut? Warum waren sie noch nicht im Himmel?«
»Sie müssen erst begraben werden. Sobald sie in der Erde sind, verschwinden sie.«
»Woher weißt du das?«, fragte Marek.
»Ich bin dein Vater«, erwiderte Jude. »Ich weiß alles.«
Sie kochten die Lämmermilch und bedeckten den Topf beim Abkühlen mit einem Tuch, damit keine Fliegen hineinfielen. Marek zupfte das Ungeziefer von ein paar Kartoffeln und warf sie zusammen mit Äpfeln zum Rösten ins Feuer. Es waren schrumpelige Äpfel vom vergangenen Herbst. Jude hatte sein Leben lang nichts anderes gegessen als Lämmermilch, Brot, Äpfel, Kartoffeln und wilde Grassamen. Genau wie die anderen Einwohner Lapvonas aß er kein Fleisch. Er trank auch keinen Met, nur Milch und Wasser. Marek aß dasselbe wie Jude, sparte aber immer ein paar Bissen für Gott auf: Er wusste, dass er Ihm mit einem Opfer am meisten Freude machte.
»Tut dir der Kopf weh?«, fragte Marek seinen Vater. Jude rieb sich die Schläfen mit den Fäusten. Er hatte oft Kopfschmerzen. Und Zahnfleischbluten.
»Sei still«, sagte Jude. »Ein Unwetter ist im Anzug, sonst nichts.«
»Regnet es heute Nacht?«
»Es regnet am Mittwoch. Wenn er am Galgen hängt.«
Tatsächlich regnete es am Mittwoch. Vater und Sohn gingen zusammen zum Marktplatz, warmer Frühlingsregen schüttelte die Zitronenblüten und wehte einen Duft unter Judes Kapuze, der schöne Kindheitserinnerungen in ihm wachrief. Er schämte sich dafür, dass er an diesem Tag solche Erinnerungen hatte. Jude hatte den Räuber noch nicht mit eigenen Augen gesehen.
»Sind meine Großeltern wirklich von Räubern umgebracht worden?«, fragte Marek.
»Meine Eltern sind ertrunken. Das weißt du doch.«
»Die Eltern meiner Mutter — haben wirklich die Räuber sie getötet?«
»Das habe ich dir doch schon hundert Mal erzählt«, sagte Jude. Er hatte Marek erzählt, seine Mutter sei mit zwölf Jahren Opfer eines Angriffs auf ihr Heimatdorf gewesen, ein Jahr jünger, als Marek jetzt war. »Erst haben sie deinem Großvater die Kehle durchgeschnitten, dann haben sie deine Großmutter vergewaltigt. Und dann haben sie auch ihr die Kehle durchgeschnitten. Deine Onkel haben sie gefesselt und in einen Brunnen geworfen. Da sind sie ertrunken. Dabei waren sie noch kleine Jungen.«
»Was haben sie mit meiner Mutter gemacht?«
»Sie haben ihr die Zunge rausgeschnitten, damit sie nichts verraten konnte, aber sie ist weggerannt«, antwortete Jude. »Sie konnte von Glück sagen, dass sie entkommen ist. Ich habe sie halb tot im Wald gefunden. Die arme Agata. Warum willst du diese Geschichte immer wieder hören?«
»Weil ich meine Mutter liebe.«
»Sie war ein zähes Mädchen, aber ihr saß der Tod im Nacken. So ist der Tod. Wie ein Bettler, der einen auf der Straße verfolgt. Und dann umbringt.«
»War meine Mutter sehr schön?«
»So eine blöde Frage«, gab Jude zurück. Den Namen und die Geschichte des Mädchens hatte er natürlich frei erfunden. Ohne Zunge hatte sie Jude gar nichts erzählen können — als sie nach Lapvona kam, verstand sie die dortige Sprache kaum. Aber Jude fand, dass er so in der Geschichte als Held wegkam. »Sie war die einzige Überlebende. Kannst du dir vorstellen, wie schuldig sie sich fühlte? Wen juckt da Schönheit?«
»Ich werde mich schuldig fühlen, wenn du stirbst«, sagte Marek zu Jude.
»Braver Junge«, antwortete Jude.
Die Menschen hatten sich auf dem Platz versammelt, und als Jude und Marek ankamen, wurde der Räuber gerade aus dem Pranger geholt. Vater und Sohn stellten sich hinter die dichtgedrängten Dorfbewohner und sahen zu, wie Villiams Wachen dem Räuber die Hände auf dem Rücken fesselten und ihn mit nachschleifenden Beinen über das Kopfsteinpflaster zerrten. Sie schleppten ihn die Stufen hoch auf das Podest unterm Galgen. Die Dorfbewohner unterhielten sich leise miteinander. Ein paar Frauen schnieften, mehrere Männer traten voller Blutdurst ungeduldig von einem Bein aufs andere. Grigor, der alte Mann, stand stoisch vor dem Galgen und betete, dass die Seelen seiner beiden toten Enkelkinder im Himmel Frieden fanden. Die Angehörigen der anderen Erschlagenen warfen dem Räuber Verwünschungen an den Kopf. Dieser Zorn war rechtschaffen. So hatte es ihnen Pater Barnabas, der Priester, erklärt. »Züchtige einen Bösewicht, und Gott erkennt, dass du gut bist.« Marek hielt sich die Ohren zu. Schimpfworte waren ihm zuwider. In der Hinsicht war er zartbesaitet. Selbst Judes Worte trafen ihn mitten ins Herz: »Zur Hölle mit ihm«, sagte Jude.
Der Strick baumelte im warmen Lüftchen, und Villiams Wachen griffen danach und legten ihn dem Räuber um den Hals. Sie brachten einen Hocker herbei, auf den sich der Mann stellen sollte, aber der Räuber konnte nicht mehr stehen. Dazu war er nicht mehr in der Lage. Er bekam keine Kapuze über den Kopf, weil er ein Mörder war. Männer, die für geringere Vergehen aufgeknüpft wurden — Diebstahl oder Vergewaltigung —, bekamen einen Sack über den Kopf. Marek betrachtete den Räuber. Das Blut von seinem abgeschnittenen Ohr hatte ihm das ganze Gesicht verschmiert, sodass nur seine Augäpfel weiß herausleuchteten, als er den Kopf hob und den Blick schamlos in die Menge richtete. Nach mehreren peinlichen Versuchen schafften es Villiams Wachen endlich, ihn auf den Hocker zu wuchten und seine Beine dort festzuhalten. Der Räuber wehrte sich nicht und verfluchte sie auch nicht. Er sagte nur: »Vergebe euch Gott«, fast dieselben Worte, die Marek wenige Tage zuvor zu ihm gesagt hatte. Und dann zogen die Wachen den Hocker weg, und der Mann schwang hin und her. Er baumelte und schaukelte, seine Beine zuckten und buckelten. Dann verkrampfte sich sein ganzer Körper und wurde starr, die Beine streckten sich steif. Und dann hing er still da.
»Ist er jetzt tot?«, fragte Marek.
»Mein Gott, bist du blind?« Jude blickte hinunter zu Marek und sah, dass der Junge sich die Augen mit der Mütze zuhielt. Jude zog sie ihm weg. »Guck doch hin.«
Marek öffnete genau in dem Moment die Augen, in dem einer von Villiams Männern dem Räuber mit einem Schwert den Bauch aufschlitzte, dass das Gedärm herausquoll und nass auf den Boden klatschte. Das Geräusch hallte über die schweigenden Zuschauer. Marek wandte sich ab und versteckte das Gesicht im Pulloverärmel seines Vaters. In der Wolle steckten Grassamen und Kletten und der Geruch von Lämmern. Marek würgte, krümmte sich zusammen und spuckte auf den Boden. Mit seinem Bauch stimmte etwas nicht. Jude nahm ihn am Arm und führte ihn weg von der Menschenmenge.
»Was ist los mit dir?«
»Weiß ich nicht.«
»Tut dir der Räuber leid?«
»Ja.«
»Und warum?«
»Vielleicht hatte er auch einen Sohn.«
»Diesen Räubern ist nichts heilig, nicht mal die eigene Familie. Sie sind die Kinder des Teufels. Vergiss ihn. Der schmort jetzt in der Hölle. Den sollen die Würmer fressen. Wollen wir auf dem Heimweg ein paar Blumen pflücken?«
»Ja.«
Die Blumen waren schüchtern und versonnen. Die Knospen öffneten sich erst zaghaft, denn es war noch früh im Jahr. Am Wegesrand wuchs blutroter Mohn, und Jude pflückte ein paar Stängel, während Villiams Wachen im Gleichschritt auf das Dorf zumarschierten. Jude ignorierte die Männer. Er konnte die aus dem Norden nicht leiden. Er war davon überzeugt, dass sie etwas Böses in sich hatten. Ihr helles Haar sah nie fettig aus, und ihre Haut schien nicht dreckig zu werden. Er traute so sauberen Menschen nicht. Sie verstanden nur die Oberfläche der Dinge, deswegen sahen sie auch so perfekt aus. Für sie waren Judes Schwermut und Leiden nichts als Charakterschwäche, davon war er überzeugt. Sie hatten keinen Respekt vor seinem Tiefsinn. Sie betrachteten ihn und seinen Sohn als dumpfe Tiere, nicht besser als die Lämmer, die sie aufzogen. Die Dorfbewohner schienen den Wachen gleichgültig zu sein. Nicht ein einziges Mal hatten sie das Dorf bei einem Überfall gegen die Räuber verteidigt. Sie zogen sich zurück aufs Schloss und legten dort ihre Bogen an. Sonst unternahmen sie nichts. Memmen, dachte Jude. Er konnte natürlich nicht wissen, dass die Räuber für Villiam arbeiteten. Er bezahlte sie dafür, dass sie das Dorf terrorisierten, wann immer es Gerüchte von Unzufriedenheit unter den Bauern gab. Diese Gerüchte wurden von Pater Barnabas an den Fürsten weitergetragen. Das war seine wichtigste Aufgabe als Dorfpfarrer: sich die Beichte der Leute unten anzuhören und jedes Anzeichen von Unmut oder Faulheit nach oben weiterzugeben. Furcht und Schrecken waren gut für die Moral, glaubte Villiam.
Jude und Marek betraten den Wald, in dem sich Agatas Grab befand. Auf dem Boden lagen Rosskastanien. Die Schweine wurden zur Mast in den Wald geführt, und Marek und Jude hörten es schnauben und quieken. Hinter dem Waldstück standen Apfelbäume, die zu alt waren, um noch Früchte zu tragen. Die silbrige Rinde war dick wie eine Rüstung und bis hoch hinauf mit Narben bedeckt, wo sich über Jahrzehnte hinweg die Dorfbewohner mit einem X verewigt hatten. Hinter dem Apfelgarten wuchs das Gras spärlich, die Erde war hell und voller Steine. Aber da es gerade geregnet hatte, gab der Boden angenehm unter Judes bloßen Füßen und Mareks dünnsohligen Schuhen nach. Marek pflückte eine Handvoll Kamillenblüten und Kornblumen, die an einem Wasserlauf wuchsen, dann lief er vom Pfad weg zu einem Straußenfarn und weiter zu einer Stelle mit wilden Iris. Er pflückte eine Iris und ein paar blühende Freesien. Dann gingen sie auf einen Hain mit Schwarzpappeln zu. Unter dem größten Baum befand sich Agatas Grab.
Beim Gehen war Marek düsterer Stimmung; er war immer noch aufgewühlt von der Szene auf dem Marktplatz. Natürlich hatte er auch früher schon gesehen, wie Räuber aufgehängt und ausgeweidet wurden, aber dieser Mann war anders gewesen. Er hatte keine Angst gezeigt, als Villiams Wachen ihn zum Galgen schleppten. Vielleicht wusste er, wohin er gehen würde. Wie Jesus am Kreuz.
»Der Räuber«, sagte Marek. »Meinst du, der hatte eine Mutter?«
»Eine Mutter hat jeder«, gab Jude zurück.
»Ist die Mutter von dem Räuber traurig, dass er tot ist?«
»Die sind nicht wie wir. Die haben kein Herz.«
»Meinst du, er hatte auch einen Sohn?«
»Na, wenn, dann einen Bankert. Wen kümmert es?«
»Hat meine Mutter mich geliebt?«
»Sie ist für dich gestorben«, sagte Jude. »Das sollte reichen.«
»Sehe ich sie im Himmel wieder?«
»Natürlich. Wenn du reinkommst.«
»Und du?«
»Mach dir keine Sorgen um mich, Marek«, erwiderte Jude.
Aber Marek machte sich große Sorgen darum, dass sein Vater nicht in den Himmel kommen könnte. Er hatte eine ungute Art. Wenn er betete, hatte Marek das Gefühl, dass Zorn wie Dampf von den Schultern seines Vaters aufstieg und die Grausamkeit aus ihm entwich wie eine Wolke. Gottlos war der Mann nicht. Aber seine Frömmigkeit kam in Form eines gewaltsamen Triebes, nicht als Liebe und Frieden, wie sich das gehörte, dachte Marek. Jude kasteite sich jeden Freitag und hatte das auch Marek beigebracht. Aber Marek fand, dass Jude sich ein bisschen zu leidenschaftlich auspeitschte. Schweißbedeckt ächzte er, schlug sich mit der Peitsche erst über die eine Schulter, dann über die andere, zuckte jedes Mal zusammen und atmete so schwer, dass ihm der Speichel aus dem Mund lief, dann sog er ihn wieder ein und spuckte ihn mit einer Inbrunst wieder aus, als würde ihm das Ganze Freude bereiten, als fühlte sich der Schmerz gut an. Das machte Marek Angst, weil auch er Freude an Schmerzen empfand, und dafür schämte er sich. Ein aufgeschlagenes Knie oder die Peitsche auf dem Rücken, alles, was ihm Schmerzen bereitete, erschien ihm seit frühester Kindheit wie Gottes Hand auf seinem Körper. Er wusste, dass sich das nicht gehörte. Deswegen hielt er es geheim, und dass sein Vater Schmerz und Lust so schamlos zur Schau stellte, kam ihm umso perverser vor. Alles, was Marek zu diesem Zeitpunkt wollte, war in den Himmel zu kommen, wo Gott und seine Mutter auf ihn warteten, die ihn liebten.
»Aber was, wenn etwas schiefgeht?«, fragte er Jude. »Was ist, wenn du es nicht in den Himmel schaffst?«
»So Gott will, schaffe ich es.«
Auf Agatas Grab lag ein einfacher, runder Stein aus dem Bach. Jude hatte eine brutale Kerbe in den Stein gemeißelt, als habe ihm der Tod des Mädchens wirklich das Herz gebrochen. Wie der Rest von Lapvona war auch Jude Analphabet, aber er behauptete, die Kerbe im Stein habe eine Bedeutung.
Normalerweise legte Marek sich quer auf das Grab seiner Mutter, als sei er das Kind und sie könne es von unten in ihren toten Armen halten. Auf diesem Stück Erde hatte er immer ein Gefühl von Heimat empfunden. Er lag auf dem Boden, blickte hinauf in die schwankenden Zweige der Pappel und lauschte dem Vogelgesang. Manchmal zwitscherte ein Bienenfresser oder ein Pirol eine zufriedene Weise. Das war für Marek seine Mutter, die im Himmel für ihn sang. Als er jetzt neben dem Grab stand, hörte er eine Elster. Sie kreischte ärgerlich, und es klang wie das heisere Gezeter einer alten Frau, die ihn vom Fenster herunter ausschimpfte.
»Warum legst du dich nicht auf die Erde?«, fragte Jude und legte die Blumen vor dem Stein mit der Kerbe nieder.
»Heute nicht. Die Vögel singen so traurig.«
Jude glaubte nicht an Vogelgesang. Er traute den Vögeln nicht. Sie hatten nichts mit der Erde zu schaffen, und er war ein Mann der Erde. Er liebte seine Lämmer, weil sie so waren wie er. Sie fühlten sich wohl auf der Weide, folgten den Linien der sonnengezeichneten Schatten, wenn sie es kühl haben wollten, oder der Sonne, wenn sie Wärme suchten, je nach Wind. Jude war genauso. Dem Tag mit seinem Verlauf von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zu folgen, war seine Pflicht und die Lämmeraufzucht seine gottgegebene Berufung. Auf die Kirchenglocken hörte er nicht. Die Uhrzeit spielte für ihn keine Rolle. Die Natur sagte ihm, wie spät es war. Er war auf diesem Weideland zur Welt gekommen, und dort würde er wahrscheinlich auch sterben. Warum hatte er Agata nicht auf der Weide beigesetzt, hatte Marek ein paar Mal gefragt. Jude hatte es nie in Betracht gezogen.
»Na, dann lass uns gehen«, sagte Jude und hatte sich schon wieder abgewandt.
Der Trampelpfad, den sie von Agatas Grab durch den Wald zur Weide gebahnt hatten, war schmal, weil Jude und Marek nie nebeneinandergingen. Jude lief immer vorneweg. Marek kannte den Rücken seines Vaters in- und auswendig. Judes Füße landeten gerade auf dem Boden. Marek lief wie eine Ente, mit den Zehen nach außen, und wenn er nicht aufpasste, ging er nicht geradeaus, sondern mit einem Rechtsdrall, so unnatürlich war sein Körper verdreht. Judes Knöchel waren in bester Ordnung, die Fußgelenke glatt und ordentlich verschraubt, und das Schienbein unterhalb der Wade schmal wie ein Handgelenk. Mareks Fußgelenke waren geschwollen und von Sommersprossen übersät, von Disteln zerkratzt, aufgeschürft und blutig. Seine Haut war zart und empfindlich. Ina rieb ihm ab und an Salbe auf die Füße, damit die Haut nicht in toten Schuppen abfiel. »Du bist wie eine Schlange«, sagte sie zu Marek. Judes Waden waren rund und stramm und braungebrannt, und die Sehnen in seinen Kniekehlen waren fein gespannt wie Bogensehnen. Der Rest seiner Beine wurde von einer Hose bedeckt, die zwischen den Beinen und am Hosenboden geflickt war. Sein Hinterteil war stark und stramm. Marek wusste, dass der Körper seines Vaters schön war. Aber er verehrte ihn nicht dafür. Er hatte einfach Respekt vor Judes Aussehen, für ihn war es Teil der Natur, so wie er auch einen Geier schön fand, oder eine Kuh. Er wusste, dass er seinem Vater nicht ähnelte. Man konnte einen Kiebitz nicht mit einem Huhn vergleichen. Das eine Federvieh hatte mit dem anderen nichts gemein. Niemand, der die zwei zusammen sah, wäre auf die Idee gekommen, sie könnten blutsverwandt sein.
Jude hatte schmale Hüften, seine Schultern waren breit, sein Rücken war lang, aber trotz dieser Statur reuevoll gebeugt. Er ging mit gesenktem Kopf. Diese Haltung rührte daher, dass er seit so vielen Jahren auf seine Lämmer hinunterblickte. Manchmal betrachtete Marek ihn voller Bewunderung, diesen harten, schwieligen Mann, der ihm ein Dach über dem Kopf schenkte und ihn, den Sohn, im Bild des Vaters erzog. Aber manchmal fand Marek auch, dass sein Vater im Schatten der Sünde lebte. Marek tat so, als würde er schlafen, wenn Jude unter der muffigen Wolldecke Hand an sich legte, immer zu Neumond, im Winter vor dem Feuer und im Frühjahr unter dem offenen Fenster. Im Sommer und in milden Herbstnächten schliefen Vater und Sohn unter den Sternen bei den Lämmern, um die Wölfe fernzuhalten, sagte Jude zumindest. Aber Marek wusste, dass Jude die warme Nachtluft auf seiner Haut liebte, die sich anfühlte, als würde Gott ihn mit jeder Brise streicheln. Wenn Jude nachts Hand an sich legte, gab er ein tiefes Stöhnen von sich, das mit so viel Grauen, so viel Pein erfüllt war, dass nur der Teufel dahinterstecken konnte, dachte Marek. Nach dem Gestöhne versteifte sich Judes Körper, dann schüttelte es ihn, und Marek kam es vor, als unterziehe sich sein Vater einer rituellen Reinigung, als wolle er etwas Böses aus seinem Körper ausstoßen. Marek gab nie zu erkennen, dass er das über Jude wusste, aber er wusste es. Und das war ein weiteres Hindernis, glaubte er zumindest, auf dem Weg seines Vaters in den Himmel.
Als sie jetzt den Wald betraten, schien sich der Himmel zu verdunkeln. Unter den Bäumen war es kalt, kein warmes Lüftchen wehte, doch die Erde roch süß und modrig reif. Jude mochte das Frühjahr lieber als den Winter. Er liebte die bunten Farben und die Romantik des Frühlings. Er liebte die Sonne. Wenn Jude nachmittags dasaß und seine Lämmchen beobachtete, wenn er sein Gesicht ins Licht drehte, kein Schatten weit und breit, dann fühlte er sich jedes Mal von Gott geküsst. Das war Gott für ihn — der Kuss der Sonne. Gottes Hand auf seiner bloßen Haut war die eine Sicherheit, die sich aus der Abstraktheit von Wahrheit und Gedanken, überhaupt allem, erhob und Jude das Gefühl gab, einen Platz auf der Erde zu haben. Er liebte das Gras zwischen den Zehen und das weiche Fell der Lämmchen, wenn es sein Bein streifte. Er liebte das Wunder und das Licht in den runden Augen seiner Kleinen, wenn sie ihn in ihrem ersten Frühjahr anlächelten. Er liebte die Nachgiebigkeit ihrer Gelenke, wenn sie herumsprangen und schnüffelten und das süße Gras kauten, wie sich ihre Öhrchen beim ersten Gezwitscher der Meisen und Mauersegler auf deren Zug nach Norden aufrichteten. Judes Herde war hornlos und blütenweiß. Die Lämmer waren besonders sanftmütig und blieben eine Saison länger Lämmchen als Schafe anderer Rassen. Sogar ihre Milchzähne waren runder und flacher. Aber sie waren Kurzhaarschafe. Man konnte sie nicht scheren. Sie taugten nur für Fleisch. Und deswegen behielt Jude von seinen Lämmern jedes Jahr nur ein paar für die Zucht, die anderen wurden zum Schlachten verkauft. Das war das Opfer, das er brachte, genau wie sein Vater vor ihm und dessen Vater davor. Jedes Frühjahr nach dem Verkauf seiner Herde versuchte Jude vergeblich, die Tränen zurückzuhalten, bis er wieder allein auf der Weide mit seinen übrig gebliebenen Tieren war — von denen die meisten natürlich im Jahr darauf auf den Markt gebracht wurden.
Die zur Zucht verbleibenden Lämmer trauerten ebenfalls. Jude konnte ihnen nicht in die Augen sehen. Er hatte schreckliche Schuldgefühle, weil er ihre Brüder und Schwestern in den Tod geschickt hatte. Doch statt sie um Vergebung zu bitten, behandelte er die noch vorhandenen Tiere grausam, tat so, als habe er sie vergessen, wenn sie von der Weide kamen, brüllte sie an, sie sollten schneller machen, als wären sie unerwünschte Überbleibsel einer Zeit, die er gern vergessen hätte. Aber er brauchte diese jungen Schafe, damit es im Revier weiterhin Nachwuchs gab. Das Weideland war nicht eingezäunt. Einen Hirtenhund hatte er auch nicht. Er verstand die Rhythmen, in denen die Lämmer grasten und tranken, und dass sie tagsüber lieber im Schatten der Hütte schliefen, nachts aber unter freiem Himmel. Die Lämmer, die Jude jetzt hatte, waren erst sechs Wochen alt. Seit dem Herbst hatte er zugesehen, wie die Bäuche der Mutterschafe dicker wurden. Als die Wiese im Winter brachlag, hatte er sie von Hand mit Heu gefüttert und sich bei ihnen entschuldigt. »Es tut mir leid, dass ich heute kein frisches Gras und keine Kräuter für euch habe.« Er half bei den Geburten im Verschlag; so lange durfte Marek nichts sagen. »Sie mögen deine Stimme nicht«, sagte er, womit er recht hatte. Die Mutterschafe blökten und schnaubten und grunzten, wenn Marek in der Nähe war. Die Schafe verstanden Judes Meinung nach, dass Marek selbst ein Lämmchen war und ihnen bei der ersten Gelegenheit die Milch stehlen würde, dass er alles Mütterliche aus ihnen heraussaugen würde, weil er so danach hungerte. »Bleib bloß weg«, riefen sie. »Mäh.«
Wenn Jude nicht hinsah, trank Marek wirklich an den Schafzitzen. Er schob die Jungtiere zur Seite, nahm die Zitze in den Mund und saugte, bis ihm übel wurde. Als Kind Gottes war das sein gutes Recht, fand er. Er war auch ein Lamm. Seine Demut hatte nichts mit Schwäche zu tun. Er war ein sanftmütiger Diener Gottes. Und als sanftmütiger Diener Gottes gehörte ihm diese Schafsmilch. Man konnte für alles eine Erklärung finden, wenn man nur lange genug darüber nachdachte. Als Vater und Sohn jetzt durch den Wald zur Weide zurückgingen, wuchs Judes Sorge ob der vielen Fußabdrücke, die er auf dem Weg sah. Er konnte nur hoffen, dass sie nicht vom Steuereintreiber stammten. Er hatte schon alles gezahlt, was ihm in diesem Frühjahr möglich war. Zahlte er mehr, würden er und sein Sohn hungern.
Im Gegensatz zu seinem Vater hatte Marek den Winter lieber als den Frühling. Er mochte die Kälte. Er war davon überzeugt, dass Gottes Liebe im Kaminfeuer brannte. Er mochte diese warme Freundlichkeit, er liebte den Geruch von Rauch. Er mochte den nassen Rotz auf seiner Oberlippe, wie er sich da verkrustete und auf der Haut klebte und brannte, wenn er den Mund zum Lächeln verzog. Er mochte den Schnee auf den Tannenzweigen und das Aussehen der Wolken, wie ein Vorhang, den man beiseiteziehen konnte. Einen wolkenlosen blauen Himmel fand er schwierig. Für Marek war er dann leer, ein Ort, an dem Gott nicht wohnte. Ihm waren die Wolken lieber, weil er sich vorstellen konnte, dass dahinter das Paradies lag. Er konnte ewig in den Himmel schauen, die Formen der Wolken betrachten, darüber nachsinnen, ob das Gottes Gesicht war oder ob Gottes Hand das so geformt hatte oder ob Gott vielleicht hinter der Nebelwand saß und auf ihn hinunterstarrte. Man konnte es nie wissen. Der dicke Umhang, den er im Winter trug, war angenehm schwer. So wie Jude den Biss der Peitsche liebte, so liebte Marek die Grausamkeit der Kälte. Er litt, er ertrug sie und sammelte dabei Punkte für Ergebenheit und Gottesfurcht. Ohne den grausamen Wind gab es keine Notwendigkeit für das schützende Herdfeuer oder ein Stoßgebet, das beantwortet werden konnte. Die Öllampe brannte, ohne zu flackern. Ihre Flamme war weiblich, fürsorglich, wie ein Geist, der über die Zeit gebietet. Das Feuer in der Feuerstelle war männlich, stark und wild. Marek zitterte nie vor Kälte. Er fühlte sich sogar wohler in der eisigen Luft, als könne er schärfer sehen, besser hören, alles war rein und weiß im Schnee und in der kristallklaren Luft.
Jude fand die stachligen Schatten der Bäume auf dem Schnee bedrohlich, er glaubte, dass die Kälte das Böse einlud, dass jeder Atemzug ein Gespenst freiließ. Weil im Winter alles starb. Es gab keine Blumen, keine Früchte, keine Blätter an den Bäumen. Im Sommer konnte Jude sich entspannen. Er lief mit freiem Oberkörper übers Feld, seine Haut wurde braun und straff, sein Haar hell. Im Winter fühlte er sich in seinem Mantel über den vielen Wollschichten beengt und wechselte die lange Unterwäsche nie, weil er die Kälte nicht am nackten Körper spüren wollte. Marek war im Februar auf die Welt gekommen. Natürlich begingen Vater und Sohn den Tag nicht als Mareks Geburtstag, sondern als Agatas Todestag. Agatas Abwesenheit kreiste über ihnen wie ein großer Vogel. Für Marek war es, als sei der Vogel gerade außer Reichweite; wenn er nur ein bisschen näher käme, könnte er ihn am Fuß packen, und der Vogel würde wegfliegen und Marek an einen besseren Ort bringen. Jude hingegen war der Vogel zu nahe. Wenn er zu ihm aufschaute, würde er ihm die Augen aushacken. Der Unterschied bestand darin, dass Jude Agata gekannt hatte. Und er kannte die wahren Gründe für ihr Verschwinden. Marek wusste nur, dass sie ihr Leben für ihren Sohn geopfert hatte, so wie es jede gute Mutter tun würde.
Als sie wieder zu Hause waren, fütterte Jude die Lämmer und schickte Marek zum Bach Wasser holen. Dies war Mareks liebste Aufgabe, weil es ihm mit seinen schiefen Schultern schwerfiel, das Joch gerade zu halten. Er genoss es, gegen seine Verkrüppelung anzuarbeiten. Er musste den Rumpf verdrehen, damit die beiden Seiten gleich hoch hingen, sonst würde das Wasser aus den Eimern schwappen. Darin hatte er viel Übung, da er mehrere Male am Tag Wasser holen musste. Eine gute Tat, dachte er, die seinem Seelenheil angerechnet werden würde. Aber als er sich an diesem Tag auf dem Weg zum Bach im Gleichgewichthalten übte, stolperte er über eine aus dem Boden ragende Baumwurzel und stürzte. Einer der Holzeimer fiel zu Boden und brach entzwei. Dass er sich das Kinn aufgeschlagen und mit den Schneidezähnen in die Unterlippe gebissen hatte, war nicht so schlimm. Er wischte sich das Blut mit dem Ärmel ab und betrachtete es. Hatte es nicht dieselbe Farbe wie das Blut des Räubers? »Vater, hilf mir!«, schrie Marek dramatisch und hoffte, sein schwaches Stimmchen wäre über die Wiese hinweg zu hören. Insgeheim freute Marek sich jedoch ein bisschen, dass er blutete und der zerbrochene Eimer Jude sicherlich zum Anlass dienen würde, ihm bei der Heimkehr eine ordentliche Tracht Prügel zu verpassen. Schmerzen waren gut, glaubte Marek. Sie offenbarten ihm die Liebe und das Mitgefühl seines Vaters. Er befühlte sein Kinn und die aufgeplatzte Lippe, dann suchte er sich einen Stein mit scharfer Kante und sägte damit an seinen Wangen herum, damit sie aufgeschürft und blutig aussahen, als sei er wesentlich schlimmer gestürzt als in Wirklichkeit. Er schlug sich mit der Steinspitze gegen die Stirn, brachte Haare und Mütze durcheinander, dann humpelte er hinunter zum Bach. Mit nur einem schweren Eimer würde es viel schwieriger sein, das Joch zu balancieren. Gut so, dachte Marek. Ich verdiene diese Qual. Er lebte für die Qual. Sie gab ihm Anlass, sich über seine körperlichen Schmerzen erhaben zu fühlen.
Nach dem Besuch bei Agatas Grab hatte Jude immer miserable Laune. Mittlerweile glaubte er fast selbst an die Lüge, die er Marek erzählte — dass Agata gestorben war und unter der Schwarzpappel begraben lag. Agata war so gut wie tot, und an der Stelle unter den Zweigen waren so viele Tränen vergossen, so viele Blumen abgelegt worden. Wie er Agatas Schreien und den Geruch des Bluts, das aus ihrem Schoß in den Hüttenboden floss, beschrieb, wirkte so echt, als hätte er es wirklich erlebt. Und das hatte er ja auch. Die Lüge, die sich daran anschloss, bereitete ihm keine Schuldgefühle. Er war zu stolz, um die Wahrheit über Agatas Verschwinden zu sagen. Aber irgendwo lebte sie wahrscheinlich noch. Sie war nicht in seinen Armen gestorben, wie er so viele Male erzählt hatte. Sie war einfach weg, unsichtbar. Jahrelang hatte Jude damit gerechnet, dass sie zurückkehren würde, mit schweren Brüsten, aus denen die Milch tropfte, voller Reue und Verzweiflung, weinend, dass sie so dumm gewesen und mitten in der Nacht davongelaufen war, nur mit ihrem Mantel und Judes Lederhandschuhen bekleidet. Weil es Winter war, vermutete er, und sie immer kalte Hände hatte. Jude hatte Marek im Arm gehalten, dieses seltsame, winzige Wesen — wie ein richtiges Menschlein sah es nicht aus — mit Froschaugen, die nicht aufgehen wollten, und einem unregelmäßigen Atem, der Jude bei jedem Aussetzen in Panik versetzte. »Das Lämmchen wird sterben«, sagte Jude, und er liebte Lämmchen. Er litt schrecklich. Wahrscheinlich ist Agata deswegen verschwunden, dachte Jude. Sie konnte das Kleine nicht sterben sehen. Sie war ja selbst noch ein Kind. Und Jude hatte sie geliebt wie ein Wilder, wie ein Tier, hatte ihr den Mond und die Sterne und Gottes Schutz versprochen, wenn sie nur bei ihm blieb. »Nimm mich zum Mann«, hatte er sie so viele Male angefleht. »Das Kleine wird sterben.« Was für schrecklich dumme Worte. Damit hatte er sie vertrieben. Sie hatte zitternd und blutend auf dem Boden gelegen. Jude hatte den Mantel über sie geworfen. »Hör auf zu zittern«, hatte er gesagt. Wenn das Kleine wirklich gestorben wäre, dann hätte seine Dummheit vielleicht Sinn gehabt. Er musste eingenickt sein, einen Augenblick, nur ganz kurz, und als er wieder zu sich kam, war Agata nicht mehr da. Er steckte das Kleine unter seinen Mantel und rannte nach draußen. Die Lämmer blökten. Er rief nach Agata. Es schneite, und in der dunklen Luft über der Weide tanzten die weißen Wirbel. Er hätte ihr hinterherlaufen, den Wald absuchen können, aber dem winzigen Wesen war kalt. Es würde sterben, davon war Jude überzeugt. Und dann, als hätte Marek gewusst, dass sein Vater eine Antwort brauchte, brüllte der Säugling los, sein Mund eine klaffende Wunde, die Zunge rosa und zitternd. »Mein Lämmchen!«, schrie Jude. Er eilte zurück ans Feuer, küsste das kleine Wesen und reinigte sein Gesicht vom Blut. Die Plazenta lag noch in einer Pfütze vor der Feuerstelle. Jude warf sie ins Feuer, wo sie zischte und dampfte.
Als die Sonne aufging, brachte er ein Lamm zu Inas Hütte, als Bezahlung für die Aufzucht des Kleinen. Ina lehnte das Tier dankend ab, versicherte Jude aber, dass sie sich um Marek kümmern würde, wenn Jude das selbst nicht konnte.
»Warum sieht das Kleine so seltsam aus?«, fragte Jude.
»Dein Mädchen wollte es umbringen, deshalb«, antwortete Ina. »Sie war viele Male hier, weil sie Kräuter wollte, um es loszuwerden.«
Und das war’s. Agata war für Jude gestorben.
Jude streichelte die neugeborenen Lämmer im nachmittäglichen Schatten und versuchte, nicht an Agata zu denken. »Armes kleines Ding«, sagte er und befingerte das Ohr des Schwächsten aus dem letzten Wurf. Jude hatte sechzehn Lämmchen, fünf Mutterschafe und einen Bock. Der Bock lebte getrennt von der Herde in einem kleinen Verschlag am südlichen Ende des Weidelands unter Kiefern. Er wurde nicht so liebevoll versorgt wie die Auen und Jungtiere. Wenn Jude ihn fütterte, warf er einfach etwas Heu über den Zaun. Wasser wurde einmal am Tag in einen leckenden Trog geschüttet. Der Schafsbock schien unverwüstlich. Und er war seltsam mitschuldig an seiner Gefangenschaft. Er versuchte nie, aus dem Gehege auszubrechen, obwohl der Zaun nur aus abgestorbenen Ästen und alten Brettern zusammengenagelt war und kurz vor dem Einsturz stand. Marek durfte den Bockspferch nicht betreten.
»Der glaubt, du bist ein Schaf, und versucht, mit dir zu rammeln oder dich umzubringen«, sagte Jude. »Was anderes kann er nicht.«
»Und warum bringt er dann die Schafe nicht um?«, fragte Marek.
»Was für eine bescheuerte Frage.« Jude war ernstlich empört. »Ein Mann bringt doch seine Frau nicht um. Er braucht Kinder, in denen er weiterlebt.«
»Lebst du mal in mir weiter?«
»Das will ich doch hoffen. Und geb’s Gott, wirst du auch bald einen Sohn haben.«
»Bald?«
»Du bist dreizehn Jahre alt. Du hast Haare auf dem Sack. Du kannst Vater werden, sobald dir danach zumute ist.«
»Aber ich will lieber Sohn sein, nicht Vater.«
»Na dann.«
Marek und Jude sahen sich immer die Paarungsrituale an. Jude riet gerne, welches der Schafe als Erstes brünstig werden würde. Nach so vielen Jahren Erfahrung nahm er ihre Gerüche wahr. Er hatte meistens recht und war dann nur noch verstimmter, wenn er dem Bock dabei zusah, wie er das Schaf besprang. Dem Schaf gefiel es nicht, vom Bock gerammelt zu werden. Das wusste Jude. Es war eine Strafe für die Aue, wenn der Bock so brutal in sie eindrang und sie dann die Last zu tragen hatte. Die Schafe taten Jude leid, und er gab ihnen Extraweizen zu fressen, wenn sie trächtig waren. Agata dagegen hatte ihm nicht leidgetan. Er war stolz gewesen auf ihren dicken Bauch. Er hatte sie geliebt, er war in sie eingedrungen, hatte etwas von sich hergeschenkt und ihren Schoß gefüllt, der von Gott für ihn geschaffen worden war. Wenn er ejakulierte, stöhnte er und war davon überzeugt, dass dies Gottes eigene Sprache war: das Stöhnen der Schöpfung. Er wusste noch, wie Agata ihm den Kopf zugedreht hatte, wenn er die Hand von ihrem Hals wegnahm. Zu Beginn des Beischlafs drückte er ihr das Gesicht ins Heukissen, aber danach sah sie ihm in die Augen. Sie weinte. Und Jude dachte: So ist’s recht, mein Mädchen. Das hast du gut gemacht, meine Kleine. Jetzt gehörst du mir. Das Weiß, das aus seinem schmierigen Penis tropfte, roch wie ein Sommerregen, würzig, nach Eisen. »Ich liebe dich«, sagte Jude und lehnte sich an die Wand. Agata weinte — verständlich, sie war ja noch ein Kind —, und Jude führte sie am Arm nach draußen, damit sie sich mit Wasser aus dem Trog der Lämmer waschen konnte. Später schlief sie drinnen vor der Feuerstelle ein, die Füße mit einem Seil an den runden Stein gefesselt, mit dem er später ihr angebliches Grab markierte. Das wurde zu ihrem allnächtlichen Ritual. Nicht allzu lang nach Beginn ihrer Liebesaffäre stellte er fest, dass Agata ein Kind erwartete.
Als Marek zerkratzt und blutend vom Bach zurückkehrte und mit dem zerbrochenen Eimer im Arm durch die Tür gewankt kam, ließ Jude den Socken sinken, den er gerade stopfte, nahm eine Schaufel und warf sie nach dem Kopf des Jungen. Marek spürte den Schlag an seinem rechten Ohr, dann wurde alles weiß. Er hörte die Engel singen. Die Bruchstücke des Holzeimers fielen lautlos zu Boden, Marek nahm die Hand ans Ohr, das sich taub und heiß anfühlte, und dann fing Jude an, ihn zu verprügeln. Marek fiel auf die Knie und versuchte, sein Gesicht am Boden vor Judes Schlägen zu verstecken. Dann nahm er die Hand vom Ohr, damit Jude weiter darauf schlagen konnte. Er hob das Gesicht hoch zu Jude, und Jude schlug ihm auf die Nase und auf beide Wangen, wie ein König mit dem Schwert auf die Schultern eines Ritters, dann trat Jude Marek das linke Knie weg, sodass er auf die Seite fiel. Marek streckte die Beine von sich und ließ sich auf den Rücken fallen, damit Jude ihn nach Herzenslaune treten konnte. Wenn mein Vater mich umbringt, dachte Marek, komme ich garantiert in den Himmel. Ein weiterer Tritt gegen seinen Kopf, und Marek musste sich abwenden und spucken. Ein Zahn löste sich aus seinem Mund und landete in dem kleinen Lichtspalt, der zur Tür hereinkam, das letzte, zwischen den Bäumen einfallende Sonnenlicht. Marek beobachtete das Licht, das auf seinem glänzenden Zahn spielte. Er hatte heute schon viel Blut gesehen. Das war in Ordnung so. Blut war der Wein des Geistes, oder etwa nicht? Er leckte sich über die Lippen und saugte das Blut zurück in seinen Mund. Der Schaden, den Jude bei ihm angerichtet hatte, würde für eine ganze Nacht der Buße sorgen, sein Vater würde weinen und Gott um Vergebung anflehen, und die Reue seines Vaters würde Marek hypnotisieren.
Und so kam es. Sobald er tief durchgeatmet und einen Schluck Wasser getrunken hatte, fasste Jude sich, dann brach er in Tränen aus. Er wischte seinem Sohn das Blut aus dem Gesicht, hielt ihn im Arm, bedeckte sein seltsames, geschwollenes Gesicht mit Küssen und erzählte ihm von Neuem die Geschichte von Agatas Opfer. »Sie ist für dich gestorben«, sagte er. »Siehst du das Blut?«
Marek war glücklich.