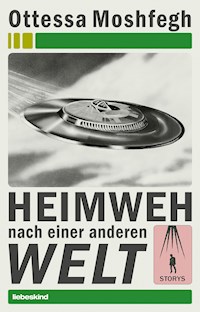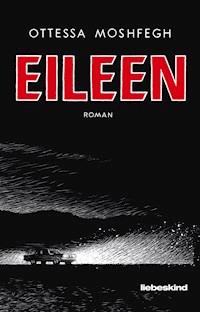10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Liebeskind
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Salem, Massachusetts. Im Jahr des Herrn 1851. Der Seemann McGlue ist schwerer Trinker und sitzt im Gefängnis. Ihm wird vorgeworfen, vor Sansibar seinen besten Freund Johnson ermordet zu haben. Nur kann er sich an nichts erinnern. Was daran liegt, dass sein Schädel gespalten ist, seitdem er vor Monaten aus einem fahrenden Zug gesprungen ist, um nicht als blinder Passagier entdeckt zu werden. McGlue will sich auch an nichts erinnern, er will nur trinken. In der Nähe von New Haven hatte Johnson ihn einst auf der Straße aufgelesen und so vor dem Erfrieren gerettet. Er war es, der nach seinem Sturz für ihn sorgte, der ihn zur Handelsmarine brachte und mit ihm um die Welt segelte. Warum also sollte McGlue ihn umgebracht haben? Ottessa Moshfegh erzählt die abgründige Geschichte eines Mannes, dessen Hass auf die Welt zu groß ist, als dass er unversehrt sein Dasein fristen kann. "McGlue" ist ein stimmgewaltiges, eindringliches Buch über das immerwährende Scheitern des Menschen, den eigenen Unzulänglichkeiten Herr zu werden. Denn zwischen Schuld und Gerechtigkeit steht immer das Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Ottessa Moshfegh
McGlue
Aus dem Englischen vonAnke Caroline Burger
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel»McGlue« bei Fence Books, Albany.
© Ottessa Moshfegh 2014© Verlagsbuchhandlung Liebeskind 2016Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Bridgeman ImagesCovergestaltung: Sieveking, MünchenISBN 978-3-95438-070-1
INHALT
SANSIBAR
INDISCHER OZEAN
MACQUARIE HARBOUR, TASMANIEN
SÜDSEE, EINEN MONAT SPÄTER
SÜDSEE
NORDSEE, SÜDLICH DER LONG FORTIES
GOLF VON BISKAYA
SÜDATLANTIK
NEW YORK, NEW YORK
LIMA
FEUERLAND
SALEM
SAN JUAN
SALEM
HOWARD STREET
HOWARD STREET
ESSEX STREET, RATHAUS
HOWARD STREET, MAL WIEDER
TAHITI
HOWARD STREET
PORT DAVID
SALEM
Die jungen Männer werden mit Messernin den Köpfen geboren.
RALPH WALDO EMERSON»Life and Letters in New England« (1867)
SANSIBAR
Ich wache auf.
Meine Hemdbrust ist steif und hat einen braunen Latz. Wenn das Blut ist, bin ich ein toter Mann. Die Seeluft gibt mir Zweifel auf, und ich lasse den Kopf drei Mal, vier Mal Richtung Füße kreiseln. Die stehen auf der Erde. Vielleicht bin ich mit dem Gesicht vorweg im Matsch gelandet. Mir egal, ich bin noch zu betrunken.
»McGlue!«
Eine zornige Stimme ruft aus Richtung Sonne, die Segel werden gesetzt, Holz knarrt, Knoten ziehen sich fest. Mein Magen macht einen Bocksprung. Mein Kopf. Im vergangenen Frühjahr habe ich mir den Schädel gespalten, als ich aus der Eisenbahn gesprungen bin – das weiß ich noch. Ich gehe wieder in die Knie.
Wieder: »McGlue!«
Dieses McGlue. Kommt mir bekannt vor.
Eine Hand packt mich am Hemd und stößt mich von hinten, steuert mich zum Fallreep und bringt mich irgendwie an Bord. Das Schiff legt ab. Ich klammere mich an der Reling fest und kotze, spucke Gift und Galle, während ich dem vorbeirauschenden Wasser zuschaue, bis kein Land mehr in Sicht ist. Eine kurze Weile ist alles friedlich. Dann will etwas in mir sterben. Ich drehe den Kopf und huste. Zwei Zähne fallen mir aus dem Mund und rollen wie Würfel übers Deck.
Danach werde ich unter Deck zu Bett gebracht. Ich suche in meinen Taschen nach einer Flasche und finde eine.
»McGlue«, sagt der Schiffsjunge, der warme Bruder, »gib mir den Scheiß.«
Da trinke ich lieber schnell aus. Rum läuft mir am Hals herunter und in den verdreckten Kragen. Ich lasse die leere Flasche zu Boden fallen.
»Du blutest«, sagt die Schwuchtel.
»Na und?«, sage ich und ziehe die Hand weg von meinem Hals. Es ist dunkles Blut, und es schmeckt nach Rum. Muss meins sein, denke ich. Ich überlege, was sich damit noch machen lässt, wenn ich später Durst habe. Die Schwuchtel schaut sorgenvoll drein. Dass er mir das Hemd aufknöpft, stört mich nicht, ich schlage nicht mal seine Hände weg, als er meinen Hals erst in die eine Richtung schiebt, dann in die andere. Ich bin viel zu müde. Fleischbeschau. Er meint, er finde keine nennenswerten Löcher in mir. »Aha«, sage ich nur. Die Schwuchtel hat ein seltsames Grinsen im Gesicht; sie wirkt ein wenig ängstlich, als sie mich versorgt, die roten Haare sorgfältig unter eine Wollmütze gesteckt, ein Schweißtropfen, der direkt unter dem Näschen auf der Oberlippe sitzt. In dem Blick, mit dem sie mir ins Auge schaut, liegt eindeutig Angst.
»Anfassen verboten«, sage ich und decke mich wieder zu. Es ist eine graue Pferdedecke mit roten Streifen, die nach Lammsmilch riecht. Ich ziehe sie mir übers Gesicht, während sich die Schwuchtel im Raum zu schaffen macht. Es ist gut hier unter der Decke. Es ist so herrlich dunkel, dass ich fast einschlafen könnte.
Meine Gedanken gehen auf die Reise zu den kalten Bergen Perus, wo ich mich eines Nachts verlaufen hatte. Eine dicke Frau ließ mich Milch aus ihrem Busen trinken, und ich ritt auf einem zotteligen Hund an einem Fluss entlang zurück zur Küste. Johnson und der Kapitän warteten schon auf mich. Das verhieß nichts Gutes. Warm durchfließt mich der Rum, und ich schließe die Augen.
»Was hast du bloß getan?«, sagt der Käpt’n, als ich sie das nächste Mal wieder aufmache. Wie ein Peitschenhieb wird mir die Decke weggerissen. Saunders zieht mir die Schuhe aus. Ich höre das Schiff knarren. Auf dem Gang wird die Glocke zum Essen geläutet. Der Kapitän steht neben meiner Pritsche. »Wir wollen es von dir selbst hören«, sagt der Kapitän. Mir geht es nicht gut. Ich schlafe wieder ein.
Münder bewegen sich. Saunders und die Schwuchtel stehen an der Tür. Schwuchtel hält eine Flasche, Saunders klimpert mit den Schlüsseln.
»Gib her.« Meine Stimme krächzt, versagt. Atmen und hören kann ich. Er gibt mir die Flasche.
»Du hast Johnson umgebracht«, sagt Saunders.
Ich trinke erst einmal die Hälfte der Flasche weg, bringe den Hals ins Gleichgewicht und falte die Schultern zurück. Der Kiefer hängt mir herunter, merke ich und blicke nach unten, erinnere mich an das Blut. Mein Hemd ist verschwunden.
»Wo ist mein Hemd?«
»Hast du es wirklich getan?«, fragt die Schwuchtel. »Offizier Pratt sagt, er hat dich gesehen. Besoffen in der Kneipe in Stone Town. Du wärst weggerannt zum Hafen, und dann haben sie ihn in der Gasse gefunden.«
»Sackerlot, ist das kalt. An alle Besitzer von Antifogmatico, schieb rüber, schönen Dank auch, du Schwuchtel«, sage ich. Und trinke.
»Der Stich hat ihn direkt ins Herz getroffen. Er ist tot, Mann«, sagt Saunders, mit leidenden Augenbrauen, die Schlüssel fest umklammert.
»Wer hat einen Sonnenstich, Saunders? Hör auf mit dem Gefasel. Da wird einem ja ganz anders. Wann wird endlich Essen gefasst?« Die Schwuchtel nimmt mir die leere Flasche weg, die ich auf die Decke habe fallen lassen. Mir ist nach Träumen zumute. »Wo sind deine Sommersprossen hin, Puck? Komm, wir tauschen.«
Sie reden nicht mehr mit mir.
»Essen, verdammte Scheiße.« Ich bin jetzt hellwach. Mit einem Blick sehe ich, wo ich gelandet bin: an die grau gestrichenen, schrägen Holzwände gepappte Anschlagzettel, Drahthaken, an denen Matrosenkleider hängen, ein grauer, schildförmiger Spiegel. Ein Klotz Sonnenlicht fällt herein, in dem weißer Staub tanzt. Die Schatten der Männer an Deck kommen durch die kleine, rechteckige Fensteröffnung hoch über meiner Schlafstelle und wandern über die Wand. Rechts und links von mir sind leere Pritschen. Jammern und Knarren von Schiff und See. Was würde ich für ein Lied und ein Bier geben. Mein neues Zuhause – tief unten im Bauch des schwankenden Schiffs treibe ich irgendwohin.
Saunders und die Schwuchtel tuscheln miteinander und gehen dann nach draußen. Als ich höre, wie Saunders die Tür abschließt, protestiere ich: »Komm zurück, Saunders, schenk mir ein Lächeln! Erzähl schon, was gibt’s Neues?« Nichts tut sich.
Es ist nicht das erste Mal auf dieser Fahrt, dass ich im Loch lande. Werde ich wohl wieder jeden Morgen lenzen und wie eine alte Jungfer Segel flicken müssen, sobald ich wieder gesund bin. Dann denke ich immer an meine Mutter, wie sie hinter den zugenagelten Fenstern der Weberei am Webstuhl sitzt, ich ein mageres, umherschleichendes Jungchen, das sich mit den Fingern hochzieht und die Augen knapp über den Horizont des Fensterbretts hievt. Von dort beobachte ich meine hochmütige, prüde Mutter, die mit gebeugtem Rücken über der Arbeit sitzt, und dann wieder am Abend bei Tisch in unserer Hütte, wie sie mich und meinen Bruder »brave Jungs« nennt, Brosamen über den Tisch schiebt, Münzen zählt und hustet. Meine Schwestern liegen schon im Bett, das ausgelaugte Haar fällt meiner Mutter offen auf den Rücken. Draußen hängen die Sterne am Himmel. Das kalte Bad der Salemer Nacht nach der Hitze des Tages. Ich würde einen Stein nehmen und ein Fenster einschmeißen, wenn ich könnte, wenn ich einen hätte. Hat Saunders nicht gesagt, Johnson wäre in der Rumpelkammer? Ich werde mal aufstehen und nachsehen.
Ich stehe auf. Mein Kopf kommt nicht mit, und ich sehe nichts, dann sehe ich Sterne. Ich glaube, Saunders hat behauptet, dass Johnson tot ist. Blind lasse ich mich zurück auf die Pritsche fallen. Bald ist Saunders wieder da, mit Johnson im Schlepptau, und lacht mich aus. Bis dahin erspare ich mir die Grübelei, in meinen Schädel bohren sich eh Dolche und züngelnde Wellen. Wahrscheinlich döse ich ein, und beim Aufwachen gibt es Brot und Butter und heiße Bohnen und Whiskey, und dann ist Nacht und wir sind schon halb in China, und dann sagen sie: »Ran an die Pumpe, McGlue«, wie beim letzten Mal, als ich über die Stränge geschlagen habe. Ich versuche, mich an den letzten Hafen zu erinnern, wo ich abgesoffen bin.
Sansibar.
Stell dir einen Ort vor, an dem du gern wärst.
Ich kann wieder sehen. Ich ziehe die Augenlider mit den Fingern auseinander, halte sie offen und mache einen Fohlensprung vor den Spiegel. Noch ein Stück näher und ich werde umgerissen. Um meinen Fuß ist ein Seil geknotet, mit dem ich am Bettpfosten festgebunden bin.
Ich rufe, und mir wird übel, als ich meine Stimme höre. Marsch, marsch, zurück ins Bett, McGlue. Danke, so ist’s recht. Die Sterne kommen heraus. Ich suche nach dem Mond, aber er versteckt sich vor mir. Ich kann meinen Weg nicht finden, nicht ermessen. Einfach treiben lassen. Wenn ich die Augen schließe, werde ich schon irgendwie ankommen.
Ich schlafe noch ein wenig.
INDISCHER OZEAN
Fiebrig wache ich auf. Ich weiß, dass es Fieber sein muss, weil ein nasser Lappen auf meiner Stirn liegt. Die Schwuchtel sitzt neben meiner Schlafstelle, im Schoß ein Buch, an einem apfelförmigen Knie baumelt ein Bein. Meine Arme sind an die Oberschenkel gefesselt, die Ohren zugestopft, das Gesicht ist mit einem Stofffetzen verbunden. Durch eine Ritze in der Decke tropft Wasser, und wenn ich atme, kann ich einen üblen Gestank nach Lauge und Scheiße schmecken. Auf dem Blatt des einklappbaren Tischchens steht ein offenes Glas Sauerkohl, daneben ein Laib Brot. Ich hebe den Blick. Die von Deck kommenden Wassertropfen fallen mir in die Augen, es brennt. Die Schwuchtel hantiert mit einem Holzzapfen, fast mütterlich hat er meinen Kopf in Händen.
Ich öffne den Mund, um zu fluchen.
Die Schwuchtel steckt mir den hölzernen Zapfen längs zwischen die Zähne. Ich knirsche darauf herum.
»Mehr kriegst du nicht, McGlue«, sagt er und hält meinen Hals fest.
Ich habe schrecklichen Durst und blicke ihm flehend in die Augen.
»Wir dürfen dir nichts mehr geben, brauchst gar nicht zu fragen«, lautet seine Antwort.
Der glaubt wohl, er hat mich in der Hand. Bitte, soll er doch, ich knirsche und klappere noch ein wenig. Unter Schwierigkeiten verdrehe ich meine Zunge so, dass ich an meinem Gaumen lecken kann. Ich schmecke Salzluft und Kot. Es ist nicht gut. Etwas Süßes hätte ich jetzt gerne. Auf Borneo, da gab es einen kleinen Außenposten, wo Honigwein verkauft wurde, das weiß ich noch. Das war gut. Die Mädchen standen herum und fächelten sich mit Silbertellern Luft zu, barbusig oben herum, darunter trugen sie eng anliegende Kettenhemden. Hüften hatten diese Mädchen, schmal wie bei einem Jungen. Wenn mir danach war, ließ ich diese schmalen Hüften zwischen meinen Händen hüpfen, als hätte ich sie mir selbst ausgedacht. Ich saß im Schatten, und wenn es kühler wurde und ich Lust hatte zum Tanzen, führte ich die Borneomädchen auf die Straße. Johnson auch. Dann sagte er: »Du bleibst da«, und verdrückte sich, »halt nach dem Dicken Ausschau und schrei ›Schwein‹, wenn du ihn kommen siehst.« Und damit zog er eins von den Mädchen hinter den Urwaldvorhang, und ich tanzte weiter, die Hände auf den Hüften des Mädchens, und als der Dicke kam, zog ich einfach die Pistole aus dem Stiefel und schoss auf die Sterne. Die Mädchen fanden das herrlich, sie kreischten und stoben davon, dann tauchten sie kichernd hinter den dunklen Palmwedeln wieder auf und kamen zurückgeschlichen, Hände auf den Mund gedrückt. Der Dicke hält sich den Bauch und deutet auf die frische Flasche auf dem Hocker, der hier als Tisch durchgeht. Scheiß auf Johnson, die treulose alte Ratte. Ich sitze da, trinke und blicke in den Himmel. Ein Mädchen kommt, nimmt mich bei der Hand, wir tanzen noch ein wenig. Johnson taucht wieder auf.
»Was, schon zurück, alter Mann?«, schreie ich ihm entgegen, als ich ihn zurück zur Straße kommen sehe, während sich sein Mädchen ins Dunkel fortschleicht, das Kettenhemd im Mondlicht glänzend. Immer hat er ein Mädchen. Wenn wir Segel setzen, verdrückt er eine Träne für sie oder das, was er ihr angetan hat. Immer eine Träne. Ich lache ihn aus. »Warum bleibst du nicht hier«, sage ich dann zu ihm, »gründest eine Familie, lernst vielleicht die Sprache?« Dann zieht er Leine, und ein paar Stunden später ist er wieder da und führt kühl und konzentriert Gespräche mit dem Kapitän über die Vorteile von Klippern gegenüber Kuttern und erkundigt sich bei ihm, wie er zu seinem Beruf gekommen ist. Mir wird schlecht. Ich betrachte die Mädchen, die in einer Reihe am Ufer stehen und uns zum Abschied winken, und stelle mir vor, sie stünden entlang des Spalts in der Decke dieser düsteren Kammer, mit Augen schimmernd wie Wassertropfen, und ich knirsche weiter.
Bitte ein Glas, irgendwas.
Mir ging’s schon mal so schlecht.
»Schiet«, versuche ich zu sagen, aber das Beißholz kommt mir in die Quere. Ich schaue die Schwuchtel an. Sie hat den Blick auf ihren Schoß gerichtet und liest irgendwas.
Wenn die Schwuchtel mir keinen Rum gibt, dann soll sie mich wenigstens die Salzlake von dem Sauerkohl trinken lassen, denke ich. Ich drehe mich auf die rechte Seite und hecke etwas aus. Schwuchtel springt auf und bohrt mir den Ellbogen in den Leib. Ich spucke das Beißholz auf den Boden. Blut quillt mir aus dem Mund.
»Jetzt zufrieden, kleine Schwuchtel?«, schlürfe ich. Jedes Wort tut mir im Kopf weh. In dem, wenn ich mich recht erinnere, ein großes Loch ist.
»Du kannst wirklich dankbar sein, McGlue. Unser nächster Hafen ist Mac Harbour, da sollten wir dich einfach abladen und mit dem Rest von den Verbrechern verrotten lassen.«
»Nur zu«, sage ich und lasse den Kopf auf die Pritsche knallen. Das Resultat ist gut: Scharf schießt mir der Geschmack von Blut hinten in die Gurgel, und mir wird erst schwarz vor Augen, dann weiß. Weiterschlafen.
MACQUARIE HARBOUR, TASMANIEN
Wir liegen am Kai und die meisten Kameraden sind auf Landgang, aber neben mir schnarchen die eingesperrten Blackies. Dann höre ich, wie einer was in eine Tasse gießt. Ich bin hellwach. Rau reibe ich meine Handgelenke an den Oberschenkeln, bis ich die Fesseln los bin, dann stehe ich auf und ziehe das Ende der Pritsche an die Wand, atme tief durch. Auf dem Klapptisch steht eine Feldflasche. Ich schleppe mich mit der Pritsche dahin, schnappe sie mir und trinke sie in einem Zug aus. Nichts als Wasser. Es gletschert mir die Gurgel runter wie das Gegenteil von Pisse auf Schnee, und ich krümme mich zusammen und fluche – meine ersten Worte seit Tagen. Die Blackies murmeln. Dann zerre ich die Pritsche wieder an die Wand, steige hinauf und blicke aus der Öffnung dort oben aufs Deck hinaus. Alles ist blau. Der Himmel ist blau. Die Wolken sind blau. Das Meer ist blau. Als meine Augen dem gemächlichen Zickzack einer Möwe folgen, fangen sie an zu tränen. Weine ich etwa? Wenn diese Seite des Schiffs landeinwärts blickte, würde ich wahrscheinlich vor lauter Verlangen reihern. An jedem anderen Tag würde ich mir eine Dose Tabak kaufen, rasch davon etwas in den Mund stecken, mit dem Rest die Pfeife stopfen, die Augen zusammenkneifen, mir auf die Brust trommeln und nach Johnson schreien, er soll endlich kommen. Dann würde ich mich erkundigen: Wie viele Stunden noch, bis unser Schiff beladen ist. Und dann nichts wie los in die Stadt, nachsehen, was dort geboten wird. In einem Land, in dem Diebe und Mörder hausen, muss es guten Stoff geben, denke ich. Blutwein, denke ich. Aus Frauenfingern gebrauter Whiskey. Irgendeinen starken Schnupftabak aus Giftkräutern, der den schwarzen Herzen im Kerker verabreicht wird. Bestimmt gibt es geröstetes Fleisch. Und Pasteten, gefüllt mit Zuckerpflaumen, Ratten, Brandy. Ich weiß schon, was die Kameraden sagen werden. Nichts als garstige Weiber mit einem Schoß wie ein Schraubstock. Ich verhungere noch.
»Ich verhungere!«, brülle ich hinaus aufs Wasser.
Ich soll etwas Unrechtes getan haben, sagen sie? Johnson ist wahrscheinlich wütend auf mich und kommt deswegen nicht zu mir runter, damit wir uns wieder vertragen. Noch nicht. Und derweil lassen sie mich einfach krepieren hier unten. Seit Tagen habe ich keinen Tropfen mehr gekriegt. Wenn sie sich dann endlich blicken lassen, liege ich völlig ausgezehrt vor ihnen, und dann tut es ihnen schrecklich leid, so leid, dass sie mir zu Füßen fallen und ofenwarme Milchbrötchen mit süßer Butter darauf hochreichen und mich anflehen, ich soll ihnen verzeihen. Alle: Johnson, Pratt, der Käpt’n, Saunders, die Schwuchtel, die ganze Welt, einer nach dem andern. Wie ein freundlicher Priester werde ich ihnen den Kopf tätscheln und nicken. Und dann tunke ich meinen Schädel in ein Fass Gin.
Die Vorstellung meiner Hand auf Johnsons geneigtem Haupt macht mich froh, meiner Finger in dem schwarz glänzenden Haar. Ich würde es zwischen den Fingern zwirbeln wie ein kleines Mädchen beim Zopfflechten, ich würde ihm in die Wangen zwicken und meine Hungermannspucke auf sein Gesicht tropfen lassen und den Frosch in meinem Hals losmachen. »Johnny«, würde ich sagen. »Auf uns, Johnny.« Hoch die Humpen und runter mit dem Bier, beide haben wir Schaum in unseren Seefahrerbärten. So war es auch in Salem, in jenen Nächten, als wir darauf warteten auszulaufen. Die Röte in Johnsons Wangen blüht mit jedem Schluck auf wie eine Blume und verwelkt wieder, wenn er spricht. Sein Haar ist schwarz und pomadenpoliert wie flüssiger Teer, da kann Wind und Wetter kommen, nie verrutscht oder zerzaust es. »Hübsch« wird er genannt. Mich nannte er »Locke« dafür, wie ich mein Haar trug, als wir uns kennenlernten: vorn so lang, dass ich mir die Haare hinter die Ohren stecken konnte. Für einen fünfzehnjährigen Jungen habe er mich gehalten in der Nacht, in der er mich fand, und sich selbst für einen wahren Helden.
Ich muss lachen. Als ich Johnson zum ersten Mal sah, dachte ich, er wäre eins von den schwulen Arschgesichtern, die im Wald mit den Jungs zugange sind, wie man hört, für ein paar Cents ein Mal blasen oder was. Ich kenne die Sorte.
»Glaubst du wirklich«, sagte er, »der Rum hält dich warm, und du erfrierst heut Nacht nicht?«
Ich hatte den Hut über dem Gesicht, die Flasche zwischen den Knien, und schmolz mit dem Hintern langsam einen Sitz in den Schnee. Todmüde lehnte ich mit dem Rücken an einem Baum. Johnson war hoch zu Ross.
»Hau ab«, sagte ich. Warmer Bruder oder nicht, das war mir egal. Ich war zu diesem Zeitpunkt schon seit etlichen Tagen auf Sauftour, irgendwo zwischen New Haven und Orange. Nach Hause würde ich nie zurückkehren. Zwischen die Bäume hindurch konnte ich den vereisten Strand im Mondlicht glitzern sehen. Ich hatte noch eine volle Flasche – einen ganzen Liter – und etwas Geld in der Tasche. Mir ging es bestens. Meinte ich jedenfalls.
Aber Johnson haute nicht ab. Sein Pferd bäumte sich auf, er riss an den Zügeln und ließ es im Kreis tänzeln. Ross wie Reiter standen weiße Dampfwolken vor den Nüstern, als kämen Geister aus ihrem Körper, wie in einem Schauermärchen für Kinder. Ich versuchte zu lachen, aber mein Gesicht war erfroren. Das weiß ich noch.
»Hier draußen stirbst du«, sagte Johnson. »Komm, ich bringe dich in den Ort.«
»Troll dich«, sagte ich zu ihm. Er tat so, als hätte er nichts gehört, und lenkte das Pferd noch ein wenig im Kreis herum.
»Droll, hast du gesagt?«, lachte er. Ich trank einen Schluck. »Da hat der Junge Shakespeare gelesen, und nun sitzt er mit dem Arsch auf Grundeis. Na komm …« Er klopfte mit der flachen Hand auf den Rumpf seines Pferds. »Steig auf, Nicky Bottom.«
Er benahm sich wie ein warmer Bruder, sah aber nicht danach aus. Eine Witzfigur, dachte ich. Macht sich über mich lustig, was soll man anderes von so einem erwarten? Er beugte sich runter von seinem hohen Ross und streckte mir die Hand vors Gesicht, damit ich sie ergriff. Er fragte, woher ich komme, und als ich »Salem« sagte, lachte er.
»Ich stamme auch aus Salem«, sagte er und zog mich zu sich hoch.