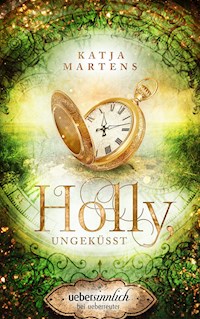1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lassiter
- Sprache: Deutsch
Es rumort am Yellowstone: In das Fauchen der Geysire und das Heulen der Wölfe mischt sich das Grollen von Erbitterung. Im neugegründeten Nationalpark darf das Wild nicht mehr angerührt werden. Das ist den Jägern ein Stachel im Fleisch. Von einem Verbot aus Washington wollen sie sich ihre Freiheit nicht beschneiden lassen.
Verwalter Philetus Norris beruft einen alten Freund in das Amt des Wildhüters, aber der ist noch keine zwei Tage im Dienst, als er tot aufgefunden wird - mit ausgestochenen Augen. Die Botschaft ist klar: Wir wollen hier keinen Aufpasser! Doch Norris lässt sich nicht einschüchtern. Er findet einen anderen Mann für den Posten: Berufsjäger Harry Yount. Der ahnt noch nicht, dass die Fallensteller nicht die einzigen sind, die ihn bis aufs Blut bekämpfen werden. Ihm steht ein höllischer Winter bevor...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Schwur des Wildhüters
Vorschau
Impressum
Der Schwur des Wildhüters
von Katja Martens
Komm schon und zeig dich! Harry Yount duckte sich tiefer zwischen die Büsche, während er mit Blicken die Umgebung absuchte. Fünf Tage und Nächte hatte er in den Wäldern am Snake River nach dem Berglöwen gesucht und war endlich auf eine Spur des Beutegreifers gestoßen: Im Schutz uralter Espen waren die Überreste eines gerissenen Tieres verscharrt worden. Die Schleifspur und die Abdrücke von Krallen im Erdreich verrieten, dass es sich um das Werk eines Pumas handelte.
Früher oder später würde er hierher zurückkehren, um sich die Reste seiner Beute zu holen. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Während der Wind flüsternd durch das Herbstlaub strich, wartete ein Jäger auf den anderen...
Diese verdammte Kälte!
Yount zerbiss einen Fluch zwischen den Lippen. Sein Atem stieg in weißen Schwaden vor seinem Gesicht auf, und in seinen Fingern hatte er kaum noch Gefühl. Wie er damit einen sicheren Schuss abgeben sollte, war ihm schleierhaft. Doch er hatte sein Wort gegeben, und er würde den Teufel tun und es brechen. Das hatte er noch nie und er hatte gewiss nicht vor, jetzt damit anzufangen. Wenn auf ein einmal gegebenes Wort kein Verlass mehr war, worauf dann?
Yount ballte die Hände zu Fäusten und löste sie wieder, um seine Finger beweglich zu halten. Die Kälte machte seinen Körper allmählich taub. Er sehnte sich nach einer Zigarette, aber der Rauch würde ihn verraten. Ebenso wie der Geruch von ein paar Fetzen Trockenfleisch, das er in seiner Tasche bei sich trug. Er verkniff sich auch dieses und ließ den Blick stattdessen über den Wald schweifen.
Im silbrigen Mondlicht schienen sich alle Farben des Herbstwaldes in verschiedene Grautöne aufzulösen. Über den Bäumen zeichneten sich die schneebedeckten Gipfel der Teton Range ab. Der Fluss mäanderte durch das Tal am Fuß der Bergkette. Über dem Wasser waberten Nebelschwaden.
Es war so still, dass Yount seinen eigenen Herzschlag hören konnte. Der Stoff seiner Jacke schien überlaut zu rascheln, als er sich auf den Bauch wälzte und die Lagerung seines Gewehrs prüfte. Er hatte ein Gestell aus Ästen gebaut, auf dem der Lauf ruhte, der geradewegs auf die vergrabene Beute des Pumas gerichtet war.
Sobald sich die Raubkatze blicken ließ, war ihr Schicksal besiegelt.
Alles, was nötig war, war Geduld.
Pumas waren Heimlichtuer. Sie lauerten im Verborgenen, hielten sich im hohen Gras oder auf Bäumen versteckt. Im geeigneten Moment sprangen sie ihre Beute aus dem Hinterhalt an, packten sie mit ihren Reißzähnen am Hals, drückten auf die Luftröhre und töteten sie durch Ersticken und Ausbluten. Große Beutetiere schleppten sie an einen sicheren Ort. Der konnte durchaus bis zu einer Meile entfernt sein. Dort fraßen sie einen Teil des Fleisches und verscharrten den Rest, die schnell verderblichen Eingeweide vergruben sie getrennt vom Rest des Kadavers.
Die Größe des Verstecks vor ihm ließ Yount vermuten, dass der Puma ein großes Wild erbeutet hatte. Einen Weißwedelhirsch vielleicht.
Für diesmal jedenfalls, ging es ihm grimmig durch den Kopf. Der Puma, den er suchte, suchte des Öfteren eine Ranch heim, die nur wenige Meilen entfernt stand. Er hatte mehrere vielversprechende Fohlen gerissen und sich sogar schon an ausgewachsenen Pferden vergriffen. George Clawson, der Besitzer der Spottet-Horse-Ranch hatte Harry Yount angeheuert, um dem Treiben ein Ende zu machen.
Yount hatte ihm sein Wort gegeben.
Er hielt den Kopf unten und verhielt sich vollkommen still. Wenn der Puma ihn entdeckte, bevor er zum Schuss kam, war sein Leben keinen müden Cent mehr wert. Das war ihm klar. Pumas waren nicht nur lautlose Jäger, sondern auch schnell. Verdammt schnell sogar.
In der Nähe wurden nun gluckernde Lockrufe laut. Etwas Schweres knackte im Unterholz. Die Rufe waren Yount vertraut: Es war Brunstzeit bei den Elchen.
Zu sehen bekam er das Tier nicht, aber die Rufe waren noch eine Weile zu hören, bis sie langsam leiser wurden und schließlich ganz verklangen.
Yount legte eine Hand auf sein Henry-Gewehr. Es war mehr als eine Waffe, es war sein Verbündeter. Er hätte eher seine Stiefel zurückgelassen, als seine Waffe.
Er war Jäger, und wie jeder Jäger, der etwas auf sich hielt, stellte seine Munition selbst her. Was er dafür brauchte, besorgte er sich unten in Jackson, wie Blei, Pulver, Hülsen und Zündkapseln aus Papier. Und er war anspruchsvoll: War eine Kugel nicht absolut perfekt, kam sie zurück ins Feuer. Er mischte Zinn und Blei im Verhältnis von eins zu sechzehn, weil er davon überzeugt war, dass seine Kugeln dann genügend Durchschlagskraft hatten, aber auch weich genug waren, um bei einem Treffer aufzupilzen, wie er es bei sich nannte. Auch beim Pulver war er wählerisch. Die führenden amerikanischen Marken wie Hazard und DuPont mochte er nicht. Damit war sein Gewehr nur schwer zu reinigen und nicht so zuverlässig, wie er es sich wünschte. Er bezahlte lieber etwas mehr Geld für besseres Schießpulver, das aus England kam. Schließlich konnte der Erfolg seiner Jagd und sogar sein Leben davon abhängen, dass seine Patrone weder knickte noch versagte.
Ein Schauer rieselte ihm durch den Körper.
Yount widerstand dem Drang, mit den Zähnen zu knirschen.
Ein Kaffee. Herrgott. Was gäbe er jetzt für einen heißen Kaffee. Er fror so erbärmlich, dass er sogar das Gebräu von Bess hinuntergestürzt hätte. Bess führte das Frühstückslokal in Jackson und hatte nicht nur ein großes Herz, sondern auch einen ausgezeichneten Geschäftssinn. Die Leute erzählten sich, dass sie das Pulver für ihren Kaffee mit Hasenmist mischte. Nachdem Yount ihren Kaffee einmal probiert hatte, war er geneigt, den Gerüchten zu glauben.
Er riss ein paar trockene Grashalme ab und ließ sie zu Boden rieseln, um die Windrichtung zu prüfen. Anschließend korrigierte er den Lauf seines Gewehrs um wenige Inches.
Nach dem Bürgerkrieg hatte sich schon in verschiedenen Berufen versucht. Er war als Fallensteller durch die Rocky Mountains gezogen, hatte sein Glück als Prospektor und Wildnisführer probiert und war schließlich bei dem hängengeblieben, was er am besten konnte: Schießen. Wenn es darauf ankam, konnte er einem Streifenhörnchen auf zweihundert Schritt eine Nuss aus der Pfote schießen.
Und so verdiente er sein Geld mit Fellen und Fleisch.
Nur an dem Abschlachten der Büffel beteiligte er sich nicht.
Noch vor zehn, fünfzehn Jahren waren schier endlose Herden über die Plains gezogen. Sie hatten den Boden zum Beben gebracht mit ihrer unermesslichen Anzahl. Doch nun waren von den Büffeln nur noch Geschichten und Spuren im Sand übrig. Die Tiere selbst verschwanden von der Bildfläche. Oh, noch immer konnte man einen Haufen Dollar mit Büffelfellen und -schädeln verdienen. Mehrere hundert Dollar im Monat, wenn man es darauf anlegte. Doch Yount schätzte die blutigen Gemetzel nicht, die das erforderte. Er war Jäger, kein Schlachter.
Während die Nacht voranschritt, kühlte die Luft weiter ab.
In seiner Feldflasche hatte er noch Wasser, das mit Whisky gemischt war, damit es nicht einfror. Doch er brauchte einen klaren Blick, wenn der Puma auftauchte, und verzichtete darauf, einen Schluck zu trinken.
Obwohl er erbärmlich fror, gab es keinen Ort, an dem er gerade lieber gewesen wäre als hier draußen in der Wildnis – mit dem freiem Himmel über sich. Heiliger Rauch, er hatte versucht, sich in der Stadt zu verdingen. Hatte einen Posten im Mietstall angenommen. Keine Woche hatte er es ausgehalten, dann hatte er hingeschmissen, sich ein Pferd besorgt und war auf und davon geritten.
Er war ein Mann der Wildnis. Das war mal sicher.
Keine Frau hielt es lange mit ihm aus, aber das störte ihn nicht weiter. Er hielt es ja auch nicht lange mit einer Frau aus. Wenn es ihn juckte, besuchte er Bess. Sie war es zufrieden, wenn er ihr eine der Dime Novels mitbrachte, die sie so gern las. Hatte eine ganze Kiste voll mit den Dingern, die gute Bess.
Vielleicht sollte er bei seiner Rückkehr einen Abstecher zu ihr einplanen und...
Da! Wie ein Blitzschlag durchfuhr ihn die Erkenntnis, dass sich etwas im Mondlicht näherte. Eine schmale Gestalt bewegte sich ebenso lautlos wie majestätisch durch das Unterholz. Der Puma! Er hielt geradewegs auf das Versteck seiner Beute zu.
Endlich.
Yount straffte sich, zog den Atem ein und ließ ihn langsam entweichen. Beim nächsten Einatmen krümmte er den Finger.
Sein Henry Gewehr spuckte Feuer und Blei. Ein harter Ruck schoss durch seine Schulter. Im nächsten Augenblick stürzte der Puma ins Laub wie von einer unsichtbaren Faust niedergemäht. Das heiße Bleistück des Jägers hatte sein Herz durchbohrt.
Yount sicherte sein Gewehr, ehe er sich an den Abstieg machte.
Auf dem Weg dorthin zupfte er ein Blatt von einem Baum. Das drückte er auf die Wunde und murmelte: »Tut mir leid, Freund. Ich mache nur meine Arbeit.«
Der Puma war ein ausgewachsenes Tier, das er unmöglich tragen konnte. Das war auch nicht nötig. Er hatte sein Pferd in der Nähe versteckt. Das holte er nun. Eine Trage war daran gebunden. Auf die zerrte er den toten Puma und zurrte ihn mit einem Seil fest. Der Wallach stampfte nervös und wollte flüchten. Der Geruch des Raubtiers machte ihn unruhig.
»Ganz ruhig, mein Alter, der kann dir nichts mehr tun.« Yount schwang sich in den Sattel und ließ sein Pferd angehen.
Seine Hütte war ein paar Meilen entfernt, aber im Mondlicht war der Weg leicht zu finden.
Einmal machte er auf einer Anhöhe die Umrisse von mehreren Wölfen aus. Ein halbes Dutzend Tiere waren es – und sie starrten mit gelben Augen geradewegs in seine Richtung. Er zwang sich, langsam weiterzureiten. Wölfe waren neugierig. Manchmal hatten sie ihn schon über weite Strecken begleitet, ohne dass etwas geschehen war. Außerdem vermied er es, sich allzu schnell zu bewegen. Das war sein Grundsatz hier draußen in der Wildnis: Nur Futter rennt.
Unbehelligt brachte er den Weg hinter sich und sah schließlich und endlich das Dach seiner Hütte zwischen den Bäumen vor sich.
Zu seiner großen Verwunderung wurde er trotz der späten Stunde erwartet. Ein Fremder lehnte an der Viehtränke, löste sich nun davon und kam ihm entgegen. Er war groß und kräftig und sicherlich zwanzig Jahre älter als Yount selbst, der mit seinen dreiundvierzig Jahren durchaus kein junger Spund mehr war. Sein Besucher ließ seine Waffe im Holster, aber er bewegte sich wie ein Mann, der ausgezogen war, um ein Territorium für sich zu beanspruchen. Sein Anzug war aus Rehleder gefertigt, dazu trug er Stiefel und einen Hut, den er sich nun vom Kopf zog. Unter buschigen Brauen musterte Yount prüfend – und nickte dann merklich.
Seine Stimme klang wie Donnergrollen, als er fragte: »Mr. Yount? Ich habe einen Auftrag für Sie...«
✰
Hörte das denn nie auf?
Harry Yount fluchte in sich hinein. Er hatte während des Krieges mehr Menschen erschossen, als er wahrhaben wollte. Menschen, die auf dem Schlachtfeld nichts anderes getan hatten, als er: ihre Pflicht.
Er wollte niemanden mehr töten.
Die Geschichten über seine Schießkünste klebten jedoch an ihm wie Büffelmist an neuen Stiefeln. Immer wieder suchten ihn Halunken auf, die nicht den Mut oder das Geschick hatten, um selbst abzudrücken, und die ihn bezahlen wollten, damit er jemanden für sie aus der Welt schaffte.
Er glitt aus dem Sattel, spuckte ins Gras und wandte er sich seinem Pferd zu. Dem Besucher warf er über seine Schulter zu: »Wenn ich jemand für Sie umbringen soll, bin ich nicht interessiert.«
»Oh, ich bin nicht deswegen hier, Mr. Yount.«
»Sind Sie nicht?«
»Bestimmt nicht. Mein Name ist Philetus Norris.«
Den Namen kannte er. »Sie sind der Verwalter des Yellowstone Nationalparks.«
Sein Besucher nickte und stellte einen Fuß auf die untere Stufe der hölzernen Treppe, die auf die Veranda führte. »Der bin ich – und zudem der Herausgeber des Norris Suburban, einer Zeitung, die ich gegründet habe. Wann immer meine Zeit es zulässt, verfasse ich Artikel. Vor allem über die Schönheiten des Parks. Das erweist sich hin und wieder als recht nützlich, um Sponsoren zu finden.«
»Sponsoren?« Yount schabte sich den Bart. »Falls Sie wegen einer Spende gekommen sind, fürchte ich, haben Sie den Weg umsonst gemacht.« Seine gesamte Barschaft belief sich auf sechs Dollar und ein paar Cents. Bis der Rancher ihm sein Geld gab, mussten die reichen. Viel reißen konnte er damit freilich nicht.
»Ich will kein Geld von Ihnen. Vielmehr biete ich Ihnen einen Posten an.«
»Was für ein Posten wäre das?«
»Ich habe gehört, dass Sie ein meisterhafter Schütze sind. Sie wissen andere und sich selbst zu verteidigen. Darum brauche ich Sie. Werden Sie Wildhüter in meinem Nationalpark.«
»Wildhüter.« Yount wusste nicht, was er davon halten sollte. Hatte sein Gegenüber den weiten Weg wirklich auf sich genommen, um ihn auf den Arm zu nehmen?
»Wildhüter«, bekräftigte Norris. »Ich will ehrlich sein, ich hatte einen anderen Mann für den Posten ausgewählt. Einen alten Freund, dem ich vertraut habe. Er war noch keine zwei Tage im Dienst, da hat man ihn tot aufgefunden. Jemand hatte ihn an einem Baum aufgehängt und ihm...« Der Besucher knirschte mit den Zähnen. »... und ihm die Augen ausgestochen.«
»Armer Teufel.«
»Das war eine Botschaft, fürchte ich.«
»Was für eine Botschaft?«
»Wir wollen hier keinen Aufpasser.«
»Verstehe. Und wen umfasst dieses ›wir‹?«
»So ziemlich jeden Jäger im Umkreis von zweihundert Meilen.« Sein Besucher strich sich über den Bart. »Viele sind gegen den Park und nicht bereit, sich an die neuen Regeln zu halten. Die müssen durchgesetzt werden, und dafür brauche ich Sie, Mr. Yount!«
Harry Yount hatte genug gehört. »Geben Sie mir ein paar Minuten. Ich will mich um mein Pferd kümmern. Es hat einen langen Weg hinter sich. Danach gehen wir rein, trinken einen Whisky und reden über Ihr Angebot.«
»Erst kommt das Pferd und dann der Mensch, was?«
»So ist das bei mir. Meine Tiere vertrauen mir, und sie vertrauen darauf, dass ich für sie sorge. Sie gehen vor. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, kommen wir auf keinen Fall überein.«
»Ganz im Gegenteil, Mr. Yount. Ganz im Gegenteil. Ihre Philosophie gefällt mir.«
Harry Yount löste die Seile, mit denen die Bahre am Sattel festgemacht war. Er zerrte sie mitsamt dem toten Puma in den Verschlag hinter seiner Hütte und verriegelte die Tür, damit der Geruch des toten Raubtiers keine anderen Beutegreifer anlockte. Anschließend brachte er sein Pferd in den Stall, rieb es trocken und streute ihm Heu und Hafer in die Raufe. Dann strich er ihm über die Flanke. »Hast mich gut getragen, mein Alter. Hast deine Angst vor dem Puma für mich überwunden.«
Der Wallach rieb seine Nase an ihm.
Yount wusste, dass sein Leben schon mehr als einmal von seinem Pferd abgehangen hatte. Das Band zwischen ihnen hatte nichts mit Sentimentalität zu tun. Es war schlicht notwendig zum Überleben.
Er verließ den Stall und bat seinen Gast in seine Hütte, die aus wenig mehr als einem Raum bestand. Ein Vorhang trennte sein Nachtlager vom Rest der Hütte.
Er schürte das Feuer und drehte die Öllampe hoch.
Wenig später saßen sie einander gegenüber am Kamin. Jeder hielt ein Glas Whisky in der Hand. Eine Weile füllte nichts als das Knistern des Feuers den Raum.
»Sie haben Ärger im Nationalpark«, brach Yount das Schweigen schließlich.
»Das stimmt. Vielen roten und weißen Jägern ist der Gedanke eines Nationalparks, in dem sie das reichlich vorhandene Wild nicht anrühren dürfen, ein Stachel im Fleisch. Sie pochen auf die alten Traditionen und sagen, sie hätten schon immer dort gejagt. Über Regeln zum Schutz der Tiere lachen sie bloß.« Philetus Norris schwenkte sein Glas. »Der Yellowstone Nationalpark soll ein Schutzgebiet sein. Für Tiere und Landschaften, die einzigartig sind. Ich will sie bewahren für künftige Generationen.«
»Das interessiert die Jäger nicht.«
»Da haben Sie recht. Ich habe dem Senat etwas Geld abgerungen. Genug, um Ihr Gehalt zu bezahlen und Sie auszurüsten.« Norris zog einen Sechsschüsser mit silbernem Griff aus seiner Tasche. In das Silber war ein verschnörkeltes Y eingraviert: Yellowstone. »Sie bekommen genug Munition dafür gestellt.«
Yount nahm die Waffe und wog sie abschätzend in der Hand. »Eine gute Waffe, das muss ich Ihnen lassen.«
»Sie werden sie brauchen, wenn Sie mein Angebot annehmen.«
Er legte die Waffe hin. Er hatte genug über den Park in der Zeitung gelesen, um zu wissen, dass es sich um ein großes Stück Wildnis handelte. »Wie viele Wildhüter werden Sie einstellen?«
»Nur Sie, Mr. Yount.«
»Nur mich?« Yount fluchte. »Ich weiß, wie groß das Gebiet ist, das Sie schützen wollen. Sie brauchen nicht mich, Sir, Sie brauchen eine verdammte Armee!«
»Ich weiß, aber habe ich nicht die Möglichkeiten. Das Interesse der Politik an unserem Nationalpark ist so gering wie seine Bedeutung für die Wirtschaft: nämlich gleich null. Wir bekommen kaum finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Ich arbeite daran, aber im Moment reicht das Geld nur für einen Mann. Sie, Yount.«
»Das ist ein Job für zwanzig Männer. Mindestens.«
»Nach allem, was ich gehört habe, sind Sie so gut wie zwanzig Männer.«
»Niemand ist so gut.« Yount schüttelte den Kopf.
»Der Posten ist schlecht bezahlt und gefährlich. Das gebe ich zu. Aber Sie können wirklich etwas bewirken. Das Wild zieht jetzt in seine Winterquartiere. Sie sollen den Wildbestand schützen und Vandalismus und Wilderei im Nationalpark bekämpfen.«