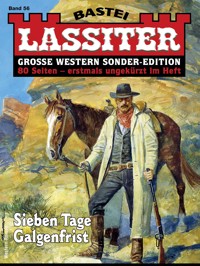
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
LASSITER GEFANGEN - STOPP - GEHEIMAUFTRAG GESCHEITERT - STOPP - REBELLEN RÜCKEN WEITER VOR - STOPP - HÖCHSTE ALARMBEREITSCHAFT NOTWENDIG - STOPP - SANTOS
Gouverneur Hernando Miguel Peralta starrte mit flackernden Augen auf das Telegramm. Sein Gesicht war bleich geworden und seine Hände zitterten ziemlich stark. "Das Ende", murmelte er heiser. "Das ist das Ende. Lassiter war unsere letzte Hoffnung. Jetzt ist er verloren - und wir ebenfalls..."
Stille herrschte in dem Raum, in dem sich der Gouverneur der Provinz Sonora zusammen mit seinen engsten Vertrauten befand. Es waren ein General und drei hohe Offiziere der regierungstreuen Armee.
"Trotz allem werden wir weiterkämpfen!", sagte schließlich der General entschlossen. "Quantez darf nicht siegen, sonst ist Mexiko verloren."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
SIEBEN TAGE GALGENFRIST
Erster Tag
Zweiter Tag
Dritter Tag
Vierter Tag
Fünfter Tag
Sechster Tag
Siebter Tag
Vorschau
Impressum
SIEBEN TAGEGALGENFRIST
von Jack Slade
LASSITER GEFANGEN – STOPP – GEHEIMAUFTRAG GESCHEITERT – STOPP – REBELLEN RÜCKEN WEITER VOR – STOPP – HÖCHSTE ALARMBEREITSCHAFT NOTWENDIG – STOPP – SANTOS
Gouverneur Hernando Miguel Peralta starrte mit flackernden Augen auf das Telegramm. Sein Gesicht war bleich geworden und seine Hände zitterten ziemlich stark. »Das Ende«, murmelte er heiser. »Das ist das Ende. Lassiter war unsere letzte Hoffnung. Jetzt ist er verloren – und wir ebenfalls...«
Stille herrschte in dem Raum, in dem sich der Gouverneur der Provinz Sonora zusammen mit seinen engsten Vertrauten befand. Es waren ein General und drei hohe Offiziere der regierungstreuen Armee.
»Trotz allem werden wir weiterkämpfen!«, sagte schließlich der General entschlossen. »Quantez darf nicht siegen, sonst ist Mexiko verloren.«
Von Lassiter sprach niemand mehr.
Sie hatten diesen Namen bereits aus ihrem Gedächtnis getilgt. Für diese Männer existierte er nicht mehr. Sie wussten, dass jeder verloren war, der den Rebellen des Generals Quantez in die Hände fiel.
Aber Lassiter lebte noch.
Das Todesurteil war zwar schon ausgesprochen, jedoch noch nicht vollstreckt worden.
Lassiter wusste nicht, warum die Rebellen die Hinrichtung hinauszögerten. Er machte sich auch keine Gedanken darüber, denn er war nicht in der Lage, seinen Verstand noch groß zu gebrauchen.
Er war mehr tot als lebendig.
Lang ausgestreckt lag er mitten im Festungshof auf der heißen Erde. Sie hatten ihm die Arme schräg nach oben gedreht und die Handgelenke an starke Holzpflöcke gefesselt, die sie in den Boden gerammt hatten. Auf dieselbe Art hatten sie seine Füße angepflockt, nachdem sie seinen Körper so sehr gestreckt und seine Beine so weit auseinandergespreizt hatten, wie das eben möglich war.
Es war eine fast unerträgliche Tortur. Reglos lag er unter der glühend heißen Sonne. Mit Hilfe von Pflöcken an die heiße Erde gekreuzigt. Wie festgenagelt.
Seine Muskeln waren steif und verkrampft. In den Händen und Füßen schien keine Spur von Leben mehr zu sein. Und er war nicht mehr in der Lage, auch nur den kleinen Finger zu bewegen.
Seine Kleider waren zerfetzt, die Haut von Peitschenhieben und Stockschlägen gezeichnet und von der erbarmungslosen Sonne verbrannt. Hunger wühlte in seinen Eingeweiden, und der Durst wurde zur höllischen Qual.
Lassiter hatte die Augen geschlossen. Sein Kopf war auf die Seite gesunken. Hin und wieder kam ein entsetzliches Stöhnen aus seiner ausgedörrten Kehle.
In ihm war keine Hoffnung mehr. Und noch nie zuvor hatte er so sehnsüchtig auf den Tod gewartet wie jetzt.
Warum kamen sie nicht endlich und holten ihn ab!
Warum stellten sie ihn nicht endlich an die graue Festungsmauer dort drüben, die jetzt schon vom Blut der vielen Opfer besudelt war, die dort exekutiert worden waren!
Sollten sie doch endlich kommen, die verdammten Teufel!
Lassiter hatte sich mit dem Unabwendbaren abgefunden. Ihm konnte niemand mehr helfen. Und er hatte ja auch nichts anderes verdient als den Tod. Er war ein Feind dieser Rebellenarmee. Und er war im Auftrag des Gouverneurs Peralta losgezogen, um einen ganz bestimmten Auftrag auszuführen.
Er hatte Pech gehabt, aber er haderte nicht mit seinem Schicksal. Er hatte von Anfang an gewusst, was ihm bevorstand, wenn ihn die Rebellen erwischten. Und das war geschehen.
Er hörte Schritte. Mehrere Männer näherten sich ihm. Blieben bei ihm stehen. Jemand sagte etwas, aber Lassiter war nicht mehr in der Lage, den Sinn der Worte zu erfassen.
Ein harter Fußtritt traf ihn. Eine Schmerzwelle schoss durch seinen gemarterten Körper. Dumpf stöhnte er auf. Drehte den Kopf etwas. Öffnete die Augen einen winzigen Spalt. »Holt Wasser!«, befahl jemand.
Lassiters Augen gewöhnten sich nur langsam an das grelle Sonnenlicht. Dunkel zeichneten sich vor dem blauen Himmel die Konturen der Männer ab, die ihn umstanden. Nach und nach erkannte er Einzelheiten und wusste bald, dass es keine gewöhnlichen Soldaten waren, die ihn umstanden. Er erkannte es an den teuren Stiefeln und den mit Tressen und Goldlitzen besetzten Uniformen.
Einer von ihnen war Quantez.
Was hatte das schon wieder zu bedeuten?
Der General persönlich kam zu ihm, dem verdammten Gringo!
Lassiters Verstand begann wieder zu arbeiten. Mit einem Schlag war wieder Hoffnung in ihm.
Jemand kam mit einem Eimer und leerte ihn über Lassiter aus. Es war zum Glück lauwarmes, abgestandenes Wasser. Den plötzlichen Schock durch eiskaltes Wasser hätte wahrscheinlich auch Lassiter in seinem augenblicklichen Zustand nicht verkraftet.
Er riss den Mund weit auf, um möglichst viel von der Flüssigkeit in seine ausgedörrte Kehle zu bekommen, und er spürte, wie seine Lebensgeister wieder zu neuem Leben erwachten.
Er starrte in das von einem schwarzen Bart umrahmte Gesicht des Generals Quantez. Der General stand breitbeinig da, die Hände in die Hüften gestemmt. Das schwere, silberbeschlagene Säbelgehänge blitzte im Sonnenlicht.
»Du hast dich gut gehalten, Gringo«, sagte er. »Das gefällt mir an dir.«
Lassiter sagte nichts. Schweigend starrte er den Rebellenführer an. War gespannt darauf, weshalb Quantez gekommen war.
Der Rebellengeneral starrte ihn forschend an. Ein teuflisches Grinsen verzerrte sein bärtiges Gesicht.
»Du hast zwar nichts zugegeben, Gringo Lassiter«, fuhr der General fort. »Aber inzwischen wissen wir es ganz genau. Du warst im Auftrage des Gouverneurs Peralta, dieses verdammten Hundesohns, unterwegs. Und du solltest mich töten, um damit die Flamme der Revolution zu ersticken. Es hat keinen Zweck, es weiterhin abzustreiten, Lassiter. Inzwischen haben wir nämlich genügend Beweise. – Wir wissen auch, dass du das volle Vertrauen des Gouverneurs genießt.«
Lassiter sah ihn fragend an.
Er wollte zwar etwas sagen, war aber nicht in der Lage dazu. Es war, als hätte man seinen Hals mit einem dünnen Draht zusammengeschnürt. Er bewegte den Mund, aber nur ein paar unverständliche, krächzende Geräusche waren zu hören.
Die Männer, die ihn umstanden, lachten. Das Gelächter verstummte, als der General kurz die Hand hob.
»Bindet ihn los!«, befahl er.
Zwei Männer schnitten kurzerhand die Stricke durch, mit denen Lassiter an die Holzpflöcke gefesselt war.
Lassiters Körper sank schlaff in sich zusammen, als die unerträgliche Spannung so plötzlich nachließ, der Muskeln, Sehnen und Knochen nun schon stundenlang ausgesetzt gewesen waren. Eine Weile lag er völlig reglos da. Dann fing er an, seine Hände und Füße langsam zu massieren.
Neben ihm stand der Eimer, in dem sich noch ein winziger Wasserrest befand. Er packte den Eimer mit beiden Händen, setzte ihn an den Mund und saugte gierig die letzten Tropfen in sich hinein.
Wieder versuchte er zu sprechen, und diesmal gelang es.
»Was ist los, General?«, krächzte er. »Was wollen Sie von mir?«
Seine Stimme hörte sich unnatürlich fremd und fern an. Es fiel ihm schwer, die Lippen zu bewegen und die Worte richtig zu formen.
»Ich will dir eine Chance geben«, sagte Quantez. »Deine Hinrichtung wird aufgeschoben.«
Lassiter glaubte nicht richtig zu hören.
»Warum?«, krächzte er.
Er sah in das bärtige Gesicht des Generals, und es erschien ihm in diesem Augenblick wie eine finstere, dämonische Fratze.
Welche Teufelei plante Quantez? Was hatte er mit Lassiter vor? Es musste schon einen äußerst wichtigen Grund haben, dass Lassiters Hinrichtung nicht stattfinden sollte.
Der Rebellengeneral sagte: »Du wirst zu Peralta gehen, Lassiter. Du wirst ihm sagen, dir wäre die Flucht gelungen. In einem günstigen Augenblick wirst du ihn dann töten. Ihn und einige andere wichtige Männer, deren Namen ich dir noch nennen werde.«
Lassiter hatte Mühe, seine Überraschung zu unterdrücken.
Was hatte Quantez da gesagt?
Hatte Lassiter überhaupt richtig gehört?
Oder erlaubte sich hier Quantez aus irgendeinem Grunde einen makabren Scherz mit Lassiter?
Der General lächelte grausam.
»Ich weiß, was du jetzt denkst, Gringo«, sagte er. »Du glaubst, ich wäre verrückt geworden. Du rechnest dir jetzt schon deine Chancen aus. Sobald ich dich freigelassen habe, wirst du zu Peralta gehen und ihm alles erklären. – Das ist doch deine Absicht, Gringo? Habe ich recht?«
Lassiter nickte mühsam.
»Sie haben recht, General. Es wäre dumm von Ihnen, mich einfach laufenzulassen. Aber Sie sind nicht dumm. – Was steckt also dahinter? Womit wollen Sie mich erpressen?«
»Du bist klug«, sagte Quantez. »Deine Worte bestätigen es. Und sie beweisen mir wieder einmal, dass ich in dir genau den richtigen Mann für meine Pläne gefunden habe.«
Lassiter ahnte etwas Düsteres, Unheilvolles.
Seine Gedanken wirbelten. Er suchte nach einer Erklärung, aber er fand keine, sosehr er sich auch anstrengte.
»Ich werde dir sieben Tage Zeit geben«, sagte der General nach einer kurzen Pause. »In spätestens sieben Tagen musst du meinen Auftrag ausgeführt haben. – Morgen beginnt diese Frist. Morgen ist der erste von diesen sieben Tagen. Die Frist ist am siebenten Tage beendet. Genau um Mitternacht. Wenn du bis dahin nicht zurückgekehrt bist, stirbt jemand.«
Lassiter spürte, wie sein Herz schneller klopfte.
»Wer?«, stieß er heiser hervor. »Wer muss dann sterben?«
»Dein Sohn«, sagte der General.
Lassiter zuckte zusammen. Er ballte die Fäuste, richtete sich mit einem jähen Ruck auf.
»Nein!«, keuchte er. »Das ist nicht wahr. Das...«
»Es ist wahr«, unterbrach ihn Quantez kalt. »Wir haben deinen Sohn Jay in unserer Gewalt. Meine Leute haben ihn aus El Paso entführt. Er wird bald hier sein. – Sein Leben liegt in deiner Hand, Lassiter. – Du hast genau sieben Tage Zeit, Lassiter. Sieben Tage!«
Lassiter beherrschte sich nur mühsam. In ihm war der Wunsch, aufzuspringen und dem verdammten schwarzbärtigen Rebellengeneral an die Kehle zu fahren.
Aber er blieb sitzen.
Er hielt den Kopf gesenkt und zwang sich zur Ruhe.
Es hatte keinen Sinn, sich jetzt irgendwie aufzulehnen und etwas zu unternehmen. Was immer er auch tat, es würde ihm nur schaden. Der Rebellengeneral brauchte nur mit dem kleinen Finger zu winken, und seine Leute würden Lassiter in Stücke schlagen.
Deshalb war er von jetzt an gezwungen, eine ganz bestimmte Rolle zu spielen. Die Rolle, die ihm aufgezwungen worden war.
Der General lachte spöttisch.
»Ich weiß, was du jetzt denkst, Lassiter«, sagte er. »Du glaubst daran, eine Chance zu haben. Und diese Chance hast du sogar. Du kannst mich beim Gouverneur verraten. Du kannst ihm sagen, was hier geschehen ist. Dagegen bin ich machtlos. – Wenn du dich also dem Gouverneur anvertraust, rettest du mit Sicherheit dein Leben. Dein Sohn jedoch muss sterben, wenn du einen Fehler machst. – Hast du das alles verstanden?«
Lassiter nickte müde.
»Was soll ich tun?«, fragte er rau.
»Du wirst nach Süden reiten«, sagte Quantez. »Du suchst den Gouverneur auf und sagst ihm, dir wäre die Flucht gelungen. – Dann wird Peralta dir sein Vertrauen schenken. Ich bin ganz sicher. Und sobald dann die Gelegenheit günstig ist, tötest du ihn.«
Lassiter grinste verzerrt.
»Ist das alles?«
»Nein. Das wäre zu wenig. Du musst ihn so töten, dass vorerst niemand etwas davon erfährt. Deine zweite Aufgabe ist es dann, in die unterirdischen Schatzkammern des Palastes einzudringen. Dort unten werden die Steuergelder aufbewahrt, die für die Zentralregierung in Mexico City bestimmt sind. Nach den Informationen, die ich erhalten habe, handelt es sich um rund zehn Millionen Pesos in Gold. In spätestens einer Woche soll dieses Geld in die Hauptstadt transportiert werden. – Ich muss es haben, Lassiter. Um jeden Preis. Denn auf diese Weise werde ich der Regierung einen schlimmen Schlag versetzen. Ja, es könnte sogar der Todesstoß für die Juaristas sein. – Verstehst du jetzt, warum ich dir sieben Tage Zeit gebe und nicht mehr? Sieben Tage, Lassiter.«
Lassiter hatte schweigend und mit gesenktem Kopf zugehört.
Jetzt blickte er auf.
»Das ist Wahnsinn«, krächzte er. »Ein Mann alleine kann das niemals schaffen. So viel Geld kann nur mit Wagen abtransportiert werden. Oder mit einer riesigen Maultierkolonne. Niemals würde ich unbemerkt die Festung und die Stadt verlassen können. Auch dann nicht, wenn mir der Anschlag auf den Gouverneur gelingen würde.«
Der General grinste.
»Das ist deine Sache«, sagte er. »Und wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, erhältst du Unterstützung.«
Lassiter versuchte aufzustehen, sank aber kraftlos wieder zurück. In seinem ganzen Körper war ein dumpfes Gefühl der Leere. Er war restlos ausgepumpt.
»Wirst du es wagen?«, fragte der General Quantez kalt.
Lassiter nickte schwach.
»Ja«, sagte er heiser. »Aber was geschieht mit meinem Jungen, wenn ich es nicht schaffe?«
Quantez zuckte die Schultern.
»Dann lasse ich ihn töten«, sagte er. »Denke immer daran, Lassiter! Ich lasse diesen kleinen Jungen erschießen, wenn du versagst. Denn dann ist für mich alles umsonst gewesen. Dann werden sich meine Soldaten von mir abwenden, weil ich meine Versprechungen nicht einhalten kann. Und auch das Volk wird mich verachten, weil ich keine großzügigen Geschenke mehr machen kann, wie ich es allen Leuten versprochen habe.«
Lassiter verstand. Er wusste jetzt, dass Quantez längst nicht so gut dastand, wie es bisher immer den Anschein gehabt hatte. Der Rebell befand sich am Rande eines gähnenden Abgrunds. Es hing so gut wie alles von Lassiter ab, ob Quantez in diesen Abgrund stürzte oder nicht.
»Und wenn ich es trotz allem schaffe?«, fragte Lassiter.
»Dann schenke ich euch beiden das Leben. Dir und deinem Sohn.«
»Ist das alles?«
»Natürlich. Das Leben ist der kostbarste Besitz, den ein Mensch hat. Mehr kann ich dir wirklich nicht geben.«
»Es ist gut«, sagte Lassiter. »Ich werde tun, was in meinen Kräften steht.«
Allmählich war er innerlich wieder kalt geworden. In der ersten zornigen Aufwallung hatte er Quantez eine ganze Menge übler Worte und Drohungen an den Kopf schleudern wollen. Aber inzwischen war er zu der Erkenntnis gekommen, dass es besser war, wenn er den Mund hielt.
Jetzt musste er den Schein wahren.
Denn es ging um das Leben seines kleinen Sohnes Jay. Acht Jahre war der Junge inzwischen alt, und er war der einzige Mensch auf der ganzen Welt, an dem Lassiter mit dem Herzen hing.
Jay musste gerettet werden!
Um jeden Preis.
»Führt ihn jetzt in die Festung!«, befahl Quantez. »Gebt ihm zu essen und zu trinken. Ich möchte, dass er möglichst schnell wieder zu Kräften kommt.«
Zwei Offiziere packten Lassiter und zerrten ihn auf die Beine. Als er stand, drehte sich kurze Zeit alles vor seinen Augen. Er atmete ein paarmal tief durch, und er spürte, wie dieser Schwächeanfall vorüberging.
»Lasst mich los!«, stieß er unwillig hervor. »Ich kann alleine gehen.«
Die beiden Offiziere ließen ihn sofort los. Lassiter setzte sich in Bewegung. Er schwankte stark, fiel aber nicht hin. Wütend presste er die Zähne zusammen, und ihn beherrschte nur ein einziger Gedanke.
Sieben Tage!
Sieben Tage Galgenfrist!
Ihm war zumute, als hätte man ihm befohlen, den Mond vom Himmel zu holen. Fast genauso unmöglich war nämlich das, was Quantez von ihm verlangte.
Trotz allem glomm in Lassiter noch ein winziger Hoffnungsfunke.
In sieben Tagen konnte viel geschehen.
Flankiert von den Rebellen, betrat er die Festung und wurde in einen kühlen, spärlich möblierten Raum geführt. Sie forderten ihn auf, an dem Tisch Platz zu nehmen, und Minuten später wurde ein Essen aufgetischt. Es waren mit grünen Bohnen gefüllte Tortillas, Brot und ein großes, scharf gewürztes Steak.
Zum Trinken gab es eine Kanne Wein.
Lassiter aß langsam und kaute jeden Bissen sehr sorgfältig durch. Anfangs hatte er das Gefühl, sein Magen müsste sich drehen, als er zum ersten Mal wieder Speisen aufnehmen musste nach so langer Zeit. Aber nach und nach wurde ihm besser.
Von dem Wein nahm er nur ganz kleine Schlucke und verdünnte ihn mit dem Wasser aus dem großen Tonkrug, den man ihm ebenfalls hingestellt hatte. Trotzdem fühlte er sich gleich darauf stark angetrunken. Sein Körper war eben noch viel zu sehr geschwächt.
Und zwei Worte kreisten immer wieder durch seine Gedanken:
Sieben Tage...
Erster Tag
Kurz vor Sonnenaufgang galoppierte er auf einem ungesattelten Pferd durch das Tor der von den Rebellen besetzten Festung. Einer der eingeweihten Offiziere hatte das Tor für Lassiter geöffnet, und drüben bei den Ställen lagen zwei bewusstlose Posten, die angeblich von Lassiter überwältigt und gefesselt worden waren.
Die ganze Sache war so inszeniert worden, dass es nach einem echten Ausbruch des Gefangenen aussah.
Lassiter war schon fast eine halbe Meile von der Festung entfernt, als man seine »Flucht« bemerkte.
Grelle Trompetensignale ertönten. Alarmschüsse wurden in die Morgenluft gefeuert, und die ersten Verfolgertrupps wurden in die Sättel gejagt.
Lassiter grinste vor sich hin. Er wusste, dass er sich jetzt Zeit lassen konnte, denn von seinen angeblichen Verfolgern hatte er ja wirklich nichts zu befürchten.
Andere, bedeutend schwierigere Probleme lagen vor ihm.
Er war von nun an völlig auf sich alleine angewiesen. Musste sich Waffen besorgen, Ausrüstung für einen langen Ritt, ordentliche Kleider, einen guten Sattel und vor allen Dingen Geld.
Er hätte sich nach der Stadt Altar wenden können, in der sein Verbindungsmann Santos lebte. Die Stadt war noch nicht von den Rebellen besetzt. Man konnte sich dort noch verhältnismäßig sicher fühlen.
Trotzdem hielt es Lassiter nicht für gut, dorthin zu reiten. Er war sicher, dass er beschattet wurde. Und wenn er sich mit Santos in Verbindung setzte, brachte er diesen Mann in höchste Gefahr.
Eduardo Santos gehörte zu den besten Agenten der Provinzregierung. Er war ehrlich, treu, zuverlässig. In Altar führte er eine Bodega mit einigen Gästezimmern. Er war ein dicker, glatzköpfiger, völlig harmlos aussehender Mann. Erst wenn man ihn genau kannte, erfuhr man um seine Gefährlichkeit.
Ob er inzwischen schon erfahren hatte, was mit Lassiter geschehen war? Ob es ihm schon gelungen war, Lassiters Auftraggeber zu benachrichtigen?
Lassiter tappte völlig im Dunkeln.
Es blieb ihm nichts anderes übrig, als abzuwarten, was die Zukunft ihm bringen würde.
Er dachte an seinen Jungen, und seine Zähne knirschten aufeinander. Verdammte Rebellenbrut!
Wenn sie Jay wirklich etwas antaten, würde Quantez keine ruhige Minute mehr haben. Diesen Schwur hatte Lassiter schon mehr als einmal vor sich selbst geleistet, ein feierliches Gelübde.
Acht Jahre war der Junge. Und er lebte in El Paso. Wuchs in der Familie von Benito Sanchez auf, dem mexikanischen Pferdehändler, der zu Lassiters besten Freunden gehörte.
Lassiter hatte Jay zu Benito gebracht, als der Junge erst wenige Monate alt war. Jay brauchte ein richtiges Zuhause und eine gute Frau, die wie eine Mutter für ihn sorgte. Emilia Sanchez war eine solche Frau. Unter ihrer Obhut war Jay zu einem prächtigen Knaben herangewachsen. Sie hatte ihm die Mutter ersetzt, die von Banditen grausam ermordet worden war.1
Die Gedanken Lassiters wanderten in die Vergangenheit, während er durch die karge Bergwelt südwärts ritt. Um seine Verfolger, die ja in Wirklichkeit gar keine richtigen Verfolger waren, kümmerte er sich überhaupt nicht.
Stunden vergingen. Am Mittag rastete er auf einem schmalen Felsenplateau und ließ seine Blicke über die graubraunen Berge gleiten. Es war ein trostloses Land. Es bot nichts anderes als Steine, Staub, vertrocknete Gräser und Büsche und hier und da ein paar verkrüppelte Kiefern an trostlosen Hängen.
Das Pferd stand müde und mit hängendem Kopf da. Seit dem Morgen hatte es erst ein einziges Mal Wasser bekommen. Das war vor zwei Stunden gewesen. Brackiges, abgestandenes, von Ungeziefer durchsetztes Wasser aus einem Tümpel zwischen Felsen.
Auch Lassiter hatte von dem Wasser getrunken. Widerwillig zwar, aber ihm war keine andere Wahl geblieben. Jetzt hielt er nach einer Stelle Ausschau, an der er eventuell auf Wasser stoßen konnte. Ganz langsam ließ er seinen Blick über die schroffen Bergketten gleiten – und entdeckte den dünnen weißen Strich, der sich senkrecht in den stahlblauen Himmel hineinschob.
Das musste eine Rauchfahne sein. Und sie konnte nur von einem Lagerfeuer oder aus einem Kamin hochsteigen.
Lassiter stieg wieder auf das sattellose Pferd. Das Tier schnaubte widerwillig, als er es antrieb.
Leise fluchte er vor sich hin.
Es war kein angenehmes Gefühl, ohne Waffen und auf einem ungesattelten Pferd durch die Berge zu reiten. Zahllose Gefahren konnten auf ihn lauern. Wilde Tiere. Räuberische Indios. Banditen.
Lassiter wusste nicht, ob er jemals lebend sein erstes Ziel, nämlich die Provinzhauptstadt, erreichen würde. Vielleicht war er schon tot, bevor der erste Tag zu Ende war.
Eine verdammte Mission!
Und der Rebellengeneral Quantez trieb ein teuflisches Spiel mit Lassiter. Er hatte ihn in eine ausweglose Situation hineingetrieben.
Eine Stunde verging, und die Rauchfahne war vom Himmel verschwunden. Jetzt konnte sich Lassiter nur noch auf sein Glück verlassen.
Das Pferd schritt immer langsamer aus. Das braune Fell war von einer klebrigen Schicht aus Schweiß und Staub bedeckt. Schaum flockte von den Nüstern. Immer wieder blieb es stehen und musste von Lassiter wieder angetrieben werden.
Seit seiner letzten Rast war er inzwischen mehr als zwei Stunden unterwegs, als er plötzlich auf eine Reiterfährte stieß. Sie kam vom östlichen Hang des Tales herunter, in dem er sich befand, und führte auf einen schmalen Seitencanyon zu, der sich in die westliche Bergflanke einkerbte.
Lassiter folgte der Fährte. Das Pferd bewegte sich auf einmal schneller und streckte witternd den Kopf vor. Das konnte nur bedeuten, dass Wasser in der Nähe war. Alle Tiere hatten dafür einen ausgeprägten Geruchssinn.
Es dauerte noch gut fünf Minuten, bis Lassiter auf einen schmalen Bachlauf stieß, der ein schmales Tal durchfloss. Die Talsohle war von gelbgrünem Gras bedeckt. An den Ufern des Baches wucherten dichte Büsche, und vereinzelte Baumgruppen hoben sich wie dunkle Inseln ab.
Ein bewohntes Tal, das erkannte Lassiter auf den ersten Blick. Überall weideten kleine Rinderrudel, und eine halbe Meile von Lassiter entfernt befanden sich die Gebäude einer Ranch inmitten einer Gruppe von mächtigen Burr-Eichen.
Schnell saß Lassiter ab und zog sein Pferd tiefer zwischen die Büsche am Bachufer.
Aber es war schon zu spät. Er war entdeckt worden.





























