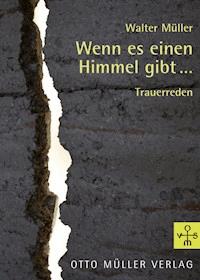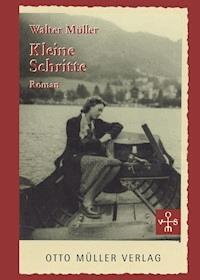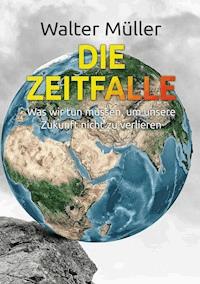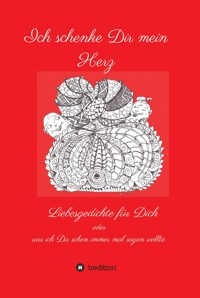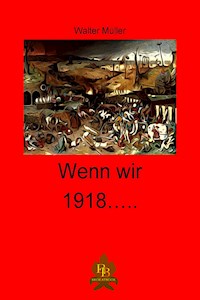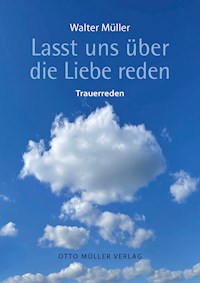
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Otto Müller Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jeder Mensch ist ein eigener Kosmos, einzigartig, unverwechselbar, besonders. Walter Müller erzählt in seinem zweiten Trauerreden-Buch die Lebensgeschichten von 22 Menschen, für die er in den letzten Jahren in Trauerhallen oder auf Friedhöfen Abschiedsreden gehalten hat. Etwa die Geschichte der Konzertgeigerin, die im gesegneten Alter von 97 Jahren starb, und die der Schülerin, die mit 17 Jahren aus dem Leben gerissen wurde. Die turbulente Geschichte des Weltmeisters im Barfußwasserskilauf und die der jungen Frau, die trotz einer mentalen Beeinträchtigung den anderen zeigen konnte, was Glück bedeutet. Der hochgeschätzte Kapellmeister vom Salzburger Landestheater wird ebenso "lebendig" wie der unkonventionelle Sozialarbeiter mit dem geliebten Liegerad oder der Künstler, der sich als Liftführer auf den Mönchsberg hinauf sein Geld verdiente und dabei die köstlichsten Geschichten aufschnappte. Jeder Mensch ist ein eigener Kosmos – und von jedem Menschenleben kann man so viel lernen. Letztlich geht es um die Liebe – die erste, die zweite, die große und die komplizierte; die Liebe zu einem Menschen, die auch nach dem Tod bestehen bleibt, die Liebe zu einer Arbeit, zu einem Hobby. Ein Buch, das trösten und zum Nachdenken anregen soll, über den Tod und weit mehr noch: über das Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Walter Müller
Lasst uns über die Liebe reden
Trauerreden
Die Drucklegung dieses Buches wurde gefördert von denKulturabteilungen von Stadt und Land Salzburg.
www.omvs.at
ISBN 978-3-7013-1291-7eISBN 978-3-7013-6291-2
© 2021 OTTO MÜLLER VERLAG SALZBURG-WIEN
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Media Design: Rizner.at
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck-Germany
Umschlaggestaltung: Leo Fellinger
Wenn du an mich denkst,erinnere dich an die Stunde,in welcher du mich am liebsten hattest.
Rainer Maria Rilke
Inhalt
Über die Liebe also, ein Vorwort
„Kommt ein Vogel …?“
Vom Mädchen, das ein bisschen anders war
Dem himmlischen Stern hinterdrein
Barfuß über jeden See
Die Zugfahrt ins Glück
„Ach, der Professor!!!“
Als der Krampus vor der Tür stand
Erste Geige – im Konzert und daheim
Rosen, Kerzen, Tränen
„Sind Sie der heilige Nikolaus?“
Santé, Friedl! Egészségére!
Rohrnetzmeister und Torschützenkönig
„Ein Pfifferl für die Frau Lotte!“
Der Himmel über dem Zirkuszelt
Pflanzenflüsterer und Strudelkönig
„Ach Gott, diese Ziele immer!“
Markus, Liebling der Menschen
„Ich bin der Peter Marzipan!“
Der „Dürre“ tanzt den Schneewalzer
Liftführer und Geschichtensammler
„Wolfram, du gehst da runter!“
Ist der Tag wichtiger als die Nacht?
Über die Liebe also
Jeder Mensch ist ein eigener Kosmos, einzigartig, unverwechselbar. Jedes Leben, ob es schwer, ob es leicht zu leben war, erzählt seine eigene Geschichte: staunenswert, unkompliziert, geheimnisvoll, bizarr, glücklich, hart, viel zu kurz, bemerkenswert lang, verspielt, enttäuschend, in Geborgenheit oder vogelfrei, vom Schicksal herausgefordert oder von Engelscharen begleitet. Aber immer war es ein einzigartiges, unverwechselbares Leben.
Als Trauer- oder besser: Abschiedsredner hat man das Privileg, in ein Menschenleben hineinhorchen, sich hineinfühlen zu dürfen. Man ist eingeladen, einen unbekannten Planeten zu betreten, einen beispiellosen Kosmos zu erkunden und zu entdecken. Und jedes Mal ist es ein Geschenk, eine bleibende Erfahrung. Über dieses ganz besondere Leben zu erzählen, den vielen Facetten eines Menschen in einer Rede gerecht zu werden, ist Aufgabe und Ehre zugleich.
Wie lässt sich aber ein Leben halbwegs oder tiefgehend erfassen, noch dazu, wenn zwischen der Anfrage von Angehörigen, die Verabschiedung zu übernehmen, und der Trauerfeier selbst nur wenig Zeit zur Verfügung steht? Manchmal eine Woche, manchmal vier oder drei Tage. Da geht sich kaum mehr als ein langes Gespräch aus, ein paar Telefonate und Mails, ein bisschen Recherchieren und Nachfragen.
Der Abschiedsredner muss also mitfühlend und zielstrebig zugleich agieren. Mit großem Verständnis dafür, dass jede Trauer anders ist, und dennoch so strukturiert, dass in den zwei, drei Stunden der persönlichen Begegnung die/der Verstorbene fassbar, spürbar wird? Dass aus einem Namen, ein paar Daten ein Menschenbild entsteht?
Mein „Hilfsmittel“ ist der Fragenkatalog geworden, den ich mir im Laufe der Zeit erarbeitet habe. Ganz präzise Fragen zur Herkunftsfamilie, zu den Lebensumständen, der Kindheit, der Schulzeit, der Berufssuche, der eigenen Familie, den Hobbys und Interessen, den sportlichen und kulturellen Vorlieben usw., bis zur Zeit der Krankheit, der Pflege, des Sterbens oder des unerwarteten, schicksalhaften Todes. Den Katalog habe ich meistens vor unserem ersten, oft einzigen Treffen, an die Familie geschickt, mit der Bitte, die Erinnerung fließen zu lassen und mir die Antworten in kurzen Sätzen oder stichwortartig zurückzuschicken. Bei der persönlichen Begegnung konnten wir dann Fragen und Antworten vertiefen und das Lebenspuzzle bunt und anschaulich zusammenfügen. Zwei Fragen erwiesen sich immer als besonders spannend und ergiebig. Die Frage „Was bringt Sie zum Schmunzeln, wenn Sie an Ihre Mutter (Ihren Mann, Ihre Großmutter, …) denken?“ Das bringt ohne Anstrengung ein Lächeln und eine Entspannung in das Gespräch … Und es ist immerhin ein Trauergespräch, kurz nach dem Tod eines geliebten Menschen. Die kleinen und größeren Schrulligkeiten eines Vaters, einer Ehefrau, eines Freundes …, quer durchs Leben, der Humor, die Lebensparolen, Urlaubsüberraschungen, Ungeschicklichkeiten und Alltagspannen hellen die düstersten Stunden auf.
Die zweite wichtige Frage – an die Kinder, Freunde, Geschwister gerichtet: „Wie haben sich die beiden kennengelernt?“ Oder – an den Witwer: „Wo und wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt?“ Wobei, einfach ein Erfahrungswert, die Witwen hier viel genauer, auch launiger, Antwort geben können.
Die allererste Begegnung, am Zuckerbäckerball, im Wartezimmer eines Zahnarztes, am Gang eines hoffnungslos ausgebuchten Zugwaggons – wo auch immer; diese Geschichten bleiben im Gedächtnis. Und stets sind es Geschichten im Glück, vom Glück. „Lasst uns über die Liebe reden …“, und dann erzählt man vom ersten Kennenlernen, von der Aufregung der Verliebtheit, vom Rendezvous ein paar Tage oder ein paar Wochen später.
Über die Liebe zu reden, hellt jeden Lebenslauf auf; da muss man nichts schönfärben oder zurechtpolieren. Die Liebe hat immer bezaubernde Überraschungen parat.
Und dann gibt es auch und vor allem die berührende Liebe einer Frau zu ihrem, unserer Welt allmählich entschwindenden Mann, die Liebe der jüngeren zur älteren Schwester, einer Mutter zu ihren Kindern, die Liebe zwischen zwei ungleichen Freunden, die Liebe eines Menschen zum Sport, zur Musik, zum Zirkus und vieles mehr.
Ich habe im Laufe der Zeit Hunderte Trauerfamilien kennengelernt, die mir von ihrem oder ihrer lieben Verstorbenen erzählt haben, und Hunderte Male, nein: jedes Mal, ist es auch um die Liebe gegangen. Um die große, die lebenslange, die konfliktbeladene, die dritte nach der zweiten und der ersten. Aber immer war von der Liebe die Rede.
Natürlich endet manche Beziehung, manche Ehe in Bitternis, und manche Enttäuschung lässt sich nicht wegzaubern. Wenn die Liebes-Episoden in einer Menschenbiografie schier unüberschaubar werden, weil der verstorbene Vater noch zwei Kinder aus einer ersten Ehe und zusätzlich zu den beiden Kindern aus der zweiten, immer noch gültigen Verbindung, ein Kind aus einem Seitensprung … – dann lese ich aus dem wahrhaftigen Gedicht Was es ist von Erich Fried vor:
… Es ist lächerlich, sagt der Stolz
Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht
Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung
es ist was es ist, sagt die Liebe.
Damit lassen sich bei der Abschiedsfeier schwierige Situationen respektvoll und warmherzig auflösen, manchmal sogar kleinere oder größere Misslichkeiten im Familienverband bereinigen. „Es ist, was es ist. Es war, was es war…“
Ach, lasst uns über die Liebe reden! Mit all ihren Spiegelungen und Brüchen. Über die Liebe und über das Leben. Und vergesst nie: Jeder Mensch ist ein eigener Kosmos, einzigartig, unverwechselbar.
„Kommt ein Vogel …?“
(Robert Grannersberger, 1969–2016)
Die Sissy gibt sich alle Mühe, spricht ihrem Mann sanft, zärtlich die beiden Wörter vor: „Noch ein …“ Jetzt wartet sie geduldig, bis er, der Robert, das richtige Wörtchen gefunden hat. „Tor“, sagt er mit unsicherer Stimme.
Richtig, Robert. „Noch ein Tor!“ Also gleich noch einmal.
Für einen ehemaligen Fußballer ist das doch eine Winzigkeit. Wie oft hat er dieses Sätzchen im Stadion gebrüllt? „SAK vor, noch ein Tor!“ Wenn er selbst kickte, hatte er es aus den Kehlen der Fans gehört: „Grannersberger vor, noch ein Tor!“ Und jetzt?
Die Sissy gibt nicht auf, und der Robert strengt sich mächtig an. Neuer Versuch, dieses Kinderlied: „Kommt ein Vogel …“ – „… geflogen“. Bravo, Robert!
Am Ende seines Lebens war Robert Grannersberger ein Kind. Ein liebenswertes 47 Jahre altes Kind, ein lieber Mensch. Mit diesem verschmitzten Lächeln ab und zu; manchmal noch für ein paar Stunden den Schalk im Nacken. Wie auf dem Foto aus dem Steintheater in Hellbrunn auf der Traueranzeige. Und wie als Kind damals.
Er war dankbar für alles. Dankbar der Mama, die jeden Tag zu ihm herübergekommen ist. Dankbar für die zärtliche Bestimmtheit, mit der seine Frau, die Sissy, auf ihn aufgepasst, ihn an der Hand genommen und durch sein so klein gewordenes Leben geführt hat. Die an seiner Seite war in den Stunden der Angst, sich gefreut hat, wenn er sich wohlgefühlt hat. Das lange, langsame Abschiednehmen. Dieses nicht leicht zu verstehende, nicht leicht zu ertragende Sich-Entfernen aus der für uns überschaubaren Welt.
Es ist so. Jeder Mensch ist ein eigener Planet – wertvoll, faszinierend, schön, spannend, liebenswert, interessant, facettenreich, anders, unvergleichbar, einzigartig. Manchmal können wir Planeten uns einem anderen Planeten annähern, beschreiben mit ihm ähnliche Flugbahnen im Universum, spüren genau dieselben Schwingungen, fühlen einander unendlich nahe, auf ein und derselben Ebene. Für kurze oder lange Zeit. Man kann das Liebe nennen, Vertrautheit, Herzgefühle.
Manchmal bleibt uns ein anderer Planet fremd oder wird einem, wodurch auch immer, fremd. Vielleicht auch wir ihm. Und wir kreisen nebeneinander her, als würden wir nicht denselben Kosmos bewohnen. Aber immer bleibt dieser Planet, dieser Mensch einzigartig, besonders, mit all seinen Ecken und Kanten, Schrulligkeiten, Liebenswürdigkeiten und seinen Geheimnissen.
Der Planet Robert Grannersberger war ein besonderer Planet, ist auf seiner Umlaufbahn um und durch diese Welt gezogen. Mit seiner eigenen Antriebskraft, seiner eigenen Sehnsucht, seiner eigenen Liebe.
Manchmal, besonders in den Jahren dieser gnadenlosen Krankheit, waren seine Geheimnisse für andere nicht zu entschlüsseln. Warum ist er so? Warum verhält er sich so merkwürdig? Wo kommen seine Stimmungen her? „Es ist so geheimnisvoll, das Land der Tränen“, heißt es im Kleinen Prinzen von Saint-Exupéry. Manche Menschen haben den Planeten Robert im Laufe des Lebens aus den Augen verloren, ihn auf seinem Weg nicht mehr begleitet, begleiten können, begleiten wollen. Manchmal prallen Planeten auch gegeneinander, und einer wird oder beide werden aus ihrer Umlaufbahn geschleudert, für lange Zeit, für immer. Andere bleiben beisammen, in guten und in schweren Jahren.
Jeder Mensch ist ein eigener Planet: kostbar, einzigartig, besonders.
Am 2. April 1969 erblickt in Maxglan Robert Grannersberger das Licht der Welt, im gleichen Jahr wie Oliver Kahn geboren wurde, der Torhüter, im Jahr, in dem der erste Mensch den Mond betrat und die englische Rockband „Led Zeppelin“ ihre erste LP herausbrachte.
1969 – das Jahr, in dem der SAK 1914 im österreichischen Fußballcup gegen die renommierte Wiener Austria (mit Köglberger, Fiala, Parits in deren Reihen) spielte und 2:5 verlor. Bei den Blaugelben aus Nonntal kickten heimische Größen wie Hannes Granzer oder Fredl Kainberger. Robert Grannersbergers Herz wird immer für die Blaugelben, für seinen Verein schlagen, so wie sein Blut immer „stiegl-rot“ sein wird, wie das Rot seiner Brauerei. Eine treue Seele.
Robert ist das Jüngste von den vier Kindern der Maria und des Otto Grannersberger. Drei Geschwister gibt es bereits, jeweils im Abstand von vier Jahren geboren: Rosemarie, Othmar und Rudi. Der Vater ist gelernter Schlosser, Heizer bei der Stieglbrauerei und Nebenerwerbsbauer. Am kleinen Hof am Haslbergerweg gibt es zwei, drei Stierkälber, zwei, drei Kühe, ein paar Schweindln.
Der Robert ist ein quirliger Bub, voller Temperament, abenteuerlustig und unerschrocken. Kein „Kittlschliafa!“ Er kraxelt überall hinauf, auch auf den „Bimbo“, den Stier, auf dem er reitet, bevor er ihn in den Transportwagen Richtung Schlachthof treiben muss.
Der Robert ist kein Riese, als Kind kann er längere Zeit unterm Tisch durchlaufen, ohne sich den Kopf anzustoßen.
Angst ist ein Fremdwort für ihn, damals. Wie ängstlich wird er später sein, in den Zeiten der Krankheit, wenn ihm etwas fremd ist … eine Gegend, in der er noch nicht gewesen ist, ein Mensch, den er nicht kennt, und er sich lieber zurückzieht, daheimbleibt, die Augen schließt.
Furchtlos aber war er damals als Kind, beim Skifahren im Lungau, in der Heimat der Mutter, bei den Großeltern. Kein Weg durch den Wald war ihm zu gefährlich, kein Sprung über Gräben zu riskant. Mit den Geschwistern, Cousins, Freunden zuerst bergauf stapfen, eine Piste ausbretteln – und dann waghalsig „schuss“ runterbrausen.
Oder auf den Pferden, den Haflingern, auf den Bergpfaden, zwischen den Bäumen herumreiten. Schöne Erinnerungen an die Ferienzeit in Lamm/Krottendorf im Zederhaustal. Und dass sich die Kinder dort nicht unbedingt jeden Abend die vom Herumlaufen schmutzigen Füße waschen müssen, bevor sie zu Bett gehen – einfach herrlich!
Fußball, Roberts große Leidenschaft. Kaum dass er laufen kann, beginnt er auch schon zu kicken. Mit den anderen auf den Wiesen in Maxglan, später dann beim SAK. Mitte der 80er-Jahre spielt er bei seinem Verein, dessen Erste es grad in die oberste Spielklasse, die Bundesliga, geschafft hat. Mit Ballkünstlern wie Detlev Szymanek oder dem Holländer Frenkie Schinkels! Robert Grannersberger ist auf dem Sprung in die Kampfmannschaft, aber dann werfen ihn Verletzungen aus dem Spiel.
Aus der Traum von der großen Fußballerkarriere! Das Talent dafür hätte er gehabt. Geblieben sind die schönen Erinnerungen und der berechtigte Stolz auf seine Erfolge am Spielfeld.
Dann also die Berufslaufbahn. Koch wäre so ein Gedanke. Er kocht sein Leben lang gerne und gut, vom Braten bis zum Apfelstrudel. Aber der Vater hat für ihn, nach absolvierter Volksschule in Moos und Hauptschule in Maxglan, eine Lehrstelle bei der Brauerei ausfindig gemacht. Der Robert wird „Stiegler“, wie sein Vater. Ein „überzeugter Stiegler“, einer mit Leib und Seele, Haut und Haar. Als Brauer, bei der Aufsicht über die Flaschenabteilung, auch beim Bewirten in der Brauwelt oder am Rupertikirtag. Für seinen Betrieb Tag und Nacht bereit für eventuelle Notfälle.
Auch bei den Treffen, den Feiern, den sportlichen Betätigungen der „Stiegler“ ist Robert Grannersberger mit Begeisterung dabei, etwa an den Skitagen bei den „Stiegl-Rennen“ auf der Reiteralm.
Bei seiner ersten Hochzeit ist der Robert grad einmal 20 Jahre alt. Die Liebe hat ihre eigenen Regeln. Die Liebe kommt, die Liebe geht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Das Schönste aber, das die Liebe zu schenken hat, sind Kinder. Die schönsten Geschenke in Robert Grannersbergers Leben: Michael, Christian, Corina.
Drei eigene Planeten in diesem Universum, besonders, kostbar, einzigartig, mit ihren eigenen Träumen und Geheimnissen. Robert Grannersberger ist verdammt stolz auf sie gewesen, war glücklich mit seinen Dreien, hat alles Mögliche und Unmögliche für sie gemacht; gekocht hat er gerne für sie. Vielleicht haben sie ja auch die Liebe zum Sport von ihm, vom Vater, geerbt, den Mut fürs Leben …
„Kommt ein Vogel …“ – „… geflogen.“
Die Sissy ist es, die den Robert durch das letzte Viertel seines viel zu kurzen Lebens begleitet. Beim Tanzen lernen die beiden einander kennen, im „Stiegl“, bei einem Gschnas. Der letzte Tanz, ganz am Schluss, das war das behutsame Führen im Gleichschritt, auf die Terrasse … zum Badezimmer.
Damals, beim Kennenlernen, sind die Schutzengel zögernd im Gebälk gehockt, und die Sissy hat nur gedacht: „Bitte, tat’s endlich weiter!“ Sie haben die beiden zusammengeführt. Auch der Christian ist ihm ans Herz gewachsen. Und er dem Christian.
Die schönen Jahre … Robert Grannersberger war ein charmanter und zuvorkommender Gastgeber, seine Freunde, Elisabeths Freundinnen haben sich bei den beiden wohlgefühlt. Wie selig war er in der Natur, im Lungau, beim Schwammerlbrocken … das hat ihm Freude bereitet, wie konnte er sich über einen einzigen, grad aufgespürten Steinpilz freuen! So freuen sich Kinder und besondere Menschen!
Er, der Robert, wollte immer auch anderen eine Freude machen. Hat manchmal gesagt: „Ja, das mach ich gern“, um niemandem, auch der Sissy nicht, eingestehen zu müssen, dass er „das“ eigentlich gar nicht so gern macht. Flohmärkte, ja gern! Aber letztendlich eher, weil sie so gerne Flohmärkte besucht. Helfen, wenn jemand Hilfe brauchte – und niemandem zur Last fallen. Das war ihm wichtig!
Robert Grannersberger war ein „Geber“, einer der mit Freude gegeben hat, Zuwendung, Mithilfe, sein Lächeln. „Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb“, heißt es in der Bibel. „Je mehr du gibst, umso mehr wächst du“, schreibt Antoine de Saint-Exupéry, „… es muss aber einer da sein, der empfangen kann.“
Der Robert hat so viel gekonnt und so viel gemacht, im Haus, im paradiesischen Garten, hat sich um keine Arbeit gedrückt („Im Garten arbeiten. Ja gern!“), mit logischem Denken und hausmännischen Fertigkeiten ausgestattet. Mit seiner Liebe und seinem Engagement. Im Haus, ums Haus herum, und genauso in der Brauerei.
Die kleinen Tagträumereien … vielleicht ein Boot am Mittelmeer … Schiffskoch wäre doch ein schöner Beruf …
„Es ist verrückt, alle Rosen zu hassen, nur weil Dich eine gestochen hat. / Oder auf alle Träume zu verzichten, nur weil sich einer nicht erfüllt hat“, heißt es im Kleinen Prinzen.
Es hat nicht nur eine Rose gestochen und es haben sich einige Träume nicht erfüllt. Als ihm, dem gewissenhaften, seinen Betrieb so liebenden Menschen (das waren die Vorboten der Krankheit), Fehler bei der Arbeit unterlaufen sind … und immer öfter Fehler, da hat auch die Verstörtheit um sich gegriffen. Eines führt zum anderen. Unverständnis zum Wutausbruch, Fehler zu Ungeduld. Die frühe Pensionierung, krankheitsbedingt.
Der furchtlose Mann, der liebenswürdige Mensch auf dem Weg zum Kind, der einzigartige Planet Robert Grannersberger auf seinem Weg in ein für andere fremdes Universum. Nicht von allen, aber von seiner Frau Elisabeth, ihrem Sohn Christian, von der Mama und ein paar Herzensmenschen aus der Familie, aus dem Freundinnenkreis begleitet.
Natürlich haben die Rosen gestochen, als sich Freunde nicht mehr blicken ließen. Es ist nicht leicht, mit dieser unbarmherzigen Krankheit, die das Bekannte ins Fremde rückt, umzugehen.
Das lächelnde erwachsene Buddha-Kind, wie es aus der Steinhöhle in Hellbrunn hervorguckt, verschmitzt, den Schalk im Nacken. Aber wenn er den Rasen mäht, ruiniert er jetzt den Rasenmäher, und wenn er an der Heizung werkt, geht die Heizung kaputt. Und wenn er über die Straße läuft … dann ist die Sissy sein Schutzengel.
Den Pflegerinnen, ohne die das Alltagsleben nicht mehr möglich wäre, macht er den Kaffee, Gentleman, der er war, der er immer noch ist. Früher hat der Robert gerne gesungen, Schlager, die Lieder von Wolfgang Ambros oder Reinhard Fendrich. „Weus d‘ a Herz hast wia a Bergwerk …“ – „Kommt ein Vogel …“, sagt die Sissy, „geflogen“, fügt er hinzu.
Keine Lust mehr, zu entdecken, nicht mehr reden, nicht mehr schauen, einfach noch ein bisschen leben, geduldig, die kleine, große Zufriedenheit. Geborgen sein wie ein Kind.
Dann die Lungenentzündungen, das Krankenhaus, wieder heim ins Haus am Haslbergerweg. Die Betreuung durch Mitarbeiter des Palliativteams. Die Mama, die Sissy … nur noch Halten, Streicheln, ihm, dem Robert, leise, sanft vermitteln, dass alles gut ist.
„Als die Stunde des Abschieds kam, sagte der Fuchs zum Kleinen Prinz: ‚Adieu. Hier mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar!‘“
Vom Mädchen, das ein bisschen anders war
(Yuriko Natalie Hoshi, 1973–2013)
Was ist Glück? Was heißt: glücklich sein? Für jeden etwas anderes. Der eine ist glücklich über die teuren Geschenke, die er bekommt, zu Weihnachten etwa. Natalie Hoshi war glücklich beim Auspacken der Geschenke. Das Auspacken war ihr wichtiger als der Inhalt.
Das Glücklichsein, wenn man ganz große Karriere gemacht hat, ein stattliches Haus besitzt, kannte Natalie nicht. Sie war glücklich über ihre Arbeit als Hilfskraft im Landeskrankenhaus Salzburg, in der Abteilung für Physikalische Medizin und Rehabilitation. Die kleine Wohnung in der Lanserhofstraße in Maxglan, in der sie die letzten vier Jahre ganz allein gelebt hat, hat sie glücklich gemacht. Und zufrieden und auch stolz. Eigene Arbeit, eigene Wohnung. Ihr eigener Rhythmus, ihr eigenes, eigenständiges Leben. Man kann glücklich sein über einen Millionengewinn beim Glücksspiel. Oder glücklich sein, wenn einem die Patienten, für die man die Therapiebäder perfekt vorbereitet hat, Schokolade schenken, weil sie so zufrieden waren.
Natalie Hoshi muss oft glücklich gewesen sein. Es heißt, wenn man schnell unterwegs ist, beim sehr langen, kilometerweiten Laufen zum Beispiel, werden Glückshormone ausgeschüttet. Natalie Hoshi war in manchem langsamer als die anderen. Vielleicht war sie deshalb glücklicher, zufriedener? Oder anders glücklich, anders zufrieden.
Manche Menschen zeigen ihr Glücklichsein, indem sie alle und jeden umarmen und küssen. Natalie war, könnte man sagen, keine Welt-Umarmerin, aber sie war sehr glücklich, wenn Liam, ihr kleiner Neffe, grad 18 Monate alt, der Bub von Akemi, ihrer Schwester, und deren Mann Sven, die Ärmchen nach ihr ausstreckte, wenn er auf sie zutrippelte und sein Köpfchen in ihren Schoß legte. Liam war der, den sie, wenn er mit seinen Eltern zu Besuch war, umarmen und herzen konnte. Eine einzige Umarmung kann glücklicher machen als alle Freundschaftsküsse dieser Welt.
Ja, Nathalie Hoshi war oft glücklich über das, was wir im Hochmut, in unserer Gedankenlosigkeit, „Kleinigkeiten“ nennen. „Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das Große vergebens warten“, schreibt Pearl S. Buck, die Literaturnobelpreisträgerin, deren Tochter übrigens seit der Geburt an einer, damals nicht behandelbaren, Erbkrankheit litt.
Natalie Hoshi war eine Lehrmeisterin in Sachen Glück. Der Name Natalie hängt mit Weihnachten zusammen, das sie sehr gemocht hat. Er kommt vom Lateinischen „dies natalis“, also Tag der Geburt; übertragen: der Geburt Christi, Weihnachten. Natalie war sozusagen ein Weihnachtskind, mitten im Sommer geboren.
Als sie das Licht der Welt erblickte, in Tokio, hatte der Vater, Takashi Hoshi, ein weltweit gefragter Maschinenbau-Ingenieur, grad beruflich in Warschau zu tun. Und für das Baby war noch kein offizieller Name ausgesucht. Die Mama sagte Natalie zum Töchterchen. Die Japaner fanden diesen Namen wunderschön. Als der Vater von der Europa-Reise nach Tokio zurückkam, nannten sie bereits alle Verwandten und Familienfreunde Natalie. Dabei blieb es, bis heute.
Geboren wird Natalie Hoshi an einem Glückstag. Der 7.7. ist ein ganz besonderer Tag in Japan. Ein Festtag. Da wird Jahr für Jahr das Tanabata-Fest gefeiert. Kinder, die an diesem Tag zur Welt kommen, werden Glückskinder genannt. Das hat mit einer schönen Legende, der Sternenlegende zu tun. Der Geschichte der Prinzessin Orihime, Tochter des Himmelsgottes, die eine fleißige Weberin ist. Vor lauter Arbeiten ist es ihr nicht möglich, einen Mann an ihrer Seite zu finden. Da schickt ihr der Vater den Rinderhirten Hikoboshi und vermählt die beiden. Orihime und Hikoboshi entflammen sofort in großer Liebe. Ja, sie lieben einander so sehr, dass sie darüber vollkommen die Arbeit vergessen. Der Vater, der Himmelsgott, bekommt keine von seiner Tochter gemachten Kleider mehr. Und die Rinder seines Schwiegersohnes werden krank. Da erzürnt der Gott und verbannt mit seinen magischen Kräften den Hirten auf die andere Seite der Milchstraße. Und nur einmal im Jahr dürfen hinfort die Liebenden einander begegnen, an Tanabata, am 7. Juli, an dem der Legende nach die Sterne Altair und Wega sich am Nachthimmel treffen.
An diesem Tag werden in Japan poetische Wünsche auf bunte Papierstreifen geschrieben und an Bambusstangen befestigt, in der Hoffnung, dass sie in Erfüllung gehen.
Natalie Hoshi ist an einem Tanabata-Tag geboren, als erstes Kind von Takashi und Annemarie Hoshi. Die Mutter stammt aus Ostpreußen, der Vater aus Japan. Sie lernen einander in Düsseldorf kennen, bei der Arbeit. Der Maschinenbau-Ingenieur muss, für die japanische Firma Mitsui, später dann für Sony, oft seinen Wohnort, seine Lebensadresse wechseln. Geheiratet wird in Düsseldorf, aber dann geht es für vier Jahre nach Tokio. Und jetzt gehört also Natalie zu ihnen.
Bald führt die Lebensreise zurück nach Düsseldorf, wo zwei Jahre nach Natalie das zweite Mädchen, Akemi, das Licht der Welt erblickt. Dann Wien für zehn Jahre, schließlich Salzburg. Die kleine Familie Hoshi ist immer dort daheim, wo der Vater zu arbeiten hat.
In Wien lebt man in Mauer, im 23. Bezirk. Ganz in der Nähe befindet sich der Waldorfkindergarten. Hier fühlt sich Natalie wohl, findet Freunde, ist bei den Spielen und Späßen mit dabei. Sie ist kleiner als die anderen Kinder, aber das macht nichts. Sie ist ein bisschen langsamer. Das macht nichts. In Wien, auch dann in der Waldorfschule, ist das kein Problem. Natalie erlernt ein Instrument – die Leier. Die kleine Schwester, Akemi, spielt Geige.
Ach, Weihnachten ist immer so schön. Erst die Geige, dann die Leier. Das Weihnachtsevangelium, von der Mama gelesen, der Christbaum. Das Auspacken der Geschenke. Die Wiener Jahre sind eine unbeschwerte Zeit. In der Schule eine tolle Lehrerin, fröhliche, nette Mitschüler. In der Freizeit alles, was Spaß macht: Schwimmen, Radfahren, im Winter Skifahren. Mit der Schwester im Garten herumtollen. Ein bisschen langsamer, aber darauf kommt es nicht an. Niemandem.
In Salzburg, so scheint es, kommt es darauf an. Keine so aufmerksame Lehrerin mehr, keine so fröhlichen, netten Mitschüler. Oder nur wenige. Nur weil sie, die Natalie, ein bisschen anders ist, ein bisschen langsamer? In Salzburg gibt es eine Diagnose für dieses Anderssein. Die lautet „Turner-Syndrom“, eine Chromosomen-Besonderheit. Damit wird man geboren. Jedes 2.500-ste Mädchen wird damit geboren. Auch wenn man an Tanabata zur Welt gekommen ist.
Jetzt ist das Mädchen 13 und es heißt: Mit diesem Syndrom kann man gut leben. Ein bisschen was ist anders, manche Entwicklung stellt sich zeitverzögert ein. Darauf kommt es nicht an. Vielen schon. Vor allem Mitschülerinnen und Mitschülern, die grad mitten in der Pubertät stecken, mit allem, was dazugehört.
Bei Natalie ist die Pubertät nicht ausgebrochen. Jetzt reden die anderen von ach so wichtigen Dingen, die ihr nicht vertraut sind. Mopedfahren, Tanzen, heiße Partys, Flirten. Da kann, da will sie nicht mitreden, nicht mitmachen. Um die Kleine, die Langsame kümmern sich nur einige aus der Klasse. Die Schule bringt sie trotzdem bis zum Abschluss hinter sich. Die Familie kümmert sich umso mehr. Die Mutter, die Schwester, die ihre Natalie im Haus in Parsch beschützen, behüten, umsorgen.
Das Mädchen hat vieles, was andere nicht haben. Natalie ist äußerst gewissenhaft, vergisst nie etwas. Wenn man ihr sagt: „Weck mich um viertel nach sechs in der Früh“, weckt sie einen um viertel nach sechs in der Früh. Sie merkt sich alle Daten, alle Geburtstage. Man kann sich auf sie voll und ganz verlassen. Sie ist pünktlich, manchmal – nicht immer zur Freude der anderen, ihrer Schwester zum Beispiel – über-überpünktlich.
Nach der Schule die Familien-Überlegungen, welchen Beruf Natalie ergreifen könnte: Was kann sie machen? Wo wird sie akzeptiert? Was will sie selbst? „Weiß ich nicht“, sagt sie auf die letzte Frage. Die Mutter schickt sie auf berufsorientierte Jugendseminare in Deutschland. Massage wäre eine Möglichkeit, vor allem, als eine Ausbildnerin meint: „Die Natalie hat schöne, energiestarke Hände.“ Sie lässt sich in diversen Massagetechniken ausbilden, auch in Shiatsu-Therapie, massiert eine Zeit lang im Bekanntenkreis. Aber, auch das ein Symptom ihrer Erkrankung, sie scheut Körperkontakt, Berührungen sind ihr nie wirklich angenehm. Umarmungen auch nicht.
Natalie Hoshi werden 50 Prozent Behinderung attestiert. Da schafft Prof. DDr. Anton Wicker, der Primararzt auf der Uni-Klinik für Physiotherapie und Rehabilitation am Landeskrankenhaus, für sie eine eigene Arbeitsstelle. Als Hilfskraft, zuständig für die Bäder, auch für die Magnetresonanztherapie. Außerdem ist sie die verlässlichste Post-Vermittlerin, die sich denken lässt. Jetzt hat sie ihre fixen Aufgaben, ihren exakten Arbeitsrhythmus. Acht Jahre lang ist sie auf ihrer Station glücklich und zufrieden. Mit dem Job, mit den liebenswürdigen Mitarbeiterinnen, mit dem Essen in der Spitalskantine.
Akemi, die Schwester, ist mit 18 von daheim ausgezogen, ist nach Linz gegangen, um – nach der Waldorfschule in Salzburg – dort die Matura zu machen, und schließlich nach Amerika, um Psychologie und Kriminalistik zu studieren und auf diesen Gebieten den Bachelor und das Master-Diplom zu erwerben. Seit 2004 lebt sie mit ihrem Mann Sven in Malaysia.
2004 stirbt der Vater, Takashi Hoshi. Die Mama und die Natalie sind und bleiben unzertrennlich, ganz aufeinander abgestimmt. Im Jahr nach Vaters Tod bekommt Natalie ihren Arbeitsplatz. Und schließlich, 2009, ihre eigene Wohnung. Und kommt prima mit allem zurecht. Das große Glücklichsein, die ganz große Zufriedenheit. Eigene Arbeit, eigene Wohnung, eigener Lebensrhythmus.
Am Vormittag wird im Krankenhaus gearbeitet, zu Mittag in der Kantine gespeist. Am Nachmittag gibt es fixe Termine: Tee zubereiten, Duschen, Wäschewaschen im Keller. Alles in ihrem Tempo, gründlich und genau geplant. Und dann, wichtig, um Punkt 18 Uhr im Ersten Deutschen Fernsehen die Vorabendserie Verbotene Liebe. Bitte ja nicht anrufen um diese Zeit! Seit 1995 gibt es diese Daily Soap, Woche für Woche, von Montag bis Freitag. Sehr viele Folgen wird Natalie Hoshi nicht versäumt haben.
Ihre Schwester Akemi schaut sich in der Ferne, in Malaysia, viele Folgen im Internet an, damit sie Bescheid weiß, wenn Natalie sie am Telefon fragt, was sie von dieser oder jener Liebesverwicklung in der Verbotenen Liebe hält. Zu ihrem 40. Geburtstag, heuer am Tanabata-Tag, hat Akemi für ihr Schwesterherz eigenhändig unterschriebene Autogrammkarten der wichtigsten Darsteller dieser Lieblingsserie per Post bei der ARD besorgt. Was für ein kleiner, großer Liebesbeweis!
Der 40. Geburtstag. Ein festliches Essen mit ein paar Freunden und der Familie natürlich beim Schützenwirt in St. Jakob. Geburtstage hat sie sehr gemocht. Und Geschenke vor allem, weil man sie auspacken konnte.
Was Natalie Hoshi noch gern gehabt hat? Schwimmen, eine richtige Wasserratte ist sie gewesen. Was für ein gutes Gefühl, wenn der Körper im See, im Meer schwerelos wird. In Griechenland, in Jugoslawien, in der Türkei, am Wallersee, im Schwimmbad.
Reisen war schön. Immer mit der Familie. Zur Akemi nach Amerika, nach Asien. Viermal war sie bei ihr in Malaysia. Ist nach Thailand, Kambodscha, Indonesien, Singapur mitgeflogen. Das hat sie toll gefunden, aber es hat sie auch immer belastet. Weil dadurch ihre Alltagsroutine durcheinandergekommen ist. Was tun wir am Abend? Was geschieht morgen? In einer Stunde? Ungewissheit hat Natalie sehr verunsichern können. Dann hat Akemi sie wieder beruhigt. Bei ihr war sie in sicheren Händen. Behütet, beschützt.
Ein Schokoladen-Fan ist sie gewesen. Die Süßigkeiten im Café Schatz hat sie nicht verachtet; überhaupt das Essen, wichtig! Als Kind am liebsten: Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Jeansröcke hat sie gerne getragen. Niemals Hosen. Ihre bevorzugte Kleiderfarbe: blau. Eine Orchidee, die ihr die Schwester einmal schenkte, hat sie durch viele Winter gebracht. „Akemi, deine Orchidee blüht immer noch!“
Malkurse bei Karin Unterburger, einer Maltherapeutin, hat sie besucht und dabei erstaunliche Bilder geschaffen. Bilder in zarten Farben, mit einer duftigen, berührend positiven Ausstrahlung. Manchmal musste man sie ein bisschen anschubsen, aber dann hat sie mit Freude weitergemalt. Der Mutter hat sie manches Bild überlassen, aber nur für einige Zeit, als Leihgabe. Natalie Hoshi war stolz auf ihre Werke.
Einmal, da war sie 23, 24 Jahre alt, hat sie begonnen, für Udo Jürgens zu schwärmen und hat sich alle CDs von ihm gekauft. Ein jahrelanges Schwärmen ist daraus geworden.
Und später für den Schauspieler und Fernseh-Conférencier Alfons Haider. Sogar seine Biografie hat sie gelesen, als eines der wenigen Bücher in ihrem Leben. Man nennt ihn den Küsserkönig, weil er so charmant und formvollendet allen Damen die Hand küsst. Im Fernsehen hat sie ihn bewundert, einmal sogar live im Salzburger Landestheater, das ist grad einmal ein Jahr her, im Stück Butterbrot von Gabriel Barylli. Der Onkel Heinz hat sie oft zum Lachen gebracht, auch wenn er sie ein bisschen auf die Schaufel genommen hat.
Liam, ihr kleiner Neffe, war der wärmste Sonnenstrahl in den letzten 18 Monaten. Wenn er ihr die Ärmchen entgegengestreckt, seinen Kopf in ihren Schoß gelegt hat, wenn sie ihn hochgehoben hat. Von ihm hat Natalie gelernt, dass man manchmal Rücksicht nehmen muss. „Wir müssen es so machen, wie es für den Liam richtig ist!“ Sie hat auch gelernt, auf die Mama Rücksicht zu nehmen, als ihr klar geworden ist, dass selbst die Mama nicht unverwundbar ist, die Mama, die ihr immer ganz, ganz nahe war und auch jetzt noch ist.
Von der Natalie, sagt Akemi, die wunderbare Schwester, hat man lernen können, dass man die Welt nicht immer durch seine eigenen Augen beurteilen kann, sondern offen sein muss für andere Betrachtungsweisen. Natalie lebte, so Akemi, in ihrer eigenen Welt, die nicht für alle zugänglich war und die andere Werte hatte. „Entschleunigen“ konnte man von ihr lernen. Selbst einmal langsamer werden.
„Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das Große vergebens warten.“ Natalie Hoshi war, weil sie ein bisschen anders war, eine Lehrmeisterin für die anderen. Eine Lehrmeisterin in Sachen kleines, großes Glück und Zufriedenheit.
Dem himmlischen Stern hinterdrein
(Richard Mühl, 1947–2012)
„Deine Wangalan“ heißt die kleine Melodie, die du sehr gemocht hast, Richard. Tobi Reiser, der Jüngere, hat sie komponiert, das Reiser-Ensemble hat sie gespielt. Wir waren Hirten beim Salzburger Adventsingen, lang ist es her. Tobi Reiser, Karl Heinrich Waggerl, das war unsere Bubenzeit, Hirtenstock und Filzhut, der Andachtsjodler und der Stern, dem wir andächtig Jahr für Jahr gefolgt sind, auf dem Weg zum Stall von Bethlehem, auch wenn wir längst gewusst haben, dass der Stern bloß ein heller Scheinwerfer hoch droben im Beleuchterhimmel in der Aula oder im Festspielhaus gewesen ist.