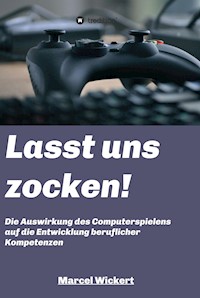
3,99 €
Mehr erfahren.
Über viele Jahre hinweg wurde der zunehmende Einfluss von Computerspielen auf ihre Nutzer unter den potenziellen Gefahren der Aggressionssteigerung, suchtähnlicher Abhängigkeit oder des nachhaltig negativen Einflusses auf die Lernfähigkeiten stigmatisiert. Dabei zeigt die moderne Forschung ein oftmals konträres Bild zu der landläufigen Meinung, dass das Spielen mit Konsolen, Handys und Computern einen allzu negativen Einfluss auf die meist jungen Nutzer ausübt. In einer Zusammenstellung jahrelanger Forschungsergebnisse soll dieses Buch dazu beitragen, das Themenfeld der Einflussnahme von Computerspielen auf die Kompetenzentwicklung von zumeist beruflichen Fähigkeiten genau zu durchleuchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Lasst uns zocken!
Die Auswirkung des Computerspielens aufdie Entwicklung beruflicher Kompetenzen
Marcel Wickert
© 2019 Marcel Wickert
Umschlaggestaltung, Illustration: Marcel Wickert
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN Taschenbuch: 978-3-7482-4354-0
ISBN Hardcover: 978-3-7482-4355-7
ISBN e-Book: 978-3-7482-4356-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Computerspiele
2.1 Definition und Beschreibung
2.2 Geräte und Gegenstände
2.3 Historie
2.4 Nutzer
2.5 Genre
2.6 Motivation
2.7 Wesen
2.8 Handlungsanforderungen und Einwirkungsmöglichkeiten
3. Kompetenzen
3.1 Abgrenzung des Kompetenzbegriffs
3.1.1 Allgemeine Darstellung
3.1.2 Historische Entwicklung des Kompetenzbegriffs
3.1.3 Kompetenzmodelle
3.1.3.1 Abgrenzung
3.1.3.2 Kompetenzmodell nach Klafki
3.1.3.3 Kompetenzmodell nach Weinert
3.1.4 Abgrenzung berufliche Kompetenz
3.2 Anwendung des Kompetenzkonzeptes
3.2.1 Kompetenzdimensionen – Aspekte beruflicher Handlungskompetenzen
3.2.2 Kompetenzstufen
3.2.3 Messung
3.2.4 Gütekriterien
3.2.5 Notwendigkeit und Umsetzung
4. Auswirkungen der Computerspielnutzung
4.1 Nutzerzahlen und Einsatz
4.1.1 KIM-Studie und JIM-Studie
4.1.2 Integration in schulische Bildung
4.2 Wirkungsweise von Computerspielen
4.2.1 Neuropsychologische Lernwege
4.2.2 Transfernotwendigkeit und Kompetenzerwerb
4.2.3 Besondere Motivation
4.2.4 Computerspielkulturen
4.3 Auswirkungen von Computerspielen
4.3.1 Kognitive und methodische Auswirkungen
4.3.2 Sozialisationsbezogene Auswirkungen
4.3.3 Kommunikative Auswirkungen
4.3.4 Auswirkungen auf Empathie
4.3.5 Aggressionsproblematik
4.3.6 Computerspielsucht
4.4 Kompetenzförderliche Eigenschaften von Computerspielen
4.4.1 Eltern als Einflussnehmer auf Effekte der Computerspielnutzung
4.4.2 Spieleentwickler als Einflussnehmer auf Effekte der Computerspielnutzung
4.5 Anstöße zur Forschung
5. Zusammenfassung
Für Sabrina
Nicht alle Superhelden stammen aus Computerspielen
1. Einleitung
Über viele Jahre hinweg wurde der zunehmende Einfluss von Computerspielen auf ihre Nutzer unter den potenziellen Gefahren der Aggressionssteigerung, suchtähnlicher Abhängigkeit oder des nachhaltig negativen Einflusses auf die Lernfähigkeiten stigmatisiert. Zudem haben Erfindungen wie der Game Boy, das Super Nintendo oder die Play Station nicht nur das Spielverhalten, sondern auch die Gewohnheiten der Gesellschaft und der damals zumeist jugendlichen Nutzer verändert.
Heute ist die erste Generation der Computerspieler bereits erwachsen und da ein Großteil von ihnen noch immer regelmäßig in virtuelle Spielsituationen eintaucht, steigt durch den Nachwuchs an aktiven Computerspielern die Bandbreite an Nutzern stetig an. Dies lässt sich auch in der Vielzahl unterschiedlicher Genre und Titel erkennen, die die enormen Interessenfelder und Voraussetzungen der einzelnen Nutzergruppen nahezu komplett abdecken.
Während das traditionelle Spielen dadurch in maßgeblichen Bereichen durch virtuelle Spielwelten zunehmend abgelöst wird, steigt auch der Einfluss der Computerspiele auf ihre Nutzer. Wie bereits erwähnt, wurden und werden entsprechende Spiele seit langem sehr kritisch beäugt und sind das Zentrum vielschichtiger wissenschaftlicher Untersuchungen. Dabei konnten die gesellschaftlichen Befürchtungen in den meisten Fällen zwar nicht bestätigt werden, dafür allerdings einige positive Auswirkungen der Nutzung von Computerspielen verifiziert werden. Hier sind beispielsweise gesteigerte Fähigkeiten im Umgang mit Computern, technisches Verständnis oder Reaktionsschnelligkeit oftmals genannte Faktoren, die einer Nutzung positive Auswirkungen unterstreichen.
Auch vor diesem Hintergrund lässt sich ein bedeutender Anstieg an Forschungsarbeiten zu der Thematik des Einflussfaktors Computerspiele auf ihre Nutzer und die Gesellschaft verzeichnen. Dabei liegt der Fokus entsprechender Bemühungen in der Regel auf Beschreibung von Verhaltensänderungen.
Das Ziel des vorliegenden Buches beläuft sich auf eine explizite Darstellung des Einflusses von Computerspielen auf die Ausbildung von Fertigkeiten und Fähigkeiten, die vor allem von beruflicher Bedeutung sind. So ist neben einem Blick auf die historische Entwicklung von Computerspielen allgemein, zunächst abzugrenzen, inwieweit man diese als Kompetenzen ausgeschriebenen Befähigungen darstellen kann und wie sie sich prinzipiell in der Umwelt verändern und anpassen. Bereits hier lassen sich einige Problematiken ausmachen, da der Kompetenzbegriff als solcher keiner einheitlichen Definition unterliegt, sondern von vielen Autoren sachbezogen beschrieben und abgegrenzt wird. Vor dem Hintergrund einer Darstellung der Veränderlichkeit beruflicher Kompetenzen ist hier allerdings eine hinreichend genaue Abgrenzung vorzunehmen, welche sowohl der aktuellen Begriffsverwendung und –konzeption als auch des Einsatzes innerhalb dieser Ausarbeitung gerecht wird.
Grundlegend ist hierbei vor allem ein tiefgreifendes Verständnis der Strukturen die dem Kompetenzbegriff und seiner Wirkungsweise zugrunde liegen. So gilt es die hier verankerten Ebenen des kognitiven, methodischen, empathischen und sozial-kommunikativen Kompetenzensembles offenzulegen und nach einer Analyse der von Computerspielen ausgehenden Einflussfaktoren auf deren Ausbildung einzugehen.
Dabei ist vor allem der Bereich der Wirkungsweise oder Einflussnahme der Spiele ein zentraler Aspekt. Dabei geht es darum, wie die Spieler untereinander kommunizieren, ob sie sich den Herausforderungen einzeln oder im Verbund stellen, wie Handlungsfelder innerhalb der Spielwelten erschlossen werden können oder wie man Erfolge und Misserfolge verarbeiten kann. Zwangsläufig muss demnach auch ein Rückschluss auf der bereits angesprochenen Aggressionsproblematik erfolgen und die Gefahr einer sogenannten Computerspielsucht abgegrenzt werden. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei weiterhin in der Motivation, welche als Grundvoraussetzung jeglichen Kompetenzaufbaus unverzichtbar ist und im Rahmen der Nutzung von Computerspielen dabei umfassend wahrgenommen wird.
2. Computerspiele
2.1 Definition und Beschreibung
Der Einzug der Computerspiele in die Spielkultur hat das Spielverhalten von Kindern und Jugendlichen wesentlich beeinflusst. Während für viele Nutzer diese Technologie erst im Jugendalter nutzbar wurde, sind jüngere Generationen mit diesem „Arbeits- und Spielgerät“ wie selbstverständlich aufgewachsen. 1
Dabei existiert eine große Vielfalt sowohl in Bezugnahme auf die Anzahl der Spiele, der hierfür nutzbaren Plattformen und Konsolen als auch Genre und Themen. Insofern fällt es schwer, eine einheitliche und stringente Definition zu formulieren, die den Begriff „Computerspiele“ vollständig umfasst. Allgemein lässt sich zunächst herausstellen, dass Computerspiele das Attribut „digital“ aufweisen, sie also mittels elektronischer Geräte oder in digitaler Form genutzt werden.2 Sie zeichnen sich außerdem dadurch aus, dass eine Spielsituation durch Bild- und Tonaufnahmen auf einem Monitor dargestellt wird und durch das Nutzen von Eingabegeräten (z.B. Joystick, Tastatur, Controller) verändert werden kann. Der Computerspieler sieht sich dabei stets wechselnden Situationen und Anforderungen gegenübergestellt, auf welche er sein spielerisches Handeln abstimmen muss. Dabei sind wichtige Elemente im Computerspiel animiert, d.h. sie sind veränderbar, nutzbar oder bewegbar. 3
Dennoch bietet die zeitgenössische Literatur eine weitgefächerte Bandbreite an Definitionen und Abgrenzungen, die das diese Thematik umreißen. Dies basiert auf dem Standpunkt, aus welchem die Thematik betrachtet wird und die eine mögliche Beschreibung entsprechend einfärbt. So lassen sich Definitionen aus Sicht der notwendigen Systemvoraussetzungen4, der Kommunikation und Interaktion5 oder dem Moment der virtuellen Welt finden.6
Allgemein wird die Nutzung einiger Spiele mit Hilfe verschiedener Zusatzelemente in der Kopf- oder Fußleiste durch Tabellen, Schaubilder oder Menüleisten vereinfacht. Oftmals bietet dies die Option des Perspektivenwechsels innerhalb eines Spiels und enthält wichtige Funktionen zur Ergänzung des Geschehens und Ablaufs. 7
Durch die Erfassung der sich wandelnden Gesamtsituation erhält der Spieler tiefgehende Einblicke in das Geschehen und den Handlungsablauf. Dies beläuft sich insbesondere auf die Bedeutung der Spielfiguren, ihre wechselseitigen Beziehungen sowie Fähigkeiten und Komponenten. Dieser Prozess, in dem der Nutzer einen Lernprozess auf der Grundlage seiner medialen Erfahrungen im Spiel durchläuft wird als „Computerspiel-Sozialisation“ bezeichnet. 8
2.2 Geräte und Gegenstände
Bezüglich des Hardwareeinsatzes unterscheidet man vier Spielformen:
(1) Arcade-Games zeichnen sich durch einen feststehenden Spielautomaten aus, wie sie vor allem in Spielhallen und Spielotheken zu finden sind. Eingabemittel sind dabei fest in den Spieleautomaten integriert. Das Spiel selbst wird i.d.R. nur durch unmittelbare Zahlung eines geringen Geldbetrages in Münzform nutzbar gemacht.9
(2) (Eigentliche) Computerspiele werden unter Nutzung von unterschiedlichen Formen von Personal-Computern (PC) gespielt. Während bis vor einiger Zeit die meisten Spiele durch auf- oder abspielen einer CD-Rom oder Bluray-Discfrüher auch durch Disketten- nutzbar gemacht werden, werden Spiele heute zunehmend durch Downloads der entsprechenden Software über das Internet installiert. 10
(3) Konsolenspiele (Videospiele) nutzen als Hardware eigens für die Spielenutzung konzipierte Konsolen. Diese werden durch Nutzung des Fernsehgeräts abgespielt und sind durch abgestimmte Komponenten besonders für den Spielegebrauch ausgerichtet und werden ebenfalls durch CD-Roms und Bluray-Discs abgespielt. Ältere Videospiele wie beispielsweise das „Super Nintendo“ werden mittels Kassetten abgespielt, wobei diese Methodik seit Einführung der „Play Station“ in den 1990er Jahren überholt ist.11
(4) Tragbare Videospiele verbinden das Prinzip der Konsolenspiele in einem „All-in-one-Prinzip“ mit der Option der Mobilität. Dabei sind Bildschirm, Eingabemittel, Stromversorgung und alle weiteren notwendigen Komponenten in einer tragbaren Konsole integriert. Vorreiter und bekanntestes Modell ist dabei der Gameboy. 12
Auch wenn diese Spielformen auf unterschiedlichen Ideen beruhen, laufen alle Erscheinungsformen auf den gleichen technischen Voraussetzungen, Grundideen und Spielabläufen, weshalb viele Spiele gleich für mehrere der oben beschriebenen Hardware veröffentlicht werden. 13
2.3 Historie
Die ersten Computerspiele wurden bereits zu Beginn der 1960er Jahre entwickelt und trotz der noch sehr eingeschränkten Umfänge und Nutzerfreundlichkeit recht begeistert angenommen. So entwickelte ein Forscherteam aus Massachusetts ein simpel gehaltenes Weltraum-Geschicklichkeitsspiel unter dem Namen „Spacewar!“, welches heute allgemein als das Geburtsmoment von Computerspielen angesehen wird. 14
Eine erste bedeutende Revolution entstand um 1972 durch die Firma Atari, welche unter der Leitung von Nolan Bushnell stand. Aufgrund der exorbitanten Publikumswirkung wurde das Spiel „Pong“ ein sehr lukratives Produkt und ebnete den Weg für folgende Spiele. Hierbei ging es in einer Tennis-Simulation darum, möglichst oft einen Ball zu treffen und dabei so zu platzieren, dass dieser für den Gegenspieler nicht mehr zu erreichen war. 15
In dem Nachfolger „Breakout“, dessen Entwicklung 5 Jahre später abgeschlossen wurde, hatte man erstmals auch die Möglichkeit ohne tatsächlichen Mitspieler und gegen einen Computergegner mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen zu spielen. 16
Neben der immer besser werdenden Grafik gewannen zunehmend auch die Inhalte der Spiele an Qualität. So basiert das aus dieser Zeit stammende Spiel „Adventure“ einzig auf der Basis eines durch Texteingabe zu steuernden Inhalts. Dabei gibt der Nutzer zumeist durch Eingaben von „Yes“ oder „No“ an, wie sich die zentrale Figur im Spiel verhalten und somit die Spielsituation entwickeln soll.17
Durch einen Zusammenschluss der verschiedenen Entwicklungsrichtungen konnte der Markt weiter erschlossen werden, was zunächst durch Arcarde-Spiele gelang. Hierbei waren vornehmlich Titel wie Pac-Man oder Space Invaders beliebt und gelten daher auch heute noch als Klassiker in diesem Genre.18
Mit der voranschreitenden Entwicklung von immer leistungsfähigeren Computern stieg auch die Möglichkeit der Spielevarianten. So wurde zu Beginn der 1990er Jahre durch Nintendo eine wegweisende Entwicklung vorangetrieben. Das bereits von Atari umgesetzte Konsolenprinzip wurde weiter ausgebaut und mit neuen Grafikmodulen und breiter aufgestellten Nutzungsmöglichkeiten genutzt. Später wurde mit der Einführung der „Play Station“ von Sony, die erstmals eine Spielekonsole auf Basis der Nutzung einer CD-Rom kreierte, die Generation an Computerspielen begonnen, die auch heute noch für moderne und weit entwickelte Computerspiele steht. 19
Dabei trägt auch das Internet einen beträchtlichen Weg zur Spieleentwicklung bei. Heute besteht ein großer Teil der Computerspiele zumindest in Teilen aus der Basis eines virtuellen Austauschs übers Internet. Es können Spieler gegeneinander oder miteinander spielen, Ergebnisse können verglichen oder sich über ihre Fortschritte ausgetauscht werden. Ein besonders beliebtes Spiel ist dabei WoW (World of Warcraft), in dem die Spieler in einer Fantasiewelt gegen computergesteuerte Monster und Mitspieler kämpfen. 20
Verglichen mit den Anfangsjahren haben Computerspiele heute allerdings i.d.R. den Status einer hohen „Verderblichkeit“. Diese ist zurückzuführen auf eine ständige Neu- und Weiterentwicklung von einzelnen Spielen und Spieleserien. Die Verderblichkeit wird durch die Gefahr von Schwarzkopien dabei noch verstärkt.21
2.4 Nutzer
Zunächst lässt sich abgrenzen, dass Computerspiele hinter dem Fernsehen zu dem am zweithäufigsten genutzten Medium avancieren. Dabei steigen die Zahlen der Konsumenten nach wie vor an, so dass heute bereits fast 80% der Jugendlichen regelmäßig Computerspiele nutzen. Weiterhin wurde festgestellt, dass fast jedes Kind im Alter zwischen 6 und 13 Jahren in irgendeiner Weise Berührungspunkte mit dem Medium Computerspiele durchläuft.22
Auch wenn deutlich weniger Mädchen als Jungen an virtuellen Spielen teilnehmen, lässt sich erkennen, dass Mädchen zunehmend öfter zu Computerspielen greifen als früher. So liegt der Anteil der Personen die überhaupt keine Computerspiele nutzen heute bei deutlich unter 20%.23
Die Spieler selbst lassen sich dabei vor allem auf der Grundlage der Motivation ihres Spielens kategorisieren. Der Spieledesigner Bartle typologisiert die Spieler vor diesem Hinblick gemäß in vier Gruppen, wie in der nachstehenden Grafik dargestellt wird.
Abb. 1: Player Types(Quelle: Designing virtual wolrds, Richard Bartle, 2003)
Auch wenn diese Eingliederung einer stetigen und kritischen Betrachtung unterliegt24, hat sie auch heute noch bestand und wurde lediglich durch Yee im Jahre 2006 auf der Grundlage einer langfristig angelegten Studie auf der Grundlage von Rollenspielen erweitert. 25
Eine repräsentative Untersuchung bezüglich der Nutzerbezifferung auf der Grundlage der Genres leisteten Quandt/Wimmer 2009. Dabei ergab sich folgendes Bild26
Genre/ Altersklassen
Erwachsene
Jugendliche
Gesamt
Rollenspiele
68,7%
65,3%
68,3%
Actionspiele
44,0%
60,0%
45,8%
Strategiespiele
35,1%
37,3%
35,4%
Sportspiele und Simulationen
14,2%
11,8%
14,0%
Tabelle 1: Auszug aus Spielenutzung, differenziert nach Erwachsenen versus Jugendlichen (Mehrfachnennungen möglich) (Quelle: Quandt/Wimmer 2009; 186)
So zeigt sich, dass Rollenspiele sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Jugendlichen am häufigsten genutzt werden, was sich mit der bereits vorab getroffenen Aussage deckt, dass gerade diese Spiele aufgrund einer starken und langfristigen Identifikation einen besonders motivierenden Einfluss auf die Nutzung mitbringen.
Der besondere Einfluss von Computerspielen auf jugendliche Heranwachsende ist ein stark diskutiertes Thema. Da hier die – wenn auch abnehmende- mit deutlichem Abstand größte Zielgruppe von Konsumenten liegt, sind gerade Kinder, Schüler, Studenten und jungen Berufstätige oftmals im Fokus von Umfragen und Untersuchungen zum Nutzungsverhalten.
Die KIM-Studie analysierte 2010 sowohl den Gerätebesitz als auch dessen Nutzung auf dieser Basis. Wie in der nachfolgend aufgeführten Grafik dargestellt hat sich demnach die Mediennutzung allgemein, aber vornehmlich die Nutzung von Spielekonsolen in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt.
Abb. 2: Gerätebesitz von Kindern im eigenen Zimmer(Möller, Glaschke: Computersucht. Was Eltern tun können, Seite 64)
Dabei liegt der prozentuale Anteil von jungen Computerspielen noch deutlich hinter den Erwartungen und belegt lediglich den vierten Platz in der Rangordnung der täglichen Freizeitbeschäftigungen von Kindern und Jugendlichen. 27
Betrachtet man allerdings das Medium „Computer“ als Zusammenschluss von PCs, Konsolen, tragbaren Konsolen und Handys, so zeigt sich, dass vor allem Jungen dieses Medium zu Spielzwecken nutzen, während Mädchen auch ausgewogen den Einsatz für Schule und andere Freizeitaktivitäten nutzen. 28
Nimmt man alle Nutzer zusammen, spielen noch immer fast ein Viertel der gesamten Bevölkerung in Deutschland regelmäßig Computerspiele. Dabei lässt sich allerdings ein Trend erkennen, nachdem die Nutzung mit zunehmendem Alter abnimmt. Interessant ist dabei auch die Erkenntnis, dass es nur selten Spieler gibt, die ausnahmslos alleine Spielen. Jedoch steigt diese Zahl mit zunehmendem Alter stetig an. Hierfür werden die Gründe in fehlenden Mitspielern bei der für die Zielgruppe ausgerichteter Spiele gesehen.29
Dennoch bleibt Computerspielen der Ruf inne, eine Spielform zu sein, welche den sozialen Kontakt zu anderen (Mitspielern) nachhaltig negativ beeinflusst. Oftmals spricht man sogar von einer Ausgrenzung sozialer Kontakte, da man weitestgehend nur alleine spielen könne. Hier lässt sich vornehmlich das Genre der Ego-Shooter als Spielform fokussieren, die diesen Ruf nachhaltig geprägt hat. Als „rotes Tuch“ für Erzieher und Pädagogen ist dieses Genre ohnehin Ausgangspunkt vieler Kritikpunkte, die oftmals unreflektiert auf andere Spielformen übernommen werden. 30
Dabei weisen nachweislich gerade Ego-Shooter eine sehr hohe soziale Komponente auf, da sie das soziale Miteinander (wenn auch in einer oftmals stark wettbewerbsbezogenen Variation) fokussieren. So konnte festgestellt werden, dass Spiele dieser Art nur dann langfristig gerne gespielt werden, wenn man (z.B. online oder im Netzwerk) mit und gegen andere reale Mitspieler spielt. Spielt man ausschließlich gegen den Computer, ebben die Motivation und damit die Spielenutzung schnell wieder ab. 31
Dahingehend lässt sich auch ein Trend erkennen, nach dem zunehmend Spielevarianten entwickelt werden, die sowohl online oder zuhause gemeinsam gespielt werden können. Selbst Rollenspielserien oder Simulationen bei denen eine gemeinschaftliche Nutzung zunächst eher destruktiv scheint, werden gerade auf das soziale Moment ausgerichtet. Als populäres Beispiel lässt sich hierbei u.a. Resident Evil nennen; ein Rollenspiel des Entwicklers Capcom. Der Spieler kämpft in einer von Zombies überfüllten Welt um das Überleben und löst dabei verschiedene Rätsel. Nachdem die ersten Teile dieser Reihe ausnahmslos als Singlegame ausgerichtet waren, enthalten die neueren Teile zuweilen nur noch die Option mit einem Partner (online oder im Multiplayermodus) zu spielen. Ähnliches lässt sich auch für Spieleserien wie FIFA oder Grand Tourismo sagen, deren Nutzung ebenfalls zunehmend auf Mehrspielervarianten zugeschnitten wird.32
2.5 Genre
Bereits seit Beginn der Computerspielekultur kristallisieren sich verschiedene Genre heraus, in welche sich die Spieltitel zuordnen lassen. Im Folgenden werden die Hauptkategorien dargestellt und sollen im weiteren Verlauf einer detaillierten Betrachtung unterliegen;
• Gesellschafts- und StrategiespieleTabelle 2: Gesellschafts- und Strategiespiele
Beschreibung





























