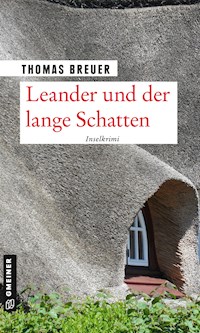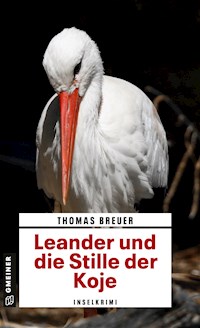Inhalte
Titelangaben
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Anhang: Die Wirklichkeit hinter der Geschichte
Danksagung
Mehr Inselkrimis im Prolibris Verlag
Info
Thomas Breuer
Leander
und die dunklen Mächte
Föhr-Krimi
Prolibris Verlag
Handlung und Figuren dieses Romans entspringen der Phantasie des Autors. Darum
sind eventuelle Übereinstimmungen mit lebenden oder verstorbenen Personen zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten, auch die des auszugsweisen Nachdrucks
und der fotomechanischen Wiedergabe sowie der Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen
insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
©Prolibris Verlag Rolf Wagner, Rasenallee 23 d, 34128 Kassel
Titelfoto: © Olaf Schlenger, Adobe Stock, Datei 469343627
Schriften: Linux Libertine
E-Book: Prolibris Verlag, 2025
ISBN E-Book: 978-3-95475-273-7
Dieses Buch ist auch als Printausgabe im Buchhandel erhältlich:
ISBN: 978-3-95475-263-8
www.prolibris-verlag.de
Der Autor
Thomas Breuer studierte Germanistik, Sozialwissenschaften und Pädagogik in Münster. Er unterrichtet seit 1993 die Fächer Deutsch, Sozialwissenschaften und Zeitgeschichte an einem Gymnasium im
Kreis Paderborn. Er lebt mit seiner Familie in Büren, Kreis Paderborn. Seit 2010 widmet er sich dem Schreiben und hat seither
zahlreiche kriminelle Kurzgeschichten und Kriminalromane um seinen
Protagonisten Henning Leander veröffentlicht, die auf Nordseeinseln spielen. Im Prolibris Verlag erschienen der
Helgoland-Krimi »Leander und der Rausch der Tiefe« und nun »Leander und die dunklen Mächte«.
Mehr Informationen zum Autor unter: www.breuer-krimi.de
Für Sina
Prolog
Es war das Trommeln seines Herzens, das ihn wieder zu sich kommen ließ. Laut pochte das Blut in den Ohren, dumpf das Herz in seiner Brust. Langsam
schlug es, viel zu langsam, das war ihm sofort klar. Und es konnte jede Sekunde
aussetzen.
»Scheiße, Mann, was ist mit ihm?«
Wo war er hier? Er quälte seine Augen auf. Verschwommen tanzten gelbe Lichtkugeln davor herum. Zwei
dunkle Schemen kamen näher, unklar wabernde Gesichter beugten sich zu ihm hinab. Wer, zum Teufel, waren
sie?
»Tu gefälligst was, verflucht noch mal! Wir können ihn doch nicht verrecken lassen!«
Diese Stimme! Leise drang sie zu ihm durch, wie durch Watte und aus weiter
Ferne, sie kam ihm bekannt vor.
Ein Schatten zog sich wieder zurück, verschwand im Nebel. Schritte entfernten sich, dumpfes Poltern. Jemand riss
an ihm herum, drehte ihn auf den Rücken, drückte auf seine Brust.
Und dann kam die Kälte. Von der Taille kroch sie in ihm hoch, eisige Kälte, während es langsam wieder schwarz vor seinen Augen wurde.
War so der Tod? Entwich auf diese Art das Leben aus einem menschlichen Körper? Und der Nebel: War das die Zwischenwelt?
Er begann zu zittern, nein zu schlottern. Seine Zähne schlugen klappernd aufeinander, der ganze Körper bebte in einem einzigen Kältekrampf.
Jetzt kamen die Schritte zurück. Dumpf klangen sie. Gummistiefel. Natürlich, das waren Gummistiefel auf Beton.
Schrill jetzt, wie in Panik, die Stimme: »Scheiße, Mann, der krepiert uns!«
Jemand griff nach seinem Kopf, quetschte Finger zwischen seine Zähne, zwang sie auseinander. Ein stechender Schmerz fuhr in seine Kieferknochen.
Er fühlte Tropfen auf der Zunge, brennend, scharf. Sie rannen die Kehle hinab, lösten einen Würgereflex aus, zum Husten war er zu schwach.
Der Herzschlag donnerte nun in seinen Ohren und in der Brust. Dann setzte er
aus. Kam nicht zurück. Schwärze fraß den Nebel, die Kälte entwich aus seinem Körper, Stille breitete sich aus.
Er fiel.
Kapitel 1
Drei Tage vorher
Am Mittwochmorgen hörte Leanders Herz auf zu schlagen. Gleichzeitig setzte seine Atmung aus.
Erschrocken riss er die Augen auf.
Wie gelähmt lag er in seinem Bett. Die plötzliche Stille machte ihm Angst. Nicht dass er sonst seinen Herzschlag gehört hatte, aber unterschwellig gespürt haben musste er ihn, denn nun fehlte etwas: das Pulsieren in den Adern, das
Pfeifen im Ohr, das ihn seit Jahren begleitete – all die Lebenszeichen, die einfach nur da sind, ohne dass man sie wahrnimmt.
Erst wenn sie plötzlich fehlen, wird man sich ihrer bewusst.
Panisch irrte sein Blick über die Balkendecke seines Schlafzimmers. Mit aufgerissenem Mund lag er da. Die
Lunge schien zusammenzufallen, der Hals schnürte sich zu. Ihm wurde bewusst, dass ihn nur noch Sekunden von seinem Tod
trennten.
Da verfingen sich seine Augen an dem Muster aus dunklen Astaugen und
Lebensringen in der hellen Deckenvertäfelung über dem Fußende seines Bettes. Es war jenes Muster, in dem er immer ein Gesicht erkannt
hatte.
Franziska!, war Leanders letzter Gedanke.
Kapitel 2
Der Anruf erreichte Franziska noch vor dem Frühstück.
»Du musst kommen«, tönte Toms aufgeregte Stimme aus dem Hörer. »Hier stimmt etwas nicht.«
»Jetzt mal langsam, Tom, was ist los?«
»Ich stehe vor Hennings Haus, aber er macht nicht auf. Dabei sind wir zum Frühstück verabredet. Wir wollten über mein neues Projekt sprechen.«
»Dann ist er Brötchen holen gegangen.« Franziska wunderte sich über die Aufregung. Sie kannte Tom zwar als einen geradezu hyperaktiven Menschen,
wenn es um seine fragwürdigen Heimatforschungsprojekte ging, aber im Alltag war er eigentlich immer
sehr gleichmütig und nicht aus der Ruhe zu bringen.
»Ich stehe aber schon eine halbe Ewigkeit vor seiner Tür.«
»Das stimmt«, hörte Franziska Johanna Husens Stimme aus dem Hintergrund. »Ich habe auch gar nicht gesehen, dass Henning das Haus verlassen hat. Er muss da
drin sein.«
Nun wurde Franziska doch etwas mulmig zumute. Im Umfeld des kleinen
Fischerhauses in der Wilhelmstraße in Wyk geschah nichts, was Hennings neugierige alte Nachbarin nicht mitbekam. »Könnt ihr durch eines der Fenster gucken?«
»Im Erdgeschoss ist nichts zu sehen«, antwortete Tom fast atemlos. »Da ist er nicht.«
»Und im Garten auch nicht«, rief Johanna dazwischen. »Ich habe natürlich zuerst über die Hecke gesehen.«
Offenbar hatte Tom sein Handy auf Lautsprecher gestellt.
»Vielleicht hat er das Haus verlassen, als Johanna … abgelenkt war.« Franziska bemühte sich um eine diplomatische Formulierung, weil sie nicht zu deutlich werden
wollte, was sie von der alten Frau und dem Ausspionieren von Nachbarn hielt.
Sie konnte förmlich sehen, wie die nun entrüstet den Kopf schüttelte. »Er wird bei Bäcker Hansen jemanden getroffen und sich verquatscht haben.« Franziska rekapitulierte kurz die allmorgendliche Routine ihres Freundes. »Er geht doch von Hansen aus immer zuerst auf die Mittelbrücke, bevor er wieder nach Hause kommt. Vielleicht hat er am Sandwall Bu-Bu
getroffen.« Wenn Henning auf den Buchhändler traf, konnte schon einmal eine halbe Stunde verfliegen. »Hast du versucht, ihn über sein Handy zu erreichen?«
»Natürlich!« Tom wurde nun langsam ungehalten. »Er geht nicht dran!« Und nach einer kurzen Pause, in der Franziska zwischen Selbstberuhigung und
mulmigem Gefühl hin- und hergerissen wurde, verkündete er entschieden: »Ich klappere jetzt die Stationen ab. Bäckerei, Mittelbrücke, Bu-Bu. Aber glaub mir, Franziska, hier stimmt etwas nicht. Das habe ich im
Gefühl.«
Nachdem Tom das Gespräch beendet hatte, wählte Franziska Leanders Nummer. Es meldete sich gleich die Mailbox.
Wahrscheinlich hatte er mal wieder vergessen, sein Handy aufzuladen.
Toms nächster Anruf erreichte sie eine Viertelstunde später. »Nichts«, stürzte er ohne jede Einleitung atemlos in das Gespräch. »Bei Hansen konnte sich keine der Verkäuferinnen erinnern, ob Henning heute schon da gewesen ist.«
Kunststück, dachte Franziska. Bei Bäcker Hansen tobt in der Saison der Bär. Da fällt ein einzelner Kunde nicht auf, wenn man als Verkäuferin im Akkord die Massen abarbeitet. Andererseits war Henning dort Stammkunde
und bestens bekannt.
»Dann bin ich zur Mittelbrücke gegangen, aber da war er auch nicht. Und Bu-Bu habe ich in seinem Keller
unter dem Laden angetroffen. Der hat ihn heute überhaupt noch nicht gesehen.« Tom klang nun geradezu verzweifelt.
In dem Moment fiel ihr etwas ein: »Johanna hat doch einen Schlüssel zu Hennings Haus!«
»Nein, hat sie nicht! Henning hat ihr den Schlüssel letztes Jahr abgenommen. Dreimal darfst du raten, warum.« Und nach einer kurzen atemlosen Pause fügte er verzweifelt hinzu: »Ich fühle es, Franziska: Da ist was passiert.«
Franziska schnürte das die Kehle zu. »Ich komme«, presste sie mühsam hervor.
Kapitel 3
Göntje warf einen letzten Blick auf den um diese Zeit noch leeren gelben
Sandstrand und das dahinter liegende Meer, das glatt und blau die ersten
Sonnenstrahlen reflektierte. Diese friedliche Stille am Morgen genoss sie ganz
besonders. In wenigen Stunden würde davon nichts mehr übrig sein, wenn die Urlauber mit ihren Strandzelten hier aufliefen.
Wie gerne wäre sie jetzt noch schnell ins Wasser gesprungen, aber dafür war sie heute Morgen zu spät dran. Seufzend wandte sie sich ab und schob ihr Fahrrad von der Promenade
durch den flachen Dünenstreifen in den Nordsee-Kurpark mit seinen vom Wind gebeugten Bäumen. Gmelin-Park nannten die Einheimischen ihn, in Erinnerung an den Arzt Dr.
Karl Gmelin, der ihn für die Patienten seiner Lungenfachklinik anlegen lassen hatte. Das war 1900
gewesen, aber die Mischung aus heimischen und subtropischen Bäumen war bis heute ein Beleg für das gesunde und gemäßigte Heilklima auf der Insel.
Von dem einst gewaltigen Klinikkomplex war inzwischen nichts mehr zu sehen.
Nachdem er jahrelang leer gestanden hatte und zur Ruine verfallen war, hatte
man an ihre Stelle eine Ferienhaussiedlung gebaut. Und gleich dahinter an der Gmelinstraße befand sich die vor zwei Jahren neu errichtete Nordwind-Klinik, in der Göntje als Gesundheits- und Krankenpflegerin arbeitete.
Sie schloss ihr Fahrrad vor dem strahlend weißen Gebäude an den Fahrradständer. Pünktlich um kurz vor sechs betrat sie mit einem knappen Gruß das Schwesternzimmer von Station drei. Schwester Anja blickte kurz von ihrem PC
auf und tat geschäftig, als dokumentierte sie gerade akribisch etwas. Göntje tauschte ihre dünne Jacke gegen den Kasack und trat hinter ihre Kollegin. Außer ein paar belanglosen Zeilen war auf dem Bildschirm nichts zu sehen.
»Wie war die Nacht?«
»Wie immer«, fasste Schwester Anja ihre Schicht zusammen. »Keine besonderen Vorkommnisse, alles ruhig.«
Natürlich. Schwester Anja hätte gar nicht mitbekommen, wenn etwas nicht in Ordnung gewesen wäre. Da musste schon die Notfallklingel Daueralarm schellen, damit die etwas
merkte.
Während Anja nach einer kurzen Übergabe den Kasack auszog und sich beeilte, von der Station zu kommen, betrat Göntje das erste Zimmer, um mit der Morgenhygiene zu beginnen. Dabei freute sie
sich auf Frau Petersen. Die Patientin hatte mit 68 Jahren einen Herzinfarkt
erlitten und kam langsam wieder auf die Beine. Trotz ihrer Schwäche war sie immer gut gelaunt und führte stets einen lustigen Spruch auf den Lippen. Und sie war dankbar für jede Minute, die man ihr schenkte.
Schon als Göntje die Zimmertür öffnete, überfiel sie das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte. Die Frau lag mit offenem Mund auf dem Rücken und rührte sich nicht. Mit zwei Schritten war Göntje bei ihr.
»Frau Petersen?« Keine Reaktion. »Frau Petersen, geht es Ihnen nicht gut?«
In Zeitlupe öffneten sich die Augen und flackerten ins Leere. Göntje atmete auf: Die Patientin lebte. Immerhin. Göntje legte zwei Finger an die Halsschlagader. Nur mühsam konnte sie den Puls fühlen. Er war deutlich verlangsamt und flach. Ein Fall für Dr. Jankowski, fand Göntje.
Sie eilte zum Schwesternzimmer und griff zum Telefon. Der Stationsarzt nahm
nicht ab. Göntje legte auf und wählte erneut. Wieder nichts. Verdammt, wieso ging der denn nicht ans Telefon? Göntjes Puls raste. Was sollte sie jetzt tun? Abwarten, ob es von selbst besser würde? Und wenn der Kreislauf der Patientin komplett absackte?
Nein, das konnte sie nicht riskieren. Also Dr. Hecht, den Belegarzt, anrufen?
Frau Petersen war seine Patientin. Genauso wie Frau Frerich, die vor zwei
Wochen auf dieser Station plötzlich verstorben war, obwohl es vorher keinerlei Anzeichen auf eine
Verschlechterung gegeben hatte.
Göntje sah auf die Uhr. Viertel nach sechs. Um diese Zeit war er sicher noch zu
Hause.
Entschlossen wählte sie die Privatnummer des Arztes, die für Notfälle unter der seiner Praxis im Notfallordner stand.
Nach dem dritten Klingeln nahm der Arzt ab. »Hecht?«
»Schwester Göntje, Station 3. Frau Petersen geht es schlecht.«
»Was ist mit dem Stationsarzt?«
Einen Moment zögerte Göntje aus Rücksicht auf Dr. Jankowski, aber dann antwortete sie doch wahrheitsgemäß: »Er geht nicht ans Telefon.«
Dr. Hecht atmete hörbar ein und aus. »Ich komme. Bleiben Sie bei der Patientin.«
Göntje atmete erleichtert auf und lief zurück ins Krankenzimmer. Frau Petersen atmete noch langsamer und flacher als vor
ein paar Minuten und hatte die Augen geschlossen.
»Frau Petersen, können Sie mich hören?« Die Patientin drehte leicht den Kopf zu ihr und blickte sie aus leeren Augen
an. »Dr. Hecht ist auf dem Weg«, beruhigte sie Frau Petersen. »Er wird Ihnen helfen.«
Während sie der Patientin die Hand hielt, flutete die Wut in ihr hoch. Wut auf
Anja, die als Krankenpflegerin völlig ungeeignet war, aber aus Personalmangel im Krankenhaus gehalten wurde – egal, was in ihrer Schicht schon alles passiert war. Wut auf Dr. Jankowski, der
selbst im Notfall nicht erreichbar war, und Wut auf das gesamte System, in dem überlastetes Pflegepersonal und viel zu wenige Ärzte den Laden nur durch Selbstausbeutung am Laufen halten konnten. Und die Nordwind-Klinik war noch vergleichsweise gut ausgestattet, weil sie einem sehr erfolgreichen
Pharma-Konzern gehörte.
Das alles hier vertrug sich so gar nicht mit Göntjes Vorstellung von einer sachgerechten und patientennahen Pflege. Wie oft
schon war sie kurz davor gewesen, den Job zu kündigen und irgendetwas anderes zu machen – egal was!
Frau Petersen stöhnte leise auf. Göntje drückte sanft ihre Hand und streichelte ihr beruhigend über den Arm.
Da wurde die Tür aufgestoßen. Dr. Hecht hetzte herein, grüßte Göntje mit einem kurzen Nicken und war schon bei seiner Patientin. Er fühlte den Puls und hörte das Herz ab. Dann nahm er eine Spritze aus seinem Koffer, zog sie auf und
injizierte ihr ein Medikament.
Mit Zeige- und Mittelfinger am Handgelenk setzte sich der Arzt auf die
Bettkante. Schließlich nickte er erleichtert. »Der Puls stabilisiert sich. Rufen Sie Dr. Jankowski. Er soll sofort herkommen.«
Da öffnete sich die Tür und der Stationsarzt eilte beflissen herein: »Herr Kollege, ich habe gehört, dass Sie im Haus sind. Gerade wollte ich nach unserer Patientin sehen.«
Dr. Hecht richtete sich zu voller Größe auf, trat auf ihn zu, schob ihn aus dem Zimmer in den Flur und bedeutete Göntje mit einer Kopfbewegung, ihm zu folgen. »Dass Sie sich überhaupt noch trauen, hier aufzukreuzen! Ich höre, Sie sind nicht ans Telefon gegangen, als Schwester Göntje Sie gebraucht hat?«
Dr. Jankowski blickte unsicher zwischen der Pflegerin und dem Kollegen hin und
her. »Das muss ich überhört haben.«
Er wartete einen Moment auf eine Reaktion. Als Dr. Hecht sich aber nur kopfschüttelnd abwandte, lief er rot an. »Irgendwann muss schließlich auch ich mal schlafen. Diese Vierundzwanzig-Stunden-Dienste hält doch kein normaler Mensch durch!«
»Und während Sie schlafen, schweben Ihre Patienten in Lebensgefahr«, zeigte sich Dr. Hechts unerbittlich. »Nichts gegen die nötigen Ruhephasen. Aber Sie sind in Rufbereitschaft und müssen jederzeit erreichbar sein.«
Dr. Jankowski schnaufte wütend und wandte sich der Tür zu.
»Sie können froh sein, dass Frau Petersen noch lebt, so schwach wie ihr Puls war«, setzte Dr. Hecht nach. »Eine halbe Stunde später wäre sie möglicherweise tot gewesen. Sie sind für dieses Haus nicht länger tragbar.«
Dr. Jankowski blieb vor dem Patienzimmer ruckartig stehen und warf den Kopf
herum. »Das haben Sie ja wohl nicht zu entscheiden! Das entscheidet immer noch die
Klinikleitung.«
Dr. Hecht ignorierte den Einwand, schob seinen Kollegen zur Seite und betrat das
Zimmer. »Gehen Sie davon aus, dass Sie sich nach Ihrer Schicht einen neuen Arbeitsplatz
suchen können.« Er schloss seine Arzttasche und schritt an Dr. Jankowski vorbei, ohne ihn
weiter zu beachten. Im Rahmen drehte er sich noch einmal um. »Gut gemacht, Göntje. Kommen Sie bitte nach Ihrem Dienst heute zu mir in die Praxis. Können Sie das einrichten?«
»Natürlich.«
Ohne ein weiteres Wort rauschte Dr. Jankowski an ihnen vorbei und verließ die Station. Dr. Hecht nickte Göntje noch einmal lächelnd zu und folgte ihm.
Kapitel 4
Die Tide war auf ihrem Tiefstand, so dass sich die Uthlande nur langsam aus dem Wittdüner Hafenbecken manövrieren konnte. Zu langsam, fand Franziska.
Sie war wie immer direkt auf das Sonnendeck gegangen und hatte sich einen Platz
an der Reling gesucht. Von hier aus hatte sie alles im Blick. Vor allem Föhr würde sie schon von Weitem nahen sehen, was ihre Unruhe und – ja, sie musste es sich eingestehen – ihre Angst vielleicht in Schach halten würde. Und jetzt saß sie hier auf der Kante ihrer harten Bank und wippte rastlos mit dem rechten Fuß, während die Pricken und Sandbänke in Zeitlupe an ihr vorbeizogen.
Toms Panik hatte sich in einer Weise auf sie übertragen, die eigentlich völlig untypisch für sie war. Normalerweise war Franziska ruhig und überlegt, hatte als Geschäftsfrau die Unbilden des Alltags im Griff und handelte stets rational. Wem nützte es schließlich, wenn sie überstürzt und aus dem Bauch heraus falsche Entscheidungen traf und sich unnötig verrückt machte?
Vom Kopf her war ihr das auch jetzt ganz klar. Aber Toms Angst um ihren Freund
hatte etwas in ihr ausgelöst, von dem sie geglaubt hatte, es längst verarbeitet zu haben. In diesem Moment sah sie jedoch wieder den
Reedereichef vor ihrer Tür stehen. Sie hatte gleich gewusst, dass etwas Schreckliches passiert sein
musste. An seinem verlegenen Blick hatte sie es abgelesen. Sieben Jahre war es
jetzt her, dass Hendrik über Bord gegangen war. Im Sturm hatte das Schiff eine haushohe Woge übergenommen und die hatte ihn von Deck gerissen, als er seiner Mannschaft beim
Vertäuen irgendwelcher Kisten geholfen hatte, die dort eigentlich gar nicht mehr hätten stehen dürfen. Sieben Jahre, seit sie ihren Mann verloren hatte. Und alles Glück in ihrem Leben. Für immer, hatte sie geglaubt, und dann war Henning gekommen. Tom hatte ihn mit
nach Amrum gebracht. Ein Neuanfang, kein leichter, aber immerhin hatten sie von
Jahr zu Jahr mehr zueinandergefunden. Jetzt konnte sie sich ein Leben ohne ihn
nicht mehr vorstellen.
Franziska sprang auf, umfasste mit verkrampften Händen die Reling, beugte sich vor und blickte am Ruderhaus vorbei zurück auf den Hafen, der sich langsam entfernte. Immerhin war die Fahrrinne tief
genug, um Wyk ohne Probleme erreichen zu können. Vor Dagebüll konnte es schon einmal vorkommen, dass die Fähren bei ablandigem Wind stundenlang auf das auflaufende Wasser warten mussten,
bevor sie in den Hafen einfahren konnten.
Sie ließ das Eisengeländer los und drehte sich um. Die Luft war klar heute, die Sicht weit und so
konnte sie gleichzeitig den Strand von Nieblum auf Föhr links und die Hallig Langeneß rechts vor sich auftauchen sehen. Die Fahrrinne lief mitten dazwischen hindurch
und die Uthlande steuerte in Zeitlupentempo darauf zu.
Wie oft schon waren Henning und Franziska gemeinsam in die eine oder andere
Richtung gefahren und hatten jede Sekunde an Deck genossen. Die Sonne, die
Weite, den Blick auf die Warften. Hier draußen hatten sie das Flair der Friesischen Karibik gefühlt und die Fahrt war ihnen zu kurz vorgekommen. Aber sie hatten ja auch immer
gemeinsame Tage auf Föhr oder Amrum vor sich gehabt.
Jetzt fuhr Franziska ins Ungewisse. Nicht auszudenken, wenn Tom gleich am
Anleger in Wyk stehen und sie ansehen würde wie damals der Chef der Reederei! Ausgerechnet Tom, der Henning und sie
miteinander bekannt gemacht hatte.
Verflucht, das ging ihr alles viel zu langsam! Sie zog ihr Smartphone hervor und tippte mit zittrigen Fingern Toms Nummer. Der nahm das Gespräch direkt an, als hätte er darauf gewartet.
»Immer noch nichts Neues?« Franziska hatte Mühe zu sprechen, so groß war der Druck auf ihrem Brustkorb.
»Nein. Wo bleibst du denn, verdammt? Ich breche gleich die Tür auf!«
Nun hatte auch Franziska das Gefühl, dass jede Minute zählen konnte. »Ruf einen Schlüsseldienst.«
Ohne darauf zu antworten, drückte Tom das Gespräch weg. Franziska sah förmlich, wie er direkt die Nummer des Schlüsseldienstes in sein Smartphone tippte.
Die Uthlande passierte die Windmühle vor der Ketelswarf auf Langeneß auf der rechten und den Südstrand von Wyk auf der linken Seite und schwenkte leicht nach links ein. Ein
Krabbenkutter mit Urlaubern an Bord kam ihnen entgegen. Lachende Kinder winkten
herüber, während ihre Eltern irgendwelchen Ausführungen eines Fischers folgten, der gestikulierend vor ihnen stand.
Und endlich kamen die blauen Aufbauten der Fähranleger in Sicht. Die Uthlande musste zum Glück nicht erst wenden, bevor sie anlegen konnte. Als Doppelendfähre konnte sie direkt auf die Fahrzeugrampe zusteuern. Auch mussten die Fußgänger nicht mehr über das Fahrzeugdeck von Bord gehen, sie konnten das Schiff über eine Fußgängerrampe an der Mole verlassen. Das entspannte die Situation für Franziska nun etwas, weil ihr das Gedränge vom Sonnendeck zu den Fahrzeugen erspart blieb. Jedoch hatten sich heute
offenbar sehr viele Amrum-Urlauber dazu entschlossen, die Nachbarinsel zu
besuchen. Sie verstopften nun die Rampe und den Weg über die Mole, die noch dazu von den Menschen bevölkert war, die darauf warteten, die Fähre betreten zu dürfen.
Endlich von Bord, drängelte sich Franziska durch die schlendernden Urlauber und versuchte, sich von
den zum Teil ungehaltenen Reaktionen nicht beeindrucken zu lassen.
Tom war weit und breit nicht zu sehen. Also rannte Franziska los, sobald sie die
Gelegenheit dazu hatte. Erst am Rathausplatz wurde es wieder voller und am
Sandwall war es dann endgültig vorbei mit der freien Bahn. Wo kamen nur all die Menschen her, die sich
hier jeden Tag an den Geschäften vorbeischoben? In der Mittelstraße drängten sie sich vor Pizza-King und der Bäckerei Hansen. Warum, verdammt noch mal, waren hier ausgerechnet heute so viele
Großfamilien unterwegs? Franziska fluchte leise, während sie Buggys und unkontrolliert umherflitzenden Kindern auswich. Erst als
sie in die Mühlenstraße einbog, hatte sie wieder freie Bahn.
Kapitel 5
Tom tigerte hektisch vor Leanders Haus auf und ab und ließ den jungen Mann vom Schlüsseldienst nicht aus den Augen, der ungeschickt am Schloss herumhantierte.
Johanna stand mit in die Hüften gestützten Händen vor der Haustür und blickte Franziska grimmig entgegen. »Na endlich! Wo bleibst du denn?«
Franziska schob sie wortlos zur Seite und holte den Haustürschlüssel hervor. Der junge Mann zuckte verlegen mit den Schultern und machte
ebenfalls den Weg frei. Mit zitternden Händen schob sie ihn in den schmalen Schlitz des Sicherheitsschlosses.
»Ich verstehe das nicht«, stieß Tom in ihrem Nacken verzweifelt hervor. »Gestern Abend haben wir noch telefoniert. Da war alles in Ordnung.«
Das Schloss klackte. Hektisch stieß Franziska die Tür auf und hastete in den schmalen Flur. Tom schob sich an ihr vorbei und
steuerte auf die Küche und das Wohnzimmer zu. Franziska rannte direkt die steile Treppe hinauf.
»Henning?«, rief sie mit zitternder Stimme. »Bist du da?«
Keine Antwort. Die Tür zum Schlafzimmer stand einen Spaltbreit offen. Franziska schob sie langsam
vollständig auf und setzte ein paar vorsichtige Schritte in den Raum. Leander lag auf
dem Rücken im Bett, die Augen geschlossen, die Bettdecke weggetreten.
»Henning?«
Keine Reaktion.
Franziska stürzte zu ihm und rüttelte heftig an seinen Schultern. »Henning, verdammt! Was ist denn mit dir?«
Da tauchte Tom an ihrer Seite auf. »Scheiße! Ist er …?«
Franziska schluchzte auf und zuckte hilflos mit den Schultern.
»Was ist denn nun los?«, keifte Johannas Stimme dazwischen. »Warum sagt mir denn keiner was?«
Die alte Frau schob Franziska und Tom rabiat zur Seite, stoppte aber dann vor
Leanders Bett und schlug die Hände vor den Mund. »Oh, mein Gott!« Allerdings fing sie sich im Gegensatz zu Franziska und Tom gleich wieder, legte
ihre knorrigen Finger an Leanders Hals und verkündete vorwurfsvoll: »Er lebt!«
Nun beugte sich auch Franziska über ihren Freund. Tatsächlich! Sie fühlte einen schwachen Puls an der Halsschlagader. Vorsichtig tätschelte sie seine Wange. »Henning? Ich bin’s, Franziska.«
»So geht das nicht! Lass mich mal«, knurrte Johanna Husen, holte aus und schlug ihm mit einem lauten Klatschen ins
Gesicht.
Erschrocken öffneten sich Leanders Augen. Er blickte um sich, als wäre er in einer ihm völlig fremden Umgebung erwacht. Dann verfing sich sein Blick in dem seiner
Freundin.
»Franziska«, hauchte er fast unhörbar. »Was ist denn los?«
Die schluchzte laut auf und sank an seine Brust.
»Puh!«, stöhnte Tom. »Da hast du uns aber einen Schrecken eingejagt.« Er setzte sich am Fußende auf die Bettkante und versenkte das Gesicht in den Händen. »Scheiße, Mann!«
»Stellt der Kerl sich tot«, schimpfte Johanna. »Lässt uns stundenlang da draußen warten und liegt hier oben faul im Bett. Unverschämtheit so was!«
»Ist gut jetzt, Johanna«, fuhr Tom sie an, rappelte sich wieder auf und schob die alte Frau aus dem Zimmer. »Was hältst du denn davon, wenn du uns erst mal einen starken Kaffee kochst?«
»Wenn das der Hinnerk noch erlebt hätte«, schimpfte sie weiter, machte sich aber vorsichtig an den Abstieg der steilen
Treppe.
Tom linste noch einmal kurz ins Schlafzimmer. »Ich lasse euch dann mal alleine und hole Brötchen.«
Kapitel 6
Leander fand nur mühsam wieder zu sich und erfasste allmählich die Situation. Er versuchte, sich zu erinnern, was am Morgen eigentlich
geschehen war. Seine Augen wanderten über die Decke und blieben an dem Astensemble hängen, das ihn immer an ein Gesicht erinnerte.
»Ich bin aufgewacht«, erzählte er Franziska, »und bekam kaum Luft. Es war, als würde mein Herz stehen bleiben.«
Franziska hatte Tränen in den Augen, als sie sein Handgelenk nahm. »Dein Puls ist sehr schwach«, stellte sie fest. »Hattest du das schon öfter?«
Leander schüttelte leicht den Kopf, bereute das jedoch sofort. Heftige Stiche fuhren ihm in
die linke Schädelseite. Er bemühte sich, nicht zu laut zu stöhnen. »Eigentlich nicht. Manchmal war mir in letzter Zeit etwas schwindelig, aber so
war es noch nie. Und die verfluchten Kopfschmerzen!«
»Soll ich einen Arzt rufen?«
»Unsinn!« Leander versuchte, sich im Bett aufzurichten. Gleich wurde ihm wieder
schwindelig und schwarz vor Augen. »Ich muss nur eine Tasse von Johannas schwarzem Kaffee trinken, dann geht das
wieder. Das Teufelszeug weckt schließlich Tote auf.« Er rang sich ein Lächeln ab und bemühte sich, das heftige Pochen in seiner Brust zu ignorieren, das ihm viel zu laut
und zu langsam vorkam und irgendwie zu holpern schien. »Lass mich noch ein paar Minuten liegen, dann komme ich zu euch in den Garten.«
»Du gehst nicht alleine die Treppe runter«, widersprach Franziska. »Ruf mich, wenn du so weit bist. Dann helfe ich dir.« Sie wischte sich die Tränen ab und verließ das Zimmer, allerdings nicht, ohne noch einen zweifelnden Blick auf ihren
Freund zu werfen.
So besorgt hatte Leander sie noch nie erlebt. Und er hatte das ungute Gefühl, dass sie auch allen Grund dazu hatte. Das war wirklich knapp gewesen heute
Morgen.
Zehn Minuten später stieg Leander gegen Franziskas Anordnung mit zusammengebissenen Zähnen allein die Treppe hinunter, was ihm einen vorwurfsvollen Blick seiner
Freundin eintrug, als er in den Garten kam. Sie hatte unter dem Apfelbaum den
Frühstückstisch gedeckt. Das hätte alles sehr idyllisch aussehen können, wenn da nicht auch Tom und Johanna gesessen hätten. Immerhin hielten die beiden Franziska nun davon ab, ihm Vorwürfe zu machen. Es hatte eben immer alles zwei Seiten.
»Na bitte«, begrüßte Tom ihn bemüht fröhlich, »du siehst ja schon wieder ganz passabel aus.« Sein besorgter Blick strafte ihn Lügen.
Johanna bewegte zweifelnd den Kopf hin und her. »Ich weiß nicht, er ist doch noch ganz schön blass.«
Franziska sagte nichts und kniff die Lippen zusammen, während sie ihrem Freund Kaffee eingoss.
Leander machte eine abwehrende Geste. »Ich kann jetzt nichts essen oder trinken. Vielleicht später.«
»Wirst sehen, Henning«, kam es in mütterlich tröstendem Ton von der alten Nachbarin, »Dr. Hecht stellt dich wieder auf die Beine.«
»Jetzt macht bitte nicht so ein Tamtam, nur weil ich mal ein kleines
Kreislaufproblem hatte«, widersprach Leander. »So alt bin ich noch nicht, dass ich wegen jedem Wehwehchen gleich zum Arzt
renne. – Und wer ist überhaupt Dr. Hecht?«
»Mein neuer Hausarzt.« Johanna tätschelte ihm sanft die Hand. »Wirst sehen, er ist sehr einfühlsam. Und ein Herzspezialist.«
Leander lag die Frage auf der Zunge, wieso sich ein Herzspezialist als Hausarzt
nach Föhr verirrte, aber das hätte wieder eine Diskussion mit der alten Nachbarin provoziert, die er heute
Morgen gar nicht gebrauchen konnte. »Da bekomme ich so schnell bestimmt keinen Termin«, wandte er stattdessen ein. »Außerdem bin ich nicht sein Patient.«
»Doch, bekommst du«, widersprach Johanna mit selbstgerechtem Nicken. »Dr. Hecht hat die Praxis erst vor Kurzem übernommen, nachdem sein Vorgänger sie ziemlich heruntergewirtschaftet hatte. Deshalb nimmt er noch neue
Patienten an.«
»Ich habe dir bereits einen Termin um vierzehn Uhr gemacht«, stellte Franziska klar und schnitt ein Brötchen auf. »Es kann überhaupt nicht schaden, sich mal durchchecken zu lassen.«
Angesichts des Tonfalls, in dem sie das sagte, schien es Leander ratsam, nicht
zu widersprechen. Dabei stank es ihm schon gewaltig, dass so über seinen Kopf hinweg entschieden wurde. Andererseits beunruhigte ihn der
morgendliche Vorfall selbst derart, dass es vielleicht wirklich besser war,
einen Arzt aufzusuchen. Irgendwie hatte sich so etwas wie Angst in ihm
aufgebaut und das kannte er von sich überhaupt nicht.
»Franziska sagt, du hast Kopfschmerzen?«, meldete sich Johanna wieder zu Wort. »Bei Gerda Petersen hat das auch so angefangen: Erst hatte sie Kopfschmerzen,
dann diese Bleckdingens, also, immer wurde ihr schwarz vor Augen und sie wurde ohnmächtig. Am Ende war das ein Hirntumor.«
Kapitel 7
Dr. Hechts Praxis lag in Boldixum am Holm, der durch eine kleine Grünanlage vom Hardesweg getrennt wurde. Göntje stellte ihr Fahrrad an der Hauswand ab und drückte die Tür auf. Der Empfangsraum war hell und großzügig. Links die Theke, rechts das Wartezimmer. Geradeaus führte ein Gang zu den Behandlungsräumen.
Hinter der Theke tippte eine junge Frau, die vielleicht zehn Jahre älter als Göntje sein mochte, etwas in ihren Computer und sah kurz auf, als sie herantrat. Göntje kannte sie flüchtig, da sie gelegentlich mit Dr. Hecht in der Nordwind-Klinik gewesen war.
»Hallo, Femke. Ich sollte mich hier melden.«
Nun hielt die junge Frau inne und musterte sie skeptisch. »Ja, der Doc hat dich angekündigt. Er hat noch einen Patienten, dann kannst du rein zu ihm.« Dabei hing die unausgesprochene Frage im Raum, was das alles zu bedeuten habe.
Als Göntje schließlich das Sprechzimmer von Dr. Hecht betrat, blickte der von seinem Schreibtisch
auf, lächelte ihr zu und deutete auf den Stuhl gegenüber. »Hat Dr. Jankowski noch etwas zu Ihnen gesagt?«
»Nein, ich habe ihn gar nicht mehr gesehen.«
Dr. Hecht nickte. »Ich habe mich dafür eingesetzt, dass er fristlos entlassen wird, aber es sind aktuell keine
qualifizierteren Ärzte zu kriegen.« Er lehnte sich sichtlich unzufrieden in seinem Stuhl zurück. »Das war doch nicht der erste Vorfall dieser Art, oder?«
»Nein. Natürlich wird man als Krankenpflegerin nicht ständig im Stich gelassen. Aber dass Tabletten falsch verordnet oder gestellt
werden und wir den Patientinnen und Patienten nicht gerecht werden können, ist leider an der Tagesordnung.« Noch während sie das sagte, machte sich ihr schlechtes Gewissen bemerkbar. »Andererseits hat Doktor Jankowski ja Recht: Die langen Dienste hält man einfach am Stück nicht durch.«
»Und diese Arbeitssituation belastet Sie sehr«, stellte Dr. Hecht fest.
Göntje nickte und senkte den Blick. »Ich glaube nicht, dass ich das noch lange ertrage.«
Der Arzt schwieg einen Moment, dann beugte er sich vor. »Könnten Sie sich vorstellen, hier bei mir in der Praxis anzufangen? Mein
Patientenstamm wächst ständig und für Femke ist das allmählich nicht mehr zu schaffen. Außerdem hat sie ja auch mal Urlaubsanspruch oder kann selber krank werden. Deshalb
suche ich eine engagierte und kompetente Kraft, die mehr kann, als Termine
machen und Blutdruck messen.«
Göntje glaubte, nicht richtig gehört zu haben. »Ist das Ihr Ernst?«
»Oh, ja. Sie können sofort bei mir anfangen. Über Ihr Gehalt werden wir uns schon einig.«
»Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Unserer Pflegedienstleitung wird das nicht gefallen. Wir haben
sowieso schon einen Personalengpass. Auf jeden Fall habe ich eine Kündigungsfrist von drei Monaten.«
»Darüber müssen Sie sich keine Gedanken machen. Nach dem Vorfall heute wird der
Pflegedienstleiter sich hüten, Ihnen Steine in den Weg zu legen. Und die Klinikleitung sowieso. Ich habe
dort einigen Einfluss. Die können sich gar nicht leisten, mir etwas abzuschlagen.«
»Einverstanden«, sagte Göntje kurz entschlossen. Sie hatte das Gefühl, als löste sich eine Klammer, die ihr Herz bislang eingeschnürt hatte.
»Abgemacht also. Ihr erster Dienst beginnt morgen früh pünktlich um sieben Uhr. Ich rufe gleich in der Klinik an und melde Sie dort ab.«
»Wenn Sie wollen, kann ich auch direkt anfangen«, antwortete Göntje.
Dr. Hecht stutzte kurz, dann lachte er. »Sie haben Angst, dass ich es mir bis morgen anders überlege, was? Keine Sorge, das wird nicht passieren. Aber wenn Sie sich die
Praxis erst einmal selbst ansehen möchten, bevor Sie sich endgültig entscheiden, meinetwegen.« Er stand auf und ging voraus zur Tür. »Femke?«
Die Sprechstundenhilfe blickte von ihrem Computerbildschirm auf.
»Wir haben doch bestimmt noch einen Kasack für Ihre neue Kollegin?« Er deutete mit dem Kopf auf Göntje.
Irritiert schaute Femke zwischen ihnen hin und her. »Natürlich. Sie kann erst mal einen von mir haben.«
»Wunderbar. Sie weisen Göntje dann ein, ja?« Damit nahm der Arzt eine bereitliegende Patientenakte vom Tresen und zog sich
wieder in sein Sprechzimmer zurück.
Femke ging zum Wartezimmer und holte den nächsten Patienten, während Göntje vor dem Tresen stand und nicht wusste, was jetzt von ihr erwartet wurde.
Femke setzte sich wieder hinter ihren Bildschirm. »Worauf wartest du?« Sie deutete mit dem Kopf nach links auf den Durchgang, der hinter den Tresen führte.
Irrte sich Göntje oder hatte ihre Stimme jetzt einen leicht verärgerten Klang? Als sie der Aufforderung gefolgt war, räusperte sich Femke, als wäre sie sich ihrer unhöflichen Art plötzlich bewusst geworden, stand wieder auf und reichte ihr die Hand.
»Also, wie es aussieht, werden wir ab jetzt zusammenarbeiten. Herzlich
willkommen.« Sie machte eine kurze Pause, in der sie Göntje musterte. »Du bist doch Krankenschwester, oder? Hoffentlich langweilst du dich bei uns
nicht.«
»Ach!« Göntje winkte leichthin ab. »Ein bisschen mehr Ruhe wird mir guttun.«
»Ruhe, ja?« Femke schnaufte auf. »Na, da täusch dich mal nicht. Ruhe hast du hier auch nicht. Ich konnte jedenfalls noch
keinen Tag freinehmen, nachdem die Kollegin, die Dr. Hecht von seinem Vorgänger übernommen hat, in Rente gegangen ist. Aber der Job ist nicht so
abwechslungsreich, wie du das wahrscheinlich gewohnt bist.«3
Diesmal schwieg Göntje. Sie hatte den Eindruck, dass alles, das sie sagen würde, ein Tritt ins Fettnäpfchen sein könnte.
»Du kannst deine Sachen da in den Schrank hängen. Der Kasack müsste passen. Wir werden dir dann gleich ein paar eigene bestellen. Und dann
zeige ich dir, was du hier zu tun hast.«
Die Tür des Arztzimmers öffnete sich wieder und Dr. Hecht trat heraus, gefolgt von seinem Patienten. »Femke wird Ihnen einen neuen Termin geben. Wir sehen uns dann in einer Woche?« Er nickte der Arzthelferin zu, die sich direkt wieder dem Computer zuwandte.
Dann deutete er lächelnd auf den Kasack mit dem Namenszug seiner Praxis, den Göntje gerade zuband. »Steht Ihnen gut.« Damit verschwand er wieder in seinem Zimmer.
Femke war dem Geplänkel mit zusammengekniffenen Augen gefolgt. Nun wandte sie sich dem Patienten
zu: »Nächsten Mittwoch um dieselbe Zeit, Herr Klaasen?«
Kapitel 8
Leander betrat die Arztpraxis mit gemischten Gefühlen: Einerseits hatte ihn der morgendliche Vorfall in Unruhe versetzt,
andererseits kam er sich wie ein Hypochonder vor, der nur wegen einer
Kreislaufschwäche und Kopfschmerzen gleich zum Arzt rannte.
Die Praxis wirkte hell und freundlich. Hinter dem Empfang arbeiteten zwei junge
Frauen. Die eine erklärte der anderen gerade etwas anhand einer Patientenakte, als er näher trat.
Die jüngere der beiden nickte nun verstehend. »Mit Dokumentationen kenne ich mich aus«, sagte sie. »Das wird kein Problem sein.«
Die andere zog skeptisch die Augenbrauen zusammen, wandte sich aber dann Leander
zu und sah ihn fragend an.
»Leander. Ich habe einen Termin um vier.«
»Waren Sie schon einmal bei uns, Herr Leander?«
»Nein.«
»Dann füllen Sie das hier mal sorgfältig aus.« Sie reichte ihm ein Klemmbrett mit ein paar Zetteln und einen Kugelschreiber. »Kassenpatient oder privat?«, fragte sie.
»Beihilfe und private Kasse«, antwortete Leander.
Die junge Frau reichte ihm einen weiteren Bogen. »Dann brauchen wir noch eine Kostenübernahme-Erklärung von Ihnen für alles, was die Beihilfe nicht anerkennt.«
Leander nahm das Brett entgegen und ging ins Wartezimmer. Neben dem Fenster war
noch ein Stuhl frei, sonst waren alle belegt – mit überwiegend alten Männern, wie Leander missmutig feststellte. Ein weiterer Beleg dafür, dass er hier nicht hingehörte!
Er setzte sich und machte sich daran, die zahlreichen persönlichen Daten einzutragen und die Gesundheitsfragen zu beantworten. Was man
alles haben konnte! Und dass er das alles noch nicht gehabt hatte, war
ausgesprochen beruhigend. Als er mit den Bögen fertig war, brachte er das Klemmbrett zurück. Die Arzthelferin nahm es entgegen, zog den Bogen mit den persönlichen Angaben ab und reichte ihn an die jüngere Kollegin weiter.
»Du legst jetzt die digitale Patientenakte an. Wie das geht, habe ich dir ja eben
erklärt. – Und Sie«, sie blickte Leander an, »können direkt zu Dr. Hecht reingehen.« Sie lief mit dem Klemmbrett und einer neuen Patientenkarte voraus und legte
beides dem Arzt auf den Schreibtisch.
Während sich Leander noch fragte, ob er angesichts des vollbesetzten Wartezimmers
in dieser Praxis als Privatpatient bevorzugt wurde, stand der Arzt auf und kam
seinem Patienten ein paar Schritte entgegen. »Herr Leander. Schön, Sie kennenzulernen.« Er deutete auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. »Sie sehen blass aus. Was fehlt Ihnen?«
Leander wusste zunächst nicht, wie er sein Erlebnis vom Morgen beschreiben sollte, ohne sich lächerlich zu machen, zumal der Arzt für ihn vollkommen fremd war. Dann gab er sich einen Ruck: »Heute Morgen habe ich gedacht, ich müsste sterben.«
»Das hört sich schlimm an.« Dr. Hecht sah ihn mit großen Augen an.
Leander berichtete von seinem Erwachen, davon, dass sein Herz eine Zeit lang
nicht geschlagen, die Atmung nicht mehr funktioniert hatte. »Ich war wie gelähmt.«
»Gab es einen Auslöser?« Der Arzt blätterte in Leanders Angaben zu den früheren Krankheiten vor und zurück, als suchte er nach einem Hinweis auf ähnliche Vorfälle, und schüttelte den Kopf.
»Keine Ahnung.«
Dr. Hecht faltete seine Hände über dem Schreibtisch und beugte sich etwas vor. »Wie lange hat dieser Atemaussetzer angehalten?«
»Schwer zu sagen. Zwei oder drei Minuten vielleicht.« In Wahrheit war ihm die Zeit sehr viel länger vorgekommen, aber es schien ihm unmöglich, mehr als drei Minuten ohne Atmung überlebt zu haben.
»Und was hat ihn wieder gelöst? Hat jemand Sie berührt oder geschüttelt? Oder haben Sie an etwas Bestimmtes gedacht?«
Leander zögerte, weil ihm die Antwort zu albern vorkam. Da der Arzt ihn aber in seiner Not
tatsächlich ernst zu nehmen schien, räusperte er sich und antwortete: »Ich habe ein Gesicht in der Maserung meiner Schlafzimmerdecke gesehen und an
meine Freundin gedacht.«
»Und dann haben Sie einfach wieder geatmet?«
»Nein, nicht einfach so. Es gab ein Poltern oder Rumpeln in meiner Brust, so, als
hätte mein Herzschlag plötzlich wieder eingesetzt. Wie ein abgesoffener Motor, verstehen Sie? Und dann
konnte ich auch wieder atmen.«
»Hatten Sie so etwas vorher schon einmal?«
»Nein, noch nie. Ehrlich, Herr Doktor, ich war mir sicher, dass ich sterben würde.«
»Dann verdanken Sie Ihrer Freundin Ihr Leben.«
Leander suchte im Gesicht des Arztes nach Hinweisen dafür, dass er sich lustig machte. Aber er fand keine. Mit ernstem Blick studierte
der die persönlichen Daten auf dem Kopf des Fragebogens. Dabei nickte er leicht.
»Sie sind Jahrgang neunundsechzig«, stellte er fest. »Das heißt, Sie sind jetzt in einem gefährlichen Alter. Zwischen fünfundfünfzig und fünfundsechzig ist die Gefahr eines Herzinfarktes besonders hoch.« Er erhob sich und umrundete den Schreibtisch. »Was machen Sie beruflich?«
»Ich war Polizist und bin seit ein paar Jahren Frühpensionär.«
»Dann haben Sie das Gröbste doch schon geschafft.« Dr. Hecht lachte und erklärte auf Leanders fragenden Blick: »Mit dem Berufsleben ist das, als müsste man durch einen riesigen See schwimmen. Man strampelt sich Jahrzehnte lang
ab und die Rente ist das rettende Ufer. Ein Drittel der Schwimmer säuft ab, wenn es in Sicht kommt. Ein weiteres Drittel erreicht das Ufer, ist aber
zu schwach, um aufzustehen und weiterzugehen, und verreckt am Strand. Sie
glauben gar nicht, wie viele Menschen ein Jahr nach dem Eintritt in den
Ruhestand sterben. Und das letzte Drittel marschiert los und hat noch etwas von
der Rente – so wie Sie. Und das ist dann auch die gute Nachricht.«
»Ich weiß nicht, ob mich das wirklich beruhigt.«
»Machen Sie sich mal obenrum frei und setzen Sie sich auf die Kante der Liege
dort.«
Leander folgte der Anweisung.
»Sie haben natürlich Recht: Mit so etwas ist nicht zu spaßen«, fuhr Dr. Hecht fort, kontrollierte zuerst den Puls, setzte dann sein
Stethoskop auf und begann, Leanders Brust abzuhorchen. Wieder nickte er, als
finde er eine Vermutung bestätigt. Dann trat er hinter seinen Patienten und horchte die Lunge ab. Als er
schließlich wieder in Leanders Blickfeld erschien, rollte er das Stethoskop zusammen
und steckte es in die Kitteltasche. »Sie können sich wieder anziehen.« Er setzte sich hinter seinen Schreibtisch und notierte etwas in die Karte. Dann
legte er seinen Stift beiseite, faltete die Hände auf dem Tisch und blickte Leander direkt in die Augen.
»Die gute Nachricht ist: Sie leben noch. Eine wirklich schlechte gibt es nicht,
aber eine Auffälligkeit: Ich habe deutliche Herzgeräusche gehört. Außerdem schlägt Ihr Herz sehr unregelmäßig. Das muss nichts heißen, kann aber ein Warnsignal sein. Gibt es in Ihrer Familie derartige
Krankheitsbilder? Herzinfarkte? Herzrhythmusstörungen? Herzklappenfehler? Etwas in der Art?«
Leander schüttelte den Kopf. »Nicht, dass ich wüsste.«
»Haben Sie aktuell sehr viel Stress?«
»Auch das nicht.«
»Gut, dann wollen wir jetzt auch nicht die Pferde scheu machen. Wir machen erst
einmal ein Belastungs-EKG und die üblichen Laboruntersuchungen. Sie haben heute sicher schon etwas gegessen, nehme
ich an?«
»Nein, ich habe nichts runterbekommen.«
»Das ist gut. Dann sind Sie nüchtern und wir können die Blutabnahme direkt vornehmen. In Ihrem Fall schlage ich vor: das volle
Programm. Sie sind doch Privatpatient?«
»Beamter im Vorruhestand.«
»Also Beihilfe und private Krankenkasse.« Dr. Hecht sagte das, als sei damit ein entscheidendes Hindernis aus dem Weg geräumt.
»Wollen Sie mich nicht lieber an einen Kardiologen überweisen?«
Der Arzt schüttelte beruhigend den Kopf. »Das ist nicht nötig. Bevor ich diese Praxis übernommen habe, war ich jahrelang Oberarzt in der Kardiologie einer großen Klinik in Kiel. Ich bin durchaus in der Lage, eine Diagnose zu stellen. Wenn
es sich tatsächlich um Herzrhythmusstörungen handeln sollte, was ich stark vermute, dann werden wir das medikamentös einstellen. Am Anfang bedeutet das Kontrolluntersuchungen in kurzen Abständen. Die machen wir doch besser hier vor Ort. Oder wollen Sie jede Woche nach
Flensburg oder Kiel fahren?«
»Nein, wenn es nicht sein muss.«
»Vertrauen Sie mir, Herr Leander, ich kenne mich mit solchen Krankheitsbildern
bestens aus. Sie sind also in guten Händen. Und ich betreue nicht nur in meiner Praxis, sondern auch in der Nordwind-Klinik einige Patienten mit einer vergleichbaren Symptomatik.«
Das fand Leander tatsächlich beruhigend. »Da ist noch etwas: Ich habe rasende Kopfschmerzen.«
Dr. Hecht nickte wissend. »Das sieht man Ihnen an. Es hängt mit dem Aussetzer heute Morgen zusammen und mit Ihrem Blutdruck, der aktuell
sehr niedrig ist. Ich verschreibe Ihnen Tabletten. Nehmen Sie am Anfang gleich
zwei davon und dann nach Bedarf eine. Aber nur die ersten Tage. Das ist ein
sehr starkes Mittel. Wenn die Kopfschmerzen in einer Woche nicht weg sind,
sehen wir weiter.« Der Arzt tippte etwas in seinen Computer. Dann stand er auf und ging zur Tür. Leander folgte ihm.
Draußen legte Dr. Hecht die Patientenkarte auf den Tresen und wandte sich an die ältere der beiden Sprechstundenhelferinnen: »Nehmen Sie bitte Blut für ein großes Blutbild ab, Femke, und schicken Sie es gleich ins Labor der Klinik. Das
volle Programm. Und machen Sie direkt ein Belastungs-EKG. Wir wollen keine Zeit
verlieren.« Er griff nach einem Rezept, das der Drucker bereits ausgespuckt hatte, und
unterschrieb es. Dann reichte er Leander die Hand. »Wir sehen uns morgen Vormittag hier wieder. Göntje wird Ihnen den Termin geben.«
Während er in sein Sprechzimmer zurückging, blickte die jüngere Sprechstundenhilfe ihn an. »Passt Ihnen morgen um elf Uhr?«
»Ja, das passt.«
Göntje notierte den Termin im Computer.
Femke kam um den Tresen herum. »Kommen Sie bitte mit?«
Leander folgte ihr zu einem Zimmer, in dem ein Stuhl und eine Liege standen. »Setzen Sie sich bitte. Wenn Sie Angst haben, Ihnen wird schlecht, gern auf die
Liege, sonst auf den Stuhl.«
Er wählte die Liege. Die Prozedur des Blutabnehmens verfolgte Leander nur vorsichtig
aus dem Augenwinkel. Er war in seinem Berufsleben schon mit einer Menge Blut
konfrontiert worden, aber sein eigenes konnte er nicht gut fließen sehen. Femke zapfte ihm mehrere Röhrchen ab, beklebte sie mit kleinen Etiketten und legte sie in eine nierenförmige Schale.
»Wann werden die Laborergebnisse hier sein?«, erkundigte sich Leander mit dem mulmigen Gefühl, tagelang in Unsicherheit warten zu müssen, ob er nicht vielleicht doch ernsthaft erkrankt war.
»Heute Abend. Das Labor in der Nordwind-Klinik kontrolliert unsere Proben immer sofort.«
Leander wunderte sich über diese Vorzugsbehandlung. Aber vielleicht hatte die Klinik ja so wenig zu
tun, dass Dr. Hechts Patienten gut in die Abläufe passten.
»So, jetzt machen wir nebenan noch das Belastungs-EKG.« Femke nahm die Schale und verließ den Raum.
Leander folgte ihr in ein Zimmer, in dem ein Fahrradergometer stand. Femke
verkabelte ihn und wies ihn an, auf das Fahrrad zu steigen und gleichmäßig zu treten. Sie selbst bediente ein Gerät, mit dem sie die Belastung stufenweise steigerte. »Wenn Sie das Gefühl haben, dass es nicht mehr geht, hören Sie auf«, sagte sie.
Leander nahm sich vor, nicht wie ein Schwächling nach wenigen Minuten schon wieder vom Rad zu steigen, und trat in die
Pedale, als machte ihm das gar keine Mühe. Als er schließlich heftig schwitzte und keuchte, hörte er auf zu treten. Femke befreite ihn gleichmütig von den Kabeln. »Dr. Hecht wird die Daten auswerten. Das Ergebnis erfahren Sie dann morgen
Vormittag.«
Als Leander schließlich die Praxis verließ, war er sich seiner Gefühle nicht sicher. Einerseits beruhigte ihn, dass der Arzt offenbar keine akute
Gefahr erkannt hatte, andererseits war da die vorläufige Diagnose Herzrhythmusstörungen. Bis gestern hatte er sich noch kerngesund gefühlt und jetzt war er plötzlich ein Herzpatient. Scheiße!, dachte Leander.
Von der Praxis in Boldixum radelte er direkt zurück in die Stadt und holte sich in der Apotheke am Rathausplatz die
Schmerztabletten. Die Apothekerin wies ihn ebenfalls darauf hin, dass er sie
nur mit Vorsicht einnehmen solle, da es sich um ein hoch dosiertes Präparat handele, das zudem einige Nebenwirkungen habe.
Von hier aus schob er sein Fahrrad durch die Fußgängerzone nach Hause. Er wollte nur noch die Tabletten nehmen, sich ins Bett
legen und darauf warten, dass die Kopfschmerzen, die inzwischen auch noch Übelkeit hervorriefen, endlich verschwanden. Aber vorher musste er Franziska die
Diagnose erläutern, ohne sie mehr als nötig in Unruhe zu versetzen.
Kapitel 9
Franziska reagierte, wie Leander es erwartet hatte: aufgeregt. Sie verordnete
ihm strikte Bettruhe und fuhr dann zurück nach Amrum, um dort alles für ihre längere Abwesenheit zu regeln. Am kommenden Tag würde sie zurückkommen und für einige Zeit bei Leander einziehen. Letzteres freute ihn. So hatte die
Aufregung am Ende doch etwas Gutes. Oder sollte die Lage ernster sein, als er
sich das eingestehen wollte?
Das mit der Bettruhe war angenehm, solange die Kopfschmerzen heftig waren. Als sie schließlich etwas nachließen, trieb es Leander in den Garten, wo er im Liegestuhl intensive
Selbstbeobachtung betrieb und seinen oft trüben Gedanken nachhing.
Irgendwann erschien Johannas Kopf über der Hecke. Leander erwartete die übliche rhetorische Frage »Henning, bist du da?«, aber die alte Nachbarin nickte nur beruhigt und zog ihren Kopf wieder zurück. Offenbar war auch sie der Ansicht, dass er geschont werden musste, was
Leander leider zusätzlich beunruhigte. Wie ernst musste es um ihn bestellt sein, wenn selbst die
alte Johanna darauf verzichtete, ihm auf die Nerven zu gehen?