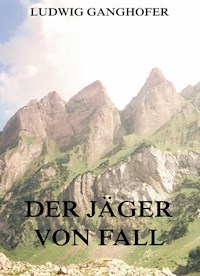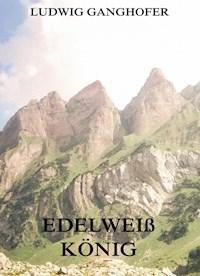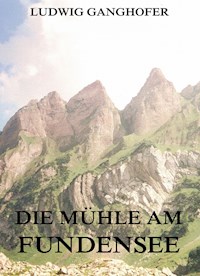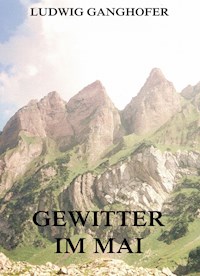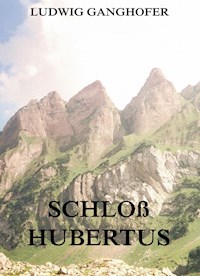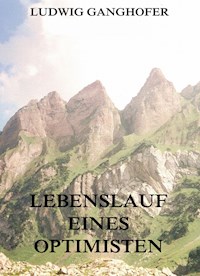
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ganghofers Autobiografie steckt, typisch für ihn, voller Humor und beschreibt viele herrliche Anekdoten aus seiner Jugend. Ludwig Albert Ganghofer war ein bayerischer Schriftsteller, der durch seine Heimatromane bekannt geworden ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1297
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lebenslauf eines Optimisten
Ludwig Ganghofer
Inhalt:
Ludwig Ganghofer – Biografie und Bibliografie
Lebenslauf eines Optimisten
Buch der Kindheit
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Buch der Jugend
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Buch der Freiheit
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Lebenslauf eines Optimisten, Ludwig Ganghofer
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN:9783849614607
www.jazzybee-verlag.de
Ludwig Ganghofer – Biografie und Bibliografie
Dichter und Schriftsteller, Sohn des August Ganghofer, geb. 7. Juli 1855 in Kaufbeuren, wandte sich erst der Maschinentechnik zu, betrieb dann in Würzburg, München und Berlin philosophische, naturwissenschaftliche und philologische Studien und widmete sich, nachdem er 1879 in Leipzig promoviert worden war, ausschließlich literarischer Tätigkeit. Er lebt in München. G. errang seine ersten Erfolge als Dramatiker durch die für die Wandertruppe der Münchener Dialektschauspieler gemeinsam mit Hans Neuert geschriebenen Volksstücke: »Der Herrgottschnitzer von Ammergau« (Augsb. 1880; 10. Aufl., Stuttg. 1901), »Der Prozeßhansl« (Stuttg. 1881, 4. Aufl. 1884) und »Der Geigenmacher von Mittenwald« (das. 1884, neue Bearbeitung 1900). Später folgten das gemeinsam mit Marco Brociner geschriebene Trauerspiel: »Die Hochzeit von Valeni« (Stuttg. 1889,.3. Aufl. 1903), die Schauspiele »Die Falle« (das. 1891), »Auf der Höhe« (das. 1892) und das ländliche Drama »Der heilige Rat« (das. 1901). Einen großen Leserkreis erwarb sich G. durch sein frisches Erzählertalent, insbes. mit seinen Hochlandsgeschichten. Wir nennen davon die meist in einer Reihe von Auflagen erschienenen Werke: »Der Jäger von Fall« (Stuttg. 1882), »Almer und Jägerleut« (das. 1885), »Edelweißkönig« (das. 1886, 2 Bde.), »Oberland« (das. 1887), »Der Unfried« (das. 1888), »Die Fackeljungfrau« (das. 1893), »Doppelte Wahrheit« (das. 1893), »Rachele Scarpa« (das. 1898), »Tarantella« (das. 1898), »Das Kaser-Mandl« (Berl. 1900) sowie die Romane: »Der Klosterjäger« (Stuttg. 1893), »Die Martinsklause« (das. 1894), »Schloß Hubertus« (das. 1895), »Die Bacchantin« (das. 1896), »Der laufende Berg« (das. 1897), »Das Gotteslehen« (das. 1899), »Das Schweigen im Walde« (Berl. 1899), »Der Dorfapostel« (Stuttg. 1900), »Das neue Wesen« (das. 1902). Daneben veröffentlichte er noch: »Vom Stamme Asra«, Gedichte (Brem. 1879; 2. vermehrte Aufl. u. d. T.: »Bunte Zeit«, Stuttg. 1883), »Heimkehr«, neue Gedichte (das. 1884), »Es war einmal«, moderne Märchen (das. 1891), »Fliegender Sommer«, kleine Erzählungen (Berl. 1893) u. a. Im Roman »Die Sünden der Väter« (Stuttg. 1886, 7. Aufl. 1902) versuchte sich G. ohne rechtes Glück als Sittenmaler; er hat darin den Dichter Heinrich Leuthold geschildert. G. gab auch eine Übersetzung von A. de Mussets »Rolla« (Wien 1880) und mit Chiavacci die »Gesammelten Werke Johann Nestroys« heraus.
Lebenslauf eines Optimisten
Buch der Kindheit
Diese Geschichte meiner frohen
Kindheit widme ich meinen Kindern:
Lolo, Sophie und Gustl.
I.
Ein entsetzlicher Spektakel mit Geklirr und Gerassel – grelles Licht – dann finstere Nacht, in der ich schreien mußte vor Angst.
Das ist die älteste unter den Erinnerungen an meine Kinderzeit in Kaufbeuren. Als ich vor vielen Jahren meiner Mutter einmal sagte, daß diese Erinnerung in mir wäre, mußte sie sich lange besinnen, bevor sie das Rätsel lösen konnte. Sie hatte mich, ein anderthalbjähriges Bübchen, an einem Winterabend auf den Boden der Wohnstube gesetzt und war in die Küche gegangen; da hörte sie diesen klirrenden Spektakel; und als sie dem Lärm erschrocken nachlief fand sie eine finstere Stube, in der ich schrie, als wär' ich an einen Spieß gebohrt; sie machte Licht, und da saß ich zeternd auf dem Tisch, während die Stehlampe in Scherben auf dem Boden lag.
Diese Lampe bekam neue Gläser, und ihr eiserner Fuß wurde fest auf einen großen, mit Blei ausgegossenen Holzteller geschraubt. Nun konnte man sie mit dem besten Kinderwillen nicht mehr umwerfen. Und so hat diese Lampe in der Wohnstube meiner Eltern noch hellen Dienst getan, als ich nach 25 Jahren der dunklen Beschäftigung oblag: Philosophie zu studieren.
Eine zweite Erinnerung: ich friere schrecklich, obwohl die Sonne scheint; viele Menschen sind um mich her; ich laufe schnell und habe Schmerzen an den Sohlen; und die vielen Menschen laufen mir nach und lachen immer.
Da hatte meine Mutter mich als dreijährigen Jungen an einem Märzmorgen ins Bad gehoben. Sie wurde abgerufen, kam zurück – und fand die Badewanne leer. In der Wohnung war der nasse Ausreißer nicht zu finden. Meine Mutter rannte über die Treppe hinunter, guckte durch die Haustür auf den Kirchplatz hinaus – und da rief ihr eine Nachbarsfrau mit Lachen zu: »Frau Aktewar, uier Ludwigle isch buzelnacket über'n Marktplatz gloffe!« Die Mutter jagte hinter mir her, vergnügte Leute wiesen ihr den Weg, und schließlich erwischte sie mich draußen vor der Stadt im Forstamte, in dessen Kanzlei mein Vater als Aktuar unter dem Forstmeister Thoma diente. – Aus dieser unsittlichen Begebenheit machte ein Kaufbeurer Gelegenheitsdichter eine Ballade, die mit den Versen begann:
»Frau Aktuar,
Ja isch denn wahr?«
Dieses Lied wurde nach der Melodie einer landläufigen Moritat gesungen.
Meine dritte Kindheitserinnerung: ich freue mich sehr über ein schönes, neues, weißes Kleidchen; immer höre ich schmetternde Musik; ich bin in einem großen Walde, und da sind noch tausend Menschen; zwischen anderen Kindern steh' ich vor einem dicken, langen Balken; ich schiebe diesen Balken; er bewegt sich, immer schneller – viel schneller, als ich mit meinen vierjährigen Beinchen laufen kann; ich hänge mit beiden Armen an dieses rasende Ungeheuer geklammert, und meine Füße fliegen in der Luft; ein grauenvoller Schreck überfällt mich; ich lasse den brausenden Drachen aus, schlage Purzelbäume durch eine linde Sache und sinke in eine schwarze fürchterliche Tiefe.
Damals wurde in Kaufbeuren das jährlich wiederkehrende ›Tänzelfest‹ gefeiert, ein Kindervergnügen, an dem sich auch alle Erwachsenen der Stadt zu beteiligen pflegten. Die schulpflichtigen Knaben waren soldatisch uniformiert, hatten Musik, Offiziere und Fahnenjunker. Ich erinnere mich noch deutlich an solch einen Junker, der auf dem Kirchplatz, inmitten eines schwarzen Ringes von Menschen, seine Kunststücke als Fahnenschwinger produzierte. In festlichem Zuge marschierte jung und alt nach einem kleinen, vor der Stadt gelegenen Wäldchen – nach dem ›Tänzelholzle‹. Unter den mancherlei Belustigungen, die es hier für die Kinder gab, befand sich auch ein etwas primitiv konstruiertes Karussell. Ein Stern von langen Balken, an deren Enden die kleinen Kutschen und Pferdchen angeschmiedet waren, drehte sich horizontal um seine Achse. Ein paar Dutzend Jungen stellten sich vor die Balken hin und brachten diesen Göppel in Lauf. Die lustige Arbeit gefiel mir; ich wollte da mitmachen, lief meiner Mutter davon und half an einem Balken schieben. Es hatte am Morgen geregnet, und der Boden unter dem Balkensterne war in klebrigen Morast verwandelt. Erst glaubte ich zu schieben, dann wurde ich geschleift, verlor den Boden unter den Füßen, ließ den Balken aus, kollerte in meinem schönen, neuen weißen Kleidchen durch den schwarzen Schlamm – und viele Schuhe trampelten über mich weg, bis ich bewußtlos davongetragen wurde.
Noch eine andere Erinnerung reicht in mein viertes Lebensjahr zurück. Ich glaube, daß ich sie nicht übergehen darf. Denn sie hilft die Frage beantworten, in welchem Lebensalter die unbewußten Ahnungen des Blutes beginnen und die Kinderseele zum ersten Male berührt werden kann von jenem Ewigkeitsgeheimnis, das zwischen Männchen und Weibchen seine unsichtbaren, aber sicher bindenden Fäden spinnt.
Meine Eltern waren mit einer Familie befreundet, in der zwei Töchter von achtzehn und neunzehn Jahren das Haus mit Frohsinn und Lachen füllten. Diese Mädchen waren meine zwei anderen Mütterchen. Namentlich die Jüngere von den beiden, das Theresle, verhätschelte mich über Gebühr. Ich war viel in diesem Hause. Und einmal blieb ich da über Nacht – ich weiß nicht, weshalb – vielleicht, weil sich daheim bei den Eltern etwas ereignete, wobei man die zweijährigen Augen meines Schwesterchens noch nicht scheute, aber schon meine vierjährigen, immer in Neugier spähenden Gucker. Ich vermute das, weil mir aus jener Zeit ein Wort im Gedächtnis blieb, das irgendjemand über mich sprach: »Das Lausbüeble spitzt überall hin, wo's vorbeischaue sollt!« Und damals wurde ja auch mein Brüderchen geboren, das Fritzele, das nach wenigen Monaten die Augen wieder schließen mußte, mit denen es die Welt noch gar nicht recht gesehen hatte.
Da sprechen nun die beiden Kontraste durcheinander: der Tod, der das Leben endet – und das Geheimnis, aus dem alles Leben quillt. Und zwischen diesen beiden Gegensätzen zittert ein erschrockenes Kinderseelchen.
Das Theresle behielt mich damals über Nacht und bescherte mir ein lindes Winkelchen in seinem Bett. Ich wurde wohl schon mit Anbruch des Abends in dieses große Nest gesteckt. Und als dann das Theresle schlafen ging, wurde ich wieder munter, tollte nach meiner Art, trieb allerlei Ungezogenheiten und warf die Kissen so unmanierlich durcheinander, daß meine achtzehnjährige Schlafkameradin unser Lager wieder in Ordnung bringen mußte. Sie legte das Federbett und die Kissen auf den Boden heraus, und während ich mir's auf dieser linden Unterlage gemütlich machte, strich das Theresle mit flinken Händen das Leintuch glatt. Und wollte beim Tisch, auf dem die Lampe brannte, etwas holen. Und stieg im Hemde über mich weg – und wie ein ahnungsloser Schläfer von Alpdrücken befallen wird, nur weil er auf dem Rücken liegt, so wurde ich da plötzlich von einem atembeklemmenden Schreck überfallen, so tief und wunderlich, daß er sich für Lebenszeit in meinem Erinnerungsvermögen festnistete.
Als mich das Mädel in das frischgemachte Bett hineinhob, blieb ich still und zitterte. Und niemals wieder ließ ich mich vom Theresle küssen oder hätscheln. Ich fing zu schreien an, wenn sie mich in die Arme nahm. Und seit damals blieb in mir durch ein Dutzend Jahre ein grober Widerwille gegen alles, was Mädchen hieß.
Warum dauerte gerade diese Erinnerung so fest und deutlich? Und vieles andere, das sich meinem Gedächtnis hätte einprägen müssen, ist erloschen in mir. Ich weiß nicht mehr, wie das auf mich wirkte, daß ich plötzlich ein Brüderchen hatte. Und weiß nicht, was ich empfand und dachte, als dieses Brüderchen über Nacht verschwunden war und nicht mehr kam. Ich erinnere mich nur dunkel an eine Zeit, in der die Mutter immer weinte und der Vater immer ein blasses Gesicht hatte. Und weiß noch, daß im Schlafzimmer meiner Eltern ein Gemälde hing, das ein bleiches, ruhig schlummerndes Kind auf weißen Kissen zeigte – und daß ich eines Tages fragte: »Warum kommt das Fritzele nicht herunter und spielt mit mir?« Nach Jahren erfuhr ich, daß dieses Bild ein verstorbenes Brüderchen meiner Mutter darstellte, das auf dem Totenbett gemalt worden war.
Wie Vater und Mutter damals in Kaufbeuren aussahen, weiß ich nicht mehr zu sagen. Wenn ich mich an die Züge der Mutter in jener Zeit zu erinnern suche, seh' ich kein Gesicht, sondern höre ein leises Weinen und dann wieder ein helles Lachen, eine heiter singende Stimme, die durch alle Zimmer klingt, Trepp' auf und nieder. Und forsche ich in meinem Gedächtnis nach meiner kleinen Schwester Berta, die anderthalb Jahre nach mir geboren wurde, so seh' ich immer ein schwarzes Mohrengesicht mit einem roten Mäulchen, das fürchterlich schreit. Ich hatte das Kind, das in seinem Bettchen schlief – und dazu noch die Kissen, die Stühle, den Tisch und die Wände – reichlich und dick mit frisch eingesottener Heidelbeermarmelade bestrichen, die zum Auskühlen am offenen Fenster stand.
Noch manches andere, was außerhalb der Mauern meiner elterlichen Heimat spielte, ist mir in Erinnerung geblieben. Ich sehe den Fröbel'schen Kindergarten, sehe die vielen kleinen Gesichter und die jungen Bäume, die in regelmäßigen Reihen frisch gepflanzt waren und nicht berührt werden durften. Ich sehe den hohen Treppenschacht in einem alten Kaufmannshause – und in der Dämmerung kommt da von der Höhe etwas Schönes, Freudenreiches und wundersam Leuchtendes herunter: ein Körbchen, das mit Süßigkeiten angefüllt und von brennenden Wachslichtern umgeben ist. Ich sehe den Hohlweg, der zum Hause des Forstmeisters Franz Thoma hinausführt, sehe den Hausflur, die Kanzlei zur Rechten, eine gute Stube zur Linken, und den gepflasterten Hof mit dem alten Brunnen. Ich sehe den Marktplatz; das Bild der Häuser ist verschwommen; aber scharf und deutlich ist da ein langer, mit grauen Bohlen zugedeckter Bachlauf; auf diesen Brettern ging ich mit Vorliebe spazieren und lag da noch lieber auf dem Bauche, um durch eine kleine vergitterte Öffnung hinunterzugucken in das dunkel vorüberschießende Wasser. Ich sehe die Honoratiorenstube im Gasthaus zum Hirschen, wo meine Eltern als Freunde der Wirtin viel verkehrten – sehe die zwei langen Tische mit den Fidibusbechern, den großen Kachelofen und das kleine, zur Küche führende Schubfenster, durch das die Hirschwirtin mit lachendem Gesicht hereinguckt, wenn sie mir ein Stück Kuchen oder sonst was Gutes zwischen die gestreckten Hände gibt – und da draußen in dem lärmvollen Raume ist immer ein duftender Qualm, und überall funkelt es von Kupfer und Messing.
Ich sehe das Schneegeglitzer und höre das Schellengerassel einer Schlittenpartie – und erinnere mich, daß mir auf der Heimfahrt grausam übel wurde. Ich sehe den großen Garten, das reiche Zimmer, den grünen Papagei und die alten freundlichen Gesichter der Schrader'schen Eheleute, die zehn Jahre später aus rätselhafter Ursache und auf schauerliche Weise ermordet wurden, ohne daß man den Täter entdecken konnte. Und deutlich ist mir der ausregungsvolle Tag im Gedächtnis geblieben, an dem ich mit meinem Schwesterchen photographiert wurde. Der Mann, der dieses Werk vollführte, hatte einen langen Knebelbart; er tauchte zwanzig Jahre später plötzlich aus meiner Erinnerung herauf, als ich in Wien eine allegorische Statue des Inn zu sehen bekam; ganz den gleichen Bart, wie dieser Tiroler Flußgott, hatte der Kaufbeurer Photograph, der neben einem schwarzverhüllten Kasten stand und immer sagte: »Passet auf, Kinderle, passet auf, da springt jetzt gleich e Füchsle raus, mit em rote Schwänzle!« Mein Schwesterl bekam ein bißchen Angst, ich guckte mit gespannter Aufmerksamkeit in das Glasauge des geheimnisvollen Kastens, aber es kam kein Fuchs heraus. Manch ein Jährchen später erzählte mir meine Mutter, ich wäre nach dieser Enttäuschung auf den Photographen zugegangen und hätte in Zorn zu ihm gesagt: »Du bischt ein Lugeschüppel!« Von einer Reise, die meine Mutter mit mir in ihre fränkische Heimat machte, nach Aschaffenburg, Frankfurt, Mainz und Wiesbaden, ist mir nur die unklare Erinnerung an zwei Abenteuer geblieben. In Wiesbaden brannte ich dem Kindermädchen durch, lief einem Bärentreiber nach und konnte erst spät am Abend mit Hilfe der Polizei wieder gefunden werden. Und auf der Rückreise saß mir im Eisenbahnwagen ein prachtvoll uniformierter Herr mit großem Barte gegenüber. Der machte Eindruck auf mich und weckte meine Neugier. Und weil ich wußte, daß der Bruder meiner Mutter Offizier war, fragte ich den Herrlichen: »Bischt du mein Onkel Wilhelm?«
»Nein.«
»Bischt du der Kaiser Napoleon?«
»Nein.«
»Dann bischt du ein Hanswurscht.«
Aber auch diese Hypothese war falsch. Denn der prachtvolle Mensch war ein Hotelportier.
Auch von einer Reise, die ich zu meinem Großvater Anton Ganghofer machen durfte, der als Forstmeister zu Ottobeuren lebte, ist mir kein Bild der Fahrt im Gedächtnis geblieben. Aber ich sehe noch das Forsthaus mit der Gaisblattlaube und der steinernen Freitreppe vor der Haustür, sehe die breiten, überwölbten Korridore, die großen Zimmer, und am deutlichsten den Fischweiher, in dem es Karpfen und Schleien gab, und aus dem in der Abendstille die schlangenförmigen Nebel herauskrochen in die Dämmerung. Ich sehe das lachende Faltengesicht des Großvaters mit den lustig zwinkernden Augen. Er steht in der Sonne unter der Haustür, hat die Hände in den Hosentaschen, sieht mich herzlich an und fragt:
»Ludwigle, magst ein Kreuzer?«
Ich zweifle: »Hascht du denn einen?« Denn ich wußte, daß die Großmutter immer alles einsperrte und die Schlüssel abzog.
Der Großvater schüttelt mit den Händen die Hosensäcke, in denen ein lautes Klingen und Klirren ist. »Schau, so viel Geld hab ich!«
Dann darf ich mich strecken, darf dem Großvater in die Taschen greifen und finde in jeder einen einsamen Kreuzer. Was da so geklingelt hatte, das waren die Schlüssel der Aktenschränke.
Auch die Großmutter seh' ich, die wenig Zeit für mich hat und immer in dem großen Hause einer Arbeit nachläuft, nie beim Mittagessen sitzen bleibt, sondern zwischen Suppe und Fleisch, zwischen Fleisch und Mehlspeise immer was zu rennen und etwas Unaufschiebbares zu tun hat. Sie ist gut. Aber ihre Augen gucken immer ein bißchen mißtrauisch. Und am Abend, wenn ich in der Ecke des großen Zimmers in dem großen Fremdenbette liege und noch nicht schlafen mag, dann droht sie mir ungeduldig: »Gleich tu schlafe! Oder das Sandmännle kommt zum Fenster herein und blast dir die Augen aus!« Weil sie mir niemals sagt, wie das Sandmännle aussieht, macht sie mich nicht ängstlich, nur neugierig. Und drum sitze ich lange Stunden wach und blinzle erwartungsvoll in das Zwielicht des Fensters, ob denn das Sandmännle nicht endlich einmal erscheinen will. Es ist nie gekommen. Deshalb sagte ich zur Großmutter einmal was Ähnliches wie zu dem Photographen, der mir ein Füchsle mit rotem Schwänzle versprochen hatte. Aber die Großmutter lachte nicht freundlich wie der Photograph, sondern gab mir eine feste Tachtel – den ersten schmerzen, den Schlag, den mein junges Leben empfing. Dafür mußte ich die Großmutter noch um Verzeihung bitten. Es fiel mir schwer, diese Notwendigkeit zu begreifen.
Am Abend, wenn im Hause keine Arbeit mehr zu tun war und das Licht noch ein bißchen gespart werden konnte, weil der Großvater auf der Rehpirsche war, saß die Großmutter in der grauen Fensternische, sah wie eine Negerin aus und erzählte mir allerlei Geschichten. Ich erinnere mich an keine mehr. Ich höre nur die ruhige, kluge, ein wenig trockene Stimme, ohne zu verstehen, was sie spricht.
Aber gut besinne ich mich noch auf einen höchst bedeutungsvollen Lebensrat, den mir die Großmutter einmal gab, als ich mit ihr im Walde spazieren ging. Da war ein langer, gerader Sandweg zwischen grünen Wänden. Und neben diesem Wege hatte sich ein junges Bauernmädchen zu einer Stellung niedergehuschelt, die jeden Zweifel über ihre menschliche Notwendigkeit ausschloß. Und da sagte die Großmutter: »Ludwigle, druck d' Auge zu! Sonst wirscht du blind!« Ich zwickte die Lider fest zusammen, bis mir die Großmutter erlaubte: »So, jetzt kannst wieder schaue!«
Vor dem Blindwerden hatte ich seit dieser Waldstunde eine große Angst. Und noch manch ein Jährchen später – in dem Dorfe, wo der Vater Revierförster wurde – hab' ich immer gleich die Augen zugedrückt, wenn ich in die Gefahr kam, blind zu werden.
In dem strengen Winter, der um die Weihnachtszeit des Jahres 1859 das bayerische Hochland in ein Klein-Sibirien verwandelte, erhielt mein Vater seine Beförderung vom Forstamtsaktuar zum Revierförster und wurde aus dem freundlichen Städtchen Kaufbeuren nach dem Dorfe Welden im schwäbischen Holzwinkel versetzt.
Die letzte Erinnerung, die ich aus meiner Vaterstadt mitfortnahm, war der unfreundliche Anblick der ausgeräumten und kalten Zimmer. Überrall an den Wänden, wo ein Bild gehangen hatte, war ein heller Fleck.
Durch 45 Jahre hab' ich meine Vaterstadt nicht mehr betreten. Ich sah sie nur manchmal vor dem Eisenbahnfenster vorüber gleiten, wenn ich auf einer Ferienfahrt und später auf einer Studienreise in die Allgäuer Berge an Kaufbeuren vorüberkam. Immer nahm ich mir vor: »Das nächstemal steigst du aus und gehst die Wege wieder, die du als Kind gegangen!« Es kam aber nie dazu. Fuhr ich den Bergen entgegen, so hatte ich Sehnsucht nach meinem blauen Ziel; war ich auf der Heimreise, so hatte ich Sehnsucht nach den Meinen. Und so blieb mir keine Zeit, die Erinnerungen meiner ersten Kindheit in mir aufzufrischen.
Als ich den fünfzigsten Geburtstag zu ertragen bekam, sandte mir die Stadt Kaufbeuren einen Glückwunsch, den die Mitteilung begleitete, daß eine Gedenktafel an mein Geburtshaus käme. Ein Jahr später wurde diese Tafel enthüllt, und die Stadt lud mich zu einer herzlichen Feier ein. Meine Frau, meine Kinder und liebe Freunde begleiteten mich. Wir standen in milder Herbstsonne vor dem alten Hause, an dessen brüchiger Mauer eine große Kupfertafel mein Bild und meinen Namen zeigte. Das war Ehre und Freude für mich. Aber die tiefe, schwere Erschütterung, die mein fünfzigjähriges Leben durchzitterte, ging von dieser alten hochgegiebelten Mauer aus, von diesen acht schmalen, in zwei Stockwerken dicht aneinandergereihten Fenstern. Die Glasscheiben waren grau und hatten keine Vorhänge. Etwas Kaltes und Ödes guckte da droben durch acht müde, leblose Augen heraus. Die Wohnung stand gerade leer – so kalt und ausgeräumt wie in jener Stunde, in der ich sie als Kind an der Hand der Mutter verlassen hatte. Ich stieg die enge, steile Treppe hinauf – jeder Schritt wie ein Schmerz und doch wie eine frohe, zärtliche Erwartung. Nun das Zimmer, das die Wohnstube meiner Eltern war! Der Raum sollte gerade tapeziert werden, und die leeren Wände waren frisch mit Zeitungspapier überklebt. Aber jäh, mit einem Schlage, war nicht nur für mein Herz, auch für meine Augen das unzerstörte Bild der vergangenen Zeit wieder da. Ich sah jedes Möbelstück, wußte genau die Stelle, wo es gestanden. Alles Kleine meines kleinen Lebens von damals erwachte. Und hier, diese abgetretene Schwelle – da trippelte ich an jedem Morgen in die Schlafstube meiner Eltern hinein, um der Mutter und dem Vater guten Morgen zu wünschen. Mir war's, als stünden die zwei Betten noch da; weil der Raum so schmal war, mußten sie der Länge nach an der gleichen Mauer stehen. Nach rechts hin, gegen das Fenster, schlief der Vater; nach links hin, in der geschützten Ecke, schlief die Mutter. Hier, zwei Spannen von dieser kahlen Mauer entfernt, erweckte die Liebe meiner Eltern den Keim meines Lebens, hier tat ich meinen ersten Schrei, meinen ersten Blick in das Licht.
Aus aller Erschütterung, die mir dieser Gedanke brachte, glomm die Erinnerung an ein Nebensächliches auf: »Hier muß irgendwo ein kleines Wandkästchen sein!« Richtig, es war noch da – das kleine Türchen noch so mit weißer Ölfarbe gestrichen wie damals. In diesem Kästchen war immer was Gutes. Und daneben hing vor fünfzig Jahren ein kleines verglastes Bild – eine Daguerreotype meiner Urgroßmutter, der neunzigjährigen Landrichterin Ganghofer von Trostberg. Wenn ich als Kind auf einen Sessel stieg, um das Bildchen von vorne zu betrachten, sah ich nichts als einen silberigen Schimmer. Man mußte zwischen Bild und Fenster den Kopf gegen die Mauer halten; dann sah man ein dunkles steifes Kleid und ein Runzelgesicht mit weißem Haar und schwarzem Häubchen drüber.
Und draußen, in der winzigen Küche, da stand noch immer der Herd in der gleichen Ecke. Doch eine wundersame Sache meiner Kinderjahre war verschwunden. Damals war da irgendwo ein steinerner Ausguß. Der war so hoch an der Mauer, daß ich als vierjähriger Junge gerade das Kinn auf den glattgescheuerten Steinrand legen konnte. Und statt einer Ausflußröhre ging nur ein rundes Loch in die Luft hinaus; im Winter war es mit einer hölzernen Klappe verschlossen, doch in warmen Zeiten stand es immer offen. Hier, vor diesem Steintrog, konnte ich unermüdlich aushalten und träumend das kleine, schöne Bild betrachten, das durch die runde Lücke zu sehen war: spitze, steile Dächer, auf denen die Katzen spazieren gingen und die Tauben saßen; Mansardenfenster, aus denen bald ein altes Frauengesicht und bald ein Schornsteinfeger herausguckte; über den Dächern ein hoher Kirchturm mit läutender Glocke, von Schwalben umflogen; und hinter allem der helle Himmel mit den weidenden Silberschäfchen auf der blauen Wiese.
Dieses liebe schöne Bild war nimmer da; der Steintrog war verschwunden, das Loch vermauert. Solche Wandlungen pflegt man fortschreitende Kultur zu nennen.
Aber verschwunden war ja in diesen fünfzig Jahren auch noch vieles andere: Leben, das mich liebte, Leben, an dem ich in Zärtlichkeit gehangen. Und dennoch war's erloschen. Ich empfand es wie Kummer und Vorwurf, daß ich an jenem Tage, der meinen Namen feierte, aus den leeren stillen Stuben heraustreten mußte, ohne daß die Gesichter von Vater und Mutter, wie sie damals in Kaufbeuren waren, in mir erwachten. Ich sah nur das Bild, das mir aus späteren Jahren von ihnen geblieben.
Von der Jugend ihres Glückes weiß ich manches zu sagen, was die Mutter mir erzählte. Ihr junges Zusammenleben war ein frohes Lachen, das entzwei gerissen wurde durch einen einzigen Schmerz – durch den Verlust ihres dritten Kindes.
Mein Vater August – im Frühling 1827 zu Baierdiessen am Ammersee geboren – stammte aus einem altbayrischen Geschlechte. Ein Ahn unseres Namens war der Maurermeister Jörg Ganghofer, der die Münchener Frauenkirche baute. Die Familie kam zu Besitz und zu einem adeligen Wappen. Aber im dreißigjährigen Kriege ging wieder flöten, was Gut und Geld hieß. Zwei Brüder Ganghofer, die dann in Niederbayern als kleine Bauern saßen, legten den Adel ab, weil sie der vernünftigen Meinung waren, daß sich ein Wappen nicht gut mit dem Mistkarren vertrüge. Ihre Kindeskinder wurden Richter und Forstleute.
Das ist so ziemlich alles, was wir Nachkommen von der Vergangenheit unseres Namens noch zu berichten wissen. In den drei Generationen, die ich als Enkel und Urenkel noch zu überschauen vermag, ging alles Leben so still und gerade, so aufregungslos und ordnungsmäßig seine ruhigen Wege, daß von diesen Heimgegangenen nur drei Worte zu erzählen sind: sie wurden geboren, taten in einem bescheidenen Leben ihre Pflicht und legten sich zur verläßlichen Ruhe nieder.
Die Frauen in dieser Familie wurden alt, manche bis an hundert Jahre. Die Männer starben früher – mein Großvater Mitte der Sechzig. Er war gesund bis aus Ende und hatte den letzten Abend noch im Gasthaus zur Post am heiteren Stammtisch mit Apotheker, Revierförster, Landrichter, Posthalter und Dekan verbracht. Ein paar Minuten vor zwölf Uhr kam er heim.
Die Großmutter erwachte. »Hascht dich gut unterhalte?«
»Großartig! 's isch lang nimmer so luschtig gwese wie heut!« Der Großvater, schon in Hemdärmeln, ging zum Waschtisch und füllte ein Glas mit Wasser. »Gelacht habe mer, daß mer schier Kröpf kriegt habe. Und der Apotheker hat wieder so ein Geschichtle erzählt ... da wirscht vor Luschtigkeit drüber schreie!« Er trank, stellte das leere Glas auf den Tisch und sagte lachend: »Paß auf!« Dann fiel er um und war tot. –
Von seinen sieben Kindern, unter denen mein Vater der Erstgeborene war, starben zwei Brüder in jungen Jahren: Ludwig bekam als Student in München den Typhus, und Joseph verlor aus unglücklicher Liebe den Verstand und erlosch in der Einsamkeit einer gepolsterten Zelle. Bevor man ihn einschließen mußte in diesen linden Kasten, wohnte er kurze Zeit im Hause meiner Eltern; man hatte mich und meine Schwester aus der Kinderstube genommen, um sie dem, kranken Onkel Joseph' einzuräumen. Wir schliefen während dieser Zeit herunten in der Wohnstube. Und da konnte ich in den Nächten lange Stunden keinen Schlummer finden, weil ich über der Stubendecke immer diese ruhelosen Schritte hörte, mit denen ein zerdrücktes Leben seinen Gram und Wahnsinn hin und her trug, wie ein Wolf seinen Hunger. Noch zwanzig Jahre später ging ein kaltes Grauen durch meine Seele, als mir eines Tages der Vater ein dickes Heft zeigte: »Das sind Gedichte, die der arme Joseph gemacht hat.« Ich wollte diese Lieder nicht lesen.
Ein Bruder meines Vaters – Onkel Franz – wurde Forstmann; Onkel Max wurde Techniker; die beiden Schwestern Irma und Berta verheirateten sich an Forstleute. Diese Tante Berta – als sie noch in der Wiege lag – hatte immer ein Dutzend langer Falten auf der kleinen Stirne. Ihrem Brüderchen, dem Franzele, gefiel dieses Runzelige nicht; drum griff das kunstsinnige Bübchen in einer unbewachten Stunde nach dem heißen Bügeleisen der Großmutter und bügelte dem zeternden Kinde so lange die Stirne aus, bis diese unschönen Runzeln verwandelt waren in eine schöne, glatte Brandblase. Das hat dem Kinde weiter nicht viel geschadet, denn es wurde aus ihm eine feste, tapfere Frau, die sich nach schweren Schicksalsschlägen mutig durchs Leben kämpfte.
Wie dieser künstlerischveranlagte Bruder Franz, so hatte auch mein Vater für seinen Lebensweg die grüne Farbe gewählt, die ihm gut bekam. Und auf der Forstschule in Aschaffenburg lernte er sein ›Lottchen‹ kennen, das er nach siebenjährigem Brautstande zur Frau nahm. Seine Art, das war gerader, fester und gesunder Schlag, ohne jede Spur von psychologischer Komplikation. Einfach, in jedem Zug seines Wesens leicht erkenntlich, ruhig und klar, pflichttreu und gewissenhaft als Mensch und Beamter, heiter ohne Neigung zum Übermaß, das über die Schnur geht, ernst ohne jeden Zug von Pedanterie, herzenswarm und aufrichtig – so war mein Vater von Jugend auf, und so blieb er sein ganzes Leben.
Im quecksilbernen, temperamentvollen und lebensfrohen Naturell meiner Mutter mischte sich fränkisches und französisches Blut. Sie war eine geborene Louis. Und in ihrer Familie geht die Sage, daß ein Ahnherr Louis als Hugenottischer Emigrant nach Deutschland gekommen und Jägermeister bei einem rheinischen Fürsten geworden wäre. Der Großvater meiner Mutter, Friedrich Louis, saß als gräflich Erbach'scher Forstrat im Odenwald. Das war ein tolles, von übermütiger Laune sprudelndes Mannsbild, dem noch heute in der Gegend des Odenwaldes allerlei Geschichten nacherzählt werden, die an mittelalterliche Schwänke erinnern.
An der Waldstraße zwischen Erbach und Eulbach stand ein Sühnestein. Da hatte man einen Mörder, den Haugschmied, an der Stätte der verübten Mordtat hingerichtet. Natürlich geisterte die Seele des Haugschmiedes an diesem gruseligen Platze. Davon sprachen in einer Mondnacht zwei Handwerksburschen, die nach Eulbach wanderten. Und einer von den beiden, um seinen Mut zu erweisen, schrie beim Henkersteine dreimal: »Haugschmied, erscheine!« Brüllend fuhr das Gespenst aus dem Straßengraben heraus, sprang dem Handwerksburschen auf den Rücken und ließ sich von dem Erschrockenen, der ein keuchendes Rennen begann, bis zum Jagdschlosse des Grafen Erbach tragen. Nach dieser dunklen Geschichte lag ein fieberkranker Handwerksbursch vier Wochen lang im Eulbacher Forsthaus, wurde gut gepflegt und nach seiner Genesung vom schmunzelnden Hausherrn mit reichlichem Viatikum und mit der Lehre entlassen: »Em Menschenskind soll wedder den Herrgott noch en Deibel versuche!« Aber die Rolle eines Gespenstes hat dieser Hausherr niemals wieder gespielt. Denn der Spaß war ihm teuer zu stehen gekommen.
Als junger Jägermeister half mein Urgroßvater seinem Grafen, der damals noch reichsunmittelbarer Herr und dazu ein fanatischer Antiquitätensammler war, den sagenhaften Helm des Hannibal zu Rom aus dem Vatikan entführen. Aus diesem lecken, zwischen Tod und groteskem Humor balancierenden Abenteuer hat Otto Müller, dem der greise Forstrat Louis die Geschichte im Odenwald erzählte, einen spannenden Roman gemacht: ›Der Helm von Cannä‹. Aber in diesem Buche mag wohl ein gut Teil gefabelt sein. Viel besser und lebendiger als mein Urgroßvater mir aus den Kapiteln dieses Romans entgegentrat, guckte sein übermütiges und verschmitztes Bild aus den heiteren Erzählungen meiner Mutter heraus. Wenn sie aus ihren Erinnerungen an den Alten ein Stücklein ums andere hervorkramte, so war das für alle, die zuhören durften, der Brunnen eines unerschöpflichen Jubels.
Als der ›Alte im Odenwald‹ schon weiße Haare hatte, bekam er eines schönen Tages zu Eulbach den Besuch eines katholischen Wanderpriesters, der den gemütlichen Ketzer im Angesichte des nahen Todes bekehren und zur Ablegung einer Beichte bewegen wollte.
»Ach wo! Laß er mich doch in Ruh! Ich habb nix zu beichte.«
Aber der Apostel läßt nicht locker und meint: daß alle Menschen schwache Sünder wären, und daß auch der Redlichste sich mancher Schuld seines Lebens mit frommer Reue zu besinnen hätte.
Der Alte schmunzelte. Und der Schelm seiner Jugend erwachte in ihm. »Herr jo! Da hat er recht. Un daß ich ihm die Wahrheit sach ... eenmal im Lewe, da habb ich was verbroche ... Herr jo, dees reut mich! Und dees will ich ihm jetzt beichte!«
Da wären um die Zeit, bevor Napoleon französischer Kaiser wurde, viele hochfürstliche Gäste im Erbacher Schlosse zu Besuch gewesen. Und er, als blutjunger Pikör, hätte vor dem Schlafzimmer einer schönen fürstlichen Dame die Ehrenwache halten müssen, in einer Dezembernacht, bei grimmiger Kälte, in einem Korridor mit Steinfließen und Marmorwänden. Um ein bißchen warm zu bekommen, hätte er immerzu die Hände um die Schultern geschlagen. Und plötzlich hätte die Tür sich ausgetan, und die schöne Dame wäre auf der Schwelle gestanden, weiß wie ein Engel, und hätte freundlich zu ihm gesagt: »Er scheint hier außen sehr kalt zu haben?«
»Ich sach: ›Herr jo, gnädigste Hoheit!‹ ... Und die Hoheit sacht: ›Da scheint er wohl sehr zu frieren?‹ ... Ich sach: ›Herr jo, dees weeß der liewe Gott, es fallen mir fast alle Glidder ussem Leib‹! ... Und da sacht die Hoheit: ›So komm er in Gottes Namen herein zu mir, in meinem Bett ist's warm.‹ Sacht's. Un geht in hochdero Stübbche zurück. Un wie en Klotz bin ich stehengeblibbe un habb da fromm und tugendhaft weitergefrore. Un seh' er nu, Hochwürdiger, dees hat mich bis heutigentags noch e jeddsmal gereut, so oft ich mich druff habb besinne müsse.«
Diese Geschichte erzählte uns die Mutter freilich nicht, als wir noch Kinder waren. Aber was sie uns damals vom Urgroßvater erzählte, das war nicht minder lustig. Am liebsten hörten wir immer die Geschichte von der Gräfin Erbach, deren Leibspeise jene knusperigen Pfannkuchen waren, wie sie in den Bauernhöfen des Odenwaldes gebacken wurden. Da stiftete eines Tages Urgroßvater Louis ein altes Bäuerlein an, der Gräfin solch einen Pfannkuchen zu überbringen und die fette Köstlichkeit, damit sie schön warm bliebe, unter dem Hemde auf der nackten Brust zu transportieren. Das gab dann im goldfunkelnden Audienzzimmer des gräflichen Schlosses einen netten Spektakel, als der Odenwäldler die gelbe Weste aufknöpfte und mit dem rauchenden Pfannkuchen herausrückte.
Eine zärtliche Sympathie empfanden wir Kinder auch für den jungen Eulbacher Schweinehirten Hannäter, der ein Dichter war und eines Mittags nach erledigter Mahlzeit am Gesindetisch des Forsthauses dieses selbstverfaßte Dankgebet zum Himmel sprach:
»Jetzt haw ich gfresse,
Bin noch nit satt,
Hätt gern noch was gesse,
Ha' nix mehr ghatt.
Der Magen ist weitgedehnt,
Das Maul ans Fresse gwehnt,
Drum hungert's mich jedderzeit
Jetz un in Ewichkeit ...«
Bevor er das Amen herausbrachte, bekam er vom Urgroßvater Louis eine fürchterliche Maulschelle. Aber trotz dieser Bitternis seiner lyrischen Laufbahn gewöhnte er sich das Dichten nicht ab. Alles besang er, Himmel und Erde, Engel und Schweine, doch am liebsten sich selbst. Drum war er ein echter Lyriker. Auf seine zahlreichen guten Eigenschaften hatte er ein langes Loblied verfaßt, das mit den Versen begann:
»Hannäter, Hannäter,
Du lustiger Bue ...«
Und als er eines Sommertages am Saum des Eulbacher Hirschparkes neben seiner weidenden Schweineherde in der Sonne saß und wieder einmal das Lied seiner guten Eigenschaften zu singen anfing: »Hannäter, Hannäter, du lustiger Bue ...« da kam aus dem Schatten des Eichenwaldes ein zwitscherndes Echo heraus:
»Hannäter, Hannäter,
Du Saubue ...«
Dieses Echo war die Stimme des zwölfjährigen Lottche Louis, das von Aschaffenburg gekommen war, um beim Großvater im Odenwald die Sommerfrische zu verbringen.
Während der letzten Lebensjahre des ›Alten im Walde‹ fanden sich für die Sommerferien manchmal an die dreißig Söhne, Töchter, Enkel, Neffen und Nichten im Eulbacher Forsthause zusammen, vom vierzigjährigen Staatsrat herunter bis zum vierjährigen Hosenprinzen, der zum erstenmal das Klettern auf die Birnbäume versuchte. Das muß in der grünen Waldstille ein heiteres Leben gewesen sein! Wenn die Mutter davon erzählte, hätte jedes von uns Kindern einen Finger seiner Hand dafür gegeben, wenn wir diese herrlichen Zeiten im Odenwalde noch hätten mitmachen dürfen.
Im großen Jägersaal des Forsthauses waren die Grasmatratzen in langen Reihen nebeneinandergelegt, um das junge Volk zu beherbergen. Und wenn Urgroßvater Louis des Nachts aus seiner lustigen Weinstube kam, dann ging er im Mondschein, der durch die hohen Fenster des Jägersaales hereinfiel, zwischen den Reihen der jungen Schläfer auf und nieder, deckte sorglich die Kleinen zu, die sich bloßgestrampelt hatten – und bei den Lagerstätten der älteren Kinder hielt er den heißen Meerschaumkopf seiner langen Tabakspfeife überall hin, wo unter einer Decke was Nacktes herausguckte.
»Kinderle, das hat fest gebrannt!« versicherte die Mutter. »Und weil ich so ein quecksilbernes Dingelche war, drum hab ich gar oft am Morge so ein Brandbläsle aufm Quartierle gehabt. Aber beim Großvater in Eulbach hat man das bald gelernt: in der Nacht schön ruhig liege! Am Tag hat man zapple dürfe, so viel man möge hat!«
Sie haben sich alle in ein frohes Leben hineingezappelt, jene Kinder von damals – keines zappelte sich zu Tode wie jener Hirsch von sechsundzwanzig Enden, der im Eulbacher Parke mit seinem mächtigen Geweih im Sprunge zwischen den Ästen einer Eiche unlösbar hängen geblieben war und vor den Augen der erschrockenen Kinder an diesem natürlichen Galgen erschossen werden mußte. Sein Geweih hängt noch heute im Hirschsaal des Erbacher Schlosses.
Stiller als die zappelseligen Sommerwochen im Odenwalde waren wohl die Wintermonate im Professorhause auf dem Katzenmarkte zu Aschaffenburg. Aber das quecksilberne Wesen des ›Schimmelche‹ – unter welchem Spitznamen die Lotte Louis in der ganzen Stadt bekannt war – bekam auch hier keinen allzustrengen Zügel zu fühlen. Es waren da nicht immer frohe Zeiten. Vier Geschwister starben in jungen Jahren; und die Mutter Louis wurde taub und krank; sie atmete fern vom Leben in einer Stube, die sie nur verließ, um nach jahrelangem Leiden zur erlösenden Ruhe getragen zu werden. Aber Karl Ludwig, der Vater, hatte doch neben allem Ernste, den sein Beruf und die herben Dinge seines Lebens in ihm erzogen, so viel vom heiteren, lebensfrohen Erbacher Blute mitbekommen, um sich nach allen Schicksalsschlägen wieder aufzurichten und seiner Tochter in drückender Stunde mit dem alten Verse raten zu können:
»Kind, das Lachen ist das Best'
Schon zu Adams Zeiten gwest.«
Er war Mathematiker, Physiker, Zoologe und Architekt, ein Jugendfreund und Studiengenosse von Klenze, Gärtner und Cornelius. Der Gelehrte, der Künstler und der Jäger mischten sich in seinem Charakter zu einem vielfarbigen Bilde. Er publizierte ein weidmännisches Werk: ›Der fährtengerechte Jäger‹; unsere Familie besitzt von seiner Hand noch Aquarelle von einer Reise, die er mit Klenze nach Italien unternahm; in München war er beim Bau des Kriegsministeriums beteiligt, in Aschaffenburg beim Bau des Pompejanums, unter dessen Wandgemälden das ›Schimmelche‹ als fliegende Genie verewigt ist; und König Ludwig I. berief ihn als Professor an die Forstschule.
Wenn der Hof in Aschaffenburg residierte, wurde Professors Lottchen zu den Tanzabenden ins Schloß befohlen – vom Prinzen Adalbert erzählte die Mutter: »Der war ein bisselche hart vom Fleck zu kriege!« – und bei den Herrenabenden des Königs konnte Großvater Louis die Tafelrunde mit mancherlei unzensurierten Heiterkeiten amüsieren. An solch einem Abend produzierte er sich als Zauberkünstler und verwandelte unter dem Hut des Königs einen lebendigen Singvogel in eine kleine, leblose, täuschend nachgemachte Sache, die keine Pflanze ist und doch unter die stacheligen Gewächse mit bekanntem lateinischen Namen gerechnet wird. Der König, der einen Spaß verstand, lachte dazu: »Louis, das muß die Königin sehen!« Am folgenden Tage wurde das überraschende Kunststück vor Ihrer Majestät wiederholt. Und der König hatte sein Vergnügen an dem Schreck und Lachen seiner hohen Gemahlin.
Wir Kinder jubelten immer, wenn die Mutter das erzählte. Aber was in solchen Geschichten vorging, war nie das Beste an ihnen. Die heiterste Wirkung ging von der Art und Weise aus, wie die Mutter so etwas erzählte. Ihr Wort und ihr Lachen hatten hundert Farben. Und für Dinge, die sich schwierig sagen lassen, fand sie immer ein lustiges Bild, einen reinlichen und unverfänglichen Ausdruck. Da wurde auch das Derbste zu einer harmlosen und liebenswürdigen Sache. Das war durch ihr ganzes Dasein ein Hauptzug ihres Wesens: gesunde Natürlichkeit, die zwischen den Dingen des Lebens keine großen Unterschiede machte und alles von einer unbedenklichen Seite nahm.
Aus ihren Aschaffenburger Mädchenjahren besitzen wir ein zartgemaltes Pastell, das eine schlanke, hübsche Blondine zeigt, mit lichtem Haar, mit leis verstecktem Lächeln und heiter träumenden Blauaugen. Ein Bild, das gefallen muß! Und das Professorhaus, in dem das ›Schimmelche‹ zwitscherte, wimmelte auch stets von Forsteleven, die im Dutzend aufeinander eifersüchtig waren. Zu diesem Schwarm von Verehrern, unter denen keiner dem vergnügten, zwanzigjährigen Lottchen mehr oder weniger als der andere galt, gesellte sich im Winter 1847 auf 48 mein Vater als 21 jähriger Forsteleve.
Ein blühender Apfelzweig entschied das Glück und Leben dieser beiden jungen Menschen. Wie das zuging, hab' ich in meinem Roman ›Der Hohe Schein‹ geschildert. Der Forstmeister Ehrenreich, den ich allen innerlichen Lebenszügen meines Vaters ähnlich machte, erzählt da: »Auf einem Balle, den die Studenten der Forstschule gaben, fiel mir ein Mädel auf, weil es einen blühenden Apfelzweig im Haar hatte. Wie ein wirklicher Zweig mit echten Blüten sah er aus. Und mußte doch falsch sein, jetzt im Februar! Und als ich ihr vorgestellt wurde, war es mein erstes Wort: ›Meiner Seel', der Zweig ist echt!‹ Mit ihren hellen Augen sah sie mich an und lächelte: ›Sie sind der einzige, der das bemerkte!‹ Und dann erzählte sie mir die Geschichte dieses Zweiges. Vor ihrem Stübchen, dicht bei den Fenstern, stand im Garten ihres Vaters ein Apfelbaum. Und als man die Winterfenster anbrachte, wurde aus Versehen ein junger Trieb des Baumes in den Fensterrahmen eingeklemmt, daß er in die Stube hereinragte. Wie ein Wunder war's, daß der Zweig nicht abstarb. Und mitten im Winter begann er in der Zimmerwärme zu blühen. Und jetzt, dieser Zweig in ihrem Haar, um ihre Stirne ... wie schön das war!« –
Dann gab's in Aschaffenburg ein paar kleine Stürme, bis die anderen, die sich um das ›Schimmelche‹ bewarben, verdrängt waren. Ein Hartnäckiger machte vor dem Professorhause auf dem Katzenmarkte seine Mondscheinpromenaden unverdrossen weiter, bis ihn mein Vater, der sich als regungslose Bildsäule auf den Brunnen gestellt hatte, in solch einer Schwärmerstunde beim romantischen Radmantel erwischte. Die Folge war eine Mensur, bei der meinem Vater die Nasenspitze abgeschlagen wurde. Sie heilte ganz gut wieder an; und die kleine Schnürung, die dann rings um die Nase herumlief tat dem festen und freundlichen Mannsgesichte keinen Eintrag.
In das erste Blühen dieses jungen Glückes fiel der Beginn der Revolution. Blieben die zwei verbundenen Herzen unberührt von allem Lebenswetter jener Zeit? Ich weiß mich nicht zu erinnern, daß Vater oder Mutter mir jemals von jenem Sturmjahr erzählt hätten. Aber ich besitze noch einen grünen Gürtel mit seidegesticktem Eichenlaub und Hirschzähnen als Eichelfrüchten. Das war die Säbelkuppel, die mein Großvater Louis als Hauptmann des aus den Forsteleven gebildeten Freikorps getragen hatte.
Dunkel erinnere ich mich, daß mein Vater von einem, Hessischen Feldzug' erzählte, bei dem nur ein einziger Schuß gefallen wäre. Und diesen Schuß hatte mein Vater gehört.
Aus dem undurchlöcherten Soldatenmantel schlüpfte er in die Uniform eines Forstamtsaktuars in Kaufbeuren. Die trug er aber nur am Königstag und beim Fronleichnamsfeste. Für gewöhnliche Zeiten tat's die graue Joppe: für die Kanzlei, für die Waldbegänge und für den Abendtarok bei der Hirschwirtin. Neben dem Glück in der Liebe hatte der Vater auch noch Glück im Spiel. Er gewann so reichlich, daß er als Junggeselle davon leben und seinen Aktuarsgehalt zusammensparen konnte, um ein Jahr früher zu heiraten. Kein Wunder, daß er pünktlich zu jedem Tarok erschien. Und eines Abends wurde der Scherz gemacht: »Am Hochzeitstag, da wird er wohl ausbleiben!«
Der Vater lachte: »Wetten wir, daß ich komme?«
Eine Wette von 20 Kronentalern wurde geboten und gehalten.
Die Hochzeit kam früher, als das Brautpaar nach seinen bescheidenen Mitteln sie geplant hatte. Großvater Louis in Aschaffenburg hatte die Augen geschlossen. Und das ›Schlimmelche‹, das schon sieben Jahre auf sein Glück gewartet hatte, blieb einsam in dem leergewordenen Hause zu Aschaffenburg zurück. Ihr Bruder Wilhelm, der einzig Überlebende von allen Geschwistern, garnisonierte als Offizier der Genietruppe zu Ingolstadt.
In den Trauerkleidern, die sie um den Vater trug, trat Lotte mit ihrem Gustl vor den Altar. In Ottobeuren, bei den Eltern des Bräutigams, wurden sie getraut – am 24. August 1854 – und die Postwagenfahrt nach Kaufbeuren war ihre Hochzeitsreise. Spät am Abend kamen sie in der Wohnung an, in der die ungeordneten Möbel und die verschlossenen Koffer umherstanden. Und die Mutter sagte: »So, Gustl, jetzt geh du hinauf zum Hirschewirt und gewinn deine Wett! Inzwische pack ich aus und mach unser Schlafstübbche schön gemütlich!« –
Als ich elf Monate später ins Leben hereinschlüpfte – am 7. Juli 1855 – war der Vater im Tarok noch immer so vom Glück begünstigt, daß er ein halbes Jahr lang seinen Gehalt nicht vom Rentamt abzuholen brauchte.
Etwas Ruhiges und wohlig Stilles überkommt mich, wenn ich das Bild jener versunkenen Zeit zu schauen versuche, in der eine Beamtenfamilie mit Mann und Frau und Kind und Magd noch alle Lebensbedürfnisse aus dem Gewinn eines harmlosen ›Schüsselchen-Taroks‹ befriedigen konnte, bei dem ein Umsatz von zwei Gulden als Ereignis galt. In einem Haushaltungsbüchelchen der Mutter aus dem Jahre 1856 stehen märchenhaft winzige Ziffern. Da ging der Verbrauch eines Tages nur selten über den Gulden hinaus. Und dennoch wurde man satt und lebte fröhlich und ohne Sorgen!
Welch' ein friedliches und aufregungsfernes Leben muß das gewesen sein, in dem der Vater während einer Reise einen mit ›sechs Neugroschen id est einundzwanzig Kreuzern‹ markierten Eilbrief nötig hatte, um der Mutter dieses Wichtige mitzuteilen: »Frage Schneller, ob das Buchenholz für Rechtsrat Kneußl schon hereingeführt sei, nämlich das aus Schiffgerbers Holz. Sollte es noch nicht geschehen sein, so soll er sogleich es durch einen andren Fuhrmann tun lassen. Das Holz soll an die rechte Seite der Schießstätte an der Hirschzeller Straße kommen, wie ich ihm damals sagte. – Er soll nachsehen, wie die heurigen Saaten sind, die wir machten, und dir es sagen, damit du mir es schreiben kannst. – Die Kartoffeln sollen nicht vergessen werden; Schneller soll sorgen, daß sie zur rechten Zeit angehäufelt werden. – Käs kann die Streu mähen, aber er dürfe ja nur die Wege und ganz öde Plätze mähen; im vorigen Jahre habe er viele Pflanzen abgemäht; er solle also die Plätze vorher wohl untersuchen!«
Mein Vater hatte damals, 1857, von der Regierung ein Reisestipendium bekommen, um die forstwirtschaftlichen Verhältnisse in Mittel- und Norddeutschland zu studieren. Von dieser Reise, die drei Monate dauerte, blieb ein Päckchen zärtlicher Briefe erhalten. Diese vergilbten Blätter! Ich kann sie nicht berühren, ohne daß mir Herz und Hände zittern.
Was da geschrieben steht, das zeigt eine Zeit, ein Glück und einen Menschen.
Die Eisenbahnfahrt von Augsburg nach Frankfurt ist eine ›sechzehnstündige Folter‹, die alle Glieder so durcheinander rüttelt, daß ein fester und gesunder Mann ein paar Tage braucht, um sich zu erholen.
»Bad Soden gefiel mir, was Lage und Gegend anbelangt, denn diese und das Klima sind wirklich italienisch zu nennen; lauter hübsche, geschmackvolle Häuser, von Gärten rings umzogen, mit Eppich und wilden Weinreben bewachsen; von herrlichen Anlagen das hübsche Kurhaus umgeben; die Gegend hügelig, die Felder mit Obstbäumen, an den Hängen Kastanienhaine; das zusammen gibt ein liebliches Bild. Weniger zog mich an das Badeleben daselbst, da die geputzten Herren und Damen, diese mit enormen Krinolinen und Volants, mit dem lieblichen Bilde der dortigen Natur sonderbar kontrastierten.«
Die Herrlichkeiten von Darmstadt, Mannheim, Heidelberg, Tharand, Potsdam, Berlin und Dresden werden mit einer Begeisterung und mit Farben geschildert, wie sie das globetrottende Volk von heute nur noch für Afrika und Indien übrig hat. Aber dieser Reisende, der in der Ferne wandert und mit hellen Augen genießt, ist mit dem Herzen doch immer daheim. Alles Schöne der Fremde wird ihm zu einer Mahnung an die Heimat, zu einem sehnsüchtigen Gedanken an die Seinen.
»Wenn die Natur mein sonst zum Enthusiasmus nicht eben geneigtes Gemüt begeistert; wenn sie mein Gefühl aus seiner etwas rauhen Schale hervorzwingt und mich so wunderlich weich macht, so geschieht das nur, weil ich stets bei allem Schönen euer gedenken muß. Wenn ich mich freue, daß die Schöpfung so groß und herrlich ist, wie sollte ich denn nicht auch zugleich mich freuen, daß ihr, meine theuersten, theil an dieser Schöpfung habt, in der ja auch das kleinste, so weise erdacht, seinen Zweck erfüllt. Erquickt eine liebliche Gegend die Seele, macht ein romantisches Felsthal uns staunend schauen, giebt uns der brausende Bergstrom das warnende Bild eines wildbewegten Lebens, – so dürfen wir doch auch im kleinsten nicht der Schöpfung kluge Freundlichkeit übersehen. Betrachte einen grünen Baum! Als Forstmann erwäge ich, wie so manchen Zwecken nützlicher Verwendung er dient; als dein Liebster denke ich, daß er Ruhe in dein Auge geben würde, dich rasten ließe in seinem kühlenden Schatten. Betrachte einen toten Stein! Für uns Menschen ist er lebendiger Vortheil, vom größten Block, der mich werdende Häuser, Schulen und Brücken sehen läßt, bis zum kleinsten farbigen Kiesel, bei dem ich denke, er könnte ein lieb Spielzeug für unsere Kinder sein. Sie ist schön, diese große Welt. Aber in unserer kleinen daheim ist's halt doch am schönsten.«
»Daß du so viel von Ludwigs drolligen Streichen mir schreibst, dafür danke ich dir herzlichst. Du weißt ja, wie ich den guten Kerl so lieb habe, und daß derlei pfiffige Possen mich von ihm ergötzen. Ich habe sie Bäschen Emma und Vetter Anton vorgelesen. Denen kamen die Thränen vor Lachen. Anton konnte ein bisgen Heiterkeit auch brauchen. Der Krankheitszustand seiner Frau (Epilepsie) ist noch schlimmer fast als früher. Zwei Kinder kamen – wohl zu deren Glück – zu früh und tot auf die Welt, und bei dem nächsten wird es wohl auch nicht besser gehen. Dem letzten Kinde machte Anton selbst den Sarg, und verzierte ihn, schmückte ihn mit Engeln und Lichtern und saß bitterlich weinend die ganze Nacht davor. Der arme Kerl dauert mich sehr, und seinem Kummer gegenüber bedrückt mich Sorge um euch, aber ich denke auch mit doppelter Süßigkeit daran, wie sehr ich unserer Kinder Geburt ersehnte, welche Freude ich bei ihrem ersten Laut empfand, wie viel Freude ich an ihnen noch zu erleben hoffe.«
»Ob du wohlseiest und die Kindergen gesund, das ist die Hauptfrage mit der ich erwache, mit der ich mich schlafen lege, von der ich träume.«
»Dich muß ich manchmal beneiden: du hast die beiden Kleinen, kannst sie herzen und küssen, kannst an Ludwigs kecken Streichen dich erheitern, über Bertas freundliches Lächeln dich freuen, in solcher Freude dich trösten. Mir mangelt meine ganze Welt, die ihr seid. – Wie ich fort von dir ging, war Ludwig vor dem Hause, und ich ging rückwärts durch den Hof; der liebe Schlingel hörte mich und rief aus voller Brust: ›Papa!‹ Aber ich kehrte nicht mehr um, da der Abschied mir ohnehin so schwer geworden. Ich überwand es. Wie oft mir aber dieses ›Papa‹ in Gedanken wiedertönt, kann ich dir nicht sagen; wo ich stehe und gehe, höre ich es; wo der Laut eines fremden Kindes mir klingt, glaube ich die Stimme des meinen zu vernehmen. Oft schon stieg mir Reue auf, daß ich nicht damals zurückkehrte und ihm noch einen herzhaften Kuß auf sein schelmisch Gesichtchen drückte. Die Thränen stehen mir in den Augen, während ich dies schreibe, und die Buchstaben schwimmen vor meinem Blick. – Denke ich zurück an die Zeit, wo wir uns kennen lernten, wo unsere Herzen sich fanden, unbeirrt durch so viele Schwierigkeiten – denke ich daran, daß wir uns in diesen drei Jahren unserer glücklichen Ehe ebenso innig liebten wie vorher – so fühle ich, daß dies alles früher mir noch weniger klar denn jetzt war, wo ich zum erstenmal und so lange von euch getrennt bin. Jetzt erst in vollem Maße erkenne ich, wie theuer ihr mir seid, wie glücklich und zufrieden ich bin. Dieses frohe Gefühl erschwert mir wohl die Trennung, läßt sie aber doch anderseits auch leichter tragen. Ich muß es halt machen, wie Freund Eulenspiegel, der immer gerne den Berg hinaufstieg, in der Hoffnung, daß es dann flink und fröhlich hinuntergienge ins schöne Thal. Und du, lieb Lollichen, mache es ebenso in deiner Sehnsucht! Du kannst doch leichter auch die noch übrige Zeit der Trennung überstehen; du hast ja unsere Kindergen, hast treue, liebende Seelen um dich, hast so viele liebe, freundliche Frauen, die gerne dich erheitern möchten. Und ich in Gedanken bin immer bei euch, vergesse dich nie und niergends!«
Die Liebe, die aus diesen vergilbten Blättern redet, umgab mit beseelter Wärme meine Kindheit. Sie sprach zu mir aus jedem ruhigen Blick des Vaters, aus jedem heiteren Lachen der Mutter. Wie hätt' ich meiner Kindheit nicht froh werden, wie hätt' ich nicht an das Leben glauben, das schöne Leben nicht lieben sollen?
In jenen Briefen meines Vaters kehrt das ein paarmal wieder: treue Seelen, liebe freundliche Frauen.
Und wenn ich, in meiner Erinnerung wühlend, die Augen schließe, höre ich aus jener Zeit ein Lachen von herzlichen Stimmen, sehe einen weißgedeckten Tisch mit goldgeränderten Kaffeeschalen und großem Guglhupf, sehe sechs oder sieben junge und bejahrte Frauen in hochgebauschten, weit auseinanderfließenden Röcken. Über die Schläfen der heiteren und flinkbeweglichen Gesichter legen sich die lichten oder dunklen Haare in Glockenform heraus, so daß von den Ohren nur die kleinen Läppchen noch hervorgucken, an denen etwas Feines und Glitzeriges baumelt. Und wenn der Abend dämmert, ist plötzlich die ganze Stube mit plaudernden Menschen angefüllt – ich höre tiefes, kräftiges Sprechen und sehe zwischen den Frauen die bärtigen Mannsgesichter, sehe, wie sich die Rauchwölkchen aus den gelben Meerschaumpfeifen kräuseln. Und wenn in diesem Zwielicht ein Fidibus sein wachsendes Sternchen aufbrennen läßt, dann werden die fröhlichen Gesichter zur Hälfte rot, es glänzen alle Dinge auf dem weißen Tisch, und an den Möbeln funkeln die polierten Leisten.
Einer von diesen ruhigen Männern ist mein Vater, eine von diesen lachenden Frauen ist meine Mutter. Welcher? Und welche? Das kann ich nimmer sagen. Aber ich weiß noch, wie ein paar von den anderen hießen: Herr und Frau Schrader; der Bürgermeister Heinzelmann und die Bürgermeisterin, die um ihres guten Herzens willen den Spitznamen ›das Liebhaberle‹ bekam; die Hirschwirtin, Frau Apotheker Roth und Magistratsrat Hafner; die Brüder Probst und ihre Mutter, in deren altem Kaufmannshause wir wohnten – ein Haus, in dem es immer so köstlich nach frischgebranntem Kaffee, nach Johannisbrot und Feigen duftete.
Ein Vierteljahrhundert später, als Vater und Mutter in München noch beisammen waren, plauderten sie noch immer gerne von Kaufbeuren, sprachen von den Freunden, die noch lebten oder schon gestorben waren, gaben jedem Namen, den sie nannten, das Eigenschaftswörtchen ›lieb‹ oder ›gut‹ – und wenn sie nachdenklich schwiegen, pflegte die Mutter nach einer Weile mit leisem Seufzer zu sagen: »Ach Gottele! Die schöne Zeit! Die kommt halt nimmer wieder!«
Auf solch ein Wort sagte der Vater gerne: »No, schau, Lotte, jetzt hast du's doch auch nicht schlecht!«
»Ei freilich, ja! Gott sei gepriesen und gebimmelt!« Da hatte die Mutter nach Tränen ihren Humor wieder gefunden. »Wenn's nur aushält, bis man himmelt!« –
Vom letzten Tage, an dem wir Kaufbeuren bei tiefem Schnee verließen, blieb mir noch die Erinnerung an viele, viele Hände, die rings um den Schlitten waren und wirr durcheinandergriffen, immer über mich hinweg. Ich atmete schwer und hatte das Gefühl einer großen Hitze – so dick war ich eingemummt zum Schutze gegen den grimmigen Frost.
Von den Etappen dieser Winterreise ist mir nichts im Gedächtnis geblieben als ihr frierendes Ende. In einer Kälte, die jeden Hauch zu Eis gerinnen machte, fahren wir durch den tiefverschneiten Adelsrieder Forst, mit dem die endlosen Wäldermassen des ›schwäbischen Holzwinkels‹ begannen. Verendete Rehe lagen neben der Straße im Schnee. Und ausgehungerte Hafen hoppelten eine lange Strecke hinter dem Schlitten her, um jeden Faden des davonwehenden Heues aufzulesen, mit dem die Schlittenkufe neben den Pelzen und Fußsäcken angefüllt war. – Das erzählte mir in späteren Jahren die Mutter. – Ich selbst bewahre nur die Erinnerung an etwas schrecklich Weißes, an einen quälenden Schmerz in den Augen, an ein Gefühl, daß ich keine Hände und Füße mehr hätte, nur noch einen schnatternden Kopf – und besinne mich noch auf eine traumartige Furcht, in der ich glaubte, daß wir einer grauenvollen Sache immer näher kämen.
Und die Schellen der Schlittengäule klingelten mich doch an jenem weißen, frierenden Tage langsam hinein in eine wunderschöne, sonnenreiche, jubelnde Knabenzeit!
II.
Kommt man auf der schwäbischen Poststraße von Augsburg her, und fuhr man an den alten Schlössern von Hamel und Aystetten vorüber, so versinkt die Straße in dunklen Fichtenwäldern, die fast kein Ende mehr nehmen wollen. Das ist der Adelsrieder Forst. In der Mitte des Waldes stand ein Kreuz; da wurde vor hundert Jahren eine Bäuerin mit ihrer Tochter von Wölfen zerrissen. Dann wieder Wald und Wald, bis die dunkelgrünen Schatten sich endlich öffnen zu einem hellen, hügeligen Wiesengelände.
An diesem Tor des Waldes sagte wohl mein Vater damals bei jener Winterreise zu der Mutter: »Schau, Lottchen, da fängt mein Revier an! Und vier Stunden braucht man bis zur anderen Grenze.«
Man fährt an dem Dorfe Kruichen, an dem Mühlweiler Ehgarten vorüber; und nach einem Stündchen, das nur vierzig Minuten hat, kommst du im schmalen Tal der Laugna nach Welden im Holzwinkel.
Das ist zu Winterszeiten keine gemütliche Landschaft. Aber der Frühling schüttet liebliche Schönheit über dieses stille Bachtal, das sich zu einem stundenweiten Rund von sanftgewellten Hügeln auseinanderdehnt. Ein dichtgeschlossener Kranz von Wäldern, in denen das strenge Nadelholz nur kleine Laubparzellen duldet, schließt sich als ein blaudunkler Wall um diesen Kessel dörflicher Kultur. Getreidefelder und Wiesen sind noch zahlreich von kleinen Gehölzen durchsetzt, die in der Nähe der Häuser zusammenfließen mit den Weißdornhecken und den blühenden Obstbäumen der Gärten.
Heute ist Welden eine stattliche Ortschaft mit Eisenbahn und Telegraph. Damals in meiner Kindheit, vor 48 Jahren, war's ein Dorf mit 800 Seelen wie der Pfarrer zu sagen pflegte; und der Postbote mußte täglich drei Stunden weit nach Zusmarshausen laufen, um die vier Zeitungen und die sieben Briefe zu holen. Einmal in der Woche fuhr ein Bote, der Stanger, mit seinem langen Blachenwagen nach Augsburg hinein und brachte, was man im ›Botebüechle‹ bei ihm bestellte. Das war die Verbindung des Holzwinkels mit der großen Welt.
Seit einem halben Jahrhundert sind die Häuser nach dem Dutzend gewachsen, und das Dorf hat sich durch die vielen Neubauten anders gestaltet. Früher glich es in seiner Anlage einem lateinischen H, das sich auf die lange Seite legte: zwei gestreckte Gassen, die durch Wiesen und den Bachlauf voneinander getrennt, durch eine häuserlose Pappelallee miteinander verbunden waren.
Die obere Gasse hieß die Kirchgasse; hier stand die große, schöne, mit hübschen Fresken ausgemalte Zopfkirche, die ein prachtvolles Geläute hatte; daneben die Schule, das Bräuhaus und der Pfarrhof; nicht weit davon das verwahrloste Benefiziatenhaus mit gutgepflegtem Garten, der Kirchgasseleskramer, der Kirchgasselesschmied, der Schuster und Schneider – und ganz am anderen Ende der langen Gasse noch ein Handwerker, dessen Schild aus der Kultur unserer Zeit verschwunden ist: der Doser, der die Schnupftabaksdosen aus gepreßter Birkenrinde fabrizierte und als Nebenverdienst die Laubsägen feilte, deren Stahlstaub, wenn er in ein brennendes Kerzenlicht gestreut wurde, sich in blitzende, wundersam schöne Sternchen verwandelte. Zwischen dem Doser und der Kirche lagen die Höfe wohlsituierter Bauern Zaun an Zaun. In der langen Reihe dieser mächtigen Strohdächer stand noch ein schmuckes, mit Ziegeln gedecktes Gebäude, von dem durch einige Jahre eine ruhelose Plage für meinen Vater ausging: das Haus des pensionierten Revierförsters Bauer, der seinem jungen Nachfolger so lange das Leben mit allerlei Hetzereien sauer machte, bis eine Haussuchung bei dem würdig aussehenden alten Herrn zwei gewilderte Rehgeißen im Keller fand. Dann war Ruhe.
Dieser Staatsbeamte hatte in seinem eigenen Besitz gewohnt, und so war kein Forsthaus da, als mein Vater kam. Die Regierung mietete das zweistöckige Anwesen eines Maurermeisters und wies es nach einem notdürftigen Umbau meinem Vater als Dienstwohnung an.
Dieses Haus lag in der unteren Gasse, die man die Bachgasse nannte, weil sie sich am Ufer der stillfließenden Laugna entlangstreckte. In dieser Gasse residierten nur ein paar von den schweren Bauern des Dorfes; dazu der Wirt zum Fäßler, der große Rollewirt und der allmächtige Nagelschmied, welcher Bürgermeister war und wegen seiner frommen und segensvollen Redensarten den Spitznamen ›der heilige Vater‹ bekam. Was in der Bachgasse sonst noch an Bauern hauste, das waren die vielen ›Kloinzuigler‹, die mäßig begüterten Söldner mit zwei oder drei Kühen. Im übrigen war die Bachgasse der Sitz der Staatsgewalt, der freien Wissenschaft und der Industrie. Denn hier hauste neben dem neuen Revierförster noch der Malz-Aufschläger und der Doktor. Hier saß als unser Wiesennachbar der Bachgasseleskramer, der den wunderlich schönen Namen ›Millimattler‹ führte; man denkt bei diesem Namen doch gleich an einen Schmetterling oder sonst an etwas Leichtes und Flatterndes; aber der Millimattler war ein kleiner Mann mit dickem Bauch, und als er starb, erschien zu seiner Nachfolge in der Krämerei ein großer Mann mit dickem Bauch und mit dem zutreffenden Namen Schweinberger.