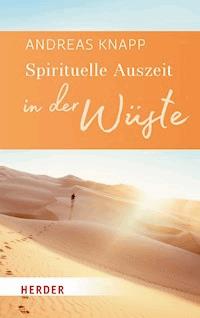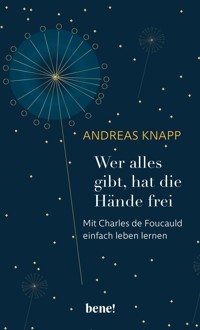Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Fernab von jeglicher Zivilisation, lebte Andreas Knapp 40 Tage in einer Einsiedelei in der Sahara. In seinem Tagebuch erzählt er vom Zauber der Wüstenlandschaft und von der Schönheit des Lichtes. Ständig gegenwärtig ist das Geheimnis von Leben und Tod, dem man in dieser Stille und Weite auf die Spur kommen kann. Die äußere Reise wird zu einem Spiegel innerer Erfahrungen, die tief religiös gedeutet und biblisch erschlossen werden. Ein Buch für Glaubende und Sinnsucher.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erweiterte und aktualisierte Neuausgabe 2025
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025
Hermann-Herder-Str. 4, 79104 Freiburg
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich an
Umschlaggestaltung: Verlag Herder, Freiburg im Breisgau
Umschlagmotiv © 35007 / GettyImages
E-Book-Konvertierung Newgen Publishing Europe
ISBN Print 978-3-451-60139-2
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-84993-0
Ich habe dich in die Wüste geführt,um dir zu Herzen zu sprechen.
Hosea 2,16
Inhalt
Vorwort von Carmen Rohrbach
Vorwort
1. Tag
2. Tag
3. Tag
4. Tag
5. Tag
6. Tag
7. Tag
8. Tag
9. Tag
10. Tag
11. Tag
12. Tag
13. Tag
14. Tag
15. Tag
16. Tag
17. Tag
18. Tag
19. Tag
20. Tag
21. Tag
22. Tag
23. Tag
24. Tag
25. Tag
26. Tag
27. Tag
28. Tag
29. Tag
30. Tag
31. Tag
32. Tag
33. Tag
34. Tag
35. Tag
36. Tag
37. Tag
38. Tag
39. Tag
40. Tag
Epilog im Plattenbau
Bibelstellenverzeichnis
Quellennachweise
Über den Autor
Über das Buch
Vorwort
von Carmen Rohrbach
Schon der Titel „Lebensspuren im Sand“ macht neugierig. Zu recht, denn das Tagebuch aus der Wüste nimmt uns 40 Tage lang mit zu einer spirituellen und zugleich philosophischen Sinnsuche. Andreas Knapp lädt uns ein, mitzuerleben, wie es einem Menschen über Tage und Wochen in der Einsamkeit und Stille ergeht, mit welchen Gedanken, Gefühlen und Einsichten er beschenkt wird.
Als Mitglied der Ordensgemeinschaft der „Kleinen Brüder vom Evangelium“ hat sich Andreas Knapp dorthin zurückgezogen, wo sich früher die Einsiedelei von Charles de Foucauld (1858–1916) befunden hat. Dieser Mönch und Abenteurer, der 2022 von Papst Franziskus heiliggesprochen wurde, lebte von 1901 bis 1903 in Béni Abbès inmitten der algerischen Sahara. Später zog er nach Tamanrasset, wo er als Freund der Tuareg deren Sprache studierte. Am 1. Dezember 1916 wurde der Eremit von Beduinen, die in den Ersten Weltkrieg hineingezogen worden waren, ermordet, und seine von ihm 1911 erbaute Klause auf dem Assekrem-Plateau zerfiel. Obwohl sich Foucauld um Mitglieder für eine Ordensgründung bemühte, blieb er allein. Erst nach seinem Tod wurden Ordensgemeinschaften gegründet, die sich auf ihn berufen – so auch die „Kleinen Brüder vom Evangelium“, denen sich der Autor angeschlossen hat. In der Nähe der ehemaligen Einsiedelei des Ordensgründers macht er also seine Wüstenerfahrungen.
Die Fülle an inneren Erlebnissen wird strukturiert und zugleich bereichert: Da sind einmal die Psalmen, zu denen er meditiert. Diese uralten Texte werden durch seine meditativen Betrachtungen lebendig und verständlich. Zum Zweiten knüpft der Autor an Zitate aus dem Neuen Testament an, die das Leben Jesu von seiner Geburt bis zu seinem Tod und seiner Auferstehung spiegeln. Diese Begebenheiten sind uns aus der Bibel wohlbekannt, doch erlangen sie im Zusammenklang mit den berichteten Erlebnissen in der Wüste eine neue, tiefere Bedeutung – so zum Beispiel die Salbung Jesu mit dem Nardenöl, die für mich eine neue Bedeutung erfuhr. Drittens durch seine Wanderungen in der Wüste, die an jedem Morgen vor Sonnenaufgang beginnen: Durch dieses Gehen von der Nacht in den Tag entsteht eine intensive Spannung. Und in einer vierten Säule lässt uns der Autor in Rückblicken an seinem persönlichen Leben und auch an Problemen und Enttäuschungen teilnehmen.
Diese Schilderung aus der Bibel, die Salbung Jesu mit dem kostbaren Nardenöl, habe ich nie verstanden. Sie ist mir erst jetzt durch das Buch verständlich geworden. Andreas Knapp meditiert darüber, warum eine Frau das Alabastergefäß über dem Kopf von Jesus zerbricht und ihn mit dem Öl salbt. Der Krug und das Nardenöl waren wohl ihr einziger wertvoller Besitz. Warum tat sie das? Andreas’ Deutung während der Meditation führt zu einer Antwort.
Die Zeit des Schweigens und der Abgeschiedenheit hat den Autor sensibel gemacht für innere und äußere Vorgänge und seine Sinne geschärft. Seine Erfahrungen lässt er in seine Texte einfließen. Das Buch ist reich an tiefsinnigen Formulierungen und eindringlichen Metaphern. Hier nur einige wenige Bespiele:
Der Mantel der Stille hüllt mich ein.
Inmitten der Wüste entstehen neue Wege.
Die Stille empfängt mich mit offenen Armen.
Mit den Füßen tief im Sand, mit dem Kopf in den Sternen.
Von großer literarischer Qualität – ganz ohne dabei aufgesetzt zu wirken – sind die Naturbeschreibungen. Jeder Sonnenaufgang ist neu und anders – und ebenso auch die Wortschöpfungen, mit denen uns der Autor seine morgendliche Wüstenwanderung nahebringt und ausmalt. Es sind 40 Tage der Fülle, die Wüste ist voller Leben für den, der Augen hat zu sehen. Wir erleben aber auch die dunklen Tage mit. Andreas Knapp verbirgt sie nicht vor uns, sondern lässt uns teilnehmen an den Tagen des Zweifels, an Gefühlen der Verlorenheit und an bedrückenden Erinnerungen.
Diesem wertvollen Stück Literatur wünsche ich nicht nur zahlreiche Leser, sondern darüber hinaus auch viele, die sich nach der Lektüre bereichert fühlen und durch sie zum Nachdenken angeregt werden. Zunehmend sehnen sich Menschen nach Erfahrungen, wie sie in diesem Buch geschildert werden – das zeigt auch die wachsende Pilgerbewegung und das Hinzukommen weiterer, neu erschlossener Jakobswege.
Zum Schluss noch eine Bemerkung: Als ich die letzte Seite umblätterte, hatte ich den Wunsch, wieder mit der ersten Seite zu beginnen. Meine Idee dazu: Wie wäre es, wenn ich an jedem Tag lesend dem Autor einen Wüstentag lang folgen würde, sodass ich ihn 40 Tage lang begleiten könnte? Vielleicht eine Möglichkeit, dieses Buch auf eine ganz besondere Weise zu erleben …
Carmen Rohrbach
Vorwort
Baba-aïda! Das also ist der Ort, an dem ich vierzig Tage allein in der Wüste leben werde: Ein paar verlassene Lehmbauten inmitten der Sahara, am Rande eines ausgetrockneten Flussbetts, unweit der Dünen des Großen Westlichen Erg. Von den zwei, drei Gebäuden der winzigen Siedlung sind fast nur Ruinen erhalten. Glücklicherweise sieht ein Raum ziemlich intakt aus. Jedenfalls ist das Flachdach, das von faserigen Palmstämmen getragen wird, noch nicht heruntergebrochen. Fenster und Türen gibt es allerdings keine mehr. Doch Wände und Dach spenden Schatten und können bei Sandsturm einen gewissen Schutz bieten. In diesem Raum werde ich hausen, mein Moskitozelt aufschlagen und es mir darin mit Isomatte und einem dünnen Schlafsack gemütlich machen.
Es ist September und die glühende Sommerhitze der Sahara lässt langsam nach. Baba-aïda liegt etwa zwei Stunden Fußmarsch entfernt von Beni Abbes, einer kleinen Oasenstadt in Algerien. Dort hatte Charles de Foucauld von 1901–1904 gelebt. In seiner „Einsiedelei“ wohnen heute drei „Kleine Brüder vom Evangelium“, unter ihnen Henri, der mich nach Baba-aïda begleitet hat.
Jetzt will mir Henri noch den Brunnen zeigen, der zwischen Dünen versteckt liegt, gute zwei Kilometer von hier. Ich bin ganz aufgeregt, weil der lang gehegte Wunsch, vierzig Tage in der Wüste zu verbringen, in Erfüllung gehen soll. Henri und ich stapfen durch den Sand, in östliche Richtung. Wir folgen mehr oder weniger den Spuren eines Fahrzeugs, die noch relativ frisch sind. Auf einmal sehen wir in der Wagenspur eine Schlange liegen, eine kurze, dicke, sandgelbe Schlange. „Eine Hornviper“, stellt Henri fest und schnalzt mit der Zunge. Sie scheint tot zu sein. Das Auto hat sie wohl überfahren. Hornvipern sind sehr aggressiv und ihr Biss endet oft tödlich. Wir nähern uns der toten Schlange, um sie genauer zu betrachten. Man kann die hörnerartigen Schuppendornen oberhalb der Augen gut erkennen. „Wenn die Schlange sich eingräbt, sieht man bisweilen nur noch die winzigen Hörnchen, die wie Dornen aus dem Sand herausragen“, erklärt mir mein Mitbruder. Ich bekomme ein mulmiges Gefühl. „Ich bin nicht sicher, ob die Schlange wirklich tot ist“, sage ich zu Henri. Ich suche einen Stock. Aber hier sehe ich nur ein paar winzige Büsche. Weiter drüben wächst ein größerer Strauch. Ich laufe dorthin und breche ein Ästchen ab. Mit diesem schubse ich die Schlange vorsichtig an. Plötzlich springt die Viper wie von einer Tarantel gestochen hoch. Henri und ich schrecken mit einem Satz nach hinten zurück. Es hat nicht viel gefehlt und sie hätte einen von uns beiden gebissen. Die Schlange windet sich auf einen Busch zu, um sich dort zu verkriechen. Ihre Fortbewegungsweise ist höchst eigenartig: Sie schlängelt sich nicht vorwärts, sondern bewegt sich seitlich voran, indem sie abwechselnd ein Stück des Körpers hinter dem Kopf und vor dem Schwanz hochstemmt und versetzt wieder ablegt. Von dieser merkwürdigen Bewegungsabfolge, die ziemlich schnell vonstatten gehen kann, rühren auch die charakteristischen Spuren her, die eine Hornviper hinterlässt: kurze, parallele Wellenlinien, die sich über den Sandteppich ziehen.
Henri und ich atmen auf. Das war knapp. Ich werde mich noch mit einer Hornviper anfreunden müssen, die in Babaaïda wohnt. Doch davon später.
Es ist nicht mehr weit bis zum Brunnen. Ich muss mir den Weg gut einprägen. In der großen, eintönigen Dünenlandschaft sieht für mich als Neuankömmling alles gleichförmig aus. In einer Senke zwischen den Dünen ist ein Brunnen zu erkennen.
Ein runder Blechdeckel liegt auf einem Autoreifen, der als Umrandung dient und den Brunnenschacht vor Versandung schützt. Eimer und Strick liegen daneben. Das Wasser ist kühl und schmeckt erfrischend. Wir füllen einige Plastikflaschen und kehren zu meiner gut durchlüfteten Behausung zurück. Jetzt können meine vierzig Tage in der Wüste beginnen.
Diese Zeit gehört zu den spirituellen Elementen, die in den Ordensgemeinschaften der „Kleinen Brüder“ und „Kleinen Schwestern“ gepflegt werden. Die Grundidee ist, wie Jesus eine Zeit lang in die Wüste zu gehen.
Seit den Anfängen des Christentums haben Einsiedlerinnen und Einsiedler eine zurückgezogene Lebensweise gewählt, um in der Stille und Abgeschiedenheit Gott zu suchen. Nach einem Wort von Meister Eckhart ist nichts im Universum Gott ähnlicher als die Stille.
In dieser Tradition hat auch Charles de Foucauld die Wüste als Ort erfahren, um Gott zu begegnen: „Man muss die Wüste durchqueren und in ihr verweilen, um die Gnade Gottes zu empfangen.“
Seit einigen Jahren bin ich Mitglied der Gemeinschaft der „Kleinen Brüder vom Evangelium“, die auf Charles de Foucauld zurückgeht. Und nun werde ich in der Nähe seiner Eremitage von Beni Abbes vierzig Tage lang in der Wüste leben.
Henri verabschiedet sich. Er hat in seinem Rucksack einen kleinen Grundstock an Lebensmitteln nach Baba-aïda gebracht, während ich das Moskitozelt, Isomatte, einen leichten Schlafsack, ein paar Kleidungsstücke, eine kleine Bibel, einen Gebetshocker und weitere Nahrungsvorräte mitgeschleppt habe. Ich schaue Henri noch lange nach, bis er zwischen den Dünen verschwunden ist. Ein eigenartiges Gefühl: Jetzt werde ich hier – von kurzen Besuchen abgesehen – vierzig Tage lang allein leben. Ich habe schon öfter Zeiten der Stille verbracht, bei Exerzitien oder Besinnungstagen. Jedoch vierzig Tage lang ganz auf mich gestellt und derart isoliert wie hier, war ich noch nie.
Als erstes richte ich mich ein. In dem niedrigen Raum liegt viel Sand – das ergibt eine weiche Unterlage, auf der ich mein Moskitozelt mit wenigen Handgriffen aufbaue. Schnell habe ich mir einen gemütlichen Schlafplatz geschaffen.
Wo werde ich beten? Ich bereite mir eine Gebetsecke vor: Eine kleine Ikone, eine Kerze und davor im Sand der Gebetshocker. Es ist so still hier, stiller als in jeder Kirche, und es zieht mich jetzt richtig ins Gebet. Ob das all die Tage so bleiben wird?
Ich sortiere meine Habseligkeiten, die ich mitgebracht habe. Nur wenig Wäsche – ich bin hier immer an der frischen Luft und allein. Was Lesestoff anbelangt, so habe ich mich sehr beschränkt: Meine Bibel, ein Sternführer und ein dickes Heft, in dem ich Gedichte gesammelt habe, die mir wichtig geworden sind.
In drei „Büchern“ will ich lesen – in der Hoffnung, dass sie sich gegenseitig zur Lesehilfe werden. Zunächst will ich das „Buch der Natur“ wahrnehmen. Diese ungewohnte, faszinierende und zugleich auch beängstigende Landschaft hat mir sicher etwas zu sagen. Vielleicht war das ursprüngliche Lesen ja das Fährtenlesen. Jedenfalls haben Menschen seit eh und je in der Natur nach Spuren für das Übernatürliche gesucht, nach den Spuren Gottes.
Das zweite „Buch“ ist das des eigenen Lebens, denn da gibt es einiges nachzulesen (Relecture). Ich durfte schon öfter erfahren, dass ich in der Nachlese Kostbares entdecken konnte. Manche Zusammenhänge wurden mir erst aus der Distanz klar und ich konnte sie im Rückblick besser deuten. Es ist wie bei einem großen Gemälde: Wenn wir die Nase zu nah am Detail haben, bleiben uns die großen Linien und Zusammenhänge verborgen. Vieles können wir erst aus dem Abstand richtig sehen. Reinhard Meys bekanntes Lied „Über den Wolken“ bringt es auf den Punkt: „Was uns groß und wichtig erscheint“, wird aus einer höheren Sicht „nichtig und klein“. Ich habe es manchmal erlebt, dass eine Verletzung, ein Versagen oder eine Blamage im Augenblick wie ein Super-GAU aussahen – der sich dann in einer zeitlichen Distanz relativierte. Hier in der Wüste bin ich weit weg von allem und hoffe, dass ich das Gemälde meines Lebens – mit dem Schönen und dem Schweren – wieder mehr in seiner Gänze in den Blick nehmen kann.
Und schließlich wird mich das Buch (biblos) begleiten, die Bibel. Ich habe mir vorgenommen, mich auf zwei Schriften zu beschränken: Ich möchte in den vierzig Tagen einmal das Buch der Psalmen ins Gebet nehmen, d. h. jeden Tag drei oder vier Psalmen lesen und meditieren. Und ich möchte dem Lebensweg Jesu, wie er in einem Evangelium erzählt wird, folgen, damit dieser mir – hoffentlich – „nachgehen“ kann. Ganz spontan habe ich mich für Markus entschieden: die kräftige, ungeglättete Sprache, die markig und ursprünglich klingt, passt gut in diese raue Umgebung.
Ich mache einen kurzen Spaziergang, dann esse ich zu Abend. Noch kann ich mir frisches Brot, Käse und Paprika schmecken lassen. Schnell wird es dunkel und über mir entzündet sich mehr und mehr ein Sternenhimmel, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Plötzlich eine Sternschnuppe: ein Aufblitzen, eine Leuchtspur über den Himmel gezogen, ein Verglimmen. Ich stehe vor meiner Hütte und schaue nach oben. Auch als mein Genick zu schmerzen beginnt, kann ich noch nicht ablassen.
Nur ungern löse ich mich von diesem Anblick und schlüpfe in meinen Schlafsack. Der Mantel der Stille umhüllt mich. Ich kann nicht gleich einschlafen, denn ich bin ein bisschen aufgeregt – wie ein Kind, das sich auf ein großes Abenteuer freut.
1. Tag
Vierzig Tage: Eine derart lange Frei-Zeit ist ein großes Geschenk. Freiheit ohne Ordnung jedoch kann sich verflüchtigen. Nicht gefüllte Zeit wird zum endlosen Bandwurm und wirkt bedrohlich, sodass man sie totschlägt. Eine lange Zeit gar im Schweigen und Alleinsein zu verbringen, das geht nur gut, wenn man sich an einen klaren Rhythmus hält. Es braucht eine Struktur, die den Tag gliedert und dadurch innerlich Halt gibt. Ich stelle mir deshalb einen Tagesplan auf, der meinen Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Feste Zeiten und Strukturen können etwas Starres sein, das einengt. Ein Rahmen kann freilich auch einen Lebensraum umschreiben. Ein altes Wort für Grenzmauern oder Zäune heißt „Umfriedung“. Hier in der Wildnis brauche ich Kultur, um innerlich zur Ruhe, zum Frieden zu finden. Diese Ordnung schützt meine Freiheit und widerspricht ihr nicht. Denn hier bin ich es selbst, der sich einen Rahmen gibt. In meinem Alltag werden mir Zeiten und Regeln vorgegeben. Aber hier bin ich Herr meiner Zeit. Und ich will ihr ein guter Herr sein.
Jeden Morgen möchte ich um vier Uhr aufstehen, um noch in der Nacht dem Gebet eine erste Stunde zu widmen. Nach dem Frühstück, bestehend aus Brot, Datteln und Wasser, breche ich auf. Obwohl es Nacht ist, scheint das Licht der Sterne so hell, dass man gut gehen kann. Ich laufe nach Osten, auf die große Dünenlandschaft zu. Bald verabschieden sich die Sterne, die kleinsten zuerst, und am Horizont wird es hell. Das Himmelsgewölbe verwandelt sich in ein Farbenspiel: ein helles Rosa, ein leuchtendes Rot, ein bezauberndes Violett. Direkt über mir hängen ein paar rot geränderte Wolken am Firmament. Ich besteige eine Düne und suche mir einen Platz, um einen Psalm zu beten.
Neugierig ziehe ich weiter. Ich suche Spuren im Sand, betrachte die mir fremden Pflanzen und merke mir Orientierungspunkte, um aus dem schier uferlosen Meer von Dünen wieder zurückzufinden. Der Große Westliche Erg, an dessen Rand sich Baba-aïda befindet, erstreckt sich über 600 km von Norden nach Süden und über 250 km von Westen nach Osten. In diesem riesigen, völlig menschenleeren Gebiet, reihen sich Dünen an Dünen, so weit das Auge reicht. Die Sonne ist hoch gestiegen und ohne die Konturen der Schatten verschwimmen die Dünen in der Ferne zu grau gewellten Linien.
Ich kehre um und komme am späten Vormittag in meine Einsiedelei zurück. Nach dem Mittagessen und einer kurzen Siesta folgen zwei Gebetszeiten von je einer Stunde in meiner Gebetsecke. Auch nach dem Abendessen nehme ich mir noch einmal Zeit für eine Meditation. Ich beginne mit den ersten Versen des Markus-Evangeliums.
Anfang des Evangeliums von Jesus Christus.
Wie beim Propheten Jesaja geschrieben steht:
Ich sende meinen Boten vor dir her; er wird deinen Weg bereiten.
Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn!
Macht seine Straßen eben!
Mk 1,1-3
Im Anfang war die Erde wüst und leer. Inmitten der Ödnis wird der göttliche Geist kreativ: Er schafft Ordnung, damit Leben möglich wird. Doch immer wieder kommt es zu Verwüstungen der Schöpfung. Wo aber das Leben bedroht wird, genau dort will Gott einen neuen Anfang ermöglichen. Inmitten der Wüste entstehen neue Wege. So beginnt auch das Evangelium.
Ich selbst bin ein Anfang, eine Schöpfung Gottes. Allerdings gibt es auch in mir Wüste und Leere. Wage ich mich in dieses unwegsame Gelände? In unbetretene Einöden? Halte ich das Eintönige aus? Damit mein Leben wieder neu wird, muss ich einen Weg durch meine Wüste finden. In den Gebetszeiten schreite ich meine inneren Landschaften ab. Woher kommt so viel staubtrockenes Land in mir? Auf dem Sand kniend spüre ich die inwendige Dürre. Ich nehme die heiße Luft wahr, die ich in ruhigen Zügen einatme. Wie vieles von dem, was ich schon geredet habe, war auch bloß heiße Luft ... Hier suche ich nach einem Wort, das mich trägt. „Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir.“ (Ps 63,2)
Vielleicht muss ich selbst mehr Wüste werden: mich entleeren von allem, was mich vollstopft und überfüllt wie Gedanken, Sorgen, Phantasien, Projekte ... Wenn mein Inneres nicht mehr von allem Möglichen zugestellt ist, kann dort ein Weg entstehen, auf dem Gott zu mir kommt.
Inmitten von „Irrsal und Wirrsal“ (Martin Buber) spricht Gott: Es werde Licht! Mitten durch die Wüste wird ein Weg gebahnt, auf dem das Evangelium zu mir kommen kann. Die Nachricht, die mich hier und heute erreicht und anspricht, lautet: Jesus ist der Anfang von etwas Neuem und Unvergleichlichem. Durch ihn, den Sohn Gottes, werden alle Menschen zu Kindern Gottes. Das ist doch eine absolut gute Nachricht!
Auch mein Anfang ist ein Evangelium. Plötzlich tauchen Bilder in mir auf: Wie war es, als meine Mutter bemerkte, dass sie schwanger war? Ich bin überzeugt, dass es für meine Eltern eine gute Nachricht war. Ich war erwünscht und erwartet. Das können viele Menschen nicht von sich sagen. Aber für jeden Menschen kann sich inmitten seiner Wüste ein Weg eröffnen. Wenn man nämlich spüren kann: Es gibt so etwas wie einen tragenden Grund, der mich leben und vorwärtsgehen lässt.
Durch Jesus, den Sohn Gottes, wird jedem und jeder gesagt: Auch dein Anfang ist ein freudiges Ereignis, ein Evangelium! Denn auch du bist eine Tochter, ein Sohn Gottes. Jede Genesis (Zeugung) ist eingebettet in die eine große Genesis (Schöpfung) Gottes: Ich will, dass es die Welt und dass es dich gibt. Und: Es ist gut, dass du da bist!
2. Tag
Mein Wecker läutet um vier Uhr in der Frühe. Ich sitze auf und horche. Die Stille empfängt mich mit offenen Armen. Ich krieche aus dem Schlafsack, aus dem Moskitozelt und knie mich halb schlaftrunken auf meinen Hocker. Die kleine Ikone leuchtet im flackernden Kerzenlicht. Es fällt mir schwer, den Tag ohne Kaffee oder Tee zu beginnen. Ich suche nach einem Satz, den ich im Atemrhythmus wiederholen kann: In der Nacht – sei du mein Licht!
Warum verbringe ich so viele Tage allein in der Wüste, ohne etwas „Sinnvolles“ zu tun? Der Sinn dieser Zeit liegt gerade im Nichts-Tun! Wir sind gewohnt, in den Kategorien von Nutzen und Zweck zu denken. Und machen dabei den Sinn unseres Lebens davon abhängig, ob wir brauchbar und nützlich sind. Viele Menschen erleben sich nur dann als wertvoll, wenn sie sich und anderen durch ihre Arbeit beweisen können, dass sie von Nutzen sind. Die Zeit in der Eremitage will helfen, eine andere Erfahrung zu machen. Als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal eine solche Zeit verbrachte, gab mir Yves, ein Kleiner Bruder, folgenden Rat mit auf den Weg: „Der Sinn der Einsiedelei ist: vivre la gratuité.“ Wir kennen im Deutschen kein entsprechendes Wort für gratuité. Am ehesten könnte man übersetzen: Lebe, dass alles ein Geschenk ist, gratis, Gnade (gratia). Und dann konkretisierte Yves: „Entdecke, wie bezaubernd eine Blume blüht oder ein Baum sich dem Licht entgegenstreckt. Nimm wahr, wie gut der Schluck Wasser aus der Quelle schmeckt. Und weil die Einsiedelei kein elektrisches Licht hat: Schau, wie schön eine Kerze leuchtet. Für all das musst du nichts machen – es ist dir als Geschenk gegeben!“
Die kleine Eremitage befand sich in der Nähe von Assisi. Sie lag ganz oben auf einem Hügel, der einen großartigen Ausblick auf die umliegende Landschaft bot. Alles war liebevoll eingerichtet: ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett. Ich hatte alles, was ich brauchte und konnte die Schönheit der Natur und die Stille des Ortes in vollen Zügen genießen. Ich nahm mir Zeit, um einen Baum zu betrachten, einen Schmetterling, den Mond, die Sterne. Eine ganze Woche lang lebte ich die gratuité und entdeckte, wie reich ich beschenkt bin. Mir ging auf, wie viel ich meiner Familie verdanke und welche Gaben mir geschenkt sind: Gesundheit, Freundschaften, Aufgaben ... So viel ist mir gegeben, ohne dass ich es mir durch Arbeit oder Leistung verdient hätte.
Auch hier in Baba-aïda gilt: Ich darf einfach da sein, ohne mich rechtfertigen zu müssen. Ich darf meine Zeit, die mir gegeben ist, „verschenken“ und den Augenblick genießen. Ich muss mein Leben nicht verdienen, sondern bin mir selbst geschenkt und darf „umsonst“ leben. Diese Gedanken lassen mich nach dem Übermaß von Arbeit und Anstrengung der letzten Monate aufatmen. Ich darf einfach da sein. Das genügt.
In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er, dass sich der Himmel öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam.
Und eine Stimme sprach aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.
Mk 1,9-11