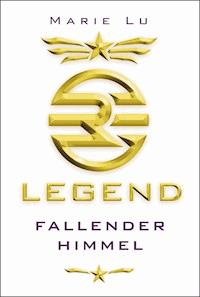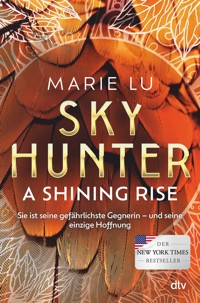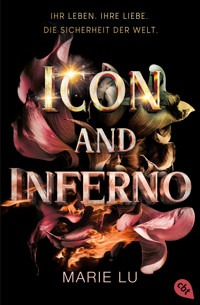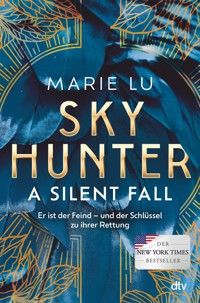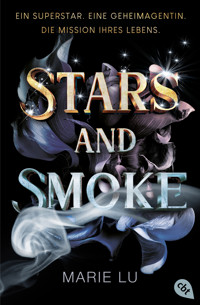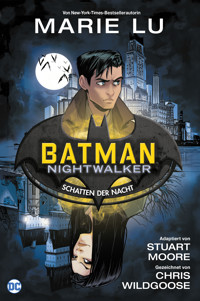17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Legend
- Sprache: Deutsch
Alle Bände der außergewöhnlichen Bestseller-Trilogie als eBook-Bundle! Die New-York-Times-Bestseller-Autorin Marie Lu bettet die zeitlose Geschichte ihrer Legend-Reihe über Rache, Verrat und eine legendäre Liebe in ein dystopisches Setting, das erschreckend realistisch und aktuell wirkt. Eine Welt der Unterdrückung. Rachegefühle, die durch falsche Anschuldigungen genährt werden. Und Hass, dem eine grenzenlose Liebe entgegentritt. Dies ist die Geschichte von Day und June. Getrennt sind sie erbitterte Gegner, aber zusammen sind sie eine Legende!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1451
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
LOS ANGELES, KALIFORNIEN
REPUBLIK AMERIKA
EINWOHNER: 20174
TEIL EINS
DER JUNGE,DER IM LICHT WANDELT
DAY
Meine Mutter glaubt, dass ich tot bin.
Wie man sieht, bin ich nicht tot, aber es ist sicherer, sie in dem Glauben zu lassen.
Mindestens einmal pro Monat sehe ich mein Fahndungsfoto auf einem der JumboTrons, die über die ganze Innenstadt von Los Angeles verteilt sind. Es wirkt da oben immer völlig fehl am Platz. Meistens zeigen die riesigen Monitore fröhliche Bilder: lachende Kinder unter einem leuchtend blauen Himmel, Touristen, die vor den Ruinen der Golden Gate Bridge posieren, Republik-Werbespots in Neonfarben. Manchmal wird auch Propaganda gegen die Kolonien gesendet. Die Kolonien wollen uns unser Land wegnehmen, verkünden die Schlagzeilen. Sie neiden euch das, was ihr habt. Lasst nicht zu, dass sie euch eure Heimat rauben! Wehrt euch!
Und mittendrin meine Fahndungsanzeige. Sie lässt die JumboTrons in all ihrer bunten Pracht erstrahlen:
GESUCHT IM NAMEN DER REPUBLIK Akten-Nr.462178-3233 »DAY«
GESUCHT WEGEN KÖRPERVERLETZUNG, BRANDSTIFTUNG, DIEBSTAHLS, BESCHÄDIGUNG STAATLICHEN EIGENTUMS UND BEHINDERUNG MILITÄRISCHER EINSÄTZE
200000 REPUBLIKNOTEN BELOHNUNG FÜR HINWEISE, DIE ZUR FESTNAHME FÜHREN
Die Meldung wird jedes Mal von einem anderen Foto begleitet. Einmal zeigt es einen Jungen mit Brille und einem wirren roten Lockenschopf. Ein anderes Mal einen Jungen mit schwarzen Augen und Glatze. Manchmal bin ich schwarz, manchmal weiß, dann wieder milchkaffeebraun oder gelb oder rot oder was ihnen sonst gerade in den Sinn kommt.
Mit anderen Worten: Die Republik hat keine Ahnung, wie ich aussehe. Sie scheinen insgesamt nicht besonders viel über mich zu wissen, außer dass ich jung bin und dass sie meine Fingerabdrücke so oft durch ihre Datenbanken jagen können, wie sie wollen – sie bekommen keinen Treffer. Darum hassen sie mich so, darum bin ich vielleicht nicht der gefährlichste Verbrecher des ganzen Landes, aber der meistgesuchte. Denn ich lasse sie ziemlich dumm aussehen.
Es ist erst früher Abend, aber draußen ist es schon stockdunkel und das Licht der JumboTrons spiegelt sich in den Pfützen auf der Straße. Ich setze mich auf ein bröckelndes Fensterbrett im dritten Stock, verborgen hinter rostigen Stahlträgern. Das hier war ursprünglich mal ein Wohngebäude, heute aber ist es total verfallen. Der Boden in diesem Zimmer ist mit kaputten Lampen und Glassplittern übersät und von den Wänden blättert die Farbe. In einer Ecke liegt ein altes Porträt unseres Elektors auf dem Boden. Ich frage mich, wer hier wohl gelebt hat – niemand wäre dumm genug, das Bild unseres Staatsoberhauptes so achtlos im Dreck liegen zu lassen.
Meine Haare habe ich wie immer unter eine alte Ballonmütze gestopft. Mein Blick ruht auf dem kleinen eingeschossigen Haus auf der anderen Straßenseite. Meine Finger spielen mit dem Anhänger, der an einer Schnur um meinen Hals hängt.
Tess lehnt an dem anderen Fenster im Zimmer und beobachtet mich. Ich bin unruhig an diesem Abend und wie immer kann sie es spüren.
Die Seuche hat den Lake-Sektor schwer erwischt. Im Schein der JumboTrons können Tess und ich die Soldaten am anderen Ende der Straße sehen. Sie inspizieren Haus für Haus und tragen ihre glänzend schwarzen Umhänge der Hitze wegen offen. Sie haben alle Gasmasken auf. Manchmal, wenn sie ein Haus wieder verlassen, markieren sie die Tür mit einem großen roten X. Danach betritt oder verlässt niemand mehr dieses Haus – zumindest nicht so, dass es jemand mitbekommt.
»Siehst du sie immer noch nicht?«, flüstert Tess. Ihr Gesichtsausdruck ist durch die Schatten verborgen.
Um mich ein bisschen abzulenken, bastele ich eine kleine Schleuder aus alten PVC-Schläuchen. »Sie haben überhaupt nicht zu Abend gegessen. Sie haben schon seit Stunden nicht mehr am Tisch gesessen.« Ich verlagere mein Gewicht und strecke mein schmerzendes Knie.
»Vielleicht sind sie gar nicht zu Hause?«
Ich werfe Tess einen verdrossenen Blick zu. Sie versucht nur, mich zu trösten, aber danach ist mir jetzt nicht zumute. »Es brennt Licht. Guck doch mal, die Kerzen. Mom würde nie Kerzen verschwenden, wenn keiner zu Hause wäre.«
Tess tritt neben mich. »Wir sollten die Stadt für ein paar Wochen verlassen, okay?« Sie versucht, ihre Stimme ruhig klingen zu lassen, aber die Angst sickert trotzdem durch. »Die Seuche ebbt bestimmt bald wieder ab, dann kannst du zurück und sie besuchen. Wir haben mehr als genug Geld für zwei Zugtickets.«
Ich schüttele den Kopf. »Einen Abend pro Woche, weißt du nicht mehr? Lass mich einen Abend pro Woche nach ihnen sehen.«
»Klar. Aber diese Woche bist du jeden Abend hergekommen.«
»Ich will nur sehen, ob es ihnen gut geht.«
»Was ist, wenn du krank wirst?«
»Das Risiko gehe ich ein. Und du hättest ja auch nicht mitkommen müssen. Du hättest genauso gut in Alta auf mich warten können.«
Tess zuckt mit den Schultern. »Irgendwer muss ja ein Auge auf dich haben.« Zwei Jahre jünger als ich – und manchmal klingt sie trotzdem, als wäre sie mein Kindermädchen.
Wir sehen eine Weile schweigend zu, wie sich die Soldaten immer weiter auf das Haus meiner Familie zubewegen. Jedes Mal, wenn sie vor einem Haus stehen bleiben, hämmert einer von ihnen laut an die Tür, während ein zweiter mit der Waffe im Anschlag daneben steht. Wenn innerhalb von zehn Sekunden niemand öffnet, tritt der erste Soldat die Tür ein. Sobald sie drinnen sind, kann ich sie nicht mehr sehen, aber ich kenne das Prozedere: Ein Soldat nimmt von jedem Familienmitglied eine Blutprobe, schiebt sie in ein tragbares Analysegerät und testet sie auf die Seuche. In zehn Minuten ist das Ganze vorbei.
Ich zähle die Häuser, die noch zwischen dem meiner Familie und den Soldaten liegen. Ich werde noch etwa eine Stunde warten müssen, bis ich ihr Schicksal erfahre.
Ein Schrei gellt vom anderen Ende der Straße durch die Dunkelheit. Mein Blick huscht in die Richtung, aus der er gekommen ist, und meine Hand schnellt zu dem Messer an meinem Gürtel. Tess atmet scharf ein.
Es ist ein Seuchenopfer. Die Frau muss schon seit Monaten dahinsiechen, denn ihre Haut ist überall aufgesprungen und blutig, und ich frage mich, wie die Soldaten sie bei ihren früheren Kontrollen übersehen konnten. Eine Weile taumelt sie orientierungslos umher, dann fängt sie plötzlich an zu rennen, nur um zu stolpern und auf die Knie zu fallen.
Ich blicke wieder zu den Soldaten. Jetzt sehen sie sie auch. Der mit der gezogenen Waffe nähert sich ihr, die übrigen elf bleiben zurück und sehen zu. Ein Seuchenopfer stellt keine große Bedrohung dar. Der Soldat hebt sein Gewehr und zielt. Funken stieben um die infizierte Frau auf.
Sie bricht zusammen und bleibt reglos liegen. Der Soldat gesellt sich wieder zu seinen Kameraden.
Ich wünschte, wir könnten irgendwie an eins von diesen Gewehren kommen. So eine nette, kleine Waffe kostet auf dem Schwarzmarkt nicht viel – 480Noten, weniger als ein Herd. Wie alle Schusswaffen ist sie hochpräzise und nutzt magnetische und elektrische Felder, sodass man ein Ziel auf drei Häuserblocks Entfernung sicher trifft. Dad hat mal gesagt, dass sie diese Technologie bei den Kolonien geklaut haben, aber das würde die Republik natürlich nie zugeben. Wenn wir wollten, könnten Tess und ich uns fünf Stück davon kaufen … Über die Jahre haben wir uns angewöhnt, einen Teil des Geldes, das wir stehlen, zu horten und für Notfälle zu sparen. Aber das eigentliche Problem bei diesen Waffen sind nicht die Kosten. Man ist damit einfach zu leicht aufzuspüren. Jede von ihnen ist mit einem Sensor versehen, der Informationen über die Handform des Benutzers, seine Fingerabdrücke und seinen Aufenthaltsort speichert. Wenn sie mich auf diese Weise nicht schnappen würden, dann weiß ich auch nicht. Also bleibe ich lieber bei meinen selbst gebauten Waffen, Schleudern aus PVC und anderem Kinderspielzeug.
»Sie haben noch eins gefunden«, sagt Tess. Sie kneift die Augen zusammen, um besser sehen zu können.
Ich blicke nach unten und beobachte, wie die Soldaten aus einem weiteren Haus strömen. Einer von ihnen schüttelt eine Spraydose und sprüht ein riesiges rotes X an die Tür. Ich kenne dieses Haus. Zu der Familie, die dort wohnt, gehörte mal eine Tochter in meinem Alter. Als meine Brüder und ich noch klein waren, haben wir mit ihr gespielt – Blindekuh oder Straßenhockey mit alten Eisenstangen und Bällen aus zusammengeknülltem Papier.
Tess versucht mich abzulenken und deutet mit dem Kinn auf das Stoffbündel, das zu meinen Füßen liegt. »Was hast du ihnen mitgebracht?«
Ich lächele, dann bücke ich mich und knote das Päckchen auf. »Ein paar von den Sachen, die wir diese Woche zusammengetragen haben. Damit können sie ein bisschen feiern, wenn sie die Kontrolle überstanden haben.« Ich wühle in dem Sammelsurium von Mitbringseln und halte schließlich eine Schutzbrille hoch. Ich untersuche sie abermals, um sicherzugehen, dass das Glas nirgends gesprungen ist. »Für John. Ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk.« Mein älterer Bruder wird diese Woche neunzehn. Er schiebt Vierzehnstundenschichten am Dampfkessel in einem nahe gelegenen Kraftwerk, und wenn er nach Hause kommt, tränen ihm immer die Augen von dem ganzen Dampf. Die Brille war ein richtiger Glücksfund, den wir in einer Lieferung von Militärausrüstung aufgestöbert haben.
Ich lege sie zurück und krame in den restlichen Sachen. Hauptsächlich Konserven mit Eintopf, die ich in der Cafeteria eines Luftschiffs geklaut habe, und ein altes Paar Schuhe mit völlig intakten Sohlen. Ich wünschte, ich könnte dabei sein, wenn sie die Sachen bekommen. Aber John ist der Einzige, der weiß, dass ich am Leben bin, und er hat versprochen, Mom und Eden nichts zu verraten.
Eden wird in zwei Monaten zehn, was bedeutet, dass er in zwei Monaten den Großen Test machen muss. Ich habe den Test nicht bestanden, als ich zehn war. Darum mache ich mir Sorgen um Eden, denn auch wenn er der Cleverste von uns drei Brüdern ist, denkt er in vielen Dingen genauso wie ich. Als ich mit meinem Test fertig war, war ich mir meiner Antworten so sicher, dass ich noch nicht mal dabei zusah, wie sie sie bewerteten. Dann aber scheuchten mich die Betreuer zusammen mit einem Grüppchen anderer Kinder in eine Ecke des Großen Stadions. Sie stempelten meinen Testbogen ab und steckten mich in einen Zug Richtung Innenstadt. Ich konnte nichts mitnehmen bis auf den Anhänger, den ich um den Hals trug. Ich konnte mich noch nicht einmal verabschieden.
Nach dem Großen Test kann dein Leben in ganz unterschiedlichen Bahnen verlaufen.
Du erreichst die volle Punktzahl: 1500. Das hat noch nie jemand geschafft – na ja, bis auf irgendein Kind vor ein paar Jahren, wegen dem das Militär einen Riesenwirbel veranstaltet hat. Aber wer weiß schon, was das Schicksal für jemanden mit so einem Ergebnis bereithält? Wahrscheinlich haufenweise Geld und Macht.
Du erreichst eine Punktzahl zwischen 1450 und 1499. In dem Fall klopf dir selbst auf die Schulter, denn du darfst die nächsten Klassen überspringen und wirst direkt für sechs Jahre auf die Highschool und anschließend für vier Jahre auf eine der besten Universitäten der Republik geschickt: Drake, Stanford oder Brenan. Danach hast du eine Stelle im Kongress sicher und scheffelst richtig viel Geld – Glück und Zufriedenheit inklusive. Zumindest nach Ansicht der Republik.
Du erreichst eine gute Punktzahl irgendwo zwischen 1250 und 1449. In diesem Fall machst du ganz normal weiter bis zur Highschool und wirst danach einem College zugeteilt. Auch nicht übel.
Du bestehst mit Ach und Krach und einer Punktzahl zwischen 1000 und 1249. Der Kongress verwehrt dir den Zugang zur Highschool. Ab jetzt bist du arm, so wie meine Familie. In dem Fall ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du entweder bei der Arbeit an den Wasserturbinen ertrinkst oder der Dampf in den Kraftwerken dich langsam dahinrafft.
Du fällst durch.
Die Kinder, die durchfallen, stammen fast immer aus den Slumsektoren. Wenn du zu dieser unglückseligen Gruppe zählst, schickt die Republik einen Beamten zu deiner Familie nach Hause. Deine Eltern werden gezwungen, ein Dokument zu unterschreiben, mit dem sie der Regierung das alleinige Sorgerecht für dich übertragen. Sie erzählen deiner Familie, dass du in ein Arbeitslager der Republik geschickt wurdest und sie dich nie wiedersehen werden. Deine Eltern müssen nicken und einwilligen. Manchmal feiern sie sogar, denn immerhin zahlt ihnen die Republik eintausend Noten als Entschädigung. Geld und ein Maul weniger zu stopfen? Wie aufmerksam von unserer Regierung.
Abgesehen davon, dass das alles eine Lüge ist. Ein minderwertiges Kind mit schlechten Genen ist für das Land nicht von Nutzen. Wenn du Glück hast, lässt der Kongress dich einfach sterben, ohne dich vorher in die Labore zu schicken, wo du auf deine Unzulänglichkeiten hin untersucht wirst.
Noch fünf Häuser.
Tess sieht die Sorge in meinen Augen und legt mir die Hand auf die Stirn. »Bekommst du wieder deine Kopfschmerzen?«
»Nein. Alles okay.« Ich spähe in das geöffnete Fenster am Haus meiner Familie und erhasche zum ersten Mal einen Blick auf ein vertrautes Gesicht. Eden geht daran vorbei, lugt nach draußen zu den näher kommenden Soldaten und richtet irgendeinen selbst gebastelten Apparat aus Metall auf sie. Dann zieht er den Kopf wieder ein und verschwindet im Inneren des Hauses. Seine Locken schimmern weißblond im flackernden Licht der Lampe. So wie ich ihn kenne, hat er das Gerät wahrscheinlich gebaut, um zu messen, wie weit jemand von ihm entfernt ist oder so ähnlich.
»Er ist dünner geworden«, murmele ich.
»Er ist lebendig und wohlauf«, entgegnet Tess. »Ich würde sagen, das ist eine gute Nachricht.«
Ein paar Minuten später gehen John und meine Mutter an dem Fenster vorbei, vertieft in ein Gespräch. John und ich sehen uns ziemlich ähnlich, nur dass er durch seine langen Schichten im Kraftwerk etwas muskulöser geworden ist. Sein Haar reicht ihm, wie den meisten in unserem Sektor, bis über die Schultern und ist zu einem einfachen Pferdeschwanz gebunden. Sein Hemd hat rote Lehmflecken. Ich kann erkennen, dass Mom ihn wegen irgendwas ausschimpft, wahrscheinlich, weil er zugelassen hat, dass Eden aus dem Fenster guckt. Sie schlägt Johns Hand weg, als einer ihrer chronischen Hustenanfälle sie zu schütteln beginnt.
Ich atme aus. Gut. Wenigstens sind sie alle drei gesund genug, um auf den Beinen zu sein. Das heißt, selbst wenn sich einer von ihnen infiziert haben sollte, bestünde noch die Chance, dass sie wieder genesen.
Ich kann nicht aufhören, daran zu denken, was passieren würde, wenn die Soldaten unsere Haustür markieren. Meine Familie würde eine Weile wie versteinert in unserem Wohnzimmer stehen, nachdem die Soldaten gegangen wären. Irgendwann würde Mom ihr gewohnt tapferes Gesicht aufsetzen, um dann die ganze Nacht wach zu liegen und sich lautlos die Tränen wegzuwischen. Ab dem nächsten Morgen würden sie mit kleinen Essens- und Wasserrationen versorgt werden und nichts tun als abzuwarten, bis sie wieder gesund wurden. Oder starben.
Meine Gedanken wandern zu dem Geheimvorrat an gestohlenem Geld, den Tess und ich angelegt haben. Zweitausendfünfhundert Noten. Genug, um uns ein paar Monate über Wasser zu halten … aber nicht genug, um meiner Familie ein paar Fläschchen Seuchenmedizin zu kaufen.
Die Minuten ziehen sich hin. Ich stecke meine Schleuder weg und spiele ein paar Runden Schere-Stein-Papier mit Tess. (Ich weiß nicht, wie sie das macht, aber sie ist so gut wie unschlagbar in diesem Spiel.) Hin und wieder werfe ich einen Blick zum Fenster unseres Hauses hinüber, aber ich kann niemanden sehen. Sie müssen sich nahe der Tür versammelt haben, bereit, sie zu öffnen, sobald sie eine Faust an das Holz hämmern hören.
Und dann ist der Zeitpunkt gekommen.
Ich lehne mich so weit über das Fensterbrett, dass Tess mich beim Arm packt, damit ich nicht kopfüber auf die Straße plumpse.
Die Soldaten klopfen an die Tür. Meine Mutter macht sofort auf, lässt sie herein und schließt die Tür wieder. Ich lausche angestrengt auf Stimmen oder Schritte, irgendwas, das aus meinem Zuhause zu mir heraufdringt. Je schneller das alles vorüber ist, desto früher kann ich John meine Geschenke zustecken.
Die Stille nimmt kein Ende.
Tess flüstert: »Keine Nachrichten sind gute Nachrichten, nicht?«
»Sehr witzig.«
Im Kopf zähle ich die Sekunden. Eine Minute vergeht. Dann zwei, dann vier, und schließlich sind es zehn.
Fünfzehn Minuten. Zwanzig.
Ich sehe Tess an. Sie zuckt mit den Schultern. »Vielleicht ist ja ihr Analysegerät kaputt«, meint sie.
Dreißig Minuten vergehen.
Ich wage nicht, mich von meinem Beobachtungsposten wegzubewegen. Ich traue mich kaum zu blinzeln, aus Angst, dass ausgerechnet dann irgendwas Wichtiges passiert. Meine Finger trommeln einen Rhythmus auf den Griff meines Messers.
Vierzig Minuten. Fünfzig Minuten. Eine Stunde.
»Da stimmt was nicht«, flüstere ich.
Tess schürzt die Lippen. »Das kannst du nicht wissen.«
»Doch, ich weiß es. Was soll denn da so lange dauern?«
Tess öffnet den Mund, um zu antworten, doch bevor sie etwas sagen kann, kommen die Soldaten aus unserem Haus, einer nach dem anderen, die Gesichter ausdruckslos. Der letzte Soldat schließt die Tür hinter sich und greift nach etwas, das an seinem Gürtel befestigt ist. Mir wird schwindelig. Ich weiß, was jetzt kommt.
Der Soldat hebt den Arm und sprüht eine lange rote Linie diagonal über unsere Tür. Dann eine zweite, sodass ein X entsteht.
Ich fluche leise und will mich schon abwenden – doch dann tut der Soldat etwas Unerwartetes, etwas, das ich noch nie zuvor gesehen habe.
Er sprüht eine dritte, vertikale Linie auf unsere Haustür und teilt das X damit in zwei Hälften.
JUNE
13:47 UHR DRAKE-UNIVERSITÄT, SEKTOR BATALLA INNENTEMPERATUR: 22 °C
Ich sitze im Vorzimmer des Dekans. Mal wieder. Auf der anderen Seite der Milchglastür lungern ein paar meiner Kommilitonen herum (alle kurz vor dem Abschluss und mindestens vier Jahre älter als ich), die aufzuschnappen versuchen, was los ist. Einige von ihnen haben mitbekommen, wie ich während des Nachmittagstrainings (heutiger Schwerpunkt: das Laden und Entladen eines XM-621-Gewehrs) von zwei bedrohlich aussehenden Wachen davongezerrt wurde. Und jedes Mal, wenn so was passiert, breitet sich die Neuigkeit rasend schnell über den ganzen Campus aus. Das Wunderkind der Republik hat mal wieder was ausgefressen.
Im Büro ist es ruhig bis auf das leise Summen des Computers auf dem Schreibtisch der Sekretärin. Ich habe mir jedes einzelne Detail dieses Raums eingeprägt (handgeschliffene Bodenfliesen aus Marmor – Dakota-Import –, 324 quadratische Deckenplatten aus Kunststoff, sechseinhalb Meter grauer Vorhang zu beiden Seiten des Porträts unseres ehrwürdigen Elektors an der Rückwand des Büros, ein stumm geschalteter 30-Zoll-Bildschirm an der Seitenwand, der soeben die Schlagzeile Gruppe rebellischer Patrioten zündet Bombe in örtlichem Militärstützpunkt, fünf Tote zeigt, gefolgt von der nächsten: Republik schlägt Kolonien in Schlacht um Hillsboro). Arisna Whitaker, die Dekanatssekretärin höchstpersönlich, sitzt an ihrem Schreibtisch und tippt mit den Fingern auf die Glasplatte ein – wahrscheinlich schreibt sie an meinem Verweis. Meinem achten in diesem Quartal. Ich möchte wetten, dass ich die einzige Studentin an der Drake bin, die es jemals geschafft hat, acht Verweise in einem Quartal zu bekommen, ohne von der Uni zu fliegen.
»Haben Sie sich an der Hand verletzt, Ms Whitaker?«, frage ich nach einer Weile.
Sie hört auf zu tippen und wirft mir einen finsteren Blick zu. »Wie kommen Sie darauf, Ms Iparis?«
»Ihr Tippen ist unregelmäßig. Sie versuchen, Ihre rechte Hand zu schonen.«
Ms Whitaker seufzt und lehnt sich in ihrem Stuhl zurück. »Ja, June. Ich habe mir gestern beim Kivaballspielen das Handgelenk verstaucht.«
»Das tut mir leid. Sie sollten versuchen, den Schwung mehr aus dem Arm zu holen statt aus dem Handgelenk.« Es ist als neutrale Bemerkung gemeint, doch es klingt eher spöttisch und trägt nicht dazu bei, dass ihre Laune sich bessert.
»Damit das ein für alle Mal geklärt ist, Ms Iparis«, sagt sie. »Sie mögen sich ja für sehr schlau halten. Sie mögen der Ansicht sein, dass Ihnen aufgrund Ihrer exzellenten Zensuren eine Sonderbehandlung zusteht. Vielleicht meinen Sie sogar, dass Sie aufgrund dieses Unsinns so etwas wie eine Fangemeinde an dieser Universität haben.« Sie deutet in Richtung der Studenten, die sich vor der Tür versammelt haben. »Aber mir hängen unsere kleinen Zusammenkünfte in meinem Büro zum Hals heraus. Und lassen Sie sich eins gesagt sein: Wenn Sie nach Ihrem Abschluss die Stelle antreten, die die Regierung für Sie vorgesehen hat – welche auch immer das sein mag –, werden Sie Ihre Vorgesetzten dort mit solchen Eskapaden nicht mehr beeindrucken können. Haben wir uns verstanden?«
Ich nicke, weil sie das von mir erwartet. Doch sie hat unrecht. Ich halte mich nicht bloß für schlau. Ich bin die Einzige in der ganzen Republik, die den Großen Test mit vollen 1500Punkten abgeschlossen hat. Ich wurde mit zwölf Jahren hierhergeschickt, an die renommierteste Uni des ganzen Landes, dem normalen Zeitplan um vier Jahre voraus. Das zweite Jahr habe ich übersprungen. Während meiner drei Jahre an dieser Uni habe ich nur die allerbesten Noten bekommen. Ich bin schlau. Ich habe das, was die Republik als gute Gene bezeichnet – und je besser die Gene, desto besser die Soldaten und desto besser die Siegeschancen im Krieg gegen die Kolonien, sagen meine Professoren. Und wenn ich das Gefühl habe, dass man mir beim Nachmittagstraining nicht gründlich genug beibringt, wie man bewaffnet eine Wand hochklettert … tja, dann kann man es wohl kaum mir vorwerfen, wenn ich mit einer XM-621 auf dem Rücken ein neunzehnstöckiges Gebäude erklimme. Diese Aktion diente ausschließlich der Weiterbildung zum Wohle meines Vaterlandes.
Gerüchten zufolge soll Day einmal fünf Stockwerke in weniger als acht Sekunden geschafft haben. Wie sollen wir den meistgesuchten Verbrecher der Republik jemals schnappen, wenn wir nicht genauso schnell sind? Und wenn wir noch nicht mal in der Lage sind, ihn zu schnappen, wie sollen wir dann erst den Krieg gewinnen?
Ms Whitakers Schreibtisch gibt einen dreifachen Piepton von sich. Sie drückt eine Taste. »Ja?«
»Captain Metias Iparis ist am Tor«, antwortet eine Stimme. »Er möchte seine Schwester abholen.«
»Gut. Schicken Sie ihn rein.« Sie lässt die Taste los und hebt warnend den Zeigefinger. »Ich hoffe, Ihr Bruder passt in Zukunft etwas besser auf Sie auf, denn wenn ich Sie dieses Quartal noch ein Mal in meinem Büro sehe –«
»Metias passt besser auf mich auf als unsere toten Eltern«, entgegne ich, vielleicht etwas schärfer als beabsichtigt.
Ein unbehagliches Schweigen breitet sich zwischen uns aus.
Schließlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, bricht draußen auf dem Gang Unruhe aus. Die Studenten, die sich an die Glastür gepresst haben, stieben hastig auseinander und ihre Umrisse machen Platz für eine hochgewachsene Silhouette. Mein Bruder.
Als Metias die Tür öffnet und hereinkommt, sehe ich, wie ein paar Mädchen im Flur verlegen kichern. Doch Metias’ Aufmerksamkeit gilt allein mir. Wir haben die gleichen Augen, schwarz mit einem leichten Goldschimmer, die gleichen langen Wimpern und dunkle Haare. Die langen Wimpern wirken besonders bei Metias sehr eindrucksvoll. Selbst als sich die Tür hinter ihm geschlossen hat, kann ich das Getuschel und Gekicher von draußen noch hören. Wie es aussieht, kommt er direkt von seinem Streifendienst, denn er trägt volle Uniform: schwarze Offiziersjacke mit einer doppelten Reihe goldener Knöpfe, glänzende Epauletten auf den Schultern, Handschuhe (Neopren mit Spectra-Einlage und dem Rangabzeichen eines Captains), schwarze Hose, blank geputzte Schuhe und passende Mütze. Unsere Blicke treffen sich.
Er ist stinksauer.
Ms Whitaker schenkt Metias ein strahlendes Lächeln. »Ah, Captain!«, ruft sie. »Wie schön, Sie zu sehen.«
Metias tippt sich zum formellen Gruß an die Kante seiner Mütze. »Ein Jammer allerdings, dass es erneut unter diesen unglücklichen Umständen sein muss«, erwidert er. »Bitte entschuldigen Sie vielmals.«
»Keine Ursache, Captain.« Die Sekretärin macht eine wegwerfende Geste. Was für eine Arschkriecherin – besonders nach dem, was sie eben noch über Metias gesagt hat. »Das ist ja nicht Ihr Fehler. Ihre Schwester wurde dabei beobachtet, wie sie während des Nachmittagstrainings an einem Hochhaus hochgeklettert ist. Sie hat sich dafür unerlaubt zwei Blocks weit vom Campus entfernt. Wie Sie sicher wissen, dürfen unsere Studenten nur die Kletterwände auf dem Universitätsgelände zu Übungszwecken nutzen, und den Campus mitten am Tag zu verlassen ist verboten –«
»Ja, das ist mir bewusst«, unterbricht Metias ihre Ausführungen und wirft mir aus dem Augenwinkel einen Blick zu. »Ich habe heute Mittag die Helikopter über der Universität gesehen und hatte schon den … Verdacht, dass June etwas damit zu tun haben könnte.«
Es waren drei Helikopter. Niemand konnte schnell genug klettern, um mich auf diese Weise von der Gebäudewand zu holen, also nahmen sie schließlich ein Netz zu Hilfe.
»Vielen Dank«, sagt Metias zu der Sekretärin. Dann schnippt er mit den Fingern, mein Zeichen aufzustehen. »Wenn June wieder zur Uni kommt, wird sie sich vorbildlich verhalten, das verspreche ich Ihnen.«
Ich ignoriere Ms Whitakers künstliches Lächeln und folge meinem Bruder aus dem Büro in den Flur. Sofort sind wir umringt von Studenten.
»June«, sagt ein Junge namens Dorian und trottet neben uns her. Er hat zwei Jahre in Folge (vergeblich) versucht, mich zum Ball der Universität einzuladen. »Ist das wahr? Wie hoch bist du gekommen?«
Metias schneidet ihm mit einem strengen Blick das Wort ab. »June geht jetzt nach Hause.« Dann legt er mir fest die Hand auf die Schulter und führt mich von meinen Mitstudenten weg. Ich werfe noch einen Blick über die Schulter und ringe mir ein Lächeln ab.
»Vierzehnter Stock!«, rufe ich ihnen zu. Sofort geht das aufgeregte Geraune wieder los. So sieht mein Verhältnis zu den anderen Studenten aus. Sie respektieren mich, diskutieren und tratschen über mich – aber selten mit mir.
Aber so ist es wohl, das Leben einer Fünfzehnjährigen im Abschlussjahrgang an einer Uni, an der man eigentlich erst mit sechzehn zu studieren beginnt.
Metias sagt kein Wort, während wir durch die Flure gehen, vorbei an der peinlich genau gestutzten Rasenfläche im Innenhof und der Statue des ehrwürdigen Elektors und schließlich durch eine der Trainingshallen. Dort findet gerade der Nachmittagskurs statt, an dem ich eigentlich hätte teilnehmen sollen. Ich sehe zu, wie meine Kameraden über eine gigantische Bahn rennen, die von einem 360-Grad-Bildschirm umgeben ist, auf dem eine Szene mit einer zerbombten Straße irgendwo an der Front zu sehen ist. Sie halten ihre Gewehre vor sich und versuchen, sie im Laufen zu laden und zu entladen, so schnell sie können. An den meisten anderen Unis gibt es gar nicht so viele Soldatenanwärter, aber wir von der Drake sind fast alle für eine Karriere beim Militär vorgesehen. Ein paar haben Aussicht auf eine Stelle in der Politik oder beim Kongress, während andere hierbleiben und Dozentenpositionen übernehmen werden. Die Drake ist die beste Uni der ganzen Republik, und da die Besten von uns nun mal zum Militär geschickt werden, ist die Trainingshalle ziemlich gut gefüllt.
Als ich schließlich auf den Rücksitz des wartenden Militärjeeps klettere, kann Metias seinen Ärger kaum noch im Zaum halten. »Eine Woche suspendiert? Kannst du mir das bitte mal erklären?«, verlangt er. »Da komme ich vom Dienst, nachdem ich mich den ganzen Morgen mit diesen Patriotenrebellen herumgeschlagen habe, und was höre ich als Erstes? Helikoptereinsatz zwei Blocks von der Drake entfernt. Weil ein Mädchen einen Wolkenkratzer hochklettert.«
Ich wechsele einen freundlichen Blick mit Thomas, dem Soldaten hinter dem Steuer. »Tut mir leid«, murmele ich.
Metias dreht sich auf dem Beifahrersitz um und funkelt mich wütend an. »Was hast du dir denn dabei gedacht? War dir etwa nicht klar, dass du dich vom Campusgelände entfernt hattest?«
»Doch.«
»Natürlich. Du bist schließlich fünfzehn. Kletterst vierzehn Stockwerke an einem –« Er holt tief Luft, schließt die Augen und versucht sich zusammenzureißen. »Ich wäre dir wirklich dankbar, wenn du mich mal meinen Dienst machen lassen würdest, ohne dass ich mich ständig darum sorgen muss, was du wohl gerade wieder anstellst.«
Ich versuche, im Rückspiegel Thomas’ Blick aufzufangen, aber seine Augen sind fest auf die Straße gerichtet. Klar, von ihm brauche ich mir wohl kaum Unterstützung zu erhoffen. Er sieht so tadellos aus wie immer, das Haar perfekt zurückgekämmt, die Uniform frisch gebügelt. Nicht eine einzige Faser scheint aus der Reihe zu tanzen. Thomas mag ein paar Jahre jünger als Metias und ihm im Dienst untergeben sein, aber er ist der disziplinierteste Mensch, den ich kenne. Manchmal wünschte ich, ich hätte auch solch eine eiserne Disziplin. Wahrscheinlich missbilligt Thomas meine Kunststückchen sogar noch mehr als Metias.
Wir verlassen die Innenstadt von Los Angeles und folgen schweigend den Windungen des Highways. Langsam verändert sich die Szenerie und die hundertstöckigen Wolkenkratzer des Batalla-Sektors weichen dicht an dicht stehenden Kasernentürmen und Zivilgebäuden, die allesamt nicht höher sind als zwanzig oder dreißig Stockwerke. Auf den Dächern blinken rote Lichtsignale und die meisten Gebäude haben während der diesjährigen Sturmsaison einen Großteil ihrer Farbschicht eingebüßt. Kreuz und quer über die Außenwände verlaufen metallene Stützstreben – ich hoffe wirklich, dass sie bald verstärkt werden. Der Krieg tobt seit einiger Zeit ziemlich heftig, und nachdem nun schon seit Jahrzehnten ein großer Teil der finanziellen Mittel, die eigentlich für die Infrastruktur gedacht waren, in die Aufrüstung fließt, bin ich mir nicht sicher, ob diese Bauten auch nur ein einziges weiteres Erdbeben überstehen würden.
Nach ein paar Minuten klingt Metias’ Stimme schon viel ruhiger. »Du hast mir heute wirklich einen Riesenschreck eingejagt. Ich hatte Angst, sie könnten dich für Day halten und auf dich schießen.«
Ich weiß, dass er mir damit kein Kompliment machen will, aber ich muss trotzdem lächeln. Ich beuge mich vor und stütze meine Arme auf die Rückenlehne seines Sitzes. »Hey«, sage ich und zupfe an seinem Ohr, so wie ich es immer gemacht habe, als ich noch klein war. »Tut mir leid, dass du dich gesorgt hast.«
Er stößt eine Art verächtliches Kichern aus, aber ich merke ihm an, dass sein größter Ärger bereits verflogen ist. »Ja, klar. Das sagst du doch jedes Mal, Junebug. Schaffen die auf der Drake es denn nicht, dein Gehirn genug auf Trab zu halten? Wenn nicht die, wer sonst?«
»Tja, du weißt doch … Wenn du mich mal auf eine deiner Missionen mitnehmen würdest, dann würde ich tausendmal mehr lernen, ganz ohne dir Ärger zu machen.«
»Netter Versuch. Du gehst nirgendwohin, bevor du nicht deinen Abschluss gemacht hast und offiziell deinen Dienst antrittst.«
Ich beiße mir auf die Zunge. Letztes Jahr hat Metias mich tatsächlich mit auf eine Mission genommen – ein einziges Mal, als alle Drake-Studenten meiner Jahrgangsstufe an einem Einsatz der Streitkräfte teilnehmen sollten. Metias’ Commander hatte ihm aufgetragen, einen entflohenen Kriegsgefangenen aus den Kolonien zu töten. Also nahm Metias mich mit und gemeinsam jagten wir den Flüchtling immer tiefer und tiefer in unser Territorium hinein, weg von den Grenzzäunen und dem Streifen Land, der von Dakota bis hinunter nach Westtexas verläuft und die Republik von den Kolonien trennt, weg von der Front, wo der Himmel voller Luftschiffe ist. Ich verfolgte seine Spur bis in eine Gasse in Yellowstone City, Montana, wo Metias ihn schließlich erschoss.
Während der Verfolgungsjagd fing ich mir drei gebrochene Rippen und einen Messerstich ins Bein ein. Seitdem weigert sich Metias, mich irgendwohin mitzunehmen.
Als er wieder etwas sagt, klingt seine Stimme wider Willen neugierig. »Also, erzähl schon«, flüstert er. »In welcher Zeit hast du die vierzehn Stockwerke geschafft?«
Thomas stößt ein tadelndes Schnauben aus, aber ich grinse breit. Der Sturm scheint sich gelegt zu haben. Metias hat mich wieder lieb. »Sechs Minuten«, flüstere ich zurück. »Und vierundvierzig Sekunden. Na, was sagst du jetzt?«
»Das muss ein neuer Rekord sein. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mit solchen Aktionen einverstanden bin.«
Thomas hält exakt an der weißen Linie vor einer roten Ampel und wirft Metias einen ungehaltenen Blick zu. »Also wirklich, Captain«, rügt er. »June … äh … Ms Iparis wird ihr Verhalten bestimmt nicht ändern, wenn Sie sie jedes Mal, wenn sie die Regeln bricht, auch noch loben.«
»Entspannen Sie sich, Thomas.« Metias streckt den Arm aus und gibt ihm einen Klaps auf den Rücken. »Hin und wieder mal eine Regel zu brechen ist in Ordnung, wenn man damit seine eigenen Fähigkeiten zugunsten der Republik trainieren will. Zugunsten des Sieges gegen die Kolonien. Stimmt’s?«
Die Ampel springt auf Grün um. Thomas wendet seinen Blick wieder der Straße zu (er scheint in Gedanken bis drei zu zählen, bevor er wieder anfährt). »Stimmt«, brummt er. »Sie sollten trotzdem aufpassen, wozu Sie Ihre Schwester ermutigen, besonders da Ihre Eltern nicht mehr da sind.«
Metias’ Mund wird zu einer dünnen Linie und ein vertrauter angespannter Ausdruck tritt in seine Augen.
Egal wie gut meine Intuition ist, egal wie brillant meine Zensuren in Selbstverteidigung, Zielschießen und Nahkampf an der Drake sind, immer liegt in Metias’ Augen diese Angst. Die Angst, dass mir eines Tages etwas zustoßen könnte – wie der Autounfall, der uns unsere Eltern genommen hat. Diese Angst lässt sich durch nichts aus seinem Gesicht vertreiben. Und das weiß auch Thomas.
Ich kannte unsere Eltern nicht lange genug, um sie so sehr zu vermissen wie Metias. Wenn ich um sie weine, dann weine ich, weil ich keine Erinnerungen an sie habe. Nur verschwommene Bilder von langen Erwachsenenbeinen, die durch unsere Wohnung eilen, und Händen, die mich aus meinem Hochstühlchen heben. Das ist alles. In allen anderen Erinnerungen an meine Kindheit – wie ich den Blick über ein Publikum schweifen lasse, als ich einen Preis verliehen bekomme, wie mir jemand Suppe kocht, als ich krank bin, wie ich abends ins Bett gebracht werde – taucht nur Metias auf.
Wir passieren die letzten Gebäude von Batalla und kommen an ein paar schäbigen Blocks vorbei. (Können diese Bettler sich denn nicht mal von unserem Jeep fernhalten?) Nach einer Weile halten wir vor den strahlenden Wolkenkratzern von Ruby. Wir sind zu Hause. Metias steigt als Erster aus. Als ich ihm folge, schenkt Thomas mir ein kleines Lächeln.
»Bis bald, Ms Iparis«, sagt er und tippt sich an die Mütze.
Ich habe es aufgegeben, ihn zu bitten, dass er mich June nennen soll – er wird sich nie ändern. Aber eigentlich ist es auch gar nicht so schlecht, so respektvoll angesprochen zu werden. Wer weiß, wenn ich erst mal älter bin und Metias vielleicht nicht mehr in Ohnmacht fällt bei dem Gedanken daran, dass ich ein Date haben könnte …
»Bis dann, Thomas. Danke fürs Herfahren.« Ich erwidere sein Lächeln und steige aus dem Wagen.
Metias wartet, bis die Autotür hinter mir zufällt, dann dreht er sich um und senkt die Stimme. »Ich komme heute erst spät nach Hause«, sagt er. Wieder diese Anspannung in seinen Augen. »Geh nicht allein raus, ja? Von der Front heißt es, dass sie in den Wohnsiedlungen den Strom abstellen, um Energie für die Luftstützpunkte zu sparen. Also bleib zu Hause, okay? Auf den Straßen wird es noch dunkler sein als sowieso schon.«
Mein Herz zieht sich zusammen. Ich wünschte, die Republik würde sich ein bisschen beeilen und diesen Krieg endlich gewinnen, damit wir mal für einen kompletten Monat ausreichend Strom haben. »Wo musst du denn hin? Kann ich nicht mitkommen?«
»Ich muss zum Labor im Los Angeles Central Hospital. Die bekommen da eine Lieferung von Medikamenten gegen irgendein mutiertes Virus – sollte eigentlich nicht die ganze Nacht dauern. Und ich hab’s dir doch schon gesagt: Nein. Keine Missionen.« Metias zögert. »Ich komme nach Hause, so schnell ich kann. Es gibt noch eine ganze Menge zu besprechen.« Er legt mir die Hände auf die Schultern und übergeht meinen fragenden Blick. Dann gibt er mir einen flüchtigen Kuss auf die Stirn. »Hab dich lieb, Junebug«, sagt er, seine Standard-Abschiedsfloskel. Er dreht sich um und steigt zurück in den Jeep.
»Ich bleibe aber bestimmt nicht auf, bis du wieder da bist!«, rufe ich ihm nach, aber der Jeep fährt schon mit Metias davon. »Sei vorsichtig«, flüstere ich.
Es ist ohnehin zwecklos. Metias ist zu weit weg, um mich zu hören.
DAY
Als ich sieben Jahre alt war, kam mein Vater für eine Woche von der Front nach Hause. Sein Job war es, das Chaos zu beseitigen, das die Truppen der Regierung hinterließen, darum war er die meiste Zeit nicht bei uns und Mom musste uns Jungs allein aufziehen. Als er dieses Mal da war, kam eine Einheit der Stadtstreife zu einer Routinekontrolle zu uns nach Hause. Sie zerrten Dad mit zum Verhör auf die Polizeiwache. Anscheinend waren sie auf irgendetwas Verdächtiges gestoßen.
Als sie ihn zurückbrachten, hatte er zwei gebrochene Arme und sein Gesicht war geschwollen und blutig.
Ein paar Nächte später gab ich einen Klumpen zerstampftes Trockeneis mit Benzin in eine Flasche, wartete, bis das Benzin eine harte Kruste um das Eis bildete, und zündete das Ganze an. Dann schoss ich die Flasche mit einer Schleuder durch ein Fenster der Polizeiwache. Ich erinnere mich, wie kurz darauf die Feuerwehrautos um die Ecke gerast kamen, und an die verkohlten Überreste des Westflügels. Sie fanden nie heraus, wer dafür verantwortlich war, und ich stellte mich auch nicht. Schließlich gab es keinerlei Beweise. Ich hatte mein erstes perfektes Verbrechen begangen.
Meine Mutter hat immer gehofft, dass ich meine bescheidenen Wurzeln eines Tages hinter mir lassen würde. Dass ich erfolgreich werden würde oder sogar berühmt.
Tja, berühmt bin ich nun, allerdings glaube ich nicht, dass sie so etwas im Sinn gehabt hat.
Wieder bricht die Nacht herein; gute achtundvierzig Stunden sind vergangen, seit die Soldaten die Tür meiner Familie markiert haben.
Einen Block vom Los Angeles Central Hospital entfernt warte ich in der Dunkelheit einer engen Gasse und beobachte, wie das Personal durch den Haupteingang des Krankenhauses hinein- und herausströmt. Der Nachthimmel ist bewölkt und es scheint kein Mond, ich kann noch nicht einmal das verwitterte Zeichen ganz oben am Bank Tower erkennen. Elektrisches Licht erleuchtet jedes Stockwerk – ein Luxus, den sich nur die Regierung und die Oberschicht leisten können. Am Straßenrand stehen Militärjeeps aufgereiht, die darauf warten, Einlass in die Tiefgarage gewährt zu bekommen. Irgendjemand kontrolliert die Ausweise der Fahrer. Ich rühre mich nicht, mein Blick liegt fest auf dem Eingang des Krankenhauses.
Heute Abend habe ich mir mit meinem Outfit besonders viel Mühe gegeben. Ich trage meine guten Schuhe – Stiefel aus dunklem, mit der Zeit weich getragenem Leder mit stabilen Schnürsenkeln und Stahlkappen. Haben mich 150Noten aus unserem Geheimvorrat gekostet. In beiden habe ich, flach auf der Sohle liegend, ein Messer versteckt. Wenn ich die Füße bewege, kann ich das kalte Metall auf der Haut spüren. Die Beine meiner schwarzen Hose stecken in den Stiefelschäften und ich habe Handschuhe und ein schwarzes Taschentuch bei mir. Ich trage ein schwarzes T-Shirt und habe mir ein dunkles langärmliges Hemd um die Taille gebunden. Das Haar hängt mir offen über die Schultern. Diesmal habe ich mein Hellblond tiefschwarz übersprüht und fühle mich, als hätte ich den Kopf in einen Bottich mit Rohöl getaucht. Tess hat heute am Hinterausgang irgendeiner Küche fünf Noten gegen einen Eimer Zwergschweineblut eingetauscht. Ich habe es mir auf die Arme und ins Gesicht geschmiert. Als Letztes, um den Look perfekt zu machen, habe ich mir Schlamm auf die Wangen gerieben.
Das Krankenhaus nimmt die unteren zwölf Etagen des Gebäudes ein, aber mich interessiert nur eine einzige, die, auf der es keine Fenster gibt. In der dritten Etage befindet sich ein Labor, in dem Blutproben und Medikamente lagern. Von außen betrachtet, ist das Stockwerk komplett hinter aufwendigen Steinreliefs und ausgeblichenen Republikflaggen verborgen. Hinter der Fassade gibt es weder Flure noch Türen – bloß einen einzigen, gigantischen Raum voller Ärzte und Krankenschwestern mit weißem Mundschutz, Reagenzgläser und Pipetten, Brutschränke und Bahren. Ich weiß das, weil ich schon einmal dort gewesen bin. Es war der Tag, an dem ich durch den Großen Test gefallen bin, der Tag, an dem ich sterben sollte.
Meine Augen suchen die Seitenwand des Hochhauses ab. Manchmal gelingt es mir, in ein Gebäude einzubrechen, indem ich von außen daran hochklettere, wenn es Balkone gibt und ich von einem zum anderen springen kann oder Fensterbänke, um darüberzubalancieren. Einmal bin ich in fünf Sekunden ein vierstöckiges Gebäude hochgeklettert. Aber das Krankenhausgebäude ist zu glatt, es bietet keinerlei Halt für meine Füße. Ich werde mich von innen bis zum Labor durchschlagen müssen. Obwohl es warm ist, läuft mir ein Schauer über den Rücken und ich wünschte, ich hätte Tess mitgenommen. Aber zwei Eindringlinge sind leichter zu schnappen als einer. Außerdem ist es ja nicht ihre Familie, die Medikamente braucht. Ich vergewissere mich, dass mein Anhänger unter meinem T-Shirt versteckt ist.
Ein Militärtransporter hält hinter den Jeeps. Ein paar Soldaten steigen aus und grüßen die Schwestern, während andere Kisten aus dem Wagen laden. Der Befehlshaber der Gruppe ist ein dunkelhaariger junger Mann, der, bis auf die zwei goldenen Knopfreihen an seiner Offiziersjacke, ganz in Schwarz gekleidet ist. Ich spitze die Ohren, um zu hören, was er zu einer der Krankenschwestern sagt.
»… aus der Gegend um das Seeufer herum.« Der Mann zieht seine Handschuhe straff. Ich erhasche einen Blick auf die Waffe an seinem Gürtel. »Meine Männer werden heute Nacht die Eingänge bewachen.«
»Ja, Captain.« Die Schwester nickt.
Der Mann tippt sich an die Mütze. »Mein Name ist Metias. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich an mich.«
Ich warte, bis sich die Soldaten um das Krankenhaus verteilt haben und der Mann namens Metias in ein Gespräch mit zweien seiner Männer vertieft ist. Ein paar weitere Krankenwagen fahren vor, liefern Soldaten ein und verschwinden wieder. Manche der Männer haben gebrochene Gliedmaßen, andere Platzwunden am Kopf oder Schnitte an den Beinen. Ich hole tief Luft, dann trete ich aus dem Schatten und stolpere auf den Eingang des Krankenhauses zu.
Eine Krankenschwester entdeckt mich als Erste, kurz vor dem Haupteingang. Ihr Blick wandert zu dem Blut auf meinen Armen und meinem Gesicht.
»Könnt ihr mich aufnehmen, Cousine?«, rufe ich ihr zu. Ich stöhne vor gespielten Schmerzen. »Habt ihr noch Platz für mich? Ich bezahle auch.«
Sie sieht mich völlig ungerührt an und kritzelt dann weiter in ihrem Notizbuch herum. Sieht aus, als hätte ich mir das vertrauliche Cousine auch sparen können. Um ihren Hals baumelt ein Ausweis. »Was ist passiert?«, fragt sie.
Ich krümme mich vornüber, als ich bei ihr ankomme, und stütze meine Hände auf die Knie. »Bin in einen Kampf geraten«, keuche ich. »Ich glaub, ich hab ’nen Messerstich abbekommen.«
Die Krankenschwester würdigt mich keines zweiten Blickes. Sie schreibt zu Ende und nickt dann einem der Wächter zu. »Durchsuchen Sie ihn.«
Ich bleibe reglos stehen, als zwei Soldaten mich nach Waffen durchsuchen. Jedes Mal, wenn sie meine Arme oder meinen Bauch berühren, stöhne ich glaubwürdig auf. Sie finden die Messer nicht, die ich in meinen Stiefeln versteckt habe. Aber sie nehmen mir die kleine Geldbörse ab, die an meinem Gürtel hängt, der Preis dafür, dass sie mich ins Krankenhaus lassen. Natürlich.
Wäre ich ein Junge aus einem der stinkreichen Sektoren, hätten sie mich ohne Bezahlung aufgenommen. Oder sie hätten mir kostenlos einen Arzt direkt nach Hause geschickt.
Als die Soldaten der Krankenschwester mit erhobenen Daumen grünes Licht geben, deutet sie auf die Eingangstür. »Das Wartezimmer ist auf der linken Seite. Setzen Sie sich da hin.«
Ich danke ihr und stolpere auf die elektrischen Schiebetüren zu. Der Mann namens Metias mustert mich, als ich an ihm vorbeigehe. Er hört geduldig einem seiner Soldaten zu, aber ich bemerke, wie er, offenbar aus Gewohnheit, mein Gesicht studiert. Auch ich präge mir sein Gesicht ein.
Das Innere des Krankenhauses ist gespenstisch weiß. Links von mir sehe ich das Wartezimmer, genau wie die Krankenschwester gesagt hat – ein riesiger Bereich voller Menschen mit Verletzungen jeder Art und Größe. Viele von ihnen stöhnen vor Schmerzen – einer liegt reglos auf dem Fußboden. Ich will gar nicht darüber nachdenken, wie lange einige wohl schon hier warten oder wie viel sie bezahlen mussten, um überhaupt reingelassen zu werden. Ich merke mir, wo die Soldaten stehen – zwei Mann vor der Anmeldung, zwei weiter hinten an der Tür zum Ärztebereich und ein paar bei den Aufzügen, jeder von ihnen trägt einen Dienstausweis –, dann senke ich den Blick zu Boden. Ich schlurfe zum nächsten Stuhl und setze mich hin. Ausnahmsweise mal kommt mir mein kaputtes Knie ganz gelegen. Um dem Bild den letzten Schliff zu verpassen, presse ich mir noch beide Hände in die Seite.
Im Kopf zähle ich zehn Minuten ab, in denen neue Patienten hinzukommen und die Soldaten das Interesse an mir verlieren. Dann stehe ich auf, humpele ein Stück und wanke dann auf den Soldaten zu, der mir am nächsten steht. Seine Hand wandert automatisch zu seiner Waffe.
»Setzen Sie sich wieder hin«, befiehlt er.
Ich stolpere und taumele gegen ihn. »Ich muss mal«, krächze ich mit heiserer Stimme. Meine Hände zittern, als ich mich Halt suchend an seinen schwarzen Umhang klammere. Der Soldat blickt mich angewidert an, während ein paar seiner Kollegen schadenfroh kichern. Ich sehe, wie seine Finger langsam zum Abzug seiner Pistole wandern, aber einer der anderen Soldaten schüttelt den Kopf. Im Krankenhaus wird nicht geschossen. Der Soldat schiebt mich von sich weg und deutet mit seiner Pistole zum anderen Ende des Gangs.
»Da drüben«, schnauzt er. »Wisch dir gefälligst den Dreck aus dem Gesicht. Und wenn du mich noch mal anfasst, jag ich dir ’ne Ladung Blei in den Hintern.«
Ich lasse ihn los und falle beinahe auf die Knie. Dann drehe ich mich um und stolpere auf die Toiletten zu. Meine Lederstiefel quietschen über die Bodenfliesen. Ich spüre die Blicke der Soldaten auf mir, bis ich die Toilettentür hinter mir zuziehe und abschließe.
Macht nichts. In ein paar Minuten werden sie mich wieder vergessen haben. Und der Soldat, an dem ich mich festgeklammert habe, wird sogar noch ein paar Minuten länger brauchen, um zu merken, dass sein Ausweis verschwunden ist.
Auf der Toilette angekommen, kann ich mit meiner Krankenmasche aufhören. Ich schaufele mir Wasser ins Gesicht und schrubbe, bis das Schweineblut und der Dreck größtenteils weg sind. Ich schnüre meine Stiefel auf und greife hinein, um meine Messer hervorzuholen, die ich in meinen Gürtel stecke. Dann ziehe ich die Stiefel wieder an. Als Nächstes knote ich das schwarze Hemd um meine Taille los, schlüpfe hinein und knöpfe es bis zum Hals zu. Dann nehme ich meine Haare zu einem straffen Pferdeschwanz zusammen und stopfe sie in meinen Hemdkragen, sodass sie platt auf meinen Rücken gepresst sind.
Als Letztes ziehe ich meine Handschuhe an und binde mir das schwarze Taschentuch über Mund und Nase. Wenn mich jetzt jemand erwischt, muss ich sowieso die Beine in die Hand nehmen. Also kann ich genauso gut gleich mein Gesicht verbergen.
Als ich fertig bin, benutze ich die Spitze eines meiner Messer, um die Abdeckung des Lüftungsschachts zu öffnen. Dann hole ich den Ausweis des Soldaten hervor, klemme ihn an die Schnur mit meinem Anhänger und krieche mit dem Kopf voran in den engen Tunnel.
Die Luft im Schacht riecht seltsam und ich bin froh über das Taschentuch vor meinem Gesicht. So schnell ich kann, robbe ich vorwärts. Der Tunnel ist vermutlich nicht breiter und höher als ein halber Meter. Jedes Mal, wenn ich mich vorwärtsziehe, muss ich die Augen schließen, mich zum Weiteratmen zwingen und mir versichern, dass die Metallwände nicht aufeinander zurücken. Es kann nicht mehr weit sein – keiner dieser Schächte führt in den dritten Stock. Ich muss es bloß bis in eins der Treppenhäuser des Krankenhauses schaffen, weg von den Soldaten im Erdgeschoss. Ich schiebe mich weiter. Ich denke an Edens Gesicht, an die Medizin, die er und John und meine Mutter brauchen werden, und an das merkwürdige rote X mit dem Strich mittendurch.
Ein paar Minuten später endet der Schacht. Ich spähe durch das Lüftungsgitter und erkenne in den schwachen Lichtstreifen Teile einer gewundenen Treppe. Das Treppenhaus ist makellos weiß, beinahe schön, und – vor allem – leer. Ich zähle im Kopf bis drei, dann hole ich mit beiden Armen aus, so weit es geht, und versetze der Schachtabdeckung einen kräftigen Stoß. Das Gitter fliegt heraus. Endlich kann ich das Treppenhaus, einen zylinderförmigen Raum mit hohen Gipswänden und winzigen Fenstern, in Gänze sehen. In seiner Mitte windet sich eine riesige Wendeltreppe nach oben.
Ab jetzt ist nicht mehr Vorsicht, sondern Schnelligkeit geboten. Los geht’s. Ich quetsche mich aus dem Schacht und stürme die Treppe hinauf. Auf halbem Weg halte ich mich am Geländer fest und stemme mich mit einem Satz auf die Treppenstufen über mir. Die Überwachungskameras müssen mich genau im Visier haben. Jeden Moment wird der Alarm losgehen. Zweiter Stock, dritter Stock. Die Zeit wird knapp. Während ich mich der Etagentür des dritten Stocks nähere, reiße ich den Ausweis des Soldaten von meiner Kette und bleibe gerade lange genug stehen, um ihn über den Scanner vor der Tür zu ziehen. Die Überwachungskameras haben nicht schnell genug Alarm ausgelöst, um die Treppenhaustüren zu verriegeln. Ein Klicken ertönt – und ich bin drin. Ich stoße die Tür auf.
Ich stehe in einem riesigen Raum – Krankenbahre reiht sich an Krankenbahre und unter Metalldeckeln brodeln Chemikalien. Ärzte, Schwestern und Soldaten sehen mich mit erschrockenen Gesichtern an.
Ich schnappe mir die erste Person, die ich sehe – einen jungen Arzt, der in der Nähe der Tür steht. Bevor auch nur einer der Soldaten seine Waffe auf uns richten kann, ziehe ich eins meiner Messer und halte es dem Mann an die Kehle. Die übrigen Ärzte und die Schwestern bleiben wie angewurzelt stehen. Ein paar von ihnen schreien.
»Wenn Sie schießen, treffen Sie ihn, nicht mich!«, rufe ich den Soldaten durch das Tuch vor meinem Mund zu. Ihre Waffen sind jetzt auf mich gerichtet. Der Arzt zittert in meinem Griff.
Ich drücke ihm das Messer fester an den Hals, achte jedoch darauf, seine Haut nicht zu verletzen. »Ich tue Ihnen nichts«, flüstere ich ihm ins Ohr. »Sagen Sie mir, wo die Seuchenmedikamente sind.«
Der Arzt gibt ein ersticktes Wimmern von sich und ich spüre, wie er zu schwitzen beginnt. Er deutet in Richtung der Kühlschränke. Die Soldaten zögern noch immer, aber einer von ihnen macht einen Schritt nach vorn.
»Lassen Sie den Doktor los!«, ruft er. »Nehmen Sie die Hände hoch.« Fast hätte ich gelacht. Der Soldat muss ein ganz frischer Rekrut sein.
Zusammen mit dem Arzt durchquere ich den Raum und bleibe vor den Kühlschränken stehen. »Zeigen Sie sie mir.« Der Arzt hebt eine zittrige Hand und öffnet die Kühlschranktür. Ein Schwall eisiger Luft schlägt uns entgegen. Ich frage mich, ob der Arzt wohl merkt, wie schnell mein Herz schlägt.
»Da«, flüstert er.
Ich lasse die Soldaten gerade lange genug aus den Augen, um zu sehen, dass die Hälfte der Flaschen im obersten Fach mit dem durchgestrichenen X gekennzeichnet ist: T. Filoviridae Virus-Mutationen. Die andere Hälfte trägt die Aufschrift 11,30Gegenmittel. Doch die Flaschen sind alle leer. Es ist nichts mehr übrig. Ich fluche gedämpft. Mein Blick huscht zu den anderen Fächern – dort stehen bloß allgemeine Seuchenhemmer und Schmerzmittel. Ich fluche abermals. Jetzt ist es zu spät, um einen Rückzieher zu machen.
»Ich lasse Sie jetzt los«, flüstere ich dem Arzt zu. »Ducken Sie sich.« Ich lockere meinen Griff und versetze ihm einen kräftigen Schubs, sodass er auf die Knie fällt.
Die Soldaten eröffnen sofort das Feuer. Aber darauf bin ich vorbereitet – ich verstecke mich hinter der geöffneten Kühlschranktür und höre, wie die Kugeln auf der anderen Seite abprallen. Ich grapsche nach ein paar Flaschen mit den allgemeinen Medikamenten und stopfe sie mir unters T-Shirt. Dann renne ich los. Eine der umherzischenden Kugeln streift mich und ein sengender Schmerz schießt meinen Arm hinauf. Ich bin fast am Ausgang.
Gerade als ich durch die Tür zum Treppenhaus stürze, heult eine Sirene los. Aus mehreren Richtungen höre ich Klickgeräusche, als sich die Türen von innen verschließen. Ich sitze in der Falle. Die Soldaten können durch jede Tür zu mir gelangen, aber ich kann nirgendwohin. Rufe und Schritte werden im Inneren des Labors laut. Jemand schreit: »Er ist getroffen!«
Mein Blick fliegt zu den winzigen Fenstern in den gipsverputzten Wänden des Treppenhauses. Sie sind zu weit weg, als dass ich sie von der Treppe aus erreichen könnte. Ich fletsche die Zähne und ziehe mein zweites Messer hervor, sodass ich jetzt in jeder Hand eins habe. Ich bete, dass der Gips weich genug ist, dann springe ich von der Treppe auf die Wand zu.
Ich ramme ein Messer in den Gips direkt über der Fensternische. Aus meinem verletzten Arm spritzt das Blut und ich schreie auf vor lauter Anstrengung. Ich baumele nun zwischen der Treppe und der Fensterscheibe in der Luft. So gut ich kann, schwinge ich ein paarmal vor und zurück.
Der Gips gibt langsam nach.
Hinter mir höre ich, wie die Labortür auffliegt und Soldaten herausströmen. Kugeln peitschen mir um die Ohren. Ich hole noch einmal Schwung, schieße mit den Füßen zuerst auf das Fenster zu und lasse im letzten Moment das Messer los, das in der Wand steckt.
Die Scheibe zerspringt und plötzlich bin ich wieder draußen in der Dunkelheit und ich falle und falle und falle wie eine Sternschnuppe in Richtung Erde. Ich reiße mein langärmliges Hemd auf, sodass es sich hinter mir aufbläht, während mir tausend Gedanken auf einmal durch den Kopf schießen. Knie anwinkeln. Mit den Füßen zuerst. Muskeln entspannen. Auf den Fußballen aufkommen. Abrollen. Der Boden kommt auf mich zugerast. Ich wappne mich.
Der Aufprall treibt mir die Luft aus den Lungen. Ich überschlage mich viermal und krache schließlich gegen die Mauer auf der anderen Straßenseite. Einen Moment lang bleibe ich liegen, blind und vollkommen hilflos. Über mir dringen wütende Stimmen aus dem Fenster im dritten Stock, als den Soldaten klar wird, dass sie nun erst zurück ins Labor müssen, um den Alarm abzuschalten. Meine Sinne werden langsam wieder schärfer – erst jetzt spüre ich die Schmerzen in meiner Seite und meinem Arm. Ich stemme mich mit meinem unversehrten Arm hoch und zucke zusammen. In meinem Brustkorb pocht es schmerzhaft. Wahrscheinlich habe ich mir eine Rippe gebrochen. Als ich aufstehen will, merke ich, dass ich mir auch einen Knöchel verstaucht habe. Ob der Adrenalinschub weitere Folgen meines Sturzes vor mir verbirgt, kann ich nicht sagen.
Auf der anderen Seite des Gebäudes erheben sich Stimmen. Ich zwinge mich, klar zu denken. Ich befinde mich fast auf der Rückseite des Krankenhauses und hinter mir führen mehrere Gassen in die Dunkelheit. Ich humpele in die Schatten.
Als ich einen Blick über die Schulter werfe, sehe ich eine kleine Gruppe von Soldaten zu dem Punkt eilen, an dem ich aufgekommen bin. Sie deuten auf die Glassplitter und Blutspuren. Einer von ihnen ist der junge Captain, den ich vor dem Krankenhaus gesehen habe, der Mann namens Metias. Er befiehlt seinen Männern auszuschwärmen. Ich laufe schneller und ignoriere die Schmerzen. Ich ziehe den Kopf zwischen die Schultern und hoffe, dass das Schwarz meiner Kleidung und Haare mich mit der Dunkelheit verschmelzen lässt. Mein Blick ist zu Boden gerichtet. Ich muss einen Gully finden.
Mein Sichtfeld beginnt, an den Rändern zu verschwimmen. Ich presse mir eine Hand aufs Ohr und taste nach Blut. Nichts – das ist ein gutes Zeichen. Ein paar Sekunden später erspähe ich einen Kanaldeckel vor mir auf der Straße. Mit einem erleichterten Seufzer ziehe ich das Taschentuch vor meinem Gesicht zurecht, dann bücke ich mich, um den Deckel anzuheben.
»Keine Bewegung. Bleiben Sie, wo Sie sind.«
Ich wirbele herum und sehe mich Metias, dem jungen Captain, gegenüber. Er hat seine Pistole genau auf meine Brust gerichtet, aber zu meinem Erstaunen drückt er nicht ab. Ich schließe die Hand fest um mein verbliebenes Messer. Irgendetwas in seinem Blick verändert sich und ich weiß, dass er mich erkannt hat als den Jungen, der sich mit einem vorgetäuschten Humpeln Zugang zum Krankenhaus verschafft hat. Ich lächele – jetzt hätte ich wohl genug echte Verletzungen, um dort aufgenommen zu werden.
Metias’ Augen werden schmal. »Hände hoch. Sie sind verhaftet wegen Diebstahls, Vandalismus und Hausfriedensbruchs.«
»Sie bekommen mich nicht lebend.«
»Tot wäre mir genauso recht, wenn Ihnen das lieber ist.«
Was als Nächstes passiert, ist wie ein einziges verschwommenes Gewirr. Ich sehe, wie Metias sich anspannt, um auf mich zu schießen. Ich schleudere mit aller Kraft mein Messer nach ihm. Bevor er abdrücken kann, trifft es ihn mit voller Wucht in die Schulter und er fällt mit einem dumpfen Aufprall hintenüber. Ich warte nicht, bis er wieder aufsteht, sondern bücke mich und hebe den Kanaldeckel an. Dann steige ich ein Stück die Leiter hinunter in die Dunkelheit und ziehe den Deckel wieder zurück auf die Öffnung des Schachts.
Jetzt holen mich meine Verletzungen ein. Ich humpele durch den Abwasserkanal, während mein Sichtfeld immer wieder zu einem zähen Nebel verschwimmt, und presse mir eine Hand in die Seite. Ich achte sorgsam darauf, nicht die Wände zu berühren. Jeder Atemzug tut weh. Ich muss mir eine Rippe gebrochen haben. Ich bin genug bei Bewusstsein, um mir darüber Gedanken zu machen, wo ich eigentlich hinlaufe, und konzentriere mich darauf, mich in Richtung des Lake-Sektors zu bewegen. Tess ist dort. Sie wird mich finden und mir helfen, mich in Sicherheit zu bringen.
Über mir meine ich, Schritte und die Stimmen von Soldaten zu hören. Sicherlich hat inzwischen irgendjemand Metias gefunden und vielleicht sind sie mir sogar hier runter in die Kanalisation gefolgt. Gut möglich, dass sie mir mit einer Meute Hunde auf den Fersen sind. Ich beschließe, ein paarmal abzubiegen und im dreckigen Kanalisationswasser weiterzulaufen. Hinter mir höre ich platschendes Wasser und das Echo von Stimmen. Ich biege noch einige Male ab. Die Stimmen kommen ein bisschen näher, dann werden sie wieder leiser. Ich konzentriere mich mit aller Kraft auf die ursprüngliche Richtung, die ich eingeschlagen hatte.
Das wäre wirklich eine ziemliche Ironie des Schicksals – aus dem Krankenhaus entkommen zu sein, nur um dann hier unten in diesem stinkenden Abwasserlabyrinth zu sterben.
Ich zähle die Minuten, um nicht ohnmächtig zu werden. Fünf Minuten, zehn Minuten, dreißig Minuten, eine Stunde. Die Schritte hinter mir scheinen jetzt weit entfernt, so als hätten sie einen anderen Weg eingeschlagen als ich. Hin und wieder höre ich seltsame Geräusche wie ein blubberndes Reagenzglas oder das Seufzen einer Dampfleitung, wie ein Luftzug. Es kommt und geht. Zwei Stunden. Zweieinhalb Stunden. Bei der nächsten Leiter, die an die Oberfläche führt, setze ich alles auf eine Karte und ziehe mich hoch. Ich bin jetzt kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren. Es kostet mich den Rest meiner Kraft, mich hinauf auf die Straße zu hieven. Ich bin in einer dunklen Gasse. Als ich wieder ein wenig zu Atem gekommen bin, blinzele ich die Benommenheit weg und studiere meine Umgebung.
In ein paar Blocks Entfernung sehe ich den Bahnhof Union Station. Jetzt ist es nicht mehr weit. Tess wird da sein und auf mich warten.
Noch drei Blocks. Noch zwei Blocks.
Noch einen Block muss ich weiter. Aber ich kann nicht mehr. Ich suche mir eine dunkle Ecke in einer Seitenstraße und breche zusammen. Das Letzte, was ich sehe, ist der Umriss eines Mädchens in der Dunkelheit. Vielleicht kommt sie auf mich zu. Ich rolle mich zusammen und dämmere langsam weg.
Kurz bevor ich das Bewusstsein verliere, merke ich, dass die Kette um meinen Hals verschwunden ist.
JUNE
Ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag, an dem mein Bruder seine Aufnahmezeremonie beim Militär der Republik verpasste.
Es war ein Sonntagnachmittag. Heiß und staubig. Braune Wolken überzogen den Himmel. Ich war sieben Jahre alt und Metias neunzehn. Mein weißer Schäferhundwelpe Ollie schlief auf den kühlen Marmorfliesen unserer Wohnung. Ich lag mit Fieber im Bett und Metias saß mit sorgenvoll gerunzelter Stirn neben mir. Draußen konnten wir die Lautsprecher hören, aus denen das Nationalgelöbnis der Republik dröhnte. Als der Teil kam, in dem unser Staatsoberhaupt erwähnt wird, stand Metias auf und salutierte in Richtung Denver, unserer Hauptstadt. Elektor Primo hatte gerade eine weitere vierjährige Amtsperiode angetreten. Seine elfte.
»Du musst nicht hier bei mir sitzen«, sagte ich zu Metias, als das Gelöbnis zu Ende war. »Geh ruhig zu deiner Aufnahmefeier. Ich bin so oder so krank.«
Metias überging meine Worte und legte mir ein frisches feuchtes Tuch auf die Stirn. »Und ich werde so oder so aufgenommen«, erwiderte er. Dann steckte er mir ein Stück Blutorange in den Mund. Ich weiß noch, wie ich ihm dabei zusah, als er sie für mich schälte; er machte einen langen, wohlplatzierten Schnitt in die Schale und entfernte sie dann in einem einzigen Stück.
»Aber was ist mit Commander Jameson?« Ich blinzelte mit geschwollenen Augen. »Sie hat dir einen Gefallen damit getan, dass sie dich nicht an die Front geschickt hat … Sie ist bestimmt böse auf dich, wenn du die Feier schwänzt. Gibt das keinen Vermerk in deiner Akte? Du willst doch wohl nicht rausgeworfen werden wie irgendein Versager von der Straße.«
Metias tippte mir tadelnd mit dem Zeigefinger auf die Nase. »So sollst du nicht über die Leute reden, Junebug. Das gehört sich nicht. Und sie kann mich ja wohl kaum aus ihrer Einheit werfen, nur weil ich die Feier verpasst habe. Außerdem«, fügte er dann mit einem Augenzwinkern hinzu, »könnte ich mich jederzeit in ihre Datenbank einhacken und meine Akte bereinigen.«