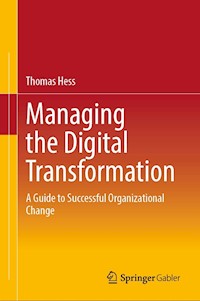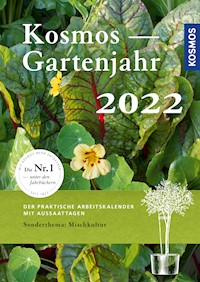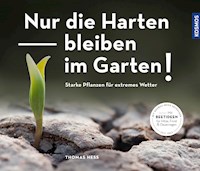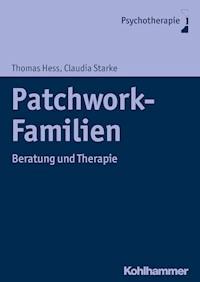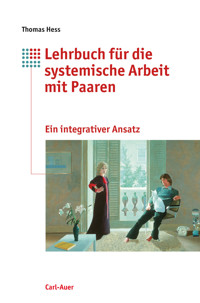
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Das Buch als Fundgrube zu bezeichnen wäre Untertreibung – es ist eher einem reichhaltigen Fundus vergleichbar. Über Jahre hinaus wird es ein Standardwerk systemischer Arbeit mit Paaren bleiben, und es wird dafür sorgen, dass die systemische Therapie ein ernstzunehmender Dialogpartner im Gespräch mit anderen Richtungen bleibt." Arist von Schlippe "Dieses durch und durch exakt strukturierte Lehrbuch für die systemische Arbeit mit Paaren verbindet sehr hilfreich alltags- und praxisnahe Gesichtspunkte mit wissenschaftlichen Aspekten. Die Bandbreite der behandelten Themen ist beeindruckend. Ein Lehrbuch, das überaus gewinnbringend ist: sowohl für die theoretische Auseinandersetzung als auch für die praktische Umsetzung." Detlef Rüsch Integrieren, was funktioniert Paarberatung stellt für Therapeuten vor allem deshalb eine besondere Herausforderung dar, weil es den Partnern meist schwer fällt, jahrelang eingeübte Muster durch neue zu ersetzen. Solche Muster prägen auch das Gespräch mit Beratenden: Die schnellen Wechsel von Themen und Ebenen oder die Konkurrenz um Anteile an Redezeit führen dazu, dass es oft nur unter hohem Strukturierungsaufwand möglich ist, den Therapieprozess zu steuern. Dieses Lehrbuch unterstützt Berater und Therapeuten dabei, sich im Beratungsprozess zurechtzufinden, indem es eine große Bandbreite an Betrachtungsweisen – es werden acht Orientierungsebenen unterschieden – und Strukturierungsmöglichkeiten bietet. Es ermutigt dazu, alles zu kombinieren, was funktioniert: Methoden und Techniken aus zahlreichen Therapieschulen sowie aus der Mediation. Der Aufbau des Praxisteiles entspricht der Professionalisierung von Beratern: Beratungshaltung, Beratungsoptik, beraterisches Handeln und Qualitätssicherung. Theoretisch orientiert sich Thomas Hess an der wieder entdeckten "Psychologie der persönlichen Konstrukte" von G. A. Kelly. Seine Erfahrungen sammelte er als Dozent und Supervisor am IEF (ehemals: Institut für Ehe und Familie) in Zürich. Der Autor: Thomas Hess, Dr. med., Kinder- und Jugendpsychiater, Paar- und Familientherapeut, Supervisor, Organisationsberater, Mediator und Klärungshelfer; nach Tätigkeit als Chefarzt einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Ambulanz 1993–1999 Leiter des IEF (Institut für Ehe und Familie, seit 1999: Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung) in Zürich. Seither in freier Praxis und als Trainer in Weiterbildungen für Systemtherapie mit dem Schwerpunkt Patchworkfamilien tätig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 731
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carl-Auer
Umschlaggestaltung: WSP Design, Heidelberg
Umschlagbild: David Hockney, ”Mr. and Mrs. Clark and Percy“, 1970/71,
Acryl auf Leinwand, 84 × 120, © David Hockney
Redaktion: Uli Wetz
Satz: Verlagsservice Hegele, Heiligkreuzsteinach
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Vierte, ergänzte Auflage, 2025
ISBN 978-3-8497-0591-6 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8516-1 (ePub)
© 2006, 2025 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/.
Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +4962216438-0 • Fax +4962216438-22
Vorwort zur vierten Auflage
Nach mehr als 20 Jahren und ca. mehreren Dutzend neuen Büchern über Paarberatung oder -therapie findet dieses Buch immer noch Leserinnen und Leser.
Auf die Frage des Carl-Auer Verlags, ob ich noch immer hinter dem Text stehen könne, antworte ich wie folgt:
Mit Sicherheit würde ich heute kein Buch mit einem solchen Umfang mehr schreiben. Kurz, stichwortartig, ohne Literaturhinweise und Zitate ist heute gefragt. Dafür mit Genderstern versehen.
Bezüglich des Inhalts bin ich immer noch der Meinung, dass es unnötig ist, eine bestimmte Therapierichtung zu vertreten, noch eine bestimmte Methode anzuwenden oder ein Vorgehen eines Gurus zu imitieren, um erfolgreich mit Paaren arbeiten zu können. Es ist gut, einiges über Menschen und Beziehungen zu wissen, und es hilft, wenn man eine Sitzung mit zwei Partnern strukturieren kann. Aber jede und jeder muss herausfinden, mit welchem Mix an Methodenbausteinen sie oder er erfolgreich ist.
Nach wie vor ist die Arbeit an Paarbeziehungen etwas sehr Herausforderndes. Was sich verschoben hat, sind die Dynamiken der Paare: Da Trennungen viel schneller erfolgen und der Wechsel zu neuen Partnern noch viel einfacher geht als vor 20 Jahren, sind die Paarthemen oft überlagert durch Komplikationen mit den Kindern aus früheren Partnerschaften, also mit Patchworkfamilien-Themen.
Der zweite Wandel ist folgender: Frauen haben heute höhere Erwartungen an eine Partnerschaft und fordern diese auch ein. Sie suchen weniger den Fels in der Brandung, der für das Einkommen sorgt und bei den Kindern erzieherisch durchgreift, wenn sie selbst nicht mehr klarkommen, sondern fordern emotionale Nähe ein. Das ist an sich gut so, nur sind viele Partner dieser Frauen überfordert, verstehen nicht, was das sein soll, weil ihre eigene Sozialisierung Gefühle eher unterband als förderte. Und zwar nicht nur die älteren Männer. Sie verstehen nicht, weshalb die Partnerin nun die ganze bisherige glückliche gemeinsame Zeit schlechtredet, und verharren in trotziger oder hilfloser Sprachlosigkeit. Solche Paare zu therapieren ist anspruchsvoll.
Und zuletzt noch ein Wort zu George A. Kelly, den ich als Erfinder der Systemtherapie portierte: Nach wie vor bin ich der Ansicht, dass es zwischen Menschen zwar Ähnlichkeiten gibt, aber die Unterschiede größer sind und dass man dem mit einem psychologischen Verständnis, das jedem Individuum zugesteht, im Laufe des Lebens seine ganz private psychische Struktur aufzubauen, am besten gerecht wird. Und dies ist der Kerngedanke von Kelly. Auch seinen Verzicht auf diagnostische Schubladen halte ich für wichtig in der Therapiearbeit.
Dank
Als Erstes gebührt den Klientinnen und Klienten Dank. Sie erlaubten, Teile ihrer Geschichten – entsprechend anonymisiert – als Fallbeispiele zu verwenden. Dazu kommen Kolleginnen und Kollegen, die sich in Gesprächen und Intervisionsgruppen mit dem aufkeimenden Konzept auseinandersetzten, und schließlich all diejenigen, die Entwürfe – oft sprachliche Zumutungen – lasen, ergänzten, hinterfragten oder korrigierten. Es waren dies folgende Fachleute mit verschiedenen beraterischen Erfahrungen: Maya Cajöri, Claudia Farley-Hess, Brigitte Lachelier, Hansjürg Lusti, Corinna Merz und Susanne Quistorp. Für die fachkundige Sichtung einzelner Kapitel oder Textstellen danke ich Caroline Bono und Cristina Diday für das Kapitel über Mediation, Elisabeth Dietzfelbinger und Christiane Giese zur deutschen Gesundheitspolitik, Andrea Brandl-Nebahay zur berufspolitischer Situation der Systemtherapie in Österreich und Guido Mattanza zur derzeitigen Lage in der schweizerischen Berufspolitik bezüglich der Psychotherapie. Korrekturlesungen leisteten Yvonne Belviso und Sibylle Körsgen. Allen diesen Helferinnen und Helfern möchte ich herzlich danken. Für den Epilog dieser Auflage habe ich noch Lukas Hess zu danken. Er half mir, beim Thema Künstliche Intelligenz auf den aktuellen Stand zu kommen. Außerdem bin ich Claudia Starke für Ihre wertvollen Anregungen für den Epilog dankbar. Ralf Holtzmann vom Carl-Auer Verlag unterstützte mich von Anfang bis heute stets ressourcenorientiert und professionell.
Männedorf (Schweiz), Januar 2025
Thomas Hess
Einleitung
„Früher, in höflichen Zeiten, war es Brauch, daß man sich entschuldigte, wenn man die Zahl der vorhandenen Bücher um eines vermehrte. Aber dann folgte gleich die Begründung, warum man sich eigentlich gar nicht zu entschuldigen brauchte. Das neue Werk war dazu bestimmt, eine Lücke zu schließen. Es erfand eine Lücke, dann sprang es hinein, und jedesmal wiederholte sich das Wunder: Die Lücke wurde dicht“ (Muschg 1967, S. 13).
Die Entschuldigung werden wir weglassen, aber die Lücken wollen wir Ihnen hier aufzeigen, damit wir sie auf den folgenden Seiten schließen können.
Die Paarberater sind heute mit einer anderen Klientel konfrontiert, als in früheren Büchern beschrieben. Die Partnerschaften führen zu neuen Herausforderungen. Es geht oft nicht mehr nur darum, eine Partnerschaft zu verbessern. Häufiger stellt sich die Frage, ob ein Paar überhaupt zusammenbleiben will. Damit steht immer auch die persönliche Entwicklung der beiden Partner unabhängig vom jeweils anderen im beraterischen Fokus. Die Grenzen zwischen Einzeltherapie und Paarberatung müssen neu gezogen oder aufgehoben werden. Das Rüstzeug, das Paar- und Familienberater bzw. Systemtherapeuten in der Aus- oder Weiterbildung beziehen, reicht für viele Paare nicht mehr aus. Die Klienten drücken ihre Unzufriedenheit mit der Beratung bzw. Therapie selten deutlich genug aus, oder es fehlt ihnen die Energie, einen zweiten oder dritten Berater auszutesten, bevor sie resignieren. Viele davon bleiben als Beratungsleichen auf der Strecke. Die Beraterinnen ihrerseits kämpfen zu einsam. Sie blicken zu wenig über die Zäune, um zu sehen, wie Kollegen aus anderen Therapieschulen eine Situation angehen. Die erste Lücke wird also dann geschlossen sein, wenn Beratern hier Mut gemacht wird, andere Methoden kennen zu lernen, mit Fachkolleginnen anderer Schulen auszutauschen, Techniken auszuleihen, sich nötigenfalls Hilfe zu holen oder Klienten abzugeben, wenn der Beratungsprozess ins Stocken geraten ist.
In systemischen Paartherapien ist oft ein Strukturmangel zu beobachten, welcher mit der Entwicklung der Systemtherapie in den letzten 20 Jahren erklärt werden kann. In den Zeiten der strukturellen Familientherapie der 1970er-Jahre war der Therapeut noch für alles allein zuständig. Er setzte fest, wie viele Sitzungen einzuhalten seien. Er strukturierte den Prozess. Er wusste, was die Klienten falsch machten. Er sagte ihnen, wie sie sich zu verändern hätten. Konstruktivismus und lösungsorientierte Kurzzeittherapien haben uns zwar von dieser Arroganz erlöst, doch das Kind wurde mit dem Bade ausgeschüttet. Heute wird den Klienten oft zu viel Verantwortung übergeben, weil viele Systemtherapeuten in ihrer Zurückhaltung zu weit gehen und sich durch die Klienten nicht nur die Inhalte, sondern auch die Struktur vorgeben lassen. Andere Therapierichtungen, die sich mit Paarberatung auseinander setzen, sind entweder hochgradig oder sehr wenig strukturiert. Der Grad der Strukturierung sollte aber nicht von der Ausbildung des Beraters oder Therapeuten abhängen, sondern von den Klienten. So viel zur zweiten Lücke.
Eine Menge Literatur zu Paar- und Familientherapie blendet Aspekte aus, die in der Einzeltherapie unter dem Blickwinkel der Psychopathologie abgehandelt werden. Deshalb stehen im Angebot Paartherapien für gesunde Menschen mit Beziehungsproblemen und Einzeltherapien für psychisch Kranke. Eine Überschneidung gibt es kaum. Damit wird suggeriert, Paarberatung finde mit Klienten statt, die psychisch unauffällig seien. Diese Diskrepanz hat mit der Beratungshaltung – ob defizitorientiert oder ressourcenorientiert – zu tun. Keine dieser Haltungen ist schlecht, aber sie sind untereinander inkompatibel. Es fehlen bis heute verbindende Ansätze. Dies führt bei Paarberatern zu Berührungsängsten, wenn einer der Partner Verhaltensweisen zeigt, die in eine Kategorie von psychischer Störung passen. Es entsteht die Tendenz, eine zusätzliche Einzeltherapie zu empfehlen. Die Schnittstelle der beiden unverträglichen Paradigmen zu überbrücken wird dadurch dem Klientensystem überlassen. Außerdem führt dies dazu, dass in einer einzigen Familie oft mehrere Beraterinnen oder Berater tätig sind: Die Eltern lassen sich einzeltherapeutisch behandeln, für ihre gemeinsamen Probleme nutzen sie eine Paartherapie, und eines oder mehrere Kinder werden in eine Spieltherapie oder Jugendberatung geschickt. Das dritte Ziel des Buches soll folgerichtig sein, die Beraterinnen und Therapeuten so weit zu professionalisieren und zu ermutigen, dass sie miteinander verknüpfte Prozesse in die eigenen Hände nehmen können. Dadurch werden Leerläufe, heimliche Konkurrenzierungen und Komplikationen verhindert, die sonst höchstens in aufwändigen Helferkonferenzen in Grenzen gehalten werden können.
Bisher ist kein neueres deutschsprachiges Lehrbuch auf dem Markt, das einen repräsentativen Überblick über die derzeitige Paarberatungslandschaft bietet. Die Legitimation, die Zahl der Fachbücher um eines zu erhöhen, so scheint uns, ist also gegeben.
Das Buch richtet sich hauptsächlich an Beraterinnen und Therapeuten1, die mit Paaren arbeiten oder es lernen wollen. Dies können Paartherapeuten und -beraterinnen, Mediatoren, Familientherapeutinnen und -berater, aus welcher therapeutischen Schule sie auch immer kommen, sein.
Wir haben uns bemüht, in einer Alltagssprache zu schreiben. Bei Bedarf werden Begriffsklärungen in Kästen beigefügt. Auch wissenschaftliche Nebenschauplätze sind in solche Kästen gesetzt; hier konnte nicht immer auf die entsprechende Fachsprache verzichtet werden. Um der Vielschichtigkeit und dem Abstraktionsniveau Kellys beizukommen, waren lange Diskussionen zwischen N. B. und T. H. nötig. Einige Ausschnitte davon wurden in den Text übernommen, da sie zur Verständlichkeit einiges beitragen können. Diese Diskussionen werden im praktischen Teil wieder aufgegriffen, um Beraterinnen nichtsystemischer Richtung den Anschluss an die spezifisch systemische Sicht- und Denkweise zu erleichtern.
Die Fallgeschichten werden vor allem aus den subjektiven Perspektiven der Klienten und des Beraters dargestellt, denn sowohl die heutigen Systemiker als auch Kelly gehen davon aus, dass es keine objektive Sichtweise gibt. Die Dialoge wurden aufgrund der Beratungsunterlagen nachkonstruiert und angemessen anonymisiert.
Zusammenfassungen am Ende der Kapitel und eine große Zahl von Querverweisen sollen dem Leser ermöglichen, bei jenem Kapitel zu beginnen, das ihn besonders interessiert.
Das Dilemma einer gerechten Verteilung von weiblichen und männlichen sprachlichen Bezeichnungen wurde gelöst, indem beide Formen kapitelweise abwechselnd zum Zug kommen. Um den Text doch lesbar zu halten, wird bei Aufzählungen zur Auflockerung dem je anderen Geschlecht doch Einlass in den Text gewährt. Bei jeder anderen Form könnte den AutorInnen (und dieses ist das einzige Mal, wo wir diese hässliche Form des erigierten „I“ verwenden) eine unbewusste Auswahl unterlaufen.
1Die Begriffe Beratung und Therapie werden nicht unterschieden, da die Abgrenzung heute keine inhaltliche, sondern mehr eine berufspolitische ist (vgl. Abschn. 2.1.2).
Prolog: Annäherungen an Liebe und Partnerschaft
„Was ist die Liebe? Ich habe zwar jedes Wort gelesen, das gewisse selbst ernannte Weise über ihre Natur geschrieben haben, ich habe mit zunehmendem Alter immer mehr darüber philosophiert, aber ich werde nie akzeptieren, daß sie etwas Unwichtiges oder Eitles sein soll. Sie ist eine Art Wahnsinn, über den Philosophie keine Macht hat; eine Krankheit, die den Menschen in jeder Phase seines Lebens befallen kann; wenn sie ihn im Alter ereilt, ist sie sogar unheilbar. Unbeschreibliche Liebe! Göttin der Natur! Nichts ist süßer als ihre Bitternis, nichts ist bitterer als ihre Süße! Göttliches Monster, das sich nur mit Paradoxen beschreiben lässt!“ (Casanova 1999, S. 7).
Liebe zu beschreiben ist ein schwieriges Unterfangen. Jeder Mensch erlebt sie anders, definiert sie auf seine eigene Art und Weise. Möglich, dass in anderen Kulturen Liebe etwas ganz anderes ist als in unseren Vorstellungen. Für den größten Teil der westlichen Welt trifft es aber wohl zu, dass Liebe an die grundlegende Spannung zwischen dem Wunsch nach Verschmelzung und demjenigen nach Unabhängigkeit rührt. Liebe wird assoziiert mit Glück, Leidenschaft, Sehnsucht, Erfüllung und Sichverstehen, aber auch mit Opferbringen, Abhängigkeit, Trennung und Schmerz.
Wie der Einzelne die Liebe erlebt, ist das eine; das von Medien, Kino und Werbung verbreitete Liebeskonzept etwas anderes. Gerken und Konitzer nennen es das romantische Liebeskonzept. Es hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts gegen die materielle Liebe durchgesetzt.
„Die romantische Ideologie – die heute am weitesten verbreitete Liebesideologie – hat ein ganz anderes Credo: ‚Verschmelzung mit dem Schicksal und Verschmelzung gegen das Schicksal‘. Das schließt die fixe Idee ein, daß einem, wenn man nur die richtige Frau, den richtigen Mann findet, fast nichts mehr passieren kann. Ob das klappt, darüber entscheidet nur das Schicksal.
Das Konzept der romantischen Liebe ist eine absolut verkitschte Ideologie. Vertrautheit, Sex und Treue – alles soll hier zu 100 Prozent erfüllt werden. Wer schafft das, wer hält das aus? Absolute Vertrautheit, glühende Leidenschaft, totale sexuelle Erfüllung und hundertprozentige Treue – und das ein Leben lang? Die logischen Konsequenzen sind Streß und Bigotterie, zunehmende Scheidungsraten und wachsende Gewinnmargen für Psychologen und Paartherapeuten“ (Gerken u. Konitzer 1995, S. 56).
Auch Dechmann und Ryffel (2001) sehen partnerschaftliche Enttäuschungen und Schwierigkeiten auf dem Hintergrund des romantischen Liebeskonzeptes (S. 89). Es sind jedoch nicht nur die überhöhten Erwartungen, die manche Beziehungen scheitern lassen. Damit die Beziehung zu einer reifen Partnerschaft heranwachsen kann, ist nicht nur die Liebe ausschlaggebend, sondern auch der familiäre und gesellschaftliche Hintergrund. War und ist dieser wachstumsfördernd, sind die Voraussetzungen günstiger. Erzwingen lässt sich Liebe jedoch auch dadurch nicht.
Mit wenigen Ausnahmen geht es in Sachbüchern kaum je um die Liebe, ja nicht einmal, wenn es sich um ein Buch über Paarberatung handelt. Noch bedenklicher ist, dass es viele dieser Bücher unterlassen, darauf hinzuweisen, wie klein und ohnmächtig Beratende vor der Unergründlichkeit der Liebe stehen, die sie nur pflegen und hegen, nie aber herbeiführen oder wieder erwecken können.
Partnerschaft ist die pragmatische Seite der Liebe, der ernüchternde Folgezustand. Partnerschaft ist Synergie, Tauschhandel, gegenseitige Entwicklungshilfe und auch Unterstützung. Sie ist Alltag, Routine, Organisation und Durchhalten. Partnerschaft muss von Liebe getragen sein, sonst verkommt sie zu Konkurrenz, Machtkampf, Egoismus und Frustration oder läuft auf Hoffen, Abwarten, Ausweichen, Sichverpassen, Einsamwerden und Resignieren hinaus.
Viele Paare finden ihr gemeinsames Glück, leben 20, 30 oder 50 Jahre zusammen. Andere suchen Hilfe, erhalten sie und sind zufrieden mit dem Angebot. Nach ein, zwei Sitzungen finden sie zurück zu ihren Ressourcen. Sie haben ein neues Gleichgewicht gefunden. Als Berater habe ich vor beidem Hochachtung. Von den verbleibenden Paaren wird im Folgenden die Rede sein. Was macht aber den Unterschied aus, dass die einen Paare nach drei Monaten aufgeben, andere 50 Jahre zusammenleben?
Die Struktur wissenschaftlicher Revolution nach Kuhn (1976)
Die Revolution umfasst vier Phasen:
Die normale Wissenschaft ist geprägt durch die Bemühungen, das in einem bestimmten Wissenschaftsbereich bestehende Paradigma2 zu bestätigen, die zugrunde liegende Theorie zu erweitern und zu differenzieren. Abweichungen werden durch geeignete Maßnahmen wegkontrolliert oder als Folge ungenauer Messungen interpretiert.
Anomalien und das Auftauchen wissenschaftlicher Entdeckungen: In dieser Phase erhalten Anomalien mehr Beachtung. Es werden Ausnahmen von der Anwendbarkeit der Theorie gefunden und beschrieben. Das Interesse der Forschung gilt nun diesen Abweichungen. Es werden Beweise zusammengetragen, welche die Begrenzung oder gar Ungültigkeit der Theorie belegen.
Krisen und das Auftauchen alternativer Theorien: Nun werden sich die Wissenschaftler dessen bewusst, dass eine Krise eingetreten ist, d. h., dass für einen Forschungsbereich verschiedene konkurrierende Theorien, aber keine allgemein anerkannte zur Verfügung stehen. Kuhn spricht von „Wucherung von Versionen einer Theorie“.
Die Reaktion auf die Krise: Jetzt folgt die Geburt einer neuen Theorie oder die Einigung des Wissenschaftsbetriebes auf eine der verschiedenen konkurrierenden Theorien. Daraufhin beginnen die Forscher erleichtert, der nun anerkannten neuen Theorie zum Durchbruch zu verhelfen, indem sie bestätigende Experimente und Beweisführungen durchführen. Der Kreislauf beginnt von vorne.
Liebesbeziehungen und Partnerschaften sind einem Entwicklungsprozess unterworfen. Dieser kann zu einer intensiven reifen Partnerschaft führen oder in der Trennung enden. Es gibt einfachere und komplexere Modelle, die diesen Prozess erklären (Jellouschek 2001; Willi 1992; 2002). Zur Beschreibung greife ich – Dechmann und Ryffel (2001) folgend – auf die Erklärung von Paradigmenwechseln in der Wissenschaftsgeschichte von Kuhn (1976, 1977) zurück (vgl. Kasten S. 15). Der Vergleich passt gut, da sowohl Partnerschaft wie auch Forschung von Neugier und Faszination genährt werden.
Nach Kuhn besteht wissenschaftliche Erkenntnis also nicht darin, dass Wahrheiten gefunden werden, sondern darin, dass die Wissenschaftsgemeinde zu einem Konsens gelangt. Genauso ist es in der Partnerschaft auch. Nicht das Auffinden von Wahrheit ist wesentlich, sondern die Suche nach einem Konsens. Dieser kann in einer neu gefundenen gemeinsamen Sichtweise, einer neuen Aufgabe bestehen oder darin, dass zu einem bestimmten Thema Dissens besteht.
Die Entwicklung einer Partnerschaft und die Überwindung einer Krise kann folgendermaßen in Beziehung zu Kuhns Konzept gebracht werden:
Die Phase der Verliebtheit ist geprägt durch die Bestätigung der Überzeugung (bzw. Theorie) „Dies ist der richtige Partner für mich“. Die Partnerschaft wird als Chance und Bereicherung erlebt. Allfällige Unterschiede zwischen Wunsch und Realität werden ausgeblendet oder beschönigt. Auseinandersetzungen werden kaum oder mit großer Kompromissbereitschaft geführt.
Die Phase der Ernüchterung: Das Paar realisiert, dass nicht alles so gut aufgeht, wie es während der Verliebtheit schien. Die Partner beginnen, sich übereinander aufzuregen, üben aneinander Kritik. Die Überzeugung „Dies ist der beste Partner für mich“ ist noch intakt, aber mit einigen Abstrichen. Die Partner stellen sich den Unterschiedlichkeiten, diskutieren und setzen sich mit den verschiedenen Meinungen und Bedürfnissen auseinander. Das Interesse gilt sowohl der Partnerschaft wie auch eigenen individuellen Interessen, die den anderen u. U. ausschließen. Ein neues Gleichgewicht wird gefunden.
Falls es den Partnern nicht gelingt, die Herausforderung der Unterschiedlichkeit als gegenseitige Bereicherung zu nutzen, sondern sich daran aufzureiben beginnen, kippen die Wahrnehmungen langsam in die Richtung von Störungen, Ärgernissen und werden dann plötzlich nur noch als Hinweis dafür gesehen, dass die Partnerwahl möglicherweise falsch war; die Wahrnehmung wird immer negativer. Die Bemühungen, die Beziehung zu verbessern, gehen grundsätzlich in Richtung der Wiederherstellung der bisherigen Paarrealität, vor allem, indem versucht wird, den Partner zu verändern.
Krisen und das Austesten neuer Lebens- oder Beziehungsformen: Nun folgt die Paarkrise, allenfalls mit Ambivalenzphase. Es wird anerkannt, dass eine Krise eingetreten und die bisherige Form der Beziehung unmöglich geworden ist. Die bisherigen Lösungsversuche werden aufgegeben, was mit Ängsten, Unsicherheiten und Verwirrungszuständen einhergeht. Vermehrte Ausrichtung nach außen ermöglicht den Partnern, neue Ressourcen zu finden. Es werden Lösungsoptionen auf neuen Ebenen diskutiert oder ausgetestet. Vielleicht versuchen die Partner mit einem neuen Hobby, mit mehr trennenden Aktivitäten, mit Wohnungswechsel oder einer anderen Aufteilung der familiären Pflichten ein neues Gleichgewicht zu finden. Auch Außenbeziehungen oder berufliche Veränderungen können hier als Lösungsoption auftauchen. In dieser Phase wird oft eine Paarberatung in die Wege geleitet.
Das Neue nach der Krise: Wie eine Erleuchtung kommt plötzlich die Erkenntnis über die Partner, dass die Krise überstanden ist. Oft sind es Kleinigkeiten, an welchen die Partner die Auslösung der Neuorientierung festmachen. Ein Satz, eine versöhnende Geste, ein Blumenstrauß. Nun kehrt wieder Ruhe ein. Eine neue Form von Beziehung oder neue Klarheit, eventuell auch mehr Distanz führen zu einer neuen Liebe oder allenfalls auch zum Akzeptieren eines Zustandes, der nicht voll befriedigt. Auch eine Trennung kann als eine solche neue Beziehungsform betrachtet werden.
Diese vier Stufen können mehrfach durchlaufen werden. Sie führen immer auch zu einer Entwicklung der Partner, die an den Auseinandersetzungen wachsen. Die Veränderungen geschehen nicht linear oder kontinuierlich, sondern in Sprüngen. Neue Erkenntnisse, neue Aktivitäten des einen oder beider Partner bringen plötzlich sehr viel in Bewegung. Das Wort „Kippeffekt“, wie Dechmann und Ryffel (2001) das Phänomen bezeichnen, umschreibt den Vorgang treffend. Die treibende Kraft, die hinter diesem Vorgang steht, ist die Sichtweise, die sich ganz plötzlich ändern kann. In einer maximal verkürzten Fassung könnte man die Entwicklung eines Paares so umschreiben: Sie beginnt mit der Verliebtheitssymbiose, führt über das Vorwürfe-Pingpong zur Selbstbesinnung und zu einer neuen Balance zwischen Bezogenheit und Individualität.
Im gesamten Geschehen dieser Entwicklungsprozesse sind Berater, kulinarisch gesehen, nur kleine Würstchen. Sie arbeiten mit den Kräften, über welche die Klienten verfügen. Die Funktion der Beratung ist mit einem Katalysator vergleichbar. Die Energie, die zentrale Kraft, die eine Veränderung antreibt, ist die Liebe – oder das Leiden an ihr.
2 Kuhn spricht von Paradigma, wenn eine Theorie und deren Verfechter eine wegweisende Funktion in einem umschriebenen Wissenschaftsbereich erfüllen, d. h., wenn sie allgemein anerkannt ist.
Theorien
1 Die Konstrukttheorie
„Es ist also klar, daß der Gedanke einer festgelegten Methode oder einer feststehenden Theorie der Vernünftigkeit auf einer allzu naiven Anschauung vom Menschen und seinen sozialen Verhältnissen beruht. Wer sich dem reichen, von der Geschichte gelieferten Material zuwendet und es nicht darauf abgesehen hat, es zu verdünnen, um seine niedrigen Instinkte zu befriedigen, nämlich die Sucht nach geistiger Sicherheit in Form von Klarheit, Präzision, ‚Objektivität‘, ‚Wahrheit‘, der wird einsehen, daß es nur einen Grundsatz gibt, der sich unter allen Umständen und in allen Stadien der menschlichen Entwicklung vertreten läßt. Es ist der Grundsatz: Anything goes“ (Feyerabend 1986, S. 31 f.; Hervorhebung im Orig.).
Theorien3 werden produziert und konsumiert, weil Menschen das Bedürfnis haben, über ihr Leben zu bestimmen oder zumindest Einfluss zu nehmen. Die einen produzieren Theorien, andere wenden sie an. Beide aus demselben Grunde.
Jeder hat den Wunsch, vorausberechnen zu können, was sich im eigenen Umfeld verändern wird, wenn er sich in einer bestimmten Art und Weise verhält. Man will Kontrolle im englischen Sinne des Wortes. Dies beginnt bei kleinsten Details, beispielsweise indem man hupt, um eine Katze zu verscheuchen, und endet bei Politikern, die ganze Machtstrukturen etablieren, um sich selber – und im besseren Falle auch der Bevölkerung – ein angenehmes Leben zu sichern. Das Bedürfnis nach Kontrolle ruft nach Zusammenhängen zwischen Handlungen und ihren Auswirkungen im Sinne von Wenn ich A tue, geschieht B. Um die Komplexität der wahrgenommenen Geschehnisse auf diese Formel zu bringen und möglichst einfache Wegweiser für eigenes Handeln daraus abzuleiten, braucht man Erklärungen darüber, wie A und B in bestimmten Lebenslagen zusammenhängen. Solche Erklärungen basieren einerseits auf der eigenen Erfahrung, andererseits werden sie von anderen geschaffen: Landkarten, Kausalitätszusammenhänge, Modelle oder Theorien. Damit kann die Komplexität der Wahrnehmungen reduziert werden.
Auch das Lesen von Sachbüchern dient demselben Zweck: Durch die Lektüre will man in bestimmten Lebenssituationen besser, d. h. fundierter, effizienter oder mit höherer sozialer Akzeptanz den Strom der Ereignisse beeinflussen. Auf dieses Buch bezogen, bedeutet dies: Sie wollen (noch) erfolgreicher beraten.
Das Bedürfnis nach Sicherheit und Klarheit und damit die Suche nach Theorien – durch Feyerabend, dem wohl provokativsten Wissenschaftstheoretiker der letzten Jahre, als „niedrige Instinkte“ abgetan – ist individuell verschieden stark ausgeprägt. Mit der abwertenden Konnotation Feyerabends bin ich nicht einverstanden. Jedoch teile ich seine Ansicht, dass Methodenzwang und Uniformität von Theorien einengen und den Fortschritt behindern. Das Bedürfnis nach Sicherheit und Eindeutigkeit kann nämlich zu einer Überbewertung der Theorien führen. Zu rasch ist man bereit, diese als Realität zu missdeuten, wenn es nützlich scheint oder Energie spart.
Eine Theorie dient als Grundlage für Entscheidungen. Ihr Anwender delegiert dadurch die Entscheidung an die Instanz, welche die Theorie schuf oder das Forschungsdesign entwarf. Es entsteht die Sicherheit, nicht selber einen Fehlentscheid auf sich nehmen zu müssen. Die oft aufwändigere Arbeit, Entscheidungen aufgrund eigener Erfahrungen zu fällen, wird vermieden. Diese Aussage soll weder wissenschaftlich fundierte Entscheidungen desavouieren noch reine Bauchentscheidungen als allein selig machend propagieren. Aber es soll eine heute noch immer sehr große Wissenschaftsgläubigkeit hinterfragt werden. Eine Auseinandersetzung zwischen Theorie und eigenen Werten und persönlicher Erfahrung ist Voraussetzung für gute Entscheidungen.
Der Produktion von Theorien und dem Schreiben von Büchern liegt grundsätzlich derselbe Antrieb zugrunde wie ihrer Verwendung: Man will die Umwelt beeinflussen. Die erhoffte Wirkung reicht allerdings weiter. Ein anderer, im obigen Zitat unerwähnter „niedriger Instinkt“ des Menschen mischt hier kräftig mit: der Machttrieb bzw. die Machtgier. Wenn es gelingt, andere von der eigenen Sicht auf bestimmte Zusammenhänge zu überzeugen, fühlt man sich überlegen, und es entfallen eigene Anpassungsleistungen an die Sicht des Gegenübers. Erreichte Macht lässt hungrig werden nach mehr Macht. Auch dies ist im Wissenschaftsbetrieb zu beobachten. Vermutlich streben viele Forscher aufgrund uneingestandener Omnipotenzwünsche danach, den Gültigkeitsbereich ihrer Theorie sukzessive zu erweitern. So werden die Theorien immer komplexer und für Durchschnittsmenschen undurchsichtig, was gegen komplexe Theorien spricht. Ein zweites Argument dagegen ist die Tatsache, dass im Alltag jedermann Theorien und Denkmodelle wie Kleidungsstücke wechselt: Je nach Lebenssituation und eigener Stimmung verwendet man die eine oder andere Theorie oder auch nur einen Bestandteil davon. Dies spricht dafür, möglichst einfache, jedoch zahlreiche Theorien zu schaffen.
Die Paarberatungslandschaft exemplifiziert das oben Gesagte schön. Die Zahl von Theorien und Modellen nimmt dauernd zu. Stiemerling (2000) zählt 16 derzeit propagierte psychotherapeutische Theorien auf, die alle Allgemeingültigkeitsanspruch anmelden und andere Theorien und Modelle ausschließen. Vertreterinnen von Psychotherapieausbildungen sind emsig mit dem Bauen von Mauern um ihre Theorien bemüht. Da es aber keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen Klient und Berater gibt, ist nicht einzusehen, dass Letzteren das Mischen von Theorien und Modellen nicht vergönnt sein sollte. Erfahrene Praktiker jedenfalls tun dies – mehr oder weniger deklariert.
Die Psychologie der persönlichen Konstrukte von Kelly (1986) ist eine gute – und zwar bereits vor 50 Jahren gegebene – Antwort auf die Tendenz zur Produktion komplexer Theorien. Es ist die einfachste Theorie, die ich kenne. Kelly bietet einerseits eine wissenschaftstheoretische Rahmentheorie und andererseits eine Theorie zur Entwicklung von Menschen an.
Bezüglich letzter Quelle von Erkenntnis sind sich Kelly, Popper (Popper 2002, 1989; Popper u. Eccles 1977) und die Konstruktivisten der 1980er-Jahre einig: Es gibt sie nicht. Aber es gibt Möglichkeiten, Irrtümer aufzudecken. Wissenschaft müsse darin bestehen, traditionelles Wissen und anerkannte Theorien zu modifizieren oder zu falsifizieren. Wissen und Theorien, die der Kritik und den Falsifizierungsversuchen standhalten, bleiben brauchbar, werden dadurch aber nicht verifiziert. Diese Relativierung gilt selbstverständlich auch für alle in diesem Buch dargestellten Zusammenhänge, Erklärungen und Mechanismen. Sie sind nicht wahr, sondern möglich. Sie sind höchstens bis zu einem bestimmten Zeitpunkt für ein bestimmtes Anwendungsgebiet noch nicht falsifiziert worden. Aber trotz aller Vergänglichkeit tut es allemal gut, schöne Zusammenhänge und Übereinstimmungen oder Konvergenzen unterschiedlicher Theoriegebäude zu reflektieren. Lassen wir uns das Vergnügen.
3Die exakten Definitionen von Theorie, Modell und anderen, verwandten Begriffen sind im Kasten auf Seite 78 zusammengefasst.
1.1 George A. Kelly, der unbekannte Erfinder der Systemtherapie
1.1.1 Kellys Erkenntnistheorie
Kelly umschrieb 1955 seine Grundhaltung folgendermaßen (hier zitiert nach Kelly 1986, S. 21 f.; Hervorhebung im Orig.):
„Die drei Annahmen über das Universum, die wir in diesem Abschnitt hervorgehoben haben, sind, daß das Universum real und kein Produkt unserer Vorstellungskraft ist, daß alles ineinandergreift wie bei einem Uhrwerk und daß es ständig in Bewegung ist und nicht einfach stillsteht.“
Und einige Zeilen weiter:
„In unserem Denken ist das Leben mehr als bloße Veränderung. Es umfaßt eine interessante Beziehung zwischen Teilen unseres Universums, in dem eines dieser Teile, das Lebewesen, es fertigbringen kann, einen anderen Teil, die Umwelt, abzubilden. Manchmal wird gesagt, daß das Lebendige im Vergleich zum Leblosen ‚empfindsam‘ sei bzw. daß es ‚reaktionsfähig‘ sei. Das ist grob gesprochen dasselbe unterscheidende Merkmal, das wir im Auge haben. Aber uns gefällt unsere Formulierung besser, weil sie die ‚schöpferische Kraft des Lebendigen betont, die Umwelt abzubilden und nicht nur auf sie zu reagieren‘. Weil das Lebewesen seine Umwelt abbildet, kann es der Umwelt alternative Konstruktionen überstülpen und tatsächlich etwas tun, wenn ihm die Umwelt nicht gefällt. Für das Lebewesen ist die Umwelt also real, aber nicht unveränderlich; es sei denn, es wollte die Umwelt so konstruieren.“
Und schließlich (ebd., S. 25):
„In diesem Abschnitt hofften wir, unsere Überzeugung zu verdeutlichen, daß sich der Mensch eigene Mittel zur Wahrnehmung der Welt schafft, in der er lebt; die Welt schafft sie nicht für ihn. Er bildet Konstrukte und probiert aus, ob sie passen.“
Unter dem Begriff konstruktiver Alternativismus schließlich relativiert Kelly seine Theorie und kommt damit dem kritischen Rationalismus, der auf Popper (Popper 2002, 1989; Popper u. Eccles 1977) zurückgeht, sehr nahe. Die gegenwärtigen Interpretationen des Universums müssten alle irgendwann revidiert und ersetzt werden. Es gibt keine die Zeit überdauernde Gültigkeit einer Theorie, sondern nur Theorien, Modelle und Konstrukte, die der Welt übergestülpt werden, um diese zu interpretieren und damit Komplexität zu reduzieren. Sie sind Produkt der Auseinandersetzung zwischen der Menschheit und dem Universum, die beide einem Wandel unter worfen sind.
Kellys Anspruch an seine Theorie war gleichzeitig bescheiden und unbescheiden. Bescheiden deshalb, weil er sie relativiert und grundsätzlich als jederzeit widerlegbar und revidierbar hinstellt. Unbescheiden, weil er mit seinem wissenschaftstheoretischen Anspruch die gesamte damalige psychologische Forschung mit einschließt und seine Theorie als diese umfassend darstellt (zit. in: Bannister u. Fransella 1981, S. 6 f.):
„Ein Mensch, der einen Großteil seiner Zeit damit verbringt, Fakten zu sammeln und zu hüten, wird nicht gerade glücklich sein über die Aussicht, daß sie sich in einen Haufen Abfall verwandeln. Er wird sie viel wahrscheinlicher wohlgeschützt unter Verschluß halten – als Denkmal seiner persönlichen Leistung. Ein Wissenschaftler zum Beispiel, der so denkt, und ganz besonders ein Psychologe, der das tut, ist auf seine Fakten angewiesen, um den letzten Beweis für die Richtigkeit seiner Behauptungen liefern zu können. Mit diesen schimmernden Goldklümpchen der Wahrheit in seinem Besitz erscheint es ihm unnötig, Verantwortung für die Schlüsse zu übernehmen, bezüglich deren er den Anspruch erhebt, sie folgten zwangsläufig aus den Fakten. Ihn an diesem Punkt darauf hinzuweisen, daß weitere menschliche Rekonstruktionen das Bild der so wertvollen Fragmente, die er gesammelt hat, ebenso vollständig verändern können wie die Richtung der Argumentation, würde bedeuten, seine wissenschaftlichen Schlußfolgerungen, seine philosophischen Standpunkte und sogar seine moralischen Gewißheiten zu bedrohen. So ist es denn auch nicht verwunderlich, daß, in den Augen einer derart konservativ gesonnenen Person, unsere Annahme, alle Fakten seien Gegenstand – seien ausschließlich Gegenstand – alternativer Konstruktionen, als sträflich subjektive, für das wissenschaftliche Establishment umstürzlerisch gefärbte Idee erscheinen muß.“
Solch kernige Aussagen, die wir im Werk Kellys haufenweise finden, mögen dazu beigesteuert haben, dass die Theorie vom größten Teil psychologischer Forscher und Kliniker nicht aufgegriffen wurde. Zwar wird Kelly von Watzlawick et al. (1974; Orig. 1967) bereits 1967 am Rande erwähnt, aber wie bahnbrechend das Gesamtwerk für die Psychotherapie war, wurde erst zwei Jahrzehnte später erkannt. Neimeyer (1992, p. 995) umschreibt dies so: 4
„Tatsächlich kann Kellys Theorie die Ironie für sich in Anspruch nehmen, mit den Jahren immer aktueller zu werden. Dies geht so weit, dass einem beim Lesen von Kelly zuweilen schwindlig wird und man sich dabei ertappt, das Druckdatum zweimal nachzuprüfen.“
Ein für die damalige Zeit wegweisendes Grundprinzip Kellys war die Aufhebung des Subjekt-Objekt-Gefälles zwischen Forscher und Forschungsobjekt einerseits bzw. Kliniker und Klient andererseits (zit. in: Sader u. Weber 1996, S. 47):
„In der Theorie für ‚Psychologen und ihr Verhalten‘ ist der Psychologe ein aktiv Handelnder und Realisierender, er ist weitgehend unabhängig von sozialen Einflüssen, er ist den üblichen Denk- und Lerngesetzen nicht unterworfen, gewissermaßen das handelnde Subjekt der Forschung. In der Theorie ‚Menschen und ihr Verhalten‘ ist der Mensch lediglich Versuchsobjekt, er ist umweltabhängig, voller Vorurteile, des Denkens und Lernens sehr eingeschränkt mächtig.“
Die Entdeckung, dass auch Forscher Menschen sind und der selbst kreierten Theorie ebenso entsprechen müssen wie deren Objekte, griff zweieinhalb Jahrzehnte später die psychologische Forschung auf (Groeben u. Westmeyer 1981). Später wurde sie auch im familientherapeutischen Alltag als Konsequenz aus der Kybernetik II (vgl. Kasten S. 132) abgeleitet.
Ein weiterer Aspekt, die Popularisierung der Psychologie durch Kelly, fand ebenfalls Jahrzehnte später in Form der Erforschung von Alltagspsychologien seinen Niederschlag: Das Wissen und die Handlungsgrundsätze der untersuchten Personen sind leitend und nicht die Theorien der Forscher (Thommen 1985).
Kelly nahm alle relevanten Aspekte der Systemtherapie, die zwischen 1975 und 1980 geschaffen wurden und als Konstruktivismus oder Kybernetik zweiter Ordnung in die Therapiegeschichte eingingen, vorweg: die Subjektabhängigkeit von Erkenntnis, die Autoorganisation von menschlichen Systemen, die Rolle des Forschers oder Beraters als Teil des Systems. Zusätzlich schuf Kelly eine Persönlichkeitstheorie, die wir heute als integrative Klammer für zahlreiche psychologische Theorien und Modelle verwenden können und die bisher im systemischen Theorienkonglomerat weitgehend fehlte.
Zusammenfassung
Die erkenntnistheoretische Position Kellys nahm die Systemtherapie, die 30Jahre später die Familientherapie revolutionieren sollte, vorweg: die Subjektabhängigkeit von Erkenntnis, die Autoorganisation von menschlichen Systemen, die Rolle des Forschers oder Beraters als Teil des Systems.
Unter dem Begriff konstruktiver Alternativismus relativiert Kelly seine Theorie und kommt damit dem kritischen Rationalismus nahe: Theorien, Modelle und Konstrukte werden der Welt übergestülpt, um diese zu interpretieren und damit Komplexität zu reduzieren. Sie müssten alle irgendwann revidiert und ersetzt werden.
Kellys Theorie wurde in den 1960er-Jahren von der Fachwelt auf eine Persönlichkeitstheorie reduziert. Erst Jahrzehnte später erkannte man, welche erkenntnistheoretische Revolution im Gesamtwerk steckte.
1.1.2 Kellys Persönlichkeitstheorie
Im Folgenden wird die Psychologie der persönlichen Konstrukte5 sehr gerafft dargestellt. Beispiele sollen ermöglichen, sich konkrete Vorstellungen von der Entstehung der Konstrukte und deren Einfluss auf das Leben des Individuums zu machen.
1.1.2.1 Konstrukte als Wahrnehmungsinstrument und Triebfeder von Verhalten
Die formale Struktur von Kellys Theorie besteht aus einem Grundpostulat und elf Folgesätzen, so genannten Korollarien6, welche im Kasten auf Seite 30 wiedergegeben sind.
Kellys Grundpostulat (1963, p. 46) enthält im Kern seine gesamte Theorie:
„Die psychischen Prozesse eines Menschen werden durch die Art und Weise, wie er Ereignisse antizipiert, gesteuert und geprägt.“
Daraus folgt zwingend, dass jeder Mensch seine ganz persönliche Art und Weise hat, Ereignisse zu antizipieren. Weiter betont der Autor, dass die Psychologie einer Person nur aus diesen antizipierenden Vorgängen besteht. Es gibt keine allgemein gültige Psychologie.
Die Konstrukte dienen zur Kontrolle und Beeinflussung der Interaktionen zwischen dem Individuum und seiner Umwelt. Die Entstehung von Konstrukten geht auf das Bedürfnis zurück, Ereignisse zu antizipieren. Nur wenn der Mensch aufgrund seiner Wahrnehmungen und Interpretationen vorausberechnen, -sehen oder fantasieren kann, was um ihn herum und mit ihm geschehen wird, kann er sich darauf einstellen und handelnd Einfluss nehmen. Ist das nicht möglich, kommt Angst7auf. Das menschliche Handeln basiert gemäß Kelly immer auf solchen Konstrukten. Ein Konstrukt besteht aus Wahrnehmungen, Erkennung und Interpretation. Der Mensch hat nach Kelly nur eine einzige psychische Kraft: den Antrieb, Ereignisse um sich herum zu antizipieren und sich selber zu erforschen.
Kelly erfand also keine Theorie über die psychischen Bestandteile des Menschen, um diese dann experimentell zu beweisen. Um Einblick in die Psychologie einer Person zu erhalten, befragte er diese strukturiert. Die Methode des Role Construct Repertory Test (Rep-Test, auch Grid-Technik genannt, s. u.) wurde als diagnostisches Hilfsmittel konzipiert und später durch andere Forscher als Instrument für wissenschaftliche Untersuchungen weiterentwickelt. Das Prinzip ist frappant einfach. Es baut nur auf Unterschieden von Interpretationen auf. Wie Maturana (1985) sowie Maturana und Varela (1987) 30 Jahre später zeigten, können nur Unterschiede wahrgenommen werden und nicht absolute Größen (vgl. dazu Kasten auf S. 132).
Role Construct Repertory Test (Rep-Test)
Vorgehen: Zuerst wird der Proband gebeten, eine vorgelegte Liste von Rollencharakterisierungen (z. B. Mutter, Vater, Partner, Lehrer, Nachbar, mit welchem ich gut auskomme etc.) mit konkreten Personen aus dem eigenen Umfeld zu füllen. Die Zahl von Rollencharakterisierungen beträgt 20 bis 30. Kelly hat 24 solcher Beschreibungen vorgegeben, ermutigt aber zur Erfindung neuer Vorgaben, die für den jeweiligen Probanden passend scheinen. Der zweite Schritt besteht darin, dass der Proband immer für drei Personen die Frage beantworten muss: „In welcher Hinsicht sind zwei der drei vorgelegten Personen ähnlich und unterscheiden sich von der dritten?“
Beispiel: Die drei vorgelegten Personen sind Mutter, Ehefrau und Schwester. Die Frage nach den Unterschieden wird, angenommen, so beantwortet: Die Mutter und die Schwester sind engstirnig, die Ehefrau ist weltoffen. Dadurch offenbart der Proband drei Dinge: Erstens legt er offen, welche Persönlichkeitsmerkmale für ihn unter anderem wichtig sind zur Beurteilung von Mitmenschen, hier das Begriffspaar engstirnig/weltoffen. Zweitens sagt er etwas aus über die Art und Weise, wie er Persönlichkeitsmerkmale definiert, und drittens ist in der Antwort eine Definition der Beziehung zu den drei angesprochenen Personen enthalten.
Auswertung: Es versteht sich, dass Kelly keine standardisierte Auswertung mit Normen vorsah. Er schuf das Instrument, um die Klienten in ihrer Art, die Welt zu konstruieren und sich darin zu bewegen, besser erfassen zu können. Heute gibt es einige EDV-Programme zur Auswertung.
(Vgl. Scheer u. Catina 1993; Sader u. Weber 1996; Pervin 2000.)
Die Konsequenz daraus ist u. a., dass jede Interpretation einer Wahrnehmung nur im Kontrast zu ihrem Gegensatz oder ihrer Negierung möglich ist. Dies gilt auch für Konstrukte, die begrifflich nicht offensichtlich dichotom wirken. Bannister und Fransella (1981, S. 14; Kursivdruck im Orig.) fassen dies so zusammen:
„Kelly behauptet jedoch, daß wir auch dort, wo nicht ohne weiteres ein Etikett für den Gegensatz zu haben ist, nicht zustimmen, ohne implizit innerhalb eines bestimmten Sinnzusammenhanges zu verneinen. Die Versicherung ‚Ich bin müde‘ hätte nur wenig Nachdruck, wenn die gegenteilige Versicherung von Frische und Energie nicht irgendwo herumschwirrte, um gleichzeitig verneint zu werden.“
Neben dem Kontrast, dem Vergleich einer Wahrnehmung mit dem Gegensatz, verwendet Kelly die Ähnlichkeit, um Konstrukte zu definieren. Es sind also drei Elemente nötig, um ein Konstrukt zu bilden: Zwei der Elemente werden als einander ähnlich und das dritte als davon verschieden konstruiert. Kelly spricht von Gegensatzpol und Ähnlichkeitspol (vgl. Kasten S. 28).
N. B.:
Wo schwirrt der Gegensatz von „Ich bin müde“ herum?
T. H.:
Um dich herum, lauter frisch wirkende Menschen, in deiner Erinnerung an einen Sonntagmorgen, nachdem du zwölf Stunden geschlafen hast. Du kannst nur „müde sein“ beschreiben, wenn du weißt, wie sich „ausgeschlafen sein“ anfühlt.
N. B.:
Das ist mir schon klar. Aber das geht ja nicht mit allem.
T. H.:
Doch, ich glaube, es geht mit allem. Du kannst etwas nur erkennen, wenn du es auf einem Hintergrund, einem Kontrast siehst. Einen Frosch würde ich nicht als Frosch erkennen, wenn die ganze Umgebung des Frosches auch aus Fröschen bestünde. Aber die Tatsache, dass es auch Bäume, Ziegen, Menschen und Wasser gibt, ermöglicht es mir, den Frosch vom Rest zu unterscheiden.
Kelly konzeptualisiert aber nicht nur die Wahrnehmung neu, sondern er verknüpft diese eng mit dem Handeln des Individuums. Menschen erwarten in bekannten Situationen grundsätzlich, dass sich Ereignisse wiederholen, die sie in ähnlichen Situationen bereits einmal erlebt haben. Die Wiederholung eines Ereignisses findet im Kopf statt, sodass das Individuum die Wahrnehmung einengt auf „Gleich wie das letzte Mal“ oder „Anders als das letzte Mal“. Aufgrund dieser Erwartung wird das Ereignis durch Handlungsimpulse und Handlung mehr oder weniger stark, mehr oder weniger bewusst, beeinflusst.
N. B.:
Ich verstehe es so, dass ein neues Ereignis nie dasselbe ist wie eines, das wir schon erlebt haben, sondern dass wir es zum gleichen machen und es deshalb voraussehbar ist. Zum Beispiel ein Erdbeben: Ein Mensch aus San Francisco weiß, wie sich ein Erdbeben anfühlt, was vor sich geht. Bebt die Erde wieder, nennt er das Ereignis wieder Erdbeben und sagt, es ist dasselbe Ereignis, obwohl beim zweiten Mal vielleicht eine Vase runtergefallen ist, und beim ersten Mal war es eine Pfanne. Es ist also von außen gesehen nicht dasselbe Ereignis, obwohl es für ihn dasselbe ist. Es liegt daran, dass wir Ereignisse benennen.
T. H.:
Und: Wenn bei den letzten drei Erdbeben kurz vorher ein Hahn gekräht hat und der Hahn einige Wochen später wieder kräht, denkt der Mensch, dass wieder ein Erdbeben kommt. Er schließt aus dem Krähen des Hahns, dass sich das Ereignis wiederholen wird. Vielleicht aber habe ich bei den letzten zwei Beben gelernt, dass es gut ist, aus dem Haus zu rennen, bis das Beben vorbei ist. Knallt mir aber beim dritten Mal ein Ziegelstein auf den Kopf, so muss ich mein Konstrukt überdenken. Ich werde das nächste Mal nicht mehr aus dem Haus rennen, ohne zuvor einen prüfenden Blick nach oben zu werfen.
Wichtigste Begriffe und Definitionen der Psychologie der persönlichen Konstrukte
Angemessenheitsbereich: all jene Situationen, auf die der Benutzer die Anwendung des jeweiligen Konstrukts sinnvoll finden würde.
Angemessenheits-Brennpunkt: Situationen, die im Angemessenheitsbereich des Konstrukts liegen und für die das Konstrukt ursprünglich entwickelt wurde.
Dichotomie und Pole: Ein Konstrukt hat zwei entgegengesetzte Pole, einen an jedem Ende der Dichotomie. Zwei Elemente sind einander ähnlich, wenn sie auf demselben Pol eines Konstrukts liegen. Sie sind sich unähnlich, wenn sie auf den entgegengesetzten Polen des Konstrukts liegen.
Ähnlichkeitsende, Ähnlichkeitspol: Wenn man sich speziell auf die Elemente an einem Pol des Konstrukts bezieht, kann dieser Pol als Ähnlichkeitsende (oder -pol) bezeichnet werden.
Gegensatzende, Gegensatzpol: Wenn man sich speziell auf die Elemente an einem Pol des Konstrukts bezieht, kann der entgegengesetzte Pol als Gegensatzende (oder -pol) bezeichnet werden.
Durchlässigkeit: Ein Konstrukt ist durchlässig, wenn es neu wahrgenommene Elemente in seinen Kontext aufnimmt. Es ist undurchlässig, wenn es Elemente aufgrund ihrer Neuartigkeit ausschließt.
Klassifikation der Konstrukte in Bezug auf ihre Kontrolle über die Elemente
Ausschließendes Konstrukt: ein Konstrukt, das seine Elemente ausschließlich als Bestandteile seines eigenen Bereichs zulässt. Es handelt sich dabei um den Nichts-als-Typ von Konstruktion: „Wenn dies ein Ball ist, dann ist es nichts als ein Ball.“
Präverbales Konstrukt: ein Konstrukt, das verwendet wird, obwohl es kein konsistentes verbales Etikett (Symbol) trägt. Es kann, muss aber nicht entstanden sein, bevor die Person das Symbolisieren durch Worte beherrschte.
Übergeordnetes Konstrukt: ein Konstrukt, das ein anderes Konstrukt als Element in seinem Kontext einschließt.
Untergeordnetes Konstrukt: ein Konstrukt, das als Element im Kontext eines anderen enthalten ist.
Kernkonstrukt: ein Konstrukt, das die lebenserhaltenden Prozesse einer Person steuert.
Peripheres Konstrukt: ein Konstrukt, das verändert werden kann, ohne dass ernsthafte Modifikationen der Kernstruktur der Person die Folge sind.
Festgelegtes Konstrukt: ein Konstrukt, das zu unveränderbaren Vorhersagen führt.
Lockeres Konstrukt: ein Konstrukt, das zu unterschiedlichen Vorhersagen führt, dabei jedoch seine Identität behält.
(Vgl. Bannister u. Fransella 1981, S. 190 ff.)
Eine Parallele zwischen Kelly und Piaget ist offensichtlich (Piaget u. Inhelder 1973). Piaget verstand die Interaktion zwischen Individuum und Umwelt als gegenseitige Anpassung (Adaptation) in Form zweier gegenläufiger Prozesse, bestehend aus Assimilation und Akkommodation. Die Assimilation ist der auf die Person gerichtete Prozess: Die Person gliedert die Dinge, Menschen, Gewohnheiten, Neigungen und nimmt sie in ihre eigenen Aktivitäten auf. Die Akkommodation ist der nach außen gerichtete Prozess, die Anpassung der Person an die Herausforderungen der Umwelt (Pulaski 1979).
Bei Willi (1996) kommt die Nähe zwischen Kellys Psychologie und Piagets Theorie besonders gut zum Ausdruck. Er nimmt in seinem Konzept der Ökologischen Psychotherapie sowohl Kellys wie auch Piagets Konzept auf und spricht von der „persönlichen ökologischen Nische“, die sich jede Person schafft und lebenslänglich umgestaltet. Der Veränderungsprozess basiert auf dem Mechanismus der Akkommodation, der Anpassung der Schemata an die Umwelt im Sinne von Piaget. Zur Erklärung der Spezifität der Wahrnehmung für jede Person verwendet Willi den Ausdruck „Schema“ weitgehend identisch mit dem Konstruktbegriff von Kelly.
Die Unterschiede der Konstrukte zwischen verschiedenen Personen beruhen auf deren Geschichte. Wenn ein Mensch bereits in früher Kindheit das Konstrukt „Wenn ich die Wahlmöglichkeit zwischen einem gewohnten, sicheren Weg und einem neuen habe, wähle ich immer den sicheren“ erworben hat, wird er sich ein eher kleines Repertoire an Konstrukten aneignen, diese sind aber gut erprobt, und die Anwendungskontexte sind klar definiert. Er wird von anderen Menschen im Spektrum zwischen „eigenständige Persönlichkeit“ und „vorsichtig bis ängstlich“ eingestuft. Ein anderer, der als frühes Konstrukt „Im Zweifelsfall folge ich meiner Neugier“ erworben hat, wird als „mutig“ bis „waghalsig“ bezeichnet. Sein Repertoire an Konstrukten wird breiter sein, die Angemessenheitsbereiche weniger deutlich abgegrenzt. Jede neue Erfahrung bestätigt oder verändert das zugrunde gelegte Konstrukt, eventuell auch mehrere Konstrukte gleichzeitig. Das Gebäude der Konstrukte wird dadurch dauernd angepasst und differenziert. Der Mensch bringt also in jede Situation ein Repertoire an Konstrukten mit. Biografisch bedingt, gibt es riesige Unterschiede, die erklären, weshalb die Psyche jedes Menschen einmalig ist und kein Mensch genau in eine diagnostische Kategorie passt.
Ein Mensch mit dem Konstrukt „Wenn bei mir etwas gut läuft, ist es mein eigenes Verdienst“ hat die Möglichkeit, sich zu einem erfolgreichen und selbstsicheren, aber unter Umständen auch überheblichen Mensch zu entwickeln, da er jeden Erfolg sich selber zuschreibt. Hat er hingegen das Konstrukt „Erfolge in meinem Leben sind Zufall“, wird er sich durch positive Erfahrungen kein besseres Selbstbild und Erfolgsgefühl aneignen (vgl. dazu auch Kasten zur Attributionstheorie S. 39).
1.1.2.2 Individuelle Struktur des Konstruktsystems
Jede Person baut sich ihr eigenes System von Konstrukten auf. Dabei sind nicht nur die Konstrukte individuell, sondern auch ihre Anzahl und die Beziehung zueinander: Es gibt eine persönliche Hierarchie mit Überordnung, Unterordnung, Einschluss oder Ausschluss.
Korollarien
Eine Person antizipiert Ereignisse, indem sie ihre Replikation konstruiert.
Personen unterscheiden sich in ihren Konstruktionen der Ereignisse voneinander.
Jede Person entwickelt eine Anzahl von Konstrukten, welche für sie charakteristisch sind und ihr ermöglichen, Ereignisse zu antizipieren. Auch die Zusammenhänge zwischen den Konstrukten sind für die Person charakteristisch und bilden als Ganzes das Konstruktionssystem.
Das Konstruktionssystem einer Person setzt sich aus einer begrenzten Zahl dichotomer Konstrukte zusammen.
Eine Person wählt für sich selbst diejenige Alternative in einem dichotomen Konstrukt, durch welche sie eine bessere Möglichkeit für Ausbau und Definition ihres Konstruktionssystems antizipiert.
Ein Konstrukt eignet sich nur zur Vorhersage eines begrenzten Bereichs von Ereignissen.
Das Konstruktionssystem einer Person verändert sich dadurch, dass die Person nach und nach Replikation von Ereignissen konstruiert.
Variationen innerhalb des Konstruktionssystems einer Person werden durch das Maß der Durchlässigkeit der Konstrukte, in deren Brauchbarkeitsbereich die Varianten liegen, bestimmt.
Eine Person kann nacheinander eine Vielzahl von Konstruktsubsystemen verwenden, die logisch unvereinbar sind.
In dem Maße, wie eine auf Erfahrung beruhende Konstruktion, die eine Person verwendet, derjenigen einer anderen Person ähnelt, sind auch ihre psychischen Prozesse denen der anderen Person ähnlich.
In dem Ausmaß, in dem eine Person die Konstruktionsprozesse einer anderen konstruiert, kann sie in einem sozialen Prozess, der die andere Person einschließt, eine Rolle spielen.
(Kelly 1986, S. 63 ff.)
Die Gesamtheit der Konstrukte ist zwar hierarchisch geordnet, aber weder in sich geschlossen noch widerspruchsfrei. Die Konstrukte können sich gegenseitig durchkreuzen oder überschneiden. Falls sich zwei Konstrukte für dieselbe Situation oder Entscheidung anbieten, kann ein Konflikt oder eine Ambivalenz entstehen. Das Dilemma kann gegebenenfalls mithilfe eines hierarchisch höheren Konstruktes gelöst werden.
Die Hierarchisierung der Konstrukte ist von Individuum zu Individuum verschieden und hängt wohl von der Reihenfolge der zugrunde liegenden Erfahrungen ab. Vermutlich sind die am frühesten erworbenen Konstrukte für die grundlegenden Verhaltens- und Reaktionsweisen des Individuums verantwortlich und stehen in der Nähe der Begriffe Trieb und Antrieb aus der Humanethologie, Motivationspsychologie (vgl. Abschn. 1.2.2) und Bindungstheorie (s. Kasten S. 49).
In einer konkreten Situation ist also oft nicht nur ein Konstrukt aktiv, sondern es können mehrere sein, die sich widersprechen oder ergänzen.
Beispiel von zwei sich ergänzenden Konstrukten:
Eine Frau wird von ihrem Partner damit konfrontiert, dass seine frühere Freundin das Vitello tonnato besser zubereiten konnte als sie. Bei ihr werden zwei Konstrukte aktiviert: Erstens: „Wenn ich mich als unverstanden definiere, muss ich der Kritik nicht ins Auge schauen.“ Und ein zweites: „Ex-Frauen meiner Partner bedrohen mich, deshalb muss ich bei jeder noch so kleinen Unsicherheit die Beziehung zu ihm klären.“ Sie wechselt das Thema von Vitello tonnato zur unverstandenen und verkannten Partnerin. Ein Paarkonflikt bahnt sich an. Eine andere Frau würde u. U. das Konstrukt „Wenn ich kritisiert werde, schweige ich am besten“ mit „Wer mich kritisiert, liebt mich nicht, dann ziehe ich mich zurück“ kombinieren und sich verletzt in die Küche zurückziehen. Hier entwickelt sich eher eine komplementäre Paardynamik von Aggressivität und Rückzug.
Beispiel von sich konkurrierenden Konstrukten und der Wirkung eines dritten:
Ich stehe vor der Entscheidung, ob ich die Korrektur und Ergänzung dieses Abschnittes, bestehend in der Erfindung eines Beispieles, gleich jetzt in Angriff nehmen soll oder erst später. Dadurch werden zwei Konstrukte abgerufen: Das erste lautet: „Die sofortige Erledigung einer Aufgabe spart Energie und Ärger.“ Das Ergebnisgefühl ist Erleichterung. Zweites Konstrukt: „Wenn ich mich zwinge, kreativ zu sein, lande ich in einem Black-out und produziere nichts.“ Das Ergebnisgefühl ist Unzufriedenheit. Das dritte Konstrukt auf einer höheren Hierarchiestufe hilft, die Ambivalenz zu lösen: „Wenn ich in einem Entscheidungspatt bin, lohnt es sich nicht, weitere Energie in die Entscheidung zu investieren. Würfeln und dann Handeln ist besser.“ Das dazugehörende Ergebnisgefühl ist Erleichterung. Dank der geworfenen Münze konnten Sie dieses Beispiel nun auch lesen.
Die Zahl und Art der Konstrukte und ihre Angemessenheitsbandbreite sowie die Struktur des Konstruktsystems machen also die Individualität des Menschen aus. Der Anspruch auf die Geschlossenheit und Widerspruchsfreiheit einer Theorie entspricht den Wünschen von Theoretikern, nicht aber der Alltagsrealität des Durchschnittsmenschen.
N. B.:
Verstehe ich es richtig, dass du die Theorie Kellys mit der psychischen Struktur gleichsetzt?
T. H.:
Er ersetzt eine allgemeine Theorie über die Psyche durch das Konstruktsystem der Person. Das ist ja das Faszinierende.
N. B.:
Entspricht die Psyche Kellys seiner Theorie?
T. H.:
Ja. Das ist ein Aspekt. Auch auf den Forscher muss die von ihm aufgestellte Theorie anwendbar sein. Und zusätzlich: Kelly schuf eine Metatheorie, innerhalb deren jeder Mensch seine private psychologische Theorie selber bauen kann. Du funktionierst nicht nur anders als z. B. Sigmund Freud, sondern die Instanzen, die du in dir hast und die dich steuern, heißen nicht Über-Ich, Ich und Es, sondern z. B. Kiff, Kaff und Kuff.
N. B.:
Ist das bei Freud auch möglich, oder versuchst du, die Ansichten Kellys auch bei Freuds Theorien einzusetzen?
T. H.:
Nach der Theorie Kellys darf Freud seine Psychologie selber bauen. Aber nicht diejenige anderer.
N. B.:
Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Die Theorie ist wie ein Kindermalbuch, das die Silhouetten vorgibt, aber die Farben dürfen wir selber wählen. Stimmt das?
T. H.:
Ja. Allerdings sehe ich die Freiheiten, die Kelly uns lässt, als noch größer als im Malbuch.Vielleicht hat er nur das Buch und die Stifte vorgegeben, alles andere ist deine oder unsere Sache. Oder: Freud, Jung, Adler, Rogers und all die andern großen Vordenker für die Psychologie postulierten eine Theorie mit allgemeinem Gültigkeitscharakter. D. h., die Theorie ist eine Landkarte von der menschlichen Psyche, die auf alle Menschen angewendet werden kann. Die Individuen unterscheiden sich nur in den Details ihrer Landschaften. Kelly gibt uns keine Karte von der menschlichen Psyche in die Hand, sondern Papier, Maßstab und Zirkel sowie einige wenige Grundprinzipien, wie man Landkarten zeichnet.
1.1.2.3 Einfluss der Konstrukte auf Beziehungen
Eine Ähnlichkeit von zwei Personen führt Kelly auf die Ähnlichkeit ihrer Konstrukte zurück. Die lebensgeschichtliche Erfahrung ist zentral dafür.
Um eine andere Person verstehen zu können, muss man allerdings nicht ähnliche Konstrukte haben, sondern die Fähigkeit, die Konstruktionen der anderen Person nachzukonstruieren. Empathiefähigkeit bekommt so einen kognitiven Anteil und entspricht dem Begriff der „strukturellen Koppelung“ zweier autopoietischer Systeme bei Maturana (1985). Wenn man sich auf einen anderen Menschen einlässt, indem man versucht, seine Art, die Welt zu erfahren, nachzuvollziehen, stellt sich das Gefühl von „Teilnahme an einem sozialen Prozess“ mit dieser Person ein. Dieses Gefühl ist verknüpft mit den Konstrukten, welche die „nachahmende Konstruktion“ ermöglichen. Menschen, deren frühe Erfahrungen bezüglich mitmenschlicher Kontakte schlecht sind, gelingt die Nachahmung nicht, und sie fühlen sich am sozialen Prozess wenig oder gar nicht beteiligt. Eine solche Person benutzt ihr Konstruktionssystem dazu, die andere Person von außen zu konstruieren, d. h., sie zu beschreiben, sie in ihre eigene Welt als Bestandteil einzubauen. Hier schließt sich der Kreis zwischen Konstrukttheorie und Bindungsverhalten (vgl. S. 49).
Paare mit solchen Konstrukten können sich nicht auf die Realität des anderen einlassen. Jegliches Kommunikationstraining bleibt vorerst erfolglos, weil sie die grundlegenden Konstrukte für ein gegenseitiges Verständnis zuerst verändern müssen.
1.1.2.4 Affekte8in der Konstrukttheorie
Es gibt Kritiker (z. B. Pervin 2000), die auf das Fehlen der Gefühlsebene in der Theorie Kellys hinweisen. Sader und Weber (1996) erklären jedoch, diese würden von einem zu engen Konstruktbegriff ausgehen. Da die Konstrukte bei Kelly von jeder Person selber geschaffen würden, obliege es diesen, Affekte in die Konstrukte einzubeziehen oder nicht. In die gleiche Richtung zielen Bannister und Fransella (1981, S. 18; Hervorhebung im Orig.):
„Kelly widersprach den Einwänden, die sein Theoretisieren als eines ansahen, das lediglich vom ‚denkenden‘ oder ‚ausschließlich rationalen Menschen‘ handelt, und in der Tat verhinderte sein Tod, daß er sich öffentlich dieser einschränkenden Herabsetzung seiner Arbeit hätte stellen können. [...] Kelly beabsichtigte tatsächlich, seine Konstrukttheorie so umzuschreiben, daß die grundlegenden Annahmen zwar dieselben blieben, jedoch die Sprache in einer Art und Weise geändert würde, dass sie zu einer Theorie dermenschlichen Leidenschaften (das war der von ihm für dieses Buch vorgesehene Titel) geworden wäre. Das Ziel dieses Buches wäre es gewesen, dass er das Konstrukt Denken versus Fühlen nicht akzeptierte.“
Und weiter unten (S. 25) formulieren sie:
„Kelly ist bemüht, sich mit der Art von Problemen zu beschäftigen, die in beidem, in der Alltagspsychologie und in den meisten der modernen Psychologien, im Zusammenhang mit den Konzepten von ‚Emotionen‘ oder ‚Trieb‘ oder ‚Motivation‘ behandelt werden, aber er versucht, dabei den allgemeinen Rahmen seiner eigenen Theorie nicht zu verlassen und nicht auf externe Konzepte zurückzugreifen.“
Kelly lehnte eine grundsätzliche Trennung von Kognition und Affekten ab. Gefühle haben im therapeutischen Prozess, wie ihn Kelly versteht, so viel Raum, wie die Klienten ihm zu geben wünschen. Sie existieren nicht an sich, sondern sind immer verknüpft mit zugehörigen Konstrukten und nicht abtrennbar von Wahrnehmungen, den zugehörigen Interpretationen, den Gedanken und Antizipationen sowie dem daraus abgeleiteten Handeln. Diese Überlegungen finden eine große Übereinstimmung mit Miller und de Shazer (2000), die hervorheben, dass Gefühle nicht als eigenständige Entität gesehen werden könnten. Sie seien gekoppelt mit dem Kontext, in welchem sie empfunden und gezeigt wurden. Daraus folgern sie, dass jedes Gefühl an einen Beziehungs- und Handlungskontext gebunden ist.
Auch Ciompi, der Schöpfer der Affektlogik (s. Kasten S. 34), spricht von „erfahrungsintegrierten affektiv-kognitiven Bezugssystemen“ und liegt damit sehr nahe bei Miller und de Shazer und dem Konstruktbegriff von Kelly – allerdings ohne Kelly zu erwähnen (Ciompi 1997, S. 47 f.):
„Solche erfahrungsintegrierende affektiv-kognitiven Bezugssysteme oder integrierte Fühl-, Denk- und Verhaltensprogramme, wie wir sie in der Folge bevorzugt nennen werden, reichen in ihrem Komplexitätsgrad von reflexartigen elementaren Abläufen bis zu hochkomplexen Verhaltensweisen mit zahlreichen Abwandlungsmöglichkeiten und Freiheitsgraden. Ausgehend von angeborenen Reflexschemata wie beispielsweise dem Saug- oder Greifreflex, beginnt ihre Konstruktion und Weiterdifferenzierung am ersten Lebenstag und hört virtuell während des ganzen Lebens nicht mehr auf.“
Die sprachliche Umschreibung von Ciompis „integrierten Fühl-, Denk- und Verhaltens-Programmen“ erfasst ebenso nur einen Bruchteil von ihnen, wie dies bei den
Affektlogik nach Ciompi (1997)
Ciompi postuliert eine sehr intensive Wechselwirkung zwischen Denken und Fühlen. Nach ihm gehören die beiden Funktionen untrennbar zusammen. Es gibt keinen Zustand ohne affektive Begleiterscheinung. Man kann nicht nicht gestimmt sein. Der affektive Zustand bestimmt die Art, zu denken und zu handeln. Zusätzlich zu den allgemein anerkannten Grundaffekten – die überlappen und nicht eindeutig umschrieben werden – wie Angst, Wut, Trauer, Freude, Ekel führt Ciompi den Affekt „Interesse-Neugier“ ein. Jeder Affekt ist mit einer bestimmten Logik gekoppelt, die das Denken bestimmt, d. h. beispielsweise, dass sich die Angstlogik eines Menschen von seiner Trauerlogik unterscheidet.
Ciompi spricht von „Fühl-Denk-Verhaltens-Programmen“, was bedeutet, dass in jedem Akt von Kognition oder Handeln der zugehörige Affekt mitverpackt ist. Oft sind diese Affekte unbewusst. Affekte sind evolutionär verwurzelte und gerichtete Energieverteilungsmuster.
Konstrukten der Fall ist. Den kognitiven Teil können wir gut, den emotionalen annähernd, den vorsprachlichen kaum mehr umschreiben. In Therapien oder Beratungen können letztere Anteile nur indirekt erschlossen oder erahnt werden.
Zusammenfassung
Kellys Persönlichkeitstheorie wird in einem Grundpostulat und elf ergänzenden Folgesätzen, so genannten Korollarien, umschrieben. Das Grundpostulat lautet: „Die psychischen Prozesse eines Menschen werden durch die Art und Weise, wie er Ereignisse antizipiert, gesteuert und geprägt.“ Konstrukte entstehen durch den Antrieb, Ereignisse zu antizipieren und zu beeinflussen. Die Gesamtheit der Konstrukte eines Menschen bildet ein hierarchisch strukturiertes Konstruktsystem, das aber weder in sich geschlossen noch widerspruchsfrei ist.
Um eine andere Person verstehen zu können, muss man die Fähigkeit haben, die Konstruktion der anderen Person nachzukonstruieren. Empathiefähigkeit bekommt so einen kognitiven Anteil. Ein Mensch, dessen Konstruktionssystem „Nachkonstruieren der Prozesse von anderen Personen“ nur ungenügend enthält, benutzt sein Konstruktionssystem dazu, andere Personen von außen zu konstruieren, sie in seine eigene Welt als Bestandteil einzubauen.
Kelly lehnte eine grundsätzliche Trennung von Kognition und Affekten ab. Affekte haben so viel Raum, wie die Klienten ihnen zu geben wünschen. Gefühle sind nicht abtrennbar von Wahrnehmungen, den zugehörigen Interpretationen, den Gedanken und Antizipationen sowie dem daraus abgeleiteten Handeln. Damit konvergiert Kellys Theorie mit dem Modell von Ciompi, der von „integrierten Fühl-, Denk- und Verhaltens-Programmen“ spricht.
1.1.3 Kellys Psychotherapieansatz
1.1.3.1 Grundsätze psychotherapeutischer Arbeit
Kelly spricht nicht von Psychotherapie, sondern von Rekonstruktion. Die Hinweise auf seine therapeutische Arbeit sind in seinem Gesamtwerk ziemlich verstreut. Eine Kostprobe soll zeigen, wie systemisch er arbeitete (Bannister u. Fransella 1981, S. 132):
„Bei dieser Unternehmung [der Psychotherapie; T. H.] hat der glückliche Klient einen Partner, den Psychotherapeuten. Aber der Psychotherapeut kennt die endgültige Antwort genausowenig – sie packen das Problem zusammen an. Unter diesen Umständen haben sie nichts zu tun, außer, daß beide Fragen stellen, forschen, und außer, daß beide gelegentlich Fehler riskieren. Und damit es ein wirklich kooperatives Bemühen sein kann, muß jeder versuchen zu verstehen, was er selbst bereit ist, als nächstes zu probieren.
Kelly sah die Rolle des Therapeuten darin, dem Klienten Gelegenheiten zur Validierung seiner Konstrukte zu geben. Diese können innerhalb oder außerhalb des Beratungssettings liegen. Dass diese Form von Therapie hinsichtlich der Rekonstruktion der Konstrukte anspruchsvoll ist, geht aus folgendem Zitat (Kelly 1986, S. 172) hervor. Die Ausgangsfrage ist, wie der Therapeut reagieren soll, wenn der Klient beispielsweise die Frage stellt: „Glauben Sie nicht auch, dass meine Frau unmöglich ist?“
„Der Therapeut muß fortwährend darauf achten, welche Konstrukte gerade ‚ausprobiert‘ werden, und versuchen, die Verfügbarkeit von Daten im Hinblick darauf zu lenken, was für das Konstrukt wichtig ist, das gerade verwendet wird. Die obenerwähnte Frage des Klienten kann auf viele andere Konstrukte als das explizit ausgedrückte hindeuten. Zum Beispiel könnte man so interpretieren: ‚Ich bin doch nicht so ein schlechter Ehemann, oder?‘ Sie kann bedeuten: ‚Sie werden mir helfen, mich vor meiner Frau zu schützen, nicht wahr?‘ Sie bedeutet vielleicht: ‚Sie sind ein besserer Freund als meine Frau, nicht wahr?‘ Oder: ‚Alles wird in Ordnung kommen, wenn ich meine Frau loswerde, nicht wahr?‘ Wenn der Therapeut eine Antwort gibt, ist es gut, wenn er weiß, welche Frage er gerade beantwortet. Natürlich ist das nicht immer möglich.“
Der Therapeut versucht, sich in die Konstruktwelt des Klienten einzufühlen, indem er anhand geeigneter Fragen die Konstrukte, auf welchen der Klient seine Frage aufgebaut hat, nachzuvollziehen versucht. Kelly bezeichnet Klient und Therapeut als Team, das zusammen experimentiert und versucht, jene Konstrukte umzubauen, deren Anwendungsbereich nicht mehr genügt.