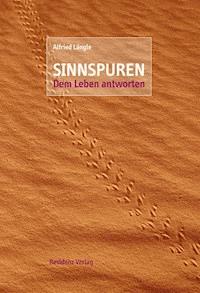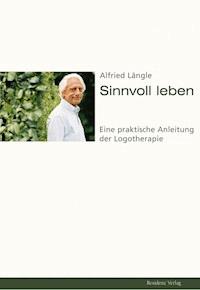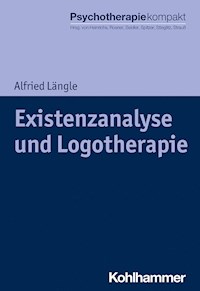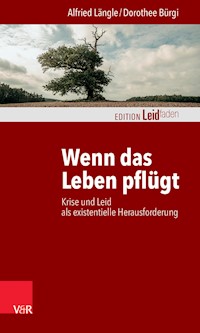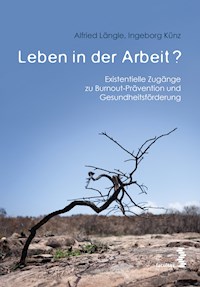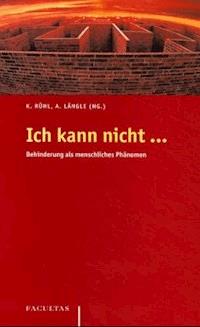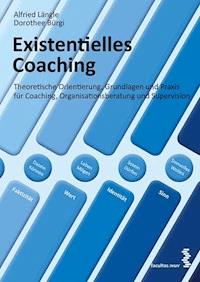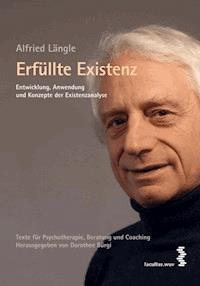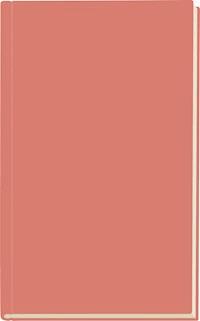20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Facultas
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Mit diesem Lehrbuch liegt die erste systematisierte und umfassende Darstellung der Grundlagen der „Existenzanalyse und Logotherapie“ vor. Die Form der Darstellung ist für das Studium und die beraterisch-therapeutische Praxis aufbereitet. Die konsequente Verknüpfung von Theorie und Methoden, die ausführliche Schilderung und Kommentierung von praktischen Anwendungsmöglichkeiten sowie die Einbeziehung und Diskussion von Fallbeispielen machen das Buch darüber hinaus zu einem unentbehrlichen Nachschlagewerk.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Alfried Längle
Lehrbuch zur Existenzanalyse
Grundlagen
Der Autor
Dr. med. Dr. phil. Alfried Längle,
Arzt für Allgemeinmedizin und psychotherapeutische Medizin, Psychotherapeut, Professor an der Psychologischen Fakultät der HSE Moskau, Dozent an der psychologischen Fakultät Klagenfurt, mehrere Ehrenprofessuren und Ehrendoktorate.
Er ist Präsident und Gründungsmitglied der Internationalen Gesellschaft für Existenzanalyse und Logotherapie (GLE-Int) und führt eine psychotherapeutische Praxis in Wien.
Lehrausbildner für Psychotherapie, Beratung und Coaching, Supervisor.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Angaben in diesem Fachbuch erfolgen trotz sorgfältiger
Bearbeitung ohne Gewähr, eine Haftung des Autors oder
des Verlages ist ausgeschlossen.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und
der Verbreitung sowie der Übersetzung, sind vorbehalten.
3., korrigierte Auflage 2024
Copyright © 2013 Facultas Verlags- und Buchhandels AG
facultas Universitätsverlag, Stolberggasse 26, 1050 Wien, Österreich
Porträt und Umschlagbild: Regina Längle
Lektorat: Sabine Schlüter, Wien
Satz: Florian Spielauer, Wien
Druck und Bindung: Facultas Verlags- und Buchhandels AG, Wien
Printed in Austria
ISBN 978-3-7089-2536-3 (Print)
ISBN 978-3-99111-953-1 (E-Pub)
Inhalt
Vorwort
Einführung
1 Was sind Existenzanalyse und Logotherapie?
1.1 Die Wurzeln der Existenzanalyse und Logotherapie
1.2 Definition von Existenzanalyse
1.2.1 Was heißt Existenz?
1.2.2 Allgemeine Definition von Existenzanalyse
1.2.3 Aufgabenbereiche der Existenzanalyse
1.2.4 Psychotherapeutische Definition von Existenzanalyse
1.3 Definition von Logotherapie
2 Grundlagen der Existenzanalyse
2.1 Die erlebnisbezogene Definition der Existenzanalyse
2.2 Das existenzanalytische Prinzip der Lebensaffirmation
2.3 Das existenzanalytische Basistheorem: die dialogische Beziehung zur Welt und zu sich selbst
2.3.1 Die existentielle Situation – das dialogische Grundmodell von Existenzanalyse und Logotherapie
2.3.2 Die personale Situation
2.4 Der Weg zu erfüllendem Leben – zentrale Folgerungen aus dem Existenzverständnis
2.4.1 Die Voraussetzung für erfüllende Existenz
2.4.2 Bereiche des Dialogs
2.4.3 Befähigung zum Dialog
2.5 Das Spezifische von Logotherapie und Existenzanalyse
2.5.1 Kennzeichen der Logotherapie
2.5.2 Kennzeichen der existenzanalytischen Vorgehensweise
2.6 Überblick über die personal-existentiellen Grundmotivationen
3 Strukturmodell und Prozessmodell der Existenzanalyse: die Grundmotivationen und die Personale Existenzanalyse (PEA)
3.1 Das Strukturmodell der Existenzanalyse: die vier personal-existentiellen Grundmotivationen im Einzelnen
3.1.1 Erste Grundmotivation – der Weltbezug gibt der Existenz ontologischen Halt
3.1.2 Zweite Grundmotivation – der Lebensbezug wird zur Wertebasis
3.1.3 Dritte Grundmotivation – der Selbstbezug als Ursprung der Authentizität (Selbstfindung)
3.1.4 Vierte Grundmotivation – der Sinn als Perspektive der Tat
3.1.5 Überblicksschema über die vier Grundmotivationen
3.2 Das Prozessmodell der Existenzanalyse: die Personale Existenzanalyse (PEA)
3.2.1 Aufgabe, Ziel und Grundlage der Personalen Existenzanalyse (PEA)
3.2.2 Die Beschreibung der Detailschritte der PEA
3.2.3 Indikation und Voraussetzung für die Personale Existenzanalyse (PEA)
3.2.4 Rahmenbedingungen der Anwendung
4 Existenzanalyse als Psychotherapie
4.1 Verhältnis von Existenzanalyse und Logotherapie
4.1.1Das Verhältnis von Existenzanalyse und Logotherapie aus historischer Sicht
4.1.2 Das Verhältnis von Existenzanalyse und Logotherapie aus methodischer Sicht
4.1.3 Das Verhältnis von Existenzanalyse und Logotherapie aus inhaltlicher Sicht
4.2 Anwendungsgebiete und Indikation von Existenzanalyse und Logotherapie
4.2.1 Prozesshafte Indikationsstellung
4.2.2 Nosologisch-kategoriale Indikationsstellung
4.2.3 Anwendungsweise
4.3 Der Fokus existenzanalytischer Therapie
4.4 Die Einordnung der Existenzanalyse in die Hauptrichtungen der Psychotherapie
4.4.1 Ist die Existenzanalyse eine humanistische Psychotherapie?
4.5 Verstehen und Erklären in der Psychotherapie
4.5.1 Existenzanalyse als phänomenologische Richtung ist primär verstehende Therapie/Beratung
4.5.2 Was sind Verstehen und Erklären?
4.5.3 Unterschied zwischen Ursache und Grund
4.5.4 Deterministische und indeterministische Modelle
4.6 Existenzanalytisches Verständnis einer Ausbildung in Existenzanalyse und Logotherapie
5 Der Hintergrund der Existenzanalyse
5.1 Zur Entwicklungsgeschichte der Existenzanalyse und Logotherapie
5.1.1 Psychotherapiegeschichtliches und problemgeschichtliches Verständnis
5.1.2 Geistes- und kulturgeschichtlicher Entwicklungshintergrund
5.1.3 Der lebensgeschichtliche Hintergrund Frankls als Element in der Entwicklung der Logotherapie
5.1.4 Geschichte der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse in Stichworten
5.2 Der philosophische Hintergrund von Existenzanalyse und Logotherapie
5.2.1 Die Psychologie hat philosophische Fundamente
5.2.2 Die Beziehung der Existenzanalyse zur Philosophie
5.2.3 Die philosophischen Inspirationen in Logotherapie und Existenzanalyse
5.2.4 Der Einfiuss der Ontologie Nicolai Hartmanns
5.2.5 Der Einfiuss der Phänomenologie
5.2.6 Der Einfiuss der Existenzphilosophie
5.2.7 Weitere philosophische Einfiüsse
6 Systematische Anthropologie der Existenzanalyse und Logotherapie
6.1Aufriss der Logotherapie nach einem Schema von Frankl: die 4 E
6.2 Das dimensionale Menschenbild
6.2.1 Das dreidimensionale Menschenbild nach Frankl
6.2.2 Zur Wahl eines dimensionalen Modus der Beschreibung des Menschen
6.3 Das Menschenbild unter existentiellen Gesichtspunkten
6.3.1 Betonung der Einheit der „Dimensionen“
6.3.2 Analogiebilder zur Anthropologie
6.4 Die anthropologischen Dimensionen im Spiegel der Grundmotivationen
6.4.1 Dynamik aus der Integration der Dimensionen
7 Die psychometrischen Verfahren der Existenzanalyse und Logotherapie
7.1 Existenzskala (ESK)
7.2 Test zur Existentiellen Motivation (TEM-R)
7.3 Test zur Existentiellen Lebensqualität (ELQ)
7.4 Andere psychometrische Verfahren der Logotherapie und Existenzanalyse
7.4.1 Logo-Test
7.4.2 Purpose in Life Test (PIL)
8 Einführung in die Motivationslehre
8.1 Definition und Begriffsklärung: Was ist „Motivation“?
8.2 Gemeinsamkeiten der verschiedenen Motivationen – Differenzierung zwischen Noodynamik und Psychodynamik
8.3 Psychische und personal-existentielle Motivationen
8.4 Motivationskonzepte einiger psychotherapeutischer Schulen
9 Berater und Psychotherapeuten als professionelle Helfer
9.1 Was ist ein „Problem“?
9.2 Was ist Hilfe?
9.3 Berufsbildfrage (Anforderungsprofil)
10 Literatur
10.1 Verwendete Literatur
10.2 Weiterführende Literatur
11 Übungsfragen
12 Namensregister
13 Sachregister
Vorwort
Die Existenzanalyse hat sich in den letzten 35 Jahren als eigenständiges psychotherapeutisches Verfahren erheblich weiterentwickelt und kommt heute neben der Psychotherapie und der Lebensberatung in weiteren Bereichen zur Anwendung, etwa in der Pädagogik, im Coaching, im Management, in Supervision und Teamberatung oder in der Mediation. Umso wichtiger wird es, die Grundlagen dieses Zugangs zum Menschen kompakt darzustellen, sodass diese Studierenden wie Interessierten für Arbeit und persönliche Weiterentwicklung und Lebensgestaltung zur Verfügung stehen.
Mit diesem Grundlagenband Existenzanalyse (mit einigen Hinweisen und Verbindungen zur Logotherapie) soll die Basis für eine Reihe geschaffen werden, in der die Inhalte der Existenzanalyse und Logotherapie praxisbezogen und didaktisch aufbereitet der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Bereits seit 30 Jahren werden diese Inhalte in den Ausbildungen für Psychotherapie und Lebensberatung so gelehrt. Der Erfahrungsschatz dieser lehrenden Vermittlung ist in diese Bände aufgenommen worden – ein Dank gilt den vielen Generationen von Ausbildungskandidaten und Ausbildnern der GLE-International, die zu dieser wertvollen Erfahrung beigetragen haben.
Ein besonderer Dank gebührt Mag. Verena Buxbaum, die dieses Buch mit großer Genauigkeit, Liebe, Sachwissen und sprachlichem Geschick redigiert und für die Inhalte eine Form gefunden hat, die Zugang und Verständnis erheblich erleichtern. Ihre zahlreichen Hinweise, Anregungen, Kritiken waren unzählige Male Anlass, Gliederungen, Formulierungen und Gedanken neu zu adaptieren, zu verändern, wegzulassen und zu ergänzen. Das hat den didaktischen Wert des Buches sehr verbessert.
Wien, im Juli 2024
Alfried Längle
Einführung
Dieses Lehrbuch soll in die Grundlagen der Existenzanalyse einführen, eine Psychotherapierichtung mit existentiellem Menschenbild. Gerade auch dieser Hintergrund macht die Existenzanalyse vielseitig anwendbar, wie z. B. in Lebensberatung, Coaching, Leadership, Pädagogik, Prävention oder Sterbebegleitung. So können die hier vorgestellten Grundlagen über die Psychotherapie hinaus von Interesse sein.
Das Besondere an der Existenzanalyse ist, dass sie ursprünglich nicht aus der experimentellen Empirie erwachsen ist, sondern aus systematischen Reflexionen über das Wesen des Menschen, also über das, was ihn ausmacht, wie er sich in dieser Welt verstehen und ganzheitlich verwirklichen kann. Der Begründer der Existenzanalyse, der Wiener Psychiater Viktor Frankl (1905–1997), hat damit versucht, die psychotherapeutische und psychiatrische Praxis von der Philosophie her zu befruchten und durch ein Verständnis des Menschen zu ergänzen, das nicht nur die Entwicklung von psychischen Störungen erklären kann, sondern auch ein „geistiges Rüstzeug“ für die Bewältigung seelischer Not bereitstellt. Für Frankl gipfelte die praktische Anwendung der Existenzanalyse in der Sinnfindung – er nannte sie Logotherapie. In der Existenzanalyse heute ist das Verständnis des Menschseins und der Wege, wie der Mensch zu einer erfüllten Existenz gelangen kann, nicht mehr allein an die logotherapeutische Hauptmotivation „Sinn“ gebunden, sondern thematisch erweitert. Mit der Entdeckung dreier weiterer existentieller Grundmotivationen ist die Theorie der Existenzanalyse auf eine breitere Basis gestellt worden, die der heutigen Existenzanalyse als Strukturmodell zugrundeliegt. Die Erweiterung der theoretischen Grundlagen führte auch zur Entwicklung zusätzlicher Vorgehensweisen und Methoden. Vor allem ist in diesem Zusammenhang die systematische Einbindung des phänomenologischen Vorgehens zu erwähnen.
Die Grundlagen der heutigen Existenzanalyse, die in ihrer Weiterführung das Frankl’sche Konzept miteinschließen, werden in diesem Buch praxisnahe dargestellt. So wird auf die Entwicklung der Existenzanalyse und ihrer historischen Aufgabe eingegangen und es erfolgen Beschreibungen ihrer wichtigsten Inhalte aus unterschiedlichen Perspektiven. Dabei werden Themen wie Dialog, Verstehen, Erklären, Helfen, Problemfindung, Motivation usw. vertiefend angesprochen. Ein kurzer Einblick in die Philosophie soll die Bedeutung und Hintergründe der Anbindung der Existenzanalyse an die Philosophie erhellen. Ebenso werden die gebräuchlichen psychometrischen Verfahren erklärt.
1 Was sind Existenzanalyse und Logotherapie?
Was Sie in diesem Kapitel erwartet
Existenzanalyse bezieht die personale (geistige) Dimension des Menschen in Psychotherapie und Beratung ein
Existenzanalyse und Logotherapie wurzeln im Lebenswerk Viktor Frankls, der unter Bezugnahme auf die Existenzphilosophie eine Ergänzung zur gängigen Psychotherapie geschaffen hat, die die geistige Dimension des Menschen miteinbezieht.
Die Verwurzelung in einer philosophischen Basis hat zur Folge, dass Erkenntnisse nicht nur aus experimentellen Studien, sondern auch aus systematischer Reflexion über das Wesen des Menschen gewonnen werden. So kommt es zu einer Gleichwertigkeit und gegenseitigen Befruchtung von Theorie und Praxis.
Von der Logotherapie als „Ergänzung zur Psychotherapie“ hat sich die Existenzanalyse über die Jahrzehnte zu einer eigenständigen Psychotherapierichtung entwickelt. Diese wird mit dem Begriff Existenzanalyse bezeichnet, während der Begriff Logotherapie für die Beratung bzw. Behandlung der Sinnthematik vorbehalten ist.
Der Begriff „Existenz“ bezeichnet das Besondere unseres Daseins, das darin besteht, im Erleben, Denken und Handeln nicht festgelegt zu sein. Darum steht der Mensch unablässig in einem Dialog mit seiner aktuellen Situation, die ihn als Person „an-geht“ bzw. „an-spricht“. Durch die in Freiheit und Verantwortung gestaltete Begegnung mit ihr „ent-steht“ seine „Ex-sistenz“.
Existenzanalyse kann definiert werden als eine phänomenologisch-personale Psychotherapie mit dem Ziel, der Person zu einem (geistig und emotional) freien Erleben, zu authentischer Stellungnahme und zu eigenverantwortlichem Umgang mit ihrem Leben und ihrer Welt zu verhelfen.
Allgemein betrachtet ist Existenzanalyse eine Analyse der Bedingungen, um zu einer erfüllenden Existenz zu gelangen.
Lernziele
Am Ende des Kapitels sollten Sie wissen bzw. verstanden haben,
• aus welchen Wurzeln theoretischer und praktischer Natur sich die Existenzanalyse entwickelt hat.
• was die Begriffe Existenzanalyse und Logotherapie bezeichnen und welchem Bedeutungswandel diese beiden Bezeichnungen unterworfen waren.
• welche Bedeutung die Unterscheidung von Theorie und Praxis in der Existenzanalyse hat und wie sie sich in ihren Aufgabenbereichen widerspiegelt.
• Welche Rolle die Sinnthematik in der Entwicklung von Logotherapie und Existenzanalyse gespielt hat und welchen Platz sie heute einnimmt.
Existenzanalyse (EA) und Logotherapie (LT) sind zwei von Viktor E. Frankl in die Psychotherapie eingeführte Begriffe zur Bezeichnung der von ihm begründeten Psychotherapiemethode.1 „Die Logotherapie und die Existenzanalyse sind je eine Seite ein und derselben Theorie. Und zwar ist die Logotherapie eine psychotherapeutische Behandlungsmethode, während die Existenzanalyse eine anthropologische Forschungsrichtung darstellt.“ (Frankl 1959, 663)
„Logos“ bedeutet Sinn
Zwei Begriffe zur Bezeichnung einer Richtung. Frankl bezeichnete mit „Existenzanalyse“ also ursprünglich2 den theoretischen Hintergrund und mit Logo-„therapie“ die praktische Anwendung dieser Theorie, die auf eine sinnorientierte Behandlung ausgelegt ist. Von daher stammt der etwas ungewöhnliche Umstand, dass zwei verschiedene Begriffe zur Bezeichnung ein und derselben Therapierichtung verwendet wurden. Der Begriff „Logos“ wurde von Frankl in der in der Philosophie gängigen Bedeutung von „Sinn“ verwendet. Somit wollte er mit dem Begriff der „Logotherapie“ die zentrale Stelle der Sinnfindung für das menschliche Leben und für die Psychotherapie unterstreichen. Mit anderen Worten: Eine Existenzanalyse, die auf das praktische Leben bezogen ist, gipfelt in Frankls Theorie in persönlich empfundenem und gelebtem Sinn: „Sofern ich existiere, existiere ich auf Sinn und Werte hin.“ (Frankl 1975, 371)
Existenzanalyse – Suche nach Freiheit und Verantwortung
Auf die Methode bezogen bedeutet das: In der Existenzanalyse geht es um das Bewusstmachen („Analyse“) der Freiheit (Frankl 1975, 271) und des Verantwortlichseins „als Wesensgrund der menschlichen Existenz“ (Frankl 1946a, 39). Verantwortung ist bei Frankl jeweils Verantwortung gegenüber einem Sinn (Frankl 1946a, 39), wodurch der Bogen von der Existenzanalyse zur Logotherapie geschlagen ist. Denn ohne Sinn, ja ohne letzten Sinn gäbe es auch keine Verantwortung (Frankl 1946a, 221). Das ist ein Grundgedanke der Existenzphilosophie. Frankl persönlich sah diesen letzten Sinn in Gott. Im Existentialismus ist dies z. B. die Würde des Menschen angesichts der Absurdität (Sartre 1946). In der Existenzanalyse und Logotherapie ist der letzte Bezug als Glaubensthema der ganz persönlichen Entscheidung überlassen. Diese Entscheidung der Person nicht durch Vorgaben oder Therapie abzunehmen, wird als wichtig für die eigene Existentialität angesehen.
1.1 Die Wurzeln der Existenzanalyse und Logotherapie
Einbeziehung der personalen (d. h. „geistigen“) Dimension in die Behandlung
Logotherapie als „Ergänzung“ zur Psychotherapie. Frankl (2005, 249; auch in 1959, 704; 1946a, 242, 25, 18; 1982, 42 f., 103) wollte mit der Logotherapie eine „Ergänzung“ zur Psychotherapie der damaligen Zeit schaffen und ein Korrektiv zu ihrer einseitigen Ausrichtung auf innerpsychische Mechanismen bilden. Die Wichtigkeit der (unbewussten) Triebdynamik für die psychische Entwicklung und für die Erhaltung des menschlichen Lebens wurde von Frankl damit nicht infrage gestellt, aber auch nicht sonderlich betont, da diese Aufgabe ohnehin von der Tiefenpsychologie wahrgenommen wurde. Als Aufgabe der Logotherapie jedoch sah er die Einbeziehung der „geistigen Dimension des Menschen“ (insbesondere die aus ihr stammende Sinnsuche) in das Verständnis und in die psychologische Behandlung des Menschen an. Damit wandte sich Frankl gegen die Reduktion des Menschen auf nur psychische Mechanismen. Dies würde seinem (geistigen) Wesen – seinem freien Person-sein und seinem Verlangen nach einem Sinnverständnis insbesondere des Leidens, aber auch des Lebens in seiner Ganzheit – nicht gerecht, würde es verfremden. Die Psychotherapie ließe den Menschen sonst abseits der Behandlung der Störungen und Krankheiten in seiner tiefen geistigen Not der Daseinsbewältigung allein. Denn wenn der Mensch das Leben nicht mehr als lohnend empfindet und keinen Sinn mehr darin sieht, fällt er der Verzweiflung anheim. Psychotherapie, die von einem reduktionistischen Menschenbild ausgeht, lässt diesen spezifisch humanen Aspekt des Menschseins offen bzw. behandelt ihn nicht adäquat.
Korrektiv zu reduktionistischen Menschenbildern
Frankl selbst hatte persönlich unter einem reduktionistischen Menschenbild gelitten (Frankl 1995, 40; Längle 1998a, 244 ff.). Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung empfand er ein tiefes Bedürfnis, Menschen in seelischer Not – d. h. letztlich allen, auch den rein körperlich Erkrankten – Beistand zu leisten bei der geistigen Suche nach einem „Wozu“ des Leidens. Logotherapie sollte nicht nur Psychotherapie und Psychiatrie ergänzen, sondern ein Werkzeug für alle Ärzte bzw. helfenden Humanberufe sein. Frankl nannte darum sein erstes Buch (1946a) über Logotherapie „Ärztliche Seelsorge“. Damit wies er darauf hin, dass die Behandlung seelischer Not auch Aufgabe des humanen Arztes3 und nicht nur Aufgabe der Priester sei.4
Psychologismuskritik
Auseinandersetzung mit der Tiefenpsychologie. Die Anfänge der Logotherapie und Existenzanalyse gehen somit auf die Auseinandersetzung mit der Tiefenpsychologie der 1920er- und 1930er-Jahre zurück, insbesondere auf die Psychologismuskritik (siehe auch Kap. 4.1 sowie Kriz 2007). Logotherapie und Existenzanalyse wurden geschaffen, um das „geistige“ Defizit in der Behandlung des Menschen auszugleichen und dem Person-Sein mit seinen Grundeigenschaften des dialogischen Austauschs, des Beachtens der Stimmigkeit in Freiheit und Verantwortung und der Sinn-Suche mehr Gewicht zu geben. Die „Existenzanalyse“ war der Gegensatz bzw. die Ergänzung zur „Psycho-analyse“.5Die Logotherapie als die praktische Umsetzung dieser „anthropologischen Grundlagen der Psychotherapie“6 wurde zur „sinnzentrierten Psychotherapie“.
Existenzphilosophie und Phänomenologie als philosophische Basis. Die Frankl’sche Logotherapie und Existenzanalyse sind für Nichtphilosophen anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, besonders weil die Begrifflichkeit zum Teil nicht leicht verständlich ist. Das kommt daher, dass es sich um eine Psychotherapierichtung handelt, die sich hauptsächlich auf philosophische Grundlagen bezieht (Frankl 1925; 1938; 1967; 1975, 22). Auch die heutige Existenzanalyse hat Verbindungen zur Existenzphilosophie und basiert auf der Phänomenologie. Im Zentrum der Existenzanalyse steht der Begriff der Existenz.
Existenzanalyse als eigenständige psychotherapeutische Richtung. In den 80er- und 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelte sich in der in Wien ansässigen Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse eine auf der Logotherapie Frankls aufbauende eigene psychotherapeutische Richtung. Weil diese auf einem neuen, nämlich phänomenologischen Paradigma beruht, umfasst sie neben der Sinnproblematik auch andere existentielle Themen. Sie hat ein breiteres theoretisches und methodologisches Verständnis und entwickelte eine hinsichtlich Inhalt, Methode und Selbsterfahrung darauf abgestimmte Ausbildung. So konnte die Existenzanalyse erstmals den heutigen Anforderungen an ein Psychotherapieverfahren gerecht werden und erhielt in der Folge auch staatliche Zulassungen in Österreich sowie (unter denjenigen Ländern, in denen die Psychotherapie gesetzlich geregelt ist) in der Schweiz, in Tschechien, Rumänien und Chile sowie akademische Lehrbefugnisse in Russland und Argentinien.
EA bezeichnet psycho therapeutische Behandlung, LT hat Fokus auf Sinn problematik
Im Rahmen dieser Weiterentwicklung wurde von der GLE-International die Begriffsdualität in der Weise aufgelöst, dass jener Bereich, der sich der Sinnthematik widmet, weiterhin mit Logotherapie bezeichnet wird, während das gesamte Feld der anderen Themen unter den Begriff Existenzanalyse fällt. In der Psychotherapie geht es schwerpunktmäßig um die Bearbeitung ursachenspezifischer Defizite oder Blockaden, die zu Ängsten, Depressionen, Verletzungen, blockierten Entwicklungen, psychodynamischen Schutzreaktionen, Unverständnis usw. führen, und nur selten um Sinn. Die Sinnfrage taucht als Begleitphänomen psychischer Störungen durchaus auf, ist aber praktisch nie die primäre Ursache psychischer Krankheiten. Taucht die Sinnfrage auf, kommt Logotherapie als begleitende Behandlung zum Zug. Diese in der GLE-International ab 1990 verwendete Terminologie liegt auch der Begrifflichkeit in diesem Buch zugrunde.
Theoretischer Hintergrund und psychotherapeutische Praxis. Die Unterscheidung zwischen anthropologischer Forschung (Theorie) und konkreter psychotherapeutischer Behandlungsmethode (Praxis) bleibt inhaltlich weiterhin relevant. Sie bedeutet, dass es analog zur philosophischen Anthropologie in der Existenzanalyse auch um das Wesen des Menschen, seine geistige Dimension und seine Stellung in der Welt geht und nicht nur um seine psychische Verfassung, um Störbilder und Verhaltensweisen. Die folgenden Definitionen sollen jeweils einen der beiden Blickwinkel – den allgemein-theoretischen und den konkret-praktischen (psychotherapeutischen) – einnehmen und somit „die zwei Seiten einer Medaille“ erhellen.
1.2 Definition von Existenzanalyse
1.2.1 Was heißt Existenz?
Existenz ist der Kernbegriff der Existenzanalyse. Mit Existenz wird eine zentrale Eigenschaft des Menschseins bezeichnet, nämlich dass er nicht einfach „da“ ist (i. S. v. „vorhanden“ wie jeder Gegenstand), sondern dass sein Dasein durch die Auseinandersetzung mit sich und allem „anderen“ (Mensch, Tier, Natur …) in jeder Situation immer aufs Neue „entsteht“.7 Diese Auseinandersetzung hat die Charakteristik eines Dialogs, d. h. eines Verstehens, Stellungnehmens und Antwortens eines Ichs angesichts eines Gegenübers. Dadurch steht der Mensch stets in einer Situation, worin er zum Umgang sowohl mit sich selbst als auch mit seiner Welt kommt. Ein solches Existenzverständnis stellt den Dialog und die Wesens-Freiheit des Menschen in den Mittelpunkt des Daseins: Der Mensch muss sich ständig (bewusst oder unbewusst-spontan) entscheiden und steht dadurch in der Verantwortung sich selbst und dem „anderen“ gegenüber. Er ist somit (Mit-)Gestalter seines Daseins. Denn jede Situation „geht“ ihn als Person etwas „an“ – man ist im Grunde vom Leben ständig „persönlich angesprochen“. Aufnehmend und im entschiedenen Handeln antwortend, vollzieht der Mensch seine Existenz. Im Kern bedeutet Existenz in jeder Situation die eigene Antwort darauf zu finden und sie zu leben.
Unter Existenz wird in der Existenzanalyse eine dialogische Verfassung des Menschen verstanden, die in dieser Offenheit zu einem Verstehen, zu Stellungnahmen und einem Antwortverhalten sich selbst und dem „anderen“ gegenüber führt. Dadurch erlebt der Mensch sein Handeln als das seinige und sich als Mitgestalter seines Daseins.
Existenz kann daher als sinnvoller, in Freiheit und Verantwortung gestalteter Lebensvollzug bezeichnet werden. Oder ganz knapp: Existenz als Lebensvollzug mit innerer Zustimmung.
Der Existenzbegriff betont, dass der Mensch nicht festgelegt, sondern weltoffen ist (Bauer 2016, 2017; Scheler 1928). Heidegger (1927) beschreibt drei Charakteristika der Existenz. Zum einen wählt der Mensch sein Sein, indem er Möglichkeiten und Werte in jeder Situation ergreift oder verwirft. Er nennt das die Existentialität des Menschen. Dabei entscheidet er sich immer aus seinem Verstehen seines Seins. Zweitens hilft ihm dabei seine emotionale Befindlichkeit und Gestimmtheit. Sie erschließt die Situation und spiegelt zugleich das Verhalten zu sich selbst. Schließlich befindet sich der Mensch jedoch zumeist in einer Alltäglichkeit eines betriebsamen Lebens, das weitgehend von der Öffentlichkeit und den Aufgaben bestimmt ist. Wenn er ihr verfällt, verliert er sich. Dieser Gefahr kann er nie ganz entkommen (vgl. Lleras 2020).
Etwas detaillierter betrachtet beinhaltet der Existenzbegriff in dieser dialogisch verfassten Begegnung einen Prozess. Dieser setzt an beim Vernehmen (Nous) dessen, was von außen als Aufforderung der Situation (Frankl 1946a, 72) und von innen von seinem Selbstsein verstanden wird, verläuft über eine (innere und äußere) dialogische Auseinandersetzung zur Entscheidungsfindung und mündet in ein Heraustreten (ex-sistere) und sich Einlassen auf Anderes (vgl. die Methode der PEA, Kap. 3). Durch seine Entscheidungen (Wille) gestaltet der Mensch „seine“ Welt und sein eigenes Sein. Es „ent-steht“ sein spezifisches Da-Sein, hebt sich aus dem bloßen Vorhandensein heraus.
Die Existenzanalyse beschreibt konkret vier Dimensionen der Existenz, die als Grundfragen der Existenz die Grundbedingungen des Existieren-Könnens erfassen. Sie sind Voraussetzungen für den Existenz-Vollzug in der situativen Begegnung. Da sie das Dasein stets durchziehen, bewegen sie den Menschen in seiner Existenz unablässig. Darum werden sie subjektiv als Grundmotivationen erlebt und sind für Therapie und Psychopathologie grundlegend (s. Kap. 3).
Der Mensch – nicht nur „getrieben“ von (unbewussten) Kräften, sondern auch „gezogen“ von Werten
Was führt zur Existenz? Wenn der Mensch unter diesem Blickwinkel gesehen wird, sind somatische, psychische und psychodynamische Fragestellungen (wie z. B. Gesundheit, Intelligenz, Lernvorgänge oder die Befriedigung von Triebspannungen) Bausteine und Mittel, aber nicht eigentliches Ziel sinnvoller Existenz. Sowohl die verhaltenstheoretische als auch die psychodynamische Betrachtung erfahren damit eine diametrale Wendung: Nicht nur unbewusste Konditionierungen und Kräfte lenken und treiben den Menschen, sondern die „Werte in der Welt“ ziehen ihn an. Sie zu erleben oder sie zu gestalten, ist „Existenz“. Dabei wird das Sinnbedürfnis (der „Wille zum Sinn“ in Frankls Terminologie) als primäre menschliche Motivationskraft von diesen Werten8 angesprochen. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es einer „Existenz-Befähigung“ durch die Schaffung der Grundbedingungen menschlicher Existenz. Das Streben danach wird als personal-existentielle Grundmotivation bezeichnet.
Existenz geschieht nur in der Welt. Eine existentielle Betrachtung des Menschen sieht diesen nie isoliert, sondern immer in dialogischer Eingebundenheit in seine Wertbezüge (vgl. z. B. Längle 1988b, 10 ff.). Der Mensch braucht den anderen und die Welt zu seiner Ergänzung. Den Menschen ganzheitlich zu sehen heißt daher Folgendes:
„Ganz“ ist der Mensch der Existenzanalyse zufolge nicht aus sich selbst, auch wenn er gesund ist und alle Triebe befriedigt sind. Der Mensch ist als Person (d. h. als geistiges Wesen) darauf hin angelegt, über sich selbst hinauszugehen und sich anderem (Dingen, Menschen, Aufgaben) zuzuwenden. Darin findet er seine existentielle Erfüllung.
Selbsttranszendenz – über sich hinaus gehen.
Frankl (1975, 10) formulierte diesen zentralen Gedanken des existenzanalytischen Menschenbildes, den er als Selbst-Transzendenz bezeichnet, so: „Der Mensch ist immer schon ausgerichtet und hingeordnet auf etwas, das nicht wieder er selbst ist, sei es eben ein Sinn, den er erfüllt, oder anderes menschliches Sein, dem er begegnet. So oder so: Menschsein weist immer schon über sich selbst hinaus, und die Transzendenz ihrer selbst ist die Essenz menschlicher Existenz.“
1.2.2 Allgemeine Definition von Existenzanalyse
Wenn man die Aufmerksamkeit auf den Menschen als einen „in der Welt Seienden“ richtet, lässt sich Existenzanalyse so definieren:
Existenzanalyse ist eine Analyse der Bedingungen für eine erfüllende Existenz.
Diese weiteste Definition von Existenzanalyse gibt eine erste, noch sehr philosophisch gehaltene Aufschlüsselung dieses Begriffs. Um den nicht leicht zu verstehenden Terminus der „Existenz“ etwas plastischer zu machen, ist es hilfreich, ihn von seinem Gegenteil her zu betrachten.
Existieren versus Vegetieren. Existenz bzw. existieren meint praktisch gesehen einen Lebensvollzug, der wahrscheinlich am leichtesten im Gegensatz zum bloßen „Vegetieren“ erklärt werden kann. Das umgangssprachlich verwendete „Vegetieren“ meint einen Zustand, bei dem man sich nicht mehr über die Bedingungen des Lebens erheben kann, sondern sich ihnen als Opfer ausgeliefert fühlt. Man ist mehr oder weniger mit dem Überleben beschäftigt. Solche Zustände kennt jeder Mensch z. B. bei Erschöpfung, schwächender Krankheit, starken Schmerzen, Ängsten, Sorgen u. ä.
‚vegetieren’ – ausgeliefert sein; ‚existieren’ – mit Entschiedenheit handeln
Offene Auseinandersetzung und Stellungnahmen zum eigenen Leben macht es erfüllender
Existenz ist persönliche Auseinandersetzung mit sich und der Welt. Geschieht dies „echt“, also indem persönliches Erleben und Empfinden, eigene Stellungnahmen und persönliche Werte einbezogen werden, und erfolgt dies in wahrhaftigem Bezug zu den Gegebenheiten und in Offenheit zu den größeren Kontexten, in denen wir stehen (Sinn), dann besteht die größte Wahrscheinlichkeit, dass Existenz auch erfüllend erlebt wird. – Dahin zu führen und zu helfen, diese Möglichkeiten zu schaffen, ist Ziel und Aufgabe der Existenzanalyse.
1.2.3 Aufgabenbereiche der Existenzanalyse
Aus dieser ersten Beschreibung können bereits Aufgaben der Existenzanalyse abgeleitet werden. Denn eine solche „Analyse der Bedingungen“, um zu einer erfüllenden Existenz zu gelangen, ist sowohl theoretisch als auch praktisch durchzuführen.
Theorie und Praxis als zwei Aufgabenbereiche. Jede Psychotherapie – so auch die Existenzanalyse – hat unter praxeologischen (= handlungstheoretischen) Gesichtspunkten zwei Aufgabenbereiche abzudecken, nämlich 1. die Entwicklung einer Theorie, eines Verstehens des Menschseins, aus der 2. das Vorgehen für die Praxis abgeleitet und begründet wird. Die beiden Bereiche sind in sich kohärent und empirisch validiert. Wenden wir diese Grundlage auf die Existenzanalyse an, so heißt das:
Die Existenzanalyse untersucht die Bedingungen erfüllender Existenz des Menschen
• theoretisch und
• praktisch.
Theoretisch beschäftigt sich die Existenzanalyse mit der Frage: „Was braucht der Mensch, um zu einem erfüllenden Leben zu kommen?“
In der Praxis geht es
1. um die methodische Frage: Mit welchen Mitteln kann der Mensch selbst dazu beitragen, Erfüllung im Leben zu erlangen?
2. um die konkrete individuelle Frage: „Was braucht es für diesen Patienten, damit er zu einem erfüllenden Leben kommen kann? – Was fehlt dieser Person für ein erfülltes Leben?“
Existenzanalyse beinhaltet Reflexion über das Menschsein
Die Existenzanalyse als Theorie des Menschseins und des Lebensvollzugs beschäftigt sich mit dem Wesen des Menschen und den Bedingungen der Existenz. Die grundlegende Frage dabei ist:
1. Was ist überhaupt ein gutes und erfüllendes Leben?
Mit dieser existenzanalytischen Grundfrage sind viele weitere Fragen verbunden, wie beispielsweise: Wer ist der Mensch? Was braucht der Mensch, um er selbst zu sein und sein Dasein in der Welt menschenwürdig leben zu können? Welche Inhalte müssen erfüllt sein, um zu einem erfüllenden Leben zu kommen? Woran kann man ein gutes Leben erkennen? Was an erfüllender Existenz hängt vom Menschen selbst ab und was ist vorgegeben? Wie kann sich der Mensch dem Unabänderlichen gegenüber verhalten?
Grundlagenforschung ist interdisziplinär
Mit solchen Fragen ist die Grundlagenforschung der Existenzanalyse befasst. In ihr werden das Menschenbild (Anthropologie) und die Theorie der Existenz reflektiert. Diese Forschung ist interdisziplinär. Sie nimmt Bezug zu Psychologie, Philosophie, Medizin, Neurobiologie, Theologie, Pädagogik und Soziologie.
Existenzanalyse ist auch Praxis des Lebensvollzugs
Darüber hinaus geht es in der Existenzanalyse um die Anwendung dieser Theorie. Eine zentrale praktisch-methodische Frage lautet:
2. Gibt es Methoden, Übungen, Mittel und Wege, um zu einem erfüllenden und guten Leben zu kommen? Was kann der Mensch selbst zur Erfüllung in seinem Leben beitragen? Welche Handlungsanleitungen können ihm dabei helfen? Wie kann der Mensch angesichts eines unabänderlichen Schicksals seinem Wesen gerecht werden?
3. Die Anwendungsseite der Existenzanalyse bleibt jedoch nicht nur bei der Entwicklung von Methoden stehen, sondern gipfelt in der persönlichen Arbeit mit dem konkreten Menschen (praktische psychotherapeutische bzw. beraterische Arbeit). Dabei wird die konkrete Existenz (das konkrete Leben des Patienten in der aktuellen Situation) auf existentielle Inhalte hin beleuchtet und mithilfe des therapeutischen Dialogs, der phänomenologischen Analyse von Situation und Person, der Mobilisierung der personalen Ressourcen, der Inhalte der Grundmotivationen und der Schritte der Methode der Personalen Existenzanalyse (PEA) behandelt. Auf die einzelnen Vorgehensweisen wird in den folgenden Kapiteln eingegangen.
Damit richtet sich die Existenzanalyse auf die Behandlung (Beratung, Therapie) pathologischer Phänomene, durch die sich Menschen in ihrem Lebensvollzug in der Weise behindert erleben, dass ihnen die innere Erfüllung in ihrem Leben fehlt. Ursache dafür ist im Allgemeinen ein Leiden oder eine Problematik, an welcher die Betroffenen selbst ursächlich (mit-)beteiligt sind. Daher liegt es (teilweise) an ihnen, eine Veränderung zu erreichen.
4. Salutogenetische Arbeit und Vorbeugung. Aus der Grundlagenforschung können auch Aufgaben bezüglich der Erhaltung der seelischen Gesundheit, nämlich Prävention (d. h. Maßnahmen in Bezug auf für nicht krankhafte, aber qualitätsmindernde Auswirkungen von Verhaltensweisen bzw. Situationen) und Prophylaxe (d. h. Vorbeugung möglicher Störungen und Erkrankungen) abgeleitet werden. Auch Lebensschulung und Persönlichkeitsbildung fallen in diesen Bereich, der von der Stärke der Existenzanalyse in der Anthropologie – dem Wissen um das Wesen des Menschen – in besonderem Maße profitiert.
Im Bereich der prophylaktischen Arbeit ergibt sich wiederum eine theoretisch-inhaltliche und eine praktisch-methodische Anwendung. Als gesundheitspsychologisches und salutogenetisches Konzept kann die Existenzanalyse außerdem in verschiedenen Bereichen wie Pädagogik, Psychologie und Medizin, aber auch in verschiedenen Anwendungsformen, etwa als Persönlichkeitsbildung, Selbsterfahrung und Lebensschule mit Gruppen und Einzelpersonen zur Anwendung kommen.
5. Empirische Forschung und Qualitätskontrolle. Theorie, Methodik und die konkrete, praktische Arbeit sind kontinuierlich einer Evaluation zu unterziehen. Dazu dienen empirische Untersuchungen mithilfe standardisierter Tests und qualitativer Forschung (die für die Existenzanalyse eine besondere Bedeutung hat) bis hin zu Supervision und Intervision.
1.2.4 Psychotherapeutische Definition von Existenzanalyse
Fachlichwissenschaftliche Definition
Nach der allgemeinen Definition der Existenzanalyse als Denk- und Behandlungsrichtung geht es in diesem Kapitel darum, sie als Psychotherapieverfahren zu beschreiben. Wegen ihrer besonderen, auf die Dynamik des Person-Seins und der Dialogik der Situation ausgerichteten Vorgehensweise kommt ihr eine Definition am nächsten, die sie über die in ihr angeleiteten Prozesse definiert (prozessuale Definition). Durch die Anbindung an die grundsätzlichen methodischen Schritte wird die praktische Vorgehensweise deutlich. Wegen des Bezugs auf die Methodik und den Arbeitsprozess handelt es sich dabei um die fachlich-wissenschaftliche Definition der Existenzanalyse.
Existenzanalyse ist ein phänomenologisch-personales Psychotherapieverfahren mit dem Ziel, der Person zu einem (geistig und emotional) freien Erleben, zu authentischer Stellungnahme und zu eigenverantwortlichem Umgang mit sich selbst und ihrer Welt zu verhelfen.
Diese Definition soll nun im Detail erläutert werden:
1. „Existenzanalyse als Psychotherapie“
Damit ist der Anspruch verbunden, alle psychischen, psychosomatischen und psychosozialen Störungen auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und Reflexion behandeln zu können. Als Psychotherapieverfahren muss die Existenzanalyse lehr- und überprüfbar sein, wie das z. B. vom österreichischen Psychotherapiegesetz gefordert wird.
2. „phänomenologisch“
Phänomenologie – den Blick auf das Wesentliche richten
Das methodische Repertoire der Existenzanalyse beruht auf einer phänomenologischen Vorgehensweise (vgl. Kap. 4.5.1, S. 124), d. h. es ist kein primär interpretativer Ansatz, sondern einer, der von der Individualität, Einmaligkeit und Einzigartigkeit des Person-Seins und ihrem konkreten Erleben ausgeht. Die Existenzanalyse arbeitet vor allem mit solchen individualisierenden Elementen und weniger mit allgemein psychologischen Erkenntnissen wie den Lerngesetzen, dem Erinnern oder der Konstruktion von Wahrnehmungen. Es geht in ihr vor allem um „Wesensschau“ – um das Erfassen des Wesentlichen der Situation und um den Blick auf das Wesen des Person-Seins und ihrer Motivation. Als phänomenologische Therapie ist Existenzanalyse folglich eine verstehende und individualisierende Psychotherapie.
3. „personal“
Begriff „PersonSein“ ist zentral
Diese Phänomenologie ist personal, d. h. sie ist eine Phänomenologie, in der das Person-Sein mit ihren Ressourcen im Mittelpunkt steht. – Der Begriff Person-Sein ist zentral in der Existenzanalyse und wird in einem eigenen Buch der Lehrbuchreihe ausführlich behandelt (vgl. auch in diesem Buch Kap. 3.2). Kurz gesagt wird unter Person-Sein eine innere (phänomenologische) Resonanzfähigkeit verstanden, die einem zu spüren gibt, was stimmig ist und was nicht, was wesentlich und echt ist und was nicht. Dieses Gespür von „stimmt so für mich“ oder „so stimmt es eigentlich nicht in meinen Augen“ verleiht dem Menschen Autonomie und Würde.
4. „der Person zu helfen“
Das Person-Sein mit seiner dialogischen und phänomenologischen Potenz wird mobilisiert. Das Person-Sein kommt durch Auseinandersetzung und Begegnung in Resonanz und erfasst das Wesentliche der Situation. Ziel der Existenzanalyse ist es, dem Person-Sein zum Durchbruch zu verhelfen, die Existenz zu „personieren“. Die Existenzanalyse versucht vorwiegend, mit diesen personalen Resonanzen in Beziehung zu kommen, und weniger mit z. B. abreagierenden Methoden (etwa Kissen schlagen, im Wald schreien usw.). Ihr Schwerpunkt liegt im Finden von Zustimmung, Stellungnahme, Verantwortung, Gewissen, Authentizität, Dialog und Sehen der Andersheit.
5. „Erleben“
Erleben – die Drehscheibe existenzanalytischer Therapie – enthält alle lebensrelevanten Informationen
Als personale und phänomenologische Richtung setzt die Existenzanalyse am konkreten Erleben der Person an. Ihr subjektives Erleben ist der Ansatzpunkt und die Drehscheibe der psychotherapeutischen Arbeit. Existenzanalyse kann als erlebensbezogene Psychotherapierichtung9bezeichnet werden; sie operiert mit erlebnisbezogenen Fragen. Zum Beispiel arbeitet sie bei einer Raucherentwöhnung mit Fragen wie: „Wie erlebst du das, wenn du eine Zigarette rauchst?“ Im subjektiven Erleben des Menschen ist alle lebensrelevante Information enthalten – sie aufzugreifen ist erforderlich, wenn man nachhaltige Veränderungen in den Haltungen und im Verhalten erreichen will.
6. „freies Erleben“
Frei ist das Erleben, wenn der Mensch zulassen kann, was er empfindet, fühlt, spürt, erfährt. Es soll mit den Patienten daran gearbeitet werden, dass sie nicht unterdrücken, nicht verdrängen, nicht übergehen, nicht abspalten, nicht verleugnen müssen. Das verankert eine „Phänomenologie nach innen hin“, eine liebende Offenheit und Schau auf das, was sich in einem selbst einstellt, rührt, bewegt. Diese Offenheit sich selbst gegenüber führt dazu, dass man sich gut in Empfang nehmen kann (Selbstannahme).
7. „geistig und emotional freies Erleben“
Dies ist eine nähere Beschreibung des „Freien“. Die Freiheit bezieht sich auf Denken, Fühlen und Spüren. Die Geistigkeit der Freiheit besteht neben der (manchmal möglichen) Wahl dessen, was wir erleben, wesentlich auch im Stellungnehmen zu dem, was wir erleben.
8. „Stellung nehmen“
Stellungnahme ist notwendig, um sich innerlich einzufinden
Stellungnahme meint, finden zu können, was man selbst zu einer Situation oder Sache zu sagen hat. Stellungnahme ist notwendig, damit man sich bei dem, was geschieht oder ist, innerlich einfinden kann.
9 „authentisch“
Diese Stellungnahmen sollen der Person entsprechen, mit ihrem Wesen übereinstimmen, echt sein.
10. „Umgang“
Neben einem freien Erleben und einer authentischen Stellungnahme soll der Person als dritter Punkt zu einer konkreten Verhaltensweise, zu einer Aktivität, zu einem Tun-Können verholfen werden.
11. „mit sich und der Welt“
Dieses Tun-Können bezieht sich auf zwei Wertbereiche: auf die Innenwelt und auf die Außenwelt, auf das Intra- und auf das Interpersonale.
12. „eigenverantwortlich“
Erleben und Stellungnahme ermöglichen ein verantwortungsvolles Handeln
Dieses Tun-Können soll so gestaltet sein, dass die Person selbst das Gefühl und die Überzeugung hat, dass sie zu dem stehen kann, was sie tut und dafür die Verantwortung übernimmt.
In der Personalen Existenzanalyse (PEA) sind die Etappen des psychotherapeutischen Prozesses beschrieben
Die Etappen des psychotherapeutischen Prozesses. Die Etappen des psychotherapeutischen Prozesses sind exemplarisch in der Personalen Existenzanalyse (PEA) beschrieben (Längle 1993a; 2000b) und stellen das Gerüst der wissenschaftlichen Definition der Existenzanalyse dar. Sie werden in Kapitel 3.2 ausführlicher behandelt. Zum besseren Verständnis der Definition seien hier jedoch kurz die Stufen angeführt, mit denen in der Existenzanalyse gearbeitet wird:
• Erfassen von Realität und Faktischem – die Arbeit an der Wahrnehmung des Faktischen
• Eindruck und Erleben – die Arbeit an Emotion und Kognition;
• personale Stellungnahmen – die integrativ-biografische Arbeit
• Ausdrucksformen – die Arbeit an authentischer und situationsbezogener Aktivität
• Verhalten – das Üben und Realisieren sinnvollen, eigenverantworteten Handelns
Therapie ist weitgehend Arbeit an der Emotionalität – dem Zentrum des Erlebens
Erleben und Verstehen als Ansatzpunkt. Ist das persönliche Erleben Ausgangspunkt für das therapeutische Arbeiten, so bedeutet dies, dass die Existenzanalyse an der persönlichen Aktualität ansetzt, also an jener Lebensaufgabe, die gerade „ansteht“. Sie wird in ihrer gegenwärtigen und biografischen Gestalt im Hinblick auf die künftige Lebensgestaltung beleuchtet und „durchspürt“. Zwar werden in der existenzanalytischen Arbeit das Erleben und das Verstehen fokussiert, doch geht es sekundär auch um Erklärungen, Kognitionen, Lernen, Üben usw. Der psychotherapeutische Prozess läuft über phänomenologische Analysen zur Emotionalität als Zentrum des Erlebens, um daraus zur Klärung von Einstellungen und Haltung zu kommen, die dann das Handeln entsprechend (neu) begründen.
Erlebtes ist nie gleichgültig, sondern enthält die Dynamik des Gefragtseins
Die existentielle Dynamik. Erleichternd für das Verständnis der Existenzanalyse ist die Kenntnis ihres Konzeptes der existentiellen Dynamik (vgl. Kap. 2.3.1). Darunter wird die Auffassung verstanden, dass Menschsein als ein ständiges „In-Frage-Stehen“ anzusehen ist, nämlich angefragt zu sein von erlebten und gespürten Werten (Beziehungen, Aufgaben usw.), in denen es „um etwas geht“ und die daher nicht „gleich-gültig“ sind. Damit verbunden ist eine „existentielle Wendung“ der Sichtweise des Daseins: Der Mensch kann sich (dank seiner Freiheit) als ein vom Leben und der jeweiligen Situation Angesprochener und Angefragter sehen statt nur als Fragender und Fordernder. Im existentiellen Verständnis hat der Mensch nämlich die Möglichkeit und ist dazu aufgefordert, auf diese „Lebensfragen“ die situativ bestmöglichen Antworten zu geben. Durch diese Antworten „ver-antwortet“ der Mensch sein Leben (Frankl 1946a, 72). Hier geht die Existenzanalyse über in die Logotherapie.
1.3 Definition von Logotherapie
Sinn ist die beste Möglichkeit in dieser Situation
Existentieller Sinn („Logos“) ist definiert als die beste (Handlungs-, Einstellungs- oder Erlebnis-)Möglichkeit in der jeweiligen Situation. Logotherapie bezeichnet heute in der GLE jene Formen der Beratung bzw. der Behandlung, die sich konkret der Sinnthematik widmen.
Als Kurzdefinition der Logotherapie kann man daher formulieren:
Logotherapie ist Begleitung und Unterstützung in der Sinnsuche.
Ziel der Logotherapie. Das Ziel der Logotherapie ist die Suche von Sinn (insbesondere bei Sinnverlust) bzw. die Verdichtung der individuell gelebten Sinnfülle („Lebensdichte“) durch das Auffinden von Werten und die Hinführung zu einer frei gewählten Verantwortung („Eigenverantwortlichkeit“).
Logos – der strukturelle Zusammenhang des Daseins
Auffinden von Strukturzusammenhängen. In der Logotherapie geht es um das Auffinden von Strukturzusammenhängen im Leben, von sinnhaften Verknüpfungen. Logos heißt „das Wort“, ist eigentlich die sinnhafte Ordnung, die gegen das Chaos steht. Logos ist das, was „logisch“ ist, d. h. eine Struktur hat, „durchgeistigt“ ist, weil es einer Gesetzmäßigkeit folgt, die als geistige Wirkkraft das Vorhandene ordnet. In der Kommunikation ist diese Ordnungsstruktur der Begriff, das Wort, das im Kontext einer Grammatik einen Inhalt vermittelt und somit „Sprache“ im eigentlichen Sinne darstellt.
Logotherapie ist im Grunde ein Arbeiten mit der „Grammatik des Lebens“, mit „Strukturzusammenhängen“, die das Leben ausmachen und die uns daher Sinn geben (Längle 1987, 1992).
Logotherapie meint also ein Finden der „Textur der Existenz“, der „Grammatik der Situation“, des Kontextes, in dem das steht, was man erlebt und tut. Es geht in der Logotherapie daher nicht um die Aufarbeitung der Probleme, Traumata, Störungsursachen, sondern um begleitende Kontextfindung. Der jeweils größere Wert soll ins Blickfeld gerückt werden, der bewirkt, trotz der widrigen Umstände weiterzumachen, weiterzuleben, nicht aufzugeben usw. Frankl (1946a, 96; 1975, 104 ff., 174 ff.) spricht in diesem Zusammenhang gerne von der spezifischen geistigen Kraft, die dem Menschen als Person eignet, mit deren Hilfe der Mensch in der Lage sein kann, auch die widrigsten Umstände durchzustehen. Er hat sie als die „Trotzmacht des Geistes“ bezeichnet. – In der Logotherapie geht es also um das „trotzdem Ja zum Leben sagen“, wie ein Buchtitel von Frankl (1946b) lautet. Logotherapie arbeitet in erster Linie ressourcenorientiert, versucht das Ich zu stärken und ihm den Zugang zu seiner geistigen Kraft aufzumachen bzw. offen zu halten.10
Aufgrund ihrer methodischen Vorgehensweise definieren wir in der GLE die Logotherapie heute so:
Logotherapie ist eine sinnzentrierte Beratungs- und Behandlungsform.
In Abgrenzung zur Existenzanalyse lässt sich Logotherapie so beschreiben:
Logotherapie ist ein Spezialgebiet der Existenzanalyse, das sich der Analyse, Prophylaxe und Behandlung von Sinnproblemen und insbesondere der Behandlung von Sinnverlusten widmet.
Der Indikationsbereich von Logotherapie ist vielfältig und reicht von Sinnproblemen bis zum Einsatz in der Pädagogik:
Logotherapie kommt in der Endphase existenzanalytischer Psychotherapie zum Einsatz, in der es nach der Bearbeitung und Lösung der lebensbehindernden Probleme um konkrete Sinnfragen geht, für die der Mensch nun wieder frei geworden ist. In diesem Sinne hatte Frankl den Einsatz von Logotherapie überhaupt als Ergänzung für alle Psychotherapien vorgeschlagen, um dem Sinnbedürfnis der Patienten begegnen zu können.
Indikation von Logotherapie: Sinnproblematik
Logotherapie kann aber auch unabhängig von vorangegangener Psychotherapie bei Sinnproblemen zum Einsatz kommen. Dies ist häufig bei Krisen, belastenden Lebenssituationen, schweren Verlusten, Krankheit, aber auch entwicklungsbedingt in verschiedenen Lebensphasen (Pubertät, Midlife-Crisis, Pensionierung) der Fall.
Ein großes Anwendungsgebiet ist die Prophylaxe psychischer Störungen und Sinnverluste. Frankl (1946a, 18) bezeichnete einen Zustand von Interesselosigkeit und Apathie durch Sinnlosigkeit als „existentielles Vakuum“. Auch in der Pädagogik spielt die Logotherapie eine wichtige Rolle. Aufbauend auf dem Menschenbild der Existenzanalyse und Frankls Logotherapie setzt sich die sinnorientierte Pädagogik zum Ziel, den heranwachsenden Menschen bei seiner Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen und ihm jene Werkzeuge zu vermitteln, die zur Entfaltung eines sinnerfüllten Lebens nötig sind.
Zusammenfassung
•Die Existenzanalyse basiert auf der Existenzphilosophie, in deren Zentrum der Begriff Existenz steht.
• Unter Existenz wird in der Existenzanalyse ein sinnvolles, in Freiheit und Verantwortung gestaltetes Leben verstanden, das der Mensch als das seinige erlebt und worin er sich als Mitgestalter versteht. Wenn der Mensch unter diesem Blickwinkel gesehen wird, sind somatische, psychologische und psychodynamische Fragestellungen (wie Gesundheit, Intelligenz, Lernvorgänge oder die Befriedigung von Triebspannungen) Bausteine und nicht eigentliches Ziel sinnvoller Existenz.
• Sowohl die verhaltenstheoretische als auch die psychodynamische Betrachtung erfahren damit eine diametrale Wendung: Nicht nur unbewusste Konditionierungen und Kräfte lenken und treiben den Menschen, sondern auch „Werte“ ziehen ihn an. Sie zu erleben oder sie zu gestalten, ist „Existenz“.
• „Ganz“ ist der Mensch der Existenzanalyse zufolge nicht aus sich selbst heraus, auch wenn er gesund ist und alle Triebe befriedigt sind. Der Mensch ist als Person darauf hin angelegt, über sich selbst hinauszugehen und sich Anderem (Menschen, Dingen, Aufgaben) zuzuwenden, um darin seine existentielle Erfüllung zu erhalten.
•Existenzanalyse kann definiert werden als eine phänomenologisch-personale Psychotherapie mit dem Ziel, der Person zu einem (geistig und emotional) freien Erleben, zu authentischer Stellungnahme und zu eigenverantwortlichem Umgang mit ihrem Leben und ihrer Welt zu verhelfen.
•Existentieller Sinn („Logos“) ist definiert als die beste (Handlungs-, Erlebnis- oder Einstellungs-)Möglichkeit in der jeweiligen Situation. Für diesen Bereich der Sinnfindung ist die Logotherapie Begleitung und Unterstützung.
• Viktor Frankl bezeichnete in der von ihm begründeten Ergänzung zur Psychotherapie ursprünglich den theoretischen Hintergrund als Existenzanalyse und die praktische Anwendung als Logo-„therapie“. Heute wird in der GLE die Psychotherapiemethode als Existenzanalyse und die Behandlung der Sinnthematik als Logotherapie bezeichnet.
1 Frankl sprach ab 1926 von Logotherapie und ab 1933 von Existenzanalyse. 1938 hat er beide Begriffe erstmals in ein und derselben Publikation verwendet.
2 Ab den 1960er-Jahren hat Frankl den Begriff Existenzanalyse nicht mehr verwendet, um der Verwechslung mit der Daseinsanalyse keinen Vorschub zu leisten. Er sprach dann nur noch von Logotheorie. Nach der Verwendung des Begriffs Existenzanalyse in der GLE begann er, ihn nach 1987 gelegentlich wieder zu gebrauchen (für einen Überblick cf. Längle 1998a, 315).
3 Der leichteren Lesbarkeit zuliebe wird hier das generische Maskulinum verwendet.
4 Die der Logotherapie und Existenzanalyse zugrunde liegende Idee beschreibt Frankl in dem bereits zitierten programmatischen Artikel von 1938 so (25 f.):
„Was not tut, ist eine immanente Kritik der Lebensauffassung des Kranken, was zur Voraussetzung hat, daß wir prinzipiell bereit sind, auf rein weltanschaulicher Basis die Diskussion aufzunehmen. Es gibt also keine Psychotherapie der Weltanschauung und kann eine solche a priori niemals geben; wohl aber ist Weltanschauung als Psychotherapie möglich und, wie wir gezeigt haben, gelegentlich auch nötig. Ähnlich der Überwindung des Psychologismus innerhalb der Philosophie durch den Logizismus wird es also dar- auf ankommen, innerhalb der Psychotherapie die bisherigen psychologistischen Abweichungen durch eine Art Logotherapie zu überwinden, das hieße durch das Einbeziehen weltanschaulicher Auseinandersetzungen in das Gesamt der psychotherapeutischen Behandlung – wenn auch in der oben dargelegten bedingten, begrenzten, neutralen Form.“
5 Als geradezu programmatisch für die spätere Entwicklung der Logotherapie und Existenzanalyse kann heute die älteste Textstelle angesehen werden, in der Frankl (1938, 18) das Motto seines Lebenswerkes ausspricht: