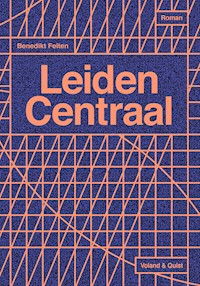
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Voland & Quist
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Party, auf der sie nie war. Eine Liebesbotschaft, die ihr nicht gilt, eine Familie an Weihnachten, die nicht ihre ist. Tausend Kindheiten, die sie nie erlebt hat. Valerie analysiert als forensische Informatikerin täglich Unmengen fremder Erinnerungen. Bei einem neuen Fall geraten Adrian und Cristina in den Fokus ihrer Ermittlungen und mit ihnen die menschenunwürdigen Machenschaften eines illegalen Leiharbeitsnetzwerks. Benedikt Feiten schickt seine drei Protagonisten auf Suche, Jagd und Flucht durch die Niederlande, Rumänien und Deutschland, durch geografische und digitale Räume. Lakonisch und durchdacht erzählt er vom Streben nach Orientierung im Vergangenen – und von der Macht der Technologie, die das Erinnern formt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benedikt Feiten wurde in Berlin geboren und lebt in München, wo er Unmengen schwarzen Tee trinkt und vieles macht, manchmal sogar, ohne sich zu verzetteln. Er ist mit dem Literaturstipendium der Stadt München ausgezeichnet worden und war Teilnehmer der Bayerischen Akademie des Schreibens. 2016 erschien sein Debütroman »Hubsi Dax« bei Voland & Quist. 2019 erhielt er für »So oder so ist das Leben« (Voland & Quist) den Bayerischen Kunstförderpreis. Nach dem Studium der Amerikanischen Literatur hat er seine Doktorarbeit über Musik und Transnationalität in den Filmen von Jim Jarmusch geschrieben und an der Ludwig-Maximilians-Universität unterrichtet. Er ist Trompeter und Cellist in verschiedenen Bands und Projekten. 2021 ist er Stipendiat des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia in Bamberg. »Leiden Centraal« ist sein dritter Roman.
Die Entstehung dieses Romans wurde gefördert durch ein Literaturstipendium des Freistaats Bayern.
© Verlag Voland & Quist GmbH, Berlin und Dresden 2022
Korrektorat: Kristina Wengorz
Umschlaggestaltung: HawaiiF3
Satz: Fred Uhde
ISBN 978-3-86391-320-5
eISBN 978-3-86391-324-3
www.voland-quist.de
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Dank
Prolog
Ihr Atem geht schwer. Schmerz pocht in ihrer Schulter. Sie hört Sirenen und sieht blaues Licht pulsieren. Vielleicht darf sie sich etwas wie Hoffnung erlauben. Bilder flackern auf. Zugezogene Reißverschlüsse. Ein Zirpen. Ein stetig flirrender Lärm, kristallin, künstlich. Dünne Melodien in schriller Verzweiflung, das Klingeln der Telefone in den Leichensäcken. Aber sie sucht nach einer anderen Erinnerung. Einer früheren …
Warmes Licht leuchtet die Bühne aus. Stühle und Notenständer stehen bereit. Jemand hustet in die gespannte Stille. Sie steht mit den anderen Kindern im Verborgenen. Neben ihr der schwere, geraffte Vorhang. Der Publikumsraum liegt im Dunkeln. Irgendwo darin müssen ihre Eltern und ihr Bruder sitzen. Der Stachel ihres Cellos kratzt auf dem schweren Holzboden, ihre Finger umklammern die Saiten am Steg. Sie riecht das frische Kolophonium an ihrem Bogen. Scheinwerfer lassen die Härchen im Nacken des Jungen vor ihr glimmen. Die Direktorin der Musikschule kündigt das Orchester an, Applaus brandet auf, die Kinder vor ihr setzen sich in Bewegung. Sie will ihnen folgen, aber ihre Beine gehorchen ihr nicht. Wie gelähmt steht sie da, sieht, wie die anderen sich an ihren Plätzen einrichten. Ihr Herz pocht. Jetzt müsste sie vortreten. Ihre Pultnachbarin winkt ihr panisch. Stumm formt sie das Wort »Komm« mit ihrem Mund. Doch der Dirigent merkt nicht, dass jemand fehlt, und hebt die Hand. Sie sieht ihren leeren Stuhl. Dort wäre sie sichtbar. Dort wäre sie Teil von etwas. Es blitzt aus der Dunkelheit. Fotos, die sie nicht zeigen werden. Der Orchesterleiter gibt den Einsatz, die Streicher setzen an. Eine zerbrechliche Harmonie erklingt ohne sie. Sie kann nur noch zuhören und sich ganz genau einprägen, was gewesen sein wird.
1
Ein Familienfoto, Mutter, Vater, Sohn, viel zu verschwommen, um mit einer Digitalkamera oder einem Handy aufgenommen worden zu sein. Vermutlich ein Scan. Die Mutter mit einem leichten Zweifel auf den Lippen. Der Vater hat seinen Arm um ihre Hüfte gelegt, seine Hand ruht auf der Schulter des Jungen. Ein schüchternes Lächeln, mittellanges, blondes Haar. Ob er das ist? Das Bild einer jungen Frau mit glatten Haaren, die einen Kuss in Richtung ihrer Handykamera bläst. Die Buchungsbestätigung einer Busreise als PDF.
Stichpunkte für ein Referat im Biologieunterricht, 11A, Klassenleitung Frau Dürnheim.
Im Suchverlauf: Reisepass verlängern München – Ronaldo Gehalt – Normales Alter für erstes Mal – Highlights FC Bayern gegen Juventus – 22-jährige Hobbynutte wird gefickt – Facebook – iPad gebraucht kaufen – Log-in hotmail.com – Teenie macht es sich selbst – Erlkönig Gedicht Bedeutung.
»Und? Gibt’s was Interessantes?« Magnus lehnt sich an den Türrahmen.
»Bis jetzt nicht. Sieht aus wie ein normaler Gymnasiast, der ein bisschen an Freunde dealt«, antwortet Valerie. Den Blick wendet sie nicht vom Bildschirm ab. »Laptop war ungeschützt, am Handy bin ich noch nicht dran.«
»Okay. Wir gehen in der Mittagspause rüber zu Mykonos. Kommst du mit?«
»Ich hab was dabei.«
»Alles klar.«
»Trotzdem danke«, schiebt sie hinterher und blickt auf, aber der Türrahmen ist schon wieder leer.
Das Handy ist schnell ausgewertet. Der Jugendliche hat die PIN verraten. Hätte er nicht gemusst, aber wahrscheinlich war er eingeschüchtert. Ein paar Chatverläufe: »Bringst du Schokolade mit?« – »Ist Günter auch dabei?«, nicht sonderlich verhohlen. Marihuana in Kleinmengen, hält sich für schlauer, als er ist. Aber das geht den meisten so.
Valerie spielt die relevanten Daten aus und schickt sie an die Kollegen. Wahrscheinlich wird das Verfahren mangels öffentlichen Interesses eingestellt. Je nachdem, wie der Junge sich eben bisher so angestellt hat. Sie seufzt. Es ist lange her, dass etwas wirklich Anspruchsvolles kam.
Vollkornreis, Gemüse, Obst für den Entsafter, Joghurt, Tiefkühlpizza, Pudding. Eine nachlässige Versorgung mit den nötigsten Nährstoffen, Süßes für den Fall, dass sie doch noch Lust auf irgendetwas verspürt.
»Da liegt noch etwas von Ihnen«, bemerkt ein älterer Herr und deutet heiter auf einen Becher.
»Ja, danke, ich weiß«, antwortet Valerie schroffer als beabsichtigt und schämt sich, dass sie ihn um den Lohn eines herzlicheren Dankes für seine Hilfsbereitschaft bringt.
»Hallo?«, ruft sie in den Flur hinein, aber spürt schon beim Betreten der Wohnung, dass ihr Bruder nicht da ist.
Die Küche ist aufgeräumt. Sie hebt den Deckel des Mülleimers. Ein zerbrochenes Glas. Ihr Blick fällt auf die Armlehnen des Holzstuhls, auf die bleichen, verschliffenen Stellen, die Thomas mit den Handballen reibt, wenn er darauf sitzt.
Auf dem Tisch liegt ein Zettel: »Bin zum Sport gegangen. Rest Pasta steht im Kühlschrank, wenn du willst. Bis nachher.« Die Buchstaben lehnen sich in alle Richtungen, ganz so, als habe er sie mit Gewalt in diese Ordnung zwingen müssen.
Valerie nimmt den Kugelschreiber und setzt ein paar Worte darunter: »Danke! Hab noch ein Date u. komm später wieder. Bis dann.«
»Hey«, begrüßt Nils Valerie und umarmt sie.
Keine seltsame Begrüßung mit Küsschen, kein kalter Händedruck, kein Sicherheitsabstand, in dem sie verlegen voreinander stehen. Er fühlt sich gut an und sieht aus, wie sie ihn sich durch sein Bild in der Dating-App vorgestellt hat: sympathisch und auf eine arglose Art freundlich. Ungefährlich attraktiv.
Als sie auf die Tür der Bar zugeht, will er sie mit ein paar eiligen Schritten überholen, aber Valerie hat die Klinke schon in der Hand. »Bitte schön«, fordert sie ihn auf und lächelt. »Nach dir.«
Er begrüßt den Barchef mit Handschlag, stellt ihn ihr als Gabriel vor. Gabriel nickt ihr höflich zu und fragt Nils, ob die Ottersaison schon begonnen habe. Der lacht und entgegnet, dass er doch hoffe, sie liege noch in weiter Ferne.
Die beiden scheinen sich zu mögen und eine gewisse Vertrautheit zu haben. Trotzdem wirkt es auf Valerie wie eine Inszenierung, zu deren Zweck Nils genau diese Bar ausgewählt hat.
Der Eindruck wird stärker, als Nils die zugehörige Anekdote liefert: wie sie als Schüler in ihrem Heimatort einen verirrten Fischotter aus dem Garten aufgelesen und zum Tierarzt gebracht hätten. Am nächsten Morgen habe sich herausgestellt, dass im Familienteich die Koi-Karpfen fehlten – der Otter habe sie getötet. Seine Mutter habe ihm die Rettung lange indirekt vorgeworfen, so als hätte er einen Verrat begangen. Dabei gehören Otter sogar zu den besonders geschützten Arten. Allerdings zerbeißen sie mit Vorliebe die Kehle und verspeisen Herz und Leber der Fische. Kein schöner Anblick in einem Reihenhaus-Vorgarten am Sonntagmorgen.
Damit endet die Geschichte.
»Na ja«, sagt er, etwas betreten über das unschöne Schlussbild.
Sie setzen sich an einen Tisch in der Nähe des Pianisten, der so betont unaufdringlich spielt, dass es fast lästig ist.
Nils will wissen, was sie beruflich so macht. Die Frage war wohl unvermeidlich.
»Forensische IT.«
»Forensische IT?«
»Alles, was mit der Sicherung von digitalem Beweismaterial zu tun hat«, erklärt Valerie geduldig.
»Also Polizistin?«
»Richtig, im Prinzip sind wir Vollzugsbeamte.«
»Hast du dann auch eine Waffe?«
»Ja. Je nach Lage unterstützen wir auch vor Ort. Kommt aber nicht oft vor.«
»Da kriegt man so einiges mit«, meint er, »oder? Hat man da nicht irgendwann eine ganz andere Sicht auf die Leute?«
Sie zuckt mit den Schultern. »Vieles, was ich sehe, kann eigentlich auch jeder andere online finden. Ist dann eben nur nicht auf eine einzelne Person bezogen.«
»Aber du siehst schon heftige Sachen, oder?«, beharrt er.
»Ich hab wohl so gut wie alles gesehen, was sich Menschen freiwillig und unfreiwillig gegenseitig antun. Nur wenn es was mit Kindern ist, das kann man nicht beiseiteschieben.«
Nils dreht verlegen das Glas auf seinem Untersetzer. »Tut mir leid.«
»Schon gut.« Sie nimmt einen Schluck.
Sie schweigen. Im Rücken von Nils greift der Pianist volle Akkorde und reißt Lücken in die weißschwarze Fläche der Tastatur. Valerie bemerkt, dass er beim Improvisieren nach jeder Phrase seine Brille hochschiebt. Jedes Tippen ein kurzes Innehalten. Vielleicht wirkt sein Spiel deshalb so strukturiert.
Nils folgt ihrem Blick und dreht sich in Richtung des Flügels. »Gute Musik, oder?«
»Nicht schlecht«, erwidert sie.
»Spielst du ein Instrument?«
»Ich hab lange Zeit Cello gespielt.«
Das zu sagen fühlt sich fremd an. Valerie versucht, sich zu erinnern, wann sie das Instrument das letzte Mal in den Händen gehalten hat, fragt sich, wie es klänge, wenn sie jetzt versuchte, etwas zu spielen, eine einfache Etüde. Doch das Einzige, was sie noch an diese Zeit erinnert, sind ihre Haare, die sie noch immer zusammengebunden nach rechts trägt, dort, wo sie nicht mit dem Griffbrett in Berührung kommen können.
»Und du?«, fragt Valerie.
Er lacht. »Völlig talentfrei. Das war schon in der Grundschule allen klar. Mir wurden immer die Klangstäbe in die Hand gedrückt. Mehr will ich keinem antun. Ich hör gern zu. Aber …«, er lehnt sich zurück, spricht leiser, fast wie zu sich selbst, »interessant, was du alles treibst. Gegen deinen Job ist das, was ich mache, ja relativ dröge.«
Eine kleine Pause entsteht.
»Was machst du denn?«, fällt ihr gerade noch ein.
»Ich bin Mechatroniker.«
»Und woran arbeitest du gerade?«
»Das ist wahrscheinlich nicht so spannend für dich«, sagt er entschuldigend und erzählt zögerlich, dann immer gestenreicher und am Ende enthusiastisch über eine Automatik zur Fahrwerksabstimmung, die er mitentwickelt hat.
Na endlich. Das spricht Valerie an. Eine Leidenschaft, die seine Routine durchbricht. Sie mustert ihn. Sauberer Haarschnitt, sichere Gesten, kennt sich mit hochwertigen Spirituosen aus, ist durchtrainiert, hat zu jedem Thema eine Meinung, ist aber umsichtig genug, gleich auch Toleranz für andere Haltungen erkennen zu geben. Wovor hat er solche Angst, dass er sich in diese unangreifbare Form gebracht hat?
Sie schweigen für einen Moment.
Er wippt mit dem Fuß, der Tisch vibriert leicht. »Der Funke springt nicht so richtig über, oder?«, fragt er.
Sie winkt mit ihrem leeren Glas in Richtung des Kellners. »Warten wir’s ab.«
Valerie wacht mit einem beengten Gefühl auf. Ein blasser Schein dringt durch die Gardinen. Nils hat den Arm um sie gelegt, seine Fingerkuppen berühren ihr Brustbein. Er atmet ihr in den Nacken. Sachte windet sie sich heraus und zieht sich an. Es entspricht nicht ihrer Gewohnheit, über Nacht zu bleiben. Sie war wohl müder als gedacht.
Als sie in der Tür noch einmal zurückschaut, sieht sie, dass er die Augen geöffnet hat.
»Mach’s gut«, sagt sie.
Er nickt ihr zu, bringt ein Lächeln auf.
Valerie schließt die Tür hinter sich.
Draußen schaltet sie ihr Handy ein. Fünf verpasste Anrufe von Thomas. Verdammt, hoffentlich ist er okay.
Wäre nicht das erste Mal, dass sie ihn irgendwo einsammeln muss. Meistens in einer der wenigen Kneipen, die bis in die Morgenstunden geöffnet haben. Wie er da sitzt, schlaflos den Raum musternd. Drei Gäste, ein Barkeeper, zwölf freie Hocker, acht Deckenlampen, fremde Dialoge, Biergläser unter dem Zapfhahn, Dinge, an denen er sich entlanghangeln kann, bis Valerie kommt. Vielleicht sprechen die Stammgäste ihn an, bestimmt antwortet er einsilbig und schweigt danach. Bis sie zur Tür hineinkommt, sein Blick an ihr hängen bleibt und er wortlos aufsteht, seine Jacke nimmt und ihr folgt. Seine Cola prickelt verlassen im Glas.
Nach ein paarmal Klingeln hebt Thomas ab.
Sie versucht, die Dringlichkeit in ihrer Stimme zu zähmen, ihr schlechtes Gewissen einzudämmen, schließlich ist sie ihm keine Rechenschaft schuldig. Es gelingt ihr nicht. Sie sei eingeschlafen, dumme Geschichte, natürlich hätte sie sich gemeldet, wenn sie vorgehabt hätte, nicht nach Hause zu kommen.
»Alles klar.« – »Verstehe.« – »Bin schon bei der Arbeit.« – »Kein Problem.« – »Ja.« – »Bis dann.« Er klingt sachlich und gemessen, das ärgert sie.
Als hätte er nicht um 1:17 Uhr, 2:11 Uhr, 3:01 Uhr, 4:33 Uhr, 6:28 Uhr und 7:10 Uhr versucht, sie zu erreichen. Als wäre er nicht in der Wohnung auf und ab gegangen oder hätte sich ein Bad eingelassen, nur um die Wanne gleich wieder zu verlassen. Als fände Valerie nicht wieder einmal Spuren einer Reihe begonnener Ablenkungen, eine gehackte Zwiebel oder einen Stapel fahrig durchblätterter Bücher, ein Schachbrett mit ein paar Zügen einer nachgespielten Partie oder einen Aschenbecher voll halb gerauchter Zigaretten.
Es ist anstrengend für sie. Aber für ihn natürlich noch viel mehr.
2
Vor Cristina liegt die Bahnhofshalle. Wieder mal war die Verbindung aus Leiden unzuverlässig, und sie musste in Frankfurt ewig auf ihren Anschluss warten. Immerhin hat sie München mit nur einer Stunde Verspätung erreicht.
Ihr Blickfeld ist vom schwarzen Stoff ihrer Kapuze umrandet, sie zieht sie enger. Ein Zug fährt ein, die Wartenden erheben sich. Cristina geht durch die Menge, Menschen betreten ihr Sichtfeld und verlassen es wieder, ein Sog wie ein sich ständig entziehendes Tunnelende.
Eine Mutter führt ihre Tochter an der Schulter aus dem Weg und lächelt Cristina dabei entschuldigend an, setzt ihr Verständnis voraus.
Die für den Spätsommer typisch tief goldene Sonne scheint auf den Vorplatz des Hauptbahnhofs, und Cristina kramt gerade nach ihrer Sonnenbrille, als die Polizisten sie ansprechen.
Warum schlägt ihr Herz immer noch höher? Ein alter Reflex. So schnell ausgewählt und abgetrennt, denkt sie.
»Was ist denn der Anlass für diese Kontrolle?«, mischt sich ein Passant ein.
Cristina lächelt ihn an. »Alles in Ordnung.«
Aber das befriedigt ihn nicht. Vielleicht fühlt er sich berufen, eine Ungerechtigkeit anzusprechen, vielleicht mag er aber auch einfach keine Polizei. »Hat die Frau irgendetwas Verbotenes gemacht?«
»Bitte gehen Sie weiter«, wirft der zweite Polizist aus dem Hintergrund ein.
»Wirklich, alles in Ordnung«, wiederholt Cristina.
Der Beamte nickt ihr zu, aber sie will seine Dankbarkeit nicht. Der Mann geht ein paar Meter weiter und beobachtet die Szene aus der Distanz.
Der Polizist nimmt den Reisepass, registriert das im Vergleich zum deutschen Dokument etwas dunklere Weinrot, den etwas größeren Adler, România. Er studiert die Papiere eingehend, Zeile für Zeile, blickt prüfend zwischen ihrem Passbild und Gesicht hin und her.
Cristina Mitu. Arad. 18.5.1991.
Cristina kennt den Ablauf.
Der Beamte fragt nach ihrem Geburtsort und Geburtsdatum. Ihre Antworten gleicht er mit den Papieren ab, nimmt sie aber ansonsten hin, ohne weiter auf sie einzugehen. Sie sieht ihm an, wie er an einem Bild von ihr werkelt, Baustein für Baustein, Frisur, Akzent, Mimik, Gestik. Aha, Rumänien. Aha, Lidschatten. Aha, enge Jeans.
»Was für eine Tätigkeit üben sie hier aus?«
»Ich arbeite für eine Consulting-Firma. Schwerpunkt Personaldienstleistung.«
»Welcher Bereich?«
»Wir vermitteln Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter in verschiedene Tätigkeitsfelder.«
»Sie sind also nicht selbst Dienstleisterin? Auf die eine oder andere Weise?«
»Was meinen Sie damit?«
»Ich meine gar nichts.«
»Meine Dienstleistung«, sagt Cristina gefasst, »besteht darin, die Fähigkeiten anderer zu vermitteln.«
Er runzelt die Stirn und nickt. »Dürfen wir den Inhalt Ihrer Handtasche sehen? Kommen Sie mal bitte mit hier rüber.« Er winkt sie zu einer Bank.
Sie seufzt und folgt ihm.
Er breitet Schminkzeug, Geldbeutel und Einkaufszettel aus. »Ihr Telefon?«, fragt er und nimmt das Gerät in die Hand.
Sie nickt.
Der Uniformierte legt das Handy beiseite, faltet die Einkaufszettel auf und wieder zusammen, zieht den Knick mit den Fingernägeln scharf nach.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Cristina gezielt aufgehalten haben? In der Nähe des Hauptbahnhofs, außerhalb der Pendlerzeiten. Gering. Wenn sie etwas von ihr wollten, hätten sie sie direkt zum Verhör geladen. Der Gedanke, dass sie sie erwartet haben, ist abwegig.
Er gibt ihr den Pass zurück. »Schönen Tag noch.«
Cristina setzt sich auf die Bank, schlägt ihre Kapuze zurück und lässt das Licht auf sich einströmen. Das Telefon vibriert, Adrians Name erscheint auf dem Display, sie ignoriert es. Die Sonne brennt auf den Rasen und schiebt die großen Schatten der Häuser stetig und unbeirrt über die grünen Rechtecke. Sie streifen über das Gras, kühle Ahnungen fressen sich durch die Halme, über die Wege, bis an ihre Füße heran.
Sie steht auf, geht zum Kiosk gegenüber, kauft Zigaretten, redet mit der Inhaberin. Ja, Rauchen sei ungesund, aber ein paar Laster brauche der Mensch schließlich. Kalt sei es geworden, stimmt, sodass man gar nicht mehr hinauswolle, aber sie habe im Kiosk ja den kleinen Elektroofen, da sei es sogar wärmer als zu Hause.
»Kompliment, Sie können wirklich gut Deutsch«, bemerkt die Frau, als Cristina sich verabschiedet.
Aber es ist kein Kompliment. Es bedeutet, dass die leichte Färbung ihres Tonfalls auch nach all den Jahren noch zu hören ist. Die letzte kleine Unüberbrückbarkeit, eine winzige Härte an den Konsonanten, ein leichtes kehliges Fauchen beim »Ch«. Das fauchende »Ich«.
Ich lebe hier schon lange, will sie sagen. Doch Cristina unterdrückt den Impuls. Es ist besser, unterschätzt zu werden.
In ihrer Wohnung ist es still. Cristina faltet Wäsche zusammen und stapelt sie in ihrem Schrank. Nicht einmal die Hälfte der Fächer ist gefüllt.
Wie lange sie schon in Deutschland ist. Fünf Jahre Studium in Hamburg. Dann für ein Jahr zurück nach Arad. Und nun sind schon fast zwei Jahre vergangen, seit sie Loredanas Spur hierher nach München gefolgt ist. Ihre Schwester, denkt sie und wiegt das Wort, es umhüllt nur Erinnerungen. Schwester. Soră.
Cristina lässt sich auf das Bett fallen, entsperrt ihr Telefon, öffnet eine leere Nachricht. Sie schreibt ihr wieder, obwohl sie weiß, dass Loredana nicht antwortet. Sie braucht die Adressatin, um sich ausdrücken zu können. Adressatin, Betreff, Absenderin. Und all das hat sie, ohne die Gefahr, sich einer Antwort auszusetzen, die sie nicht lesen will. Dass sie schreibt, ist wichtiger als der Inhalt, also reiht sie wahllos Erinnerungen aneinander. Die ganzen Telenovelas, die sie mit Loredana gesehen hat: wie Rosalinda ihr Gedächtnis verliert, wie sich Milagros und Ivo in »Muñeca Brava« zu Latin Pop küssen. Der Liebeskummer, den sie zusammen überwunden haben, die langen Ferien im Sommer, die Partys am Fluss.
Cristina verbindet ihr Handy mit dem Lautsprecher und stellt Musik an, Nicolae Guță singt. Der König des Manele. Was hat sie sich früher mit Loredana gestritten, wenn sie dieses kitschige Album ununterbrochen abgespielt hat. Immer wieder die gleichen Rhythmen und Texte. Aber jetzt ist es gut. Verlangen in Schleifen. Herzschmerz auf Repeat.
Ihre Gedanken laufen ins Leere. Sie fragt sich, wie sie die Nachricht beenden möchte, was für ein Gefühl am Ende stehen soll. Wehmut vielleicht. Oder Reife. Sie schreibt keine Grüße und stellt keine Fragen. Sie sendet die Nachricht, obwohl sie weiß, dass die Nummer längst abgemeldet ist.
Cristina steht auf und öffnet die Schreibtischschublade. Sie greift ganz nach hinten, wo die Schnur an der Schiene befestigt ist, zieht sie mit spitzen Fingern zu sich und fühlt die Erleichterung, als sie das Ende des Fadens spürt. Sie angelt nach dem Beutel, der daran hängt, nimmt ihren Pass aus der Innentasche ihrer Jacke, streicht über die raue Oberfläche. Das konnte der Polizist nicht verstehen: Dieses kleine Büchlein ist das Wertvollste, was sie besitzt. Ihr Geheimnis. Niemand weiß, dass sie einen zweiten Pass hat. Sie steckt ihn in den Beutel, fährt mit dem Nagel die Linie des Druckverschlusses entlang und hängt den Beutel wieder hinter die Schublade.
Mit ihrem Zeichenblock in der Hand geht Cristina auf den Balkon. Die Häuser stehen auf verschiedenen Ebenen. Treppen mit scharf geschnittenen Geländern verbinden sie. Zwischen den weißen Bodenkacheln der Plätze wächst vereinzelt Gras. Der Himmel zieht vorbei, nicht in ausgeformten Wolken, sondern in Schichten, die das Licht träge ändern. Vom Balkon aus wirken die Gebäude wie trübsinnige Geschwister, für ein Familienfoto aufgereiht.
Cristina zieht ihre Umrisse in ein paar fahrigen Linien nach. Zuerst widmet sie sich den groben Teilen und ihren Verhältnissen zueinander, in feinen Linien, kaum Druck auf dem Papier. Dann setzt sie die Konturen entschieden und schwungvoll mit dem Bleistift, bekräftigt die Bahnen mit einem feinen Filzstift. Am Ende nimmt sie den Radierer und löscht alle Vorüberlegungen, das Konstrukt, wieder aus. Nicht das vollendete Bild ist ihr wichtig, es beruhigt sie, Formen zu definieren und Material zu verbrauchen. Der Abrieb des Radiergummis. Minenstaub. Zarte Flocken Holz. Wie die Klingen beim Spitzen der Stifte ins Holz fahren und sich in den Widerstand drehen. Wie leicht die Filzstifte sind, wenn die Tinte daraus auf’s Papier geflossen ist.
Sie denkt daran, wie sich Loredana in der letzten Nacht, bevor sie gegangen ist, an sie gelehnt hat. Wortlos. Wie sie ihren Kopf auf Cristinas Schulter gelegt hat. Das Ohr ihrer Schwester am Ansatz ihres Schlüsselbeins. Wie es ein ganz kleines bisschen zu heiß war, eine ganz leichte feuchte Schicht unter ihrer Wange. Wie Loredana Cristinas Hand genommen und auf ihren Bauch gelegt hat und sich Cristinas Hand mit Loredanas Atem bewegt hat. Vielleicht wollte Loredana nichts anderes. Eine Berührung. Vielleicht war es ihr Abschied. Aber was, wenn nicht? Wenn eine Frage gereicht hätte, um sie mit ihr darüber sprechen zu lassen, was sie vorhatte. Cristina hatte gespürt, dass ihre Schwester sie brauchte.
Hätte sie einen Unterschied machen können?
Sie löscht das Licht und scrollt durch die Bilder auf ihrem Handy, um den Moment hinauszuzögern, wenn sie in den Schlaf driftet und alles von ihr abfällt. Wenn ihre Schutzwälle brechen und die kühlen, bitteren Fragen sie erreichen. Was, wenn sie Loredana nicht findet? Was, wenn sie alleine bleibt? Eine Stimme von weit her. Der Teppich im Wohnzimmer ihrer Großeltern. Ein schwerer Lampenständer aus Messing. Ein Flur, der aussieht, als würde er sich verengen.
3
Zu wenig Schlaf und schon zu viel Hektik um Valerie herum. Alle haben einen Vorsprung, funktionieren, steigen in Busse, stellen sich in Schlangen an, telefonieren. Valerie ringt noch um Zugriff auf den Tag. Sie sieht die Spiegelung der Passanten an der Haltestelle im Schaufenster gegenüber, und es dauert lange, bis sie sich selbst in der Menge erkennt: blass, unscheinbar, übernächtigt.
»Na? Auch schon da?«, fragt Magnus in einem scherzhaften Ton, in dem leichte Schadenfreude anklingt.
Egal. Valerie startet ihren Rechner und geht in die Küche.
»Bitte Kaffeesatz leeren«, erscheint in weißen LED-Buchstaben im Display. Sie enthakt die Schublade und nimmt den Behälter heraus, wiegt ihn prüfend. Der Druck hat aus dem Kaffee einzelne, restfeuchte Briketts gebildet, sie liegen ungleichmäßig in der Schale wie der Kot eines scheuen Tieres. Sie kippt den Inhalt in den Mülleimer.
Valerie setzt sich Magnus gegenüber, der mit beiden Zeigefingern angestrengt Sätze zusammenzimmert. Nach ein paar Worten hebt er den Kopf wie ein Schwimmanfänger, der Luft holt. Mit zusammengekniffenen Augen mustert er den Bildschirm und taucht, sobald er festgestellt hat, dass er nichts verbessern muss, wieder in seinen bürokratischen Satzbau ab. Schreiben als Kraftakt. Es ist ihr ein Rätsel, wie jemand, der den ganzen Tag vor dem Rechner verbringt, nur so mühselig tippen kann.
Der Dienststellenleiter kommt in den Raum, und ein paar Sekunden später ist sein schweres Rasierwasser wahrnehmbar, die Duftwolke folgt ihm als gehorsamer Ballon ohne Außenhaut. Er räuspert sich. »Okay, Männer«, sagt er jetzt gefasst und bestimmt, »wir haben …«, sein Blick fällt kurz auf Valerie, und er gerät ins Stocken, spricht aber weiter, ohne sich zu korrigieren: »Wir haben eine Spontanaktion. Kollegen von der Spurensicherung sind schon vor Ort. Abmarsch in einer halben Stunde. Adresse hab ich eben rausgeschickt.«
Eine Spontanaktion. Das passiert nur bei Kapitaldelikten. Ein Kribbeln durchströmt Valerie.
»Da wurde ja das ganz große Besteck rausgeholt«, stellt Valerie fest, als sie das wuchtige Gefährt vor der Villa stehen sieht.
Es ist einer von zwei Tatortbussen, die mit allem ausgerüstet sind, was man brauchen könnte, vom Stromgenerator über Flutlicht bis hin zum Zelt. Sie wundert sich, was der hier macht. Normalerweise werden die nur bei Fällen von großem Ausmaß verwendet. Kollegen in weißen Schutzanzügen gehen bedächtig durch die Gartenlandschaft wie nachdenkliche Stormtroopers. Es wirkt wie eine Kunstinstallation.
»Sieht nach stumpfer Gewalt aus«, erläutert die Kommissarin, »eher aus Affekt als geplant. Na ja. Man wird sehen.« Sie wendet sich zwei Mitarbeitern der Spurensicherung zu.
»Vielleicht ein Beziehungsstreit?«, fragt Magnus.
Valerie schüttelt den Kopf. »Die Anzüge brauchen wir nur, wenn sie hoffen, DNA einer beteiligten Person zu finden. Und bei einer Beziehungstat hilft DNA wohl kaum weiter. Es ist ja alles voll mit den Spuren der Menschen, die hier leben.« Sie reißt die Packung auf und fädelt ihr Bein in das Plastik.
»Die lassen sich es ja gut gehen«, zischt Magnus durch die Maske hindurch, als sie die Lobby betreten.
Was für ein komischer Satz. Was für ein schräger Typ er manchmal ist.
Valerie schüttelt den Kopf.
Aber klar: Wer so einen weitläufigen Raum nur als Eingangsbereich verwendet und mit Marmor ausgekleidet, der hat keine Probleme, seine Miete aufzubringen. Wenn er überhaupt mietet.
Der Tote liegt im Wohnzimmer. Mehr als eine ausgestreckte Hand vom Flur aus hat Valerie von ihm bisher noch nicht gesehen. Weder seine Frau noch Kinder oder irgendwelche Angestellten sind da. So liegt er seltsam bezugslos auf den harten Fliesen, nicht als Ehemann, Vater oder Chef, was er nach ersten Kurzinformationen zweifellos ist, sondern als Teil einer zu deutenden Konstellation, als Cluster von Spuren.
Ein Kollege von der Spurensicherung hat das Handy des Opfers schon eingetütet. »Mobilfunk-Endgerät« wird es in der Auflistung genannt werden. Mit jedem Schritt knistert Valeries Anzug, gleiten ihre in Plastik gehüllten Schuhe auf dem Marmor entlang. Worte dringen leicht gedämpft durch die Folienkapuze an ihre Ohren. Sie stellt den Router sicher, schraubt die Festplatten aus zwei Arbeitsrechnern im Büro, entkabelt die Telefone. Valerie bewegt sich weiter durch das Haus, keine Kameras, aber jede Menge Smarthome-Installationen. Steuerung für Lampen und das Garagentor. Ein Staubsauger-Roboter. Beleuchtung für die Einfahrt. Im Badezimmer per App einstellbare Lichter. Sogar die Wassertemperatur ist steuerbar. In der Ecke steht ein Smart Speaker. Könnte vielversprechend sein. Valerie sichert ihn.
Das Badezimmer ist größer als ihr eigenes Zimmer zu Hause. Eine große verglaste Dusche neben der Badewanne. Ein Bild, wie jemand darunter zusammengekauert weint, blitzt in ihr auf. Riesige Spiegel lassen das Bad noch weitläufiger erscheinen. Auf beiden Seiten sieht sie sich, eine in weißem Plastik aufgeplusterte Gestalt, die sich bis in die Unendlichkeit wiederholt.
Zurück im Büro teilen sie die Asservate auf. Magnus hat sich der Festplatten angenommen, Valerie dem Auslesen des Handys. Manche frustriert das, Valerie liebt es. Diese Beharrlichkeit. Die Ruhe. Die Systematik. Wenn sie Glück hat, wird sich alles aufblättern und erschließen.
»Ein Fall für die Hexe?«, fragt Magnus vergnügt.
Sein Spitzname für Valerie amüsiert ihn. Im Hex-Editor kann sie Dinge, die selbst sein Verständnis übersteigen. Da, wo es an das Grundgerüst der Daten geht, an die blank offenliegenden Bytes. Leider ist das ist nur selten nötig.
»Später vielleicht«, sagt Valerie.
Um Valerie und Magnus herum ist es ruhig. Sie reden nicht, sind vertieft in ihre Aufgaben. Es gelingt Valerie, das Handy zu öffnen und eine Kopie der Daten auf dem Gerät zu erstellen. Aha. Sie rückt ihren Stuhl näher an den Bildschirm. Komm schon. Lass sehen, wer du bist.
Er hat die üblichen Apps installiert, Facebook-Messenger, WhatsApp, Tinder und eine weitere Dating-App, Dienste, deren Betreiber normalerweise keine Infos herausgeben. Und ein triftiger Grund wie Suizidgefahr oder Terrorverdacht steht ja nicht im Raum. Aber zum Auslesen der gängigsten Plattformen kann Valerie auf kommerzielle Programme zurückgreifen.
Sie findet abgehackte Kurzsätze in einem Chat-Verlauf mit einer »Cristina«: »Und du so?« – »Vermiss dich.« – »War schön gestern.« – »Wann sehen wir uns?« Ein Rhythmus aus Herzen und Kuss-Smileys. Weit aufgerissene Augen, schieres Erstaunen, gerötete Scham, »Was treibst du so?«, zwinker, zwinker, »Das schaffst du«, ein gespannter Bizeps, Daumen hoch, »Sorry, dass ich mich jetzt erst melde«, Affengesicht hinter Händen verborgen. Ein fünfzigjähriger Mann schreibt wie ein Teenager. Wieder so eine Comic-Sans-Romanze.
Kurz hat sie Mitleid mit dem vielleicht frisch Verliebten. So schnell geht Schwung verloren und verpufft ins Nichts. Ausgeschaltet. Jetzt liegt er auf irgendeinem Obduktionstisch, und bald werden seine Organe inklusive des Gehirns in einem Plastiksack im Brustkorb verstaut. Am Ende bleibt ein zugenähter Körper.
»Wie heißt denn die Frau von Wagenbach?«, wendet sie sich an Magnus.
»Von wem?«, fragt er abgelenkt. »Ach so, Magdalena heißt die.«
Leuchtet ein. Wenn er nicht gerade ständig auf Geschäftsreise ist, warum sollten sich beide sonst so fortwährend vermissen? Das Gespräch verläuft tagsüber, nur vereinzelt Texte in der Nacht, die ausnahmslos von ihr kommen. Er wird wohl kaum seiner Frau geschrieben haben.
Valerie öffnet die Medien. Bilder der Frau, grelle Farben, wallende Locken, große Augen, maskenhaft. In Pose geworfenes Verlangen, das Valerie nicht überzeugt.
Sie gibt die Daten an die ermittelnden Kommissare weiter. Feierabend. Morgen mehr.
Zu Hause riecht es nach angebratenem Knoblauch. Thomas steht in der Küche und hat auf zwei Brettern alles Mögliche fein gehackt. Zwiebeln, gelbe Paprika, Kirschtomaten, Zucchini und Pilze liegen in ordentlich voneinander abgetrennten Häufchen nebeneinander.
»Kann ich was helfen?«
»Ich komme klar, danke.«
Sie schenkt sich ein Glas Wein ein und setzt sich an den Küchentisch.
»Was macht die Arbeit?«, fragt er beiläufig.
Sie seufzt und nimmt einen Schluck. »Wir waren nach langer Zeit mal wieder an einem Tatort. Reicher Typ. Erschlagen. Hatte wohl eine Affäre. Vielleicht war es Eifersucht.«
Sie erzählt von dem riesigen Haus, von der installierten Technik, erwähnt die Marmorböden und wird dabei immer unzufriedener mit ihrer Erzählung. Obwohl sie versucht, alle Details zu schildern, kann sie einen wichtigen Kern nicht fassen, ein fundamentales Gefühl von Kälte und Einsamkeit in diesem Haus, einen Mangel an Zugehörigkeit, eine durchdringende Verlorenheit. Sobald sie versucht, das zu beschreiben, hört es sich banal an oder, noch schlimmer, als wäre es ihre Projektion, als wäre sie einer dieser Menschen, die alles immer mit einem tieferen Sinn beladen müssen.
Sie essen vor dem Fernseher, schauen einen Film, den sie ausgesucht hat. Mit dem Essen auf dem Schoß, auf der Couch, eine Variation von lang zurückliegenden Kindheitsmomenten.
Es ist ein komplizierter schwedischer Thriller über die Entführung eines Jungen, und Valerie muss ein paarmal nachfragen, warum etwas passiert. Thomas hält den Film an und erklärt ihr in seinem vertraut lakonischen Ton die Zusammenhänge. Er hat ein echtes Talent dafür, nicht nur der Geschichte zu folgen, sondern auch nicht chronologisch Erzähltes zu entwirren, für das Gesamtbild vernachlässigbare Einzelheiten wegzulassen und Handlungsstränge kompakt wiederzugeben.
Thomas wirkt entspannt und ruhig, aber dann erscheint die Mutter des entführten Kindes im Bild und geht mit einer Waffe auf das Gerichtsgebäude zu. Der Film blendet aus, und Thomas wird nervös. Er mag keine offenen Enden.
Valerie gähnt, steht vom Sofa auf, hebt die Hand und geht in ihr Zimmer.
Eine Weile ist alles still. Dann hört sie Thomas auf und ab gehen, in der Küche rumoren. Sie steht auf und findet ihn auf dem Balkon.
»Kannste nicht schlafen?«, fragt er sie.
»Und selber?«
Er zuckt mit den Schultern und zieht an der Zigarette. Ihr Blick fällt auf seine Umrisse auf dem Boden vor der Balkontür, und sie ist für einen kurzen Augenblick irritiert, dass die Glut des Schattenmannes nicht aufglimmt.
»Hast du es mit einem Hörbuch probiert?« Der Boden unter ihren Fußsohlen ist kalt.
»Hörbuch, Buch, Musik … Ich bin irgendwie unruhig. Ich weiß auch nicht.«
Sie denkt nach. »Gibt es nichts, auf das du Lust hast?«
Er betrachtet seine Zigarette und dreht die Asche bedächtig in den Aschenbecher. Wie zu sich selbst sagt er: »Waffeln. Ich hab schon lange keine Waffel mehr gegessen. Wir müssen bald mal welche machen.«
»Wir backen jetzt welche«, beschließt sie und geht in die Küche.
Er folgt ihr verschämt. Während sie die Zutaten vermischt, spekuliert sie darüber, was nach dem Ende des Films passiert ist. Die Mutter habe sich am Entführer ihres Kindes gerächt.
Die Attacke sei doch gar nicht gezeigt worden, wendet Thomas ein.
»Es wurde aber angedeutet«, erwidert Valerie.
»Aber dann wird die Mutter doch angeklagt.«
»Natürlich.«
»Und das Kind?«
»Das Kind kommt in ein Jugendheim.«
»Und der Entführer?«
»Der überlebt den Angriff und wird zu einer hohen Gefängnisstrafe verurteilt.«
»Sicher?«
»Ganz sicher.«
Das scheint ihn zu beruhigen. Valerie ahnt, dass er damit hadert, sich nicht alleine in Balance bringen zu können. Er nimmt ein paar Bissen von der Waffel, bedankt sich kaum hörbar und schleicht wieder in sein Zimmer. Ruhe.
Valerie legt sich ins Bett. Neben ihr auf dem Kopfkissen blinkt ihr Handy. Eine Nachricht von ihrer Freundin Anna, ob sie bald mal wieder etwas unternehmen. Ein zweiter Text: »Ich denk gerade an dich. Du hast dich gut angefühlt. Nils«
Sie wird ihm nicht antworten.
Ihr Blick fällt auf das Cello, das in seinem Kasten in der Ecke steht. Mit seiner bauchigen, untersetzten Form und dem klobigen Kopf sieht es aus wie ein gedrungener Mann. Ein stummer Zeuge. Daneben im Schrank ruht ihre Dienstwaffe im Tresor.
Sie denkt daran, wie sie den Schulchor begleitet hat. Chor mit Streichquartett. Wie war das noch? Lieder von Brahms. Ihr Cello mit tief schnurrenden Tönen, die Sängerinnen mit dramatischen Worten, der Geiger immer knapp neben ihrer Tonlage. Sie versucht, sich an Melodien zu erinnern, schafft es nicht, hangelt sich an Fetzen von Texten entlang. Leimleisten-Arglist? Arglust? Nein. Leimruten-Arglist. Genau. Und: »Wer da nicht zu seufzen weiß.« – »Unbewegte laue Luft.« Und: »Ein dunkeler Schacht ist Liebe.« Das Bild eines Pärchens vor dem Louvre blitzt auf und verlässt sie. Eine staubige Straße in Spanien. Sie lenkt ihre Gedanken zurück zu den Liedern. Was war da noch? »Es träumte mir, ich sei dir teuer. Doch zu erwachen bedurft ich kaum. Denn schon im Traume bereits empfand ich, es sei ein Traum.«
Als es hell wird, liegt Valerie mit dem Gesicht zum Fenster und wacht in kurzen Abständen auf. Jedes Mal, wenn sie die Augen öffnet, hat das Licht wieder eine andere Nuance angenommen. Sie hört, wie die Wohnungstür sich öffnet, zuschlägt und Thomas den Gang hinuntergeht. Einen Moment lang sitzt sie auf dem Bettrand, die Hände auf die Knie gestützt. Sie öffnet das Fenster, ein erregt flimmernder Schein über den Häuserblocks ihres Viertels.
Wie die Menschen in ihren Betten liegen. Zwei in den benachbarten Wohnungen. Einer gegenüber. Einer über ihr. Einer unter ihr. Sechzehn in ihrem Gang. Dreihundertzwanzig in den zwanzig Stockwerken des Flügels. Mit den anderen Flügeln zusammen sind es eintausendzweihundertachtzig. Eintausendzweihundertachtzig Menschen, die sich noch mal umdrehen, räkeln, Kaffee in Filter füllen, Pausenbrote für ihre Kinder schmieren. Wände links, rechts, oben, unten.
Valerie hat nichts mit ihnen zu tun.
4
Adrian räkelt sich. Menschen in Wohnungen hinter Balkonen. Einer davon ist er. Einfach und simpel. Nicht mehr als eine Skizze: Der Tag nimmt Form an. Sonnenlicht fällt durch sein staubiges Fenster wie durch Pergamentpapier, ein sorgloser Moment, bis ihn ein drückendes Gefühl beschleicht: Wagenbach.
Adrian steht auf, gießt Milch auf Cornflakes, nimmt einen Zug von der Zigarette, isst einen Löffel. Ein säuerlicher Geschmack legt sich auf seine Zunge. Er drückt die Zigarette aus. Sein Handy vibriert, Jasmin will wissen, wann er Paul am Wochenende abholen kann. Er überfliegt den Text, schließt ihn und ruft die letzte SMS von Wagenbach auf. »Wir müssen reden.«
Aber was zum Henker wollte er mit ihm besprechen? Sicher irgendwas mit Cristina. Wagenbach, dieser Trottel. Musste er sich mit ihr einlassen? Aber vielleicht ist auch gar nichts gelaufen. Er wollte das, so viel steht fest, so oft, wie er ohne Grund in der Fabrik aufgetaucht ist, wenn Cristina da war. Und jetzt ist er tot. Aber wer war das? Sie selbst? Jemand, der eifersüchtig war? Victor? Niemals. Oder was Geschäftliches? Kober und Wagenbach waren gleichberechtigt, wer weiß, was die für ein Verhältnis hatten. Aber daran glaubt Adrian nicht, es lief doch alles reibungslos. Wagenbach hat es einfach nicht verstanden: Ein System, das funktioniert, muss man in der Balance halten. Da kann man nicht an einer Sache drehen und denken, es wirkt sich nicht auf alles andere aus. Da kann man nicht immer mehr wollen, mehr Geschäftsbereiche, mehr Frauen, das wird alles instabil. Jetzt wackelt das ganze Konstrukt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Bullen auch bei ihm auftauchen. Was für eine Scheiße.
Nun, da Wagenbach tot ist, hat Kober ihn zu sich bestellt. Normalerweise wollen Leute wie er gar keine Einzelheiten dazu wissen, wie Adrian arbeitet. Solange alles gut läuft. Aber Kober muss klar sein, warum seine Kosten so niedrig sind. Warum er und seine Geschäftsfreunde in den Bonzen-Karossen in der Gegend herumfahren, in Autos, deren Motor man gar nicht hört, die über den Asphalt gleiten, einen vollkommen abkapseln von allem, was rütteln oder ablenken, schlecht riechen, klappern, dröhnen oder sonst wie stören könnte.
Adrian fährt mit dem Fahrstuhl in die Tiefgarage, angenehm kühl ist es hier, er drückt auf den Schlüssel, und der Land Rover blinkt auf, Karosserie gewordene Zuverlässigkeit. Er gibt Kobers Privatadresse ins Navigationssystem ein, eine Straße in Harlaching.
Warum lädt ihn Kober nicht ins Büro ein? Es kann nur bedeuten, dass er sich für seinen Umgang mit ihm schämt, dass Adrian sich nicht am Empfang melden soll, dass niemand aus Kobers Arbeitsumfeld sie zusammen sehen soll. Dieses feige Arschloch.
Adrian bewegt den Wagen durch die Straßen, SUVs und gehobene Mittelklasseautos, sporadisch stehen Sportwagen am Straßenrand, rein vom Modell her passt seiner dazu. Das Navi informiert ihn, dass er sein Ziel erreicht hat, und er fährt an den Rand der viel zu breiten Straße. Er drückt den Messingknopf neben Kobers Namen, hört kein Klingeln.
Kober versteckt seinen Reichtum nicht verschämt, stellt ihn aber auch nicht zur Schau wie Wagenbach, der Hund. Hier ist es eher ein gut gefütterter Wohlstand, dicke Mauern, kleine Fenster, zumindest zur Straße hin. Hinter den Hecken, in Richtung Terrasse, sieht es anders aus. Eine Frau auf einer Liege im Nachbargarten. Die Sonne so tief, dass der Schatten der Hecke sie bald erreicht. Eine warme, milde Zurückgezogenheit. Ein solides Haus, bescheiden, es hebt sich nicht von den anderen ab, obwohl deren Bewohner wahrscheinlich ähnlich reich sind. Wie eine Absprache, bloß nicht durch Extravaganz hervorzustechen. Das soll ein seriöser Reichtum sein, einer der erarbeitet aussieht. Als wäre das Geld nicht schon seit Ewigkeiten in der Familie. Zumindest vermutet Adrian das, es ist ja immer so. Von der Vorgeneration in der Nachkriegszeit erarbeitet, oder auch weiter zurückreichend, Prunk wäre da geschmacklos. Bestimmt gibt es innen eine große Sauna, einen Pool oder so was.
Über allem liegt eine unfassbare Langeweile. Geräusche von einem Federballspiel hinter einer Hecke. Flupp. Flupp. Pausen, wenn der Ball geräuschlos aufkommt. Wer da spielt, sieht Adrian nicht.
Er klingelt erneut.
»Sorry!«, ruft Kober von der Tür.
Der Summer ertönt, und Adrian drückt das Tor auf, drückt sich in den Garten, drückt Kobers Hand, der sagt: »Wunderbar, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen, ganz wunderbar ist das.« Um seine Schultern ist ein kleines Handtuch gelegt, dabei ist er weder verschwitzt, noch hat er nasse Haare.
»Wunderbar«, wiederholt Adrian langsam und folgt Kobers Geste in den kühlen Hausflur.
»Einfach durch ins Wohnzimmer.«
Adrian setzt sich an den Esstisch vor der offenen Küche, vor den halb geschlossenen Jalousien. Frisch geschnittene Blumen stehen in eine zu schmale Vase gepresst.
Kober gießt ihm ein Glas Wasser aus einer Karaffe ein.
»Also, was ich hauptsächlich besprechen will, ist, wie die veränderte Situation möglicherweise Abläufe beeinträchtigt, unsererseits – oder vielleicht auch bei Ihnen.«
»Die Situation«, wiederholt Adrian.
»Ja, Sie wissen schon«, sagt Kober und weicht Adrians Blick aus. »Wagenbach und das alles, diese ganze unglückselige Geschichte, das hat uns natürlich schockiert, und wir sind auch besorgt. Auch wegen unserer eigenen Sicherheit, versteht sich.«
Adrian nimmt einen Schluck. Das Glas ist schwer und kalt. »Ich habe nichts damit zu tun.«
»Natürlich«, sagt Kober hastig und tupft sich mit dem Handtuch ins Gesicht. »Damit wollte ich keinesfalls implizieren …«
»Wir sind bestens aufgestellt, da müssen Sie sich keinerlei Sorgen machen.« Adrians Hand liegt noch an dem Glas.
Kober nickt, seine Miene zeigt pures Verständnis.





























