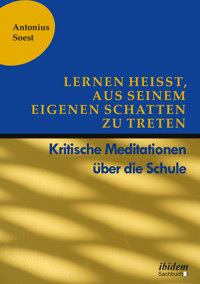
12,99 €
Mehr erfahren.
Es heißt, das Reden über Kunst sei ein notwendiges Selbstgespräch der Gesellschaft. Noch viel mehr gilt das für das Reden über das Lernen. Ist ein gelingendes Leben ohne gelingendes Lernen möglich? Kann eine Gesellschaft funktionieren, ohne dass die Menschen erfolgreich gelernt haben? Was ist überhaupt erfolgreiches Lernen? Antonius Soest, langjähriger Schulleiter, setzt sich in seinem vorliegenden Buch mit den Bedingungen erfolgreichen Lernens auseinander – und mit der Rolle des wichtigsten Ortes institutionalisierten Lernens, der Schule. Worauf kommt es an, damit die Schule nicht nur eine Qualifizierungsfunktion übernimmt, sondern gleichzeitig Lust am Lernen vermittelt und ein Ort der demokratischen Erneuerung sein kann? Lernen, das nicht auf Bulimie hinauslaufen soll, ist – wie stark auch immer – Neudenken, Umdenken, Experimentieren, Üben, Lust am produktiven Ausprobieren. Davon ist Soest überzeugt. Er zeigt auf, wie ein solcher Lernprozess, auch in der Schule, gestaltet sein kann, welche Voraussetzungen und Haltungen entstehen müssen, damit Lernen von der Pflicht zur großartigen Erfahrung wird. Der Lernende bewegt sich, verändert sich selbst und genießt so das Leben. Damit treten Lernende aus ihrem Schatten und damit aus der Gefahrenzone von Gleichgültigkeit, Fanatismus und Selbstzerstörung. Lernende sind zunächst einmal Kinder, aber auch Eltern und alle Lehrende. Und wenn Politiker über Bildung reden, kann man nur hoffen, dass sie Lernende sind. Es gibt in der Gesellschaft eine Sehnsucht nach dem Besseren. Dieses Buch möchte helfen, diese Sehnsucht alltagstauglich zu machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
ibidem Press, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
Eine Herzenssache
Einleitung: Licht und Schatten
I. Warum es sich lohnt, optimistisch zu sein
1. Erste Einstimmung auf pädagogischen Optimismus
Lernen als erfüllte Gegenwart
Wie in den großen Ideen die Pädagogik übersehen wird
Ein kleiner Sidestep und ein neues Blickfeld
Lernen oder Fanatismus
2. Zweite Einstimmung auf pädagogischen Optimismus
Krisensymptome und praktische Hilflosigkeit
Leben-Lernen und Selbstoptimierung
Lehren, Lernen und die Glückserwartung
II. Die alte Schule und die Schattenwelt
1. Schule als Ort der schwachen Botschaften
Was sind starke Botschaften?
Traditionelle Strategien, Botschaften eine starke Wirkung zu geben
Schwache Botschaften, starke Handlungen
2. Selbsttäuschungen pädagogischer Professionalität
Kritik des naiven Professionalismus
Professionalität im Bann vordemokratischer Strukturen
An den Rändern des professionellen pädagogischen Alltags
3. Armer Sisyphos – glücklicher Sisyphos
Armer Sisyphos
Glücklicher Sisyphos
Der glückliche Sisyphos und die Produktivkräfte des Lernens
III. Produktivkräfte des Lernens
1. Die Produktivkraft der Selbstwahrnehmung: Ich weiß, was ich tue
Pädagogische Miniaturen zur Selbstwahrnehmung
Der aktive Blick auf sich selbst
Die Selbstwahrnehmung als Glückserfahrung
Das Logbuch: praktisches Lernfeld und Metapher des Leben-Lernens
2. Die Produktivkraft des Engagements: Ich tue, was ich will
Pädagogische Miniaturen zum Engagement
Engagement: Akte der Freiheit
Produktives Handeln und die Idee des Konzeptes
Engagement und schulisches Lernen
Die Fundierung von Engagement nach Feldenkrais und Goethe
„Schläft ein Lied in allen Dingen“
3. Die Produktivkraft der Freundlichkeit: Ich will Nähe
Pädagogische Miniaturen zur Freundlichkeit
Freundlichkeit – der pädagogische Lackmustest
Erfahrungen in Parallelwelten
Freundlichkeit – eine konstruktive Sprengkraft
4. Produktivkraft der Bewegung: Ich will Leichtigkeit
Pädagogische Miniaturen zur Bewegung
Bewegung in der Schule
Verausgabung, Leere und die innere Ruhe
Wenn ich Fußballtrainer wäre …
5. Produktivkraft der praktischen Intelligenz: Ich will über mich hinaus
Pädagogische Miniaturen zur praktischen Intelligenz
Intelligenz als problematischer Indikator
„Jenseits von Begabt und Unbegabt“
Was fördert die Intelligenz?
„Du kannst mehr als du glaubst“
6. Die Produktivkraft der Gelassenheit, der Muße und der Meditation: Ich lasse die Welt sein
Pädagogische Miniaturen zur inneren Ruhe
Selbstvergessenheit in der Selbstbehauptung
Schule als Ort der Selbsterfahrung und Selbsterforschung
Schule als spiritueller Ort
„In Würde lehren und lernen“
IV. Schule und praktische Intelligenz
Eine bessere Schule ist möglich: hier und jetzt
Wozu die Produktivkräfte des Lernens taugen
Individualisierung und der Denkfehler
„Intelligenz der Praxis“
Eine Sache zu Ende bringen
„Archiv der Zukunft“ oder wie Fantasie praktisch wird
Ordnung und Freiheit
Geistesblitze, Emotionen und langer Atem oder Lernen als stärkstes Antidepressivum
Gedankenexperiment
V. Wie meine Schule aussehen könnte
PS: Wie man am Ende der Dienstzeit aus seinem eigenen Schatten tritt
Literaturverzeichnis
Dank
Eine Herzenssache
„Als 63jähriger trete ich vor Sie – allerdings weniger als Lehrender, denn als Entleerender –: Im Laufe der jahrzehntelangen Arbeit im Steinbruch der Sprache ist mir natürlich vieles um die Ohren geflogen, ist mir manches durch den Kopf gegangen, ist einiges darin hängengeblieben, und wes der Kopf voll ist, des geht der Mund über –: Hörnwerma, dannwermansehn.“1
Das sagte Robert Gernhardt am Anfang seiner Poetikvorlesungen.
Ich bin auch ungefähr so alt. Was Gernhardt über die Sprache sagt, gilt für die Schule, für das Lernen und Lehren allemal. Als Lehrer und Schulleiter weiß auch ich ein Liedchen davon zu singen. Und was werden wir sehen? Soll nach der Lektüre des Buches alles klar sein und anders werden? Na ja, schön wär’s. Manchmal geht ja selbst von Illusionen eine große Kraft aus. Denn – so eine mögliche Übersetzung – Illusionen bringen ja etwas ins Spiel. Es gibt jedenfalls gute Gründe, dass vieles besser wird. Viel zu vielen Lehrkräften geht es nicht gut mit der Schule und viel zu vielen Schülerinnen und Schülern auch nicht. Aber warum sollte es so bleiben? Weil es immer so war?
Wollen wir uns nicht kleiner machen, als wir sind. Wir sind die Subjekte unserer Arbeit, zumindest sollten wir uns als Subjekte neu ermächtigen.
In meiner alten Schule, der Gebrüder-Humboldt-Schule, habe ich viel gelernt, so viel, dass ich mich ermutigt sehe, den Weg unserer Arbeit noch in anderer Form weiterzugehen.
Wenn ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, das Buch lest, bedenkt die vielen Zeiten, die ihr mit Abwesenheit und Abwendung verbracht habt. Die mögen für euch auch schön gewesen sein, vielleicht schöner als der Unterricht. Ihr werdet euch jedoch auch erinnern, wie stark ihr euch in den Momenten großer Intensität gefühlt habt. Und wie ihr von diesen Momenten gezehrt habt. Diese Momente könnten – im Ernst – der Normalzustand sein. Und bitte, wendet euch nicht ab, wenn es um die Wege zur Selbstdisziplin geht. Sie ist nämlich eine Glücksbedingung.
Wenn ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Buch lest, werdet ihr euch über manche Stellen freuen, über manche aber auch ärgern. Ruft nicht zu schnell „Wolkenkuckucksheim!“. Erinnert euch an die glücklichen Momente eurer Arbeit. Ich habe noch eure Gesichter vor Augen, denen man ansehen konnte, wenn die Arbeit mit den Lernenden gelungen war, Freude gemacht hat. Man konnte ihnen aber auch das Gegenteil ansehen. Die große Sympathie für euch ist mir nicht abhanden gekommen und ich finde, dass ich euch noch schuldig bin, meine Gedanken darzustellen, die helfen könnten, das Schul-Dasein erfolgreicher, intensiver, ja glücklicher zu machen. Ich habe viel von euch gelernt und weiß, dass im Moment des Unglücklichseins eine Kraft der Veränderung liegt, aber nicht im Moment der Gleichgültigkeit.
Und Sie, liebe Eltern, sind immer wieder über Ihren Schatten gesprungen. Sie wollen ja vor allem, dass Ihre eigenen Kinder „in der Schule gut sind“. Damit allein ist aber der Blick auf Schule eingeengt. Mit diesem Hauptanliegen neigen nunmal Eltern dazu, konservativ zu sein. Sie blenden nicht selten die Qualitäten der Schule aus, auf die es ankommt, damit alle gut lernen können. Ich weiß aber, dass Sie mehr wollten. Sie wollten, dass die Schule gut sein sollte, dass Lernen gelingen sollte. Ich habe das gute Gefühl, dass Sie bei größeren Veränderungen mitspielen würden.
Sehr geehrte Anhänger der Schulfolklore aus aller Welt, auf Ihnen werde ich viel herumhacken, und das haben Sie sich verdient. Sie vertreten den Stammtisch der Pädagogik. Sie sind denkfaul und oft borniert. Um sich selbst nicht in den Blick zu kommen, haben Sie für alles Scheitern EINEN Grund: der faule oder dumme Schüler, der faule oder unfähige Lehrer, die anmaßenden oder gleichgültigen Eltern. Wenn das alles nicht passt, bleibt Ihnen: So ist die Schule/So ist das Leben/So war es schon immer. Das ist eingebrannt ins Bewusstsein. Konstruktive Kritik ist Ihnen ein Gräuel. Visionen sind Ihnen ein Krankheitssymptom. Glück ist Ihnen ein Zufallsprodukt. Jede Veränderung ist Ihnen eine Zumutung, unnütz und schlimmstenfalls Missbrauch an Kindern. Den Status quo sprechen Sie heilig. Notfalls liefern Sie einen zuckersüßen Überguss über eine unbefriedigende Wirklichkeit. Man muss Ihre verdammt große Macht beschneiden, wenn wir das Lernen ernster nehmen wollen. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, diesen Folkloristen bekämpfe ich in mir selbst.
Liebe Kulturschaffende, herzlichen Dank für die unentwegten Anstöße. Sie sind unzufrieden, fordern, haben immer wieder neue Ideen. Sie wollen der Welt und den Menschen helfen, manchmal provokativ. Wenn Sie es ernst meinen, warum fragen Sie uns Pädagogen nicht, was wir dazu beitragen können zu klären, ob in der Schule denn überhaupt das Richtige bzw. richtig gelernt wird, um große Ideen wirksam werden zu lassen? Sie müssen sich schon mit uns verständigen. Oder fürchten Sie, große Ideen würden im Praxistest der Pädagogik kontaminiert? Dieses Buch dient der Vermittlung von Idee und Praxis. Wir brauchen Sie. Sie brauchen aber auch uns.
Wir befinden uns immer noch in der Gefangenschaft einer unbefriedigenden Tradition. Das muss nicht so bleiben.
Was Robert Gernhardt zum Gedicht sagt, gilt genauso für die Schule:
ALS ER GEFRAGT WURDE,
WIE EIN GUTES GEDICHT
BESCHAFFEN SEIN SOLLTE:
Gut gefühlt
Gut gefügt
Gut gedacht
Gut gemacht.2
Am Anfang steht das Gefühl. Es bereitet den Weg zu den Fakten und bringt sie zum Schwingen. Wenn es einen Vorgang gibt, der der Schwingung bedarf, dann das Lernen. Damit nehmen wir uns wichtig genug, wirksam zu handeln.
1 Robert Gernhardt, Was das Gedicht alles kann: Alles. Texte zur Poetik, Frankfurt 2012, S. 11.
2 Ibid., Rückseite des Buches.
Einleitung: Licht und Schatten
Es ist wie verhext. Nichts wird so oft wiederholt wie: „Die Bildung ist elementar.“ „In einer Gesellschaft wie unserer kommt es auf die Bildung aller an.“ „Unsere soziale, ökonomische und ökologische Zukunft hängt davon ab, ob alle Bildungsressourcen ausgeschöpft werden.“ Aber nichts ist so gewiss wie: Es ändert sich im Prinzip nichts. Veränderungen lassen sich allenfalls quantitativ beschreiben. Es gibt keinen wirklichen Fortschritt. Es wird immer das Entscheidende verfehlt: die Art, wie Menschen lernen, die Art, wie sie sich immer wieder im Lernprozess neu gewinnen müssen. Was stellt man sich vor, wenn man von der Ausschöpfung von Bildungsressourcen spricht? Irgendwie scheinen große Apparaturen im Spiel zu sein. Und wo diese im Spiel sind, sind Entscheidungszentralen am Werk. Jedenfalls hat man großartige technische Vorgänge vor Augen. Wer es so angeht, wird scheitern. Die Drohung der „Bildungskatastrophe“ von Georg Picht 19641 und wiederholt von Julian Nida-Rümelin 20152 nützt so viel und so wenig wie die Drohung mit der Klimakatastrophe. Alle ökonomischen Begründungen für mehr Bildung sind nicht schlecht, aber nicht zwingend überzeugend angesichts der Wirtschaftsdaten Deutschlands. Primär geht es um etwas anderes: um die Fähigkeit demokratischer Teilhabe, ohne die es soziale Verwahrlosung gibt, und um die Ermöglichung individuellen Glücks. Wer wollte das verbreitete psychische Elend leugnen? Neben den wachsenden sozialen und psychischen Problemen wird die Inklusion von behinderten Kindern und Flüchtlingskindern im Rahmen tradierten Unterrichts scheitern. Weder Schönreden noch moralischer Druck werden das verhindern. Allein zusätzliche finanzielle Mittel, selbst in erheblichem Umfang, werden daran nichts ändern.
Ein Gewährsmann für bessere Bildung ist Ralf Dahrendorf, dessen Forderung von 1965 immer noch nicht erfüllt ist. Er spricht unaufgeregt vom „Bürgerrecht auf Bildung“.3
„Das Bürgerrecht auf Bildung ist zunächst ein soziales Grundrecht aller Bürger, das gleichsam den Fußboden absteckt, auf dem jeder Staatsbürger stehen darf und muß, um als solcher tätig zu werden.“
Ich wiederhole: tätig zu werden. Zu diesem Bürgerrecht stellt er weiterhin fest:
„Es darf keine systematische Bevorzugungen oder Benachteiligungen bestimmter Gruppen auf Grund leistungsfremder Merkmale wie Herkunft oder wirtschaftliche Lage geben.“
Er wendet sich aber auch gegen die Verkürzung dieses Bürgerrechts auf formale Chancengleichheit und formuliert einen bis auf den heutigen Tag uneingelösten Anspruch:
„Als materiale Chancengleichheit, genauer als Lösung der Menschen aus zugeschriebenen Bindungen und Befreiung zu eigener Entscheidung, ist das Prinzip der Bürgerrechte zugleich virulent und konkret.“
Auch wenn ich nicht genau weiß, wie sich Dahrendorf „virulent und konkret“ ausmalt, ich möchte es jedenfalls ausmalen.
Vor einigen Wochen habe ich in Hamburg eine Veranstaltung besucht, in der es um die Frage von Glück und Ausbeutung in der Arbeit ging. Sabine Donauer stellte ihr Buch „Faktor Freude“ vor, mit dem Untertitel: „Wie die Wirtschaft Arbeitsgefühle erzeugt“.4 Freude ist eine Ausdrucksform des Glücks. Sie kann aber auch zu einem Faktor werden, der raffiniert Ausbeutung fördert. Sie kann wie eine emotionale Hülle wirken, in der sich auf moderne Weise Anpassung bis zur Selbstvergessenheit vollzieht. Freudvoll schlittern Menschen unter die Armutsgrenze und in die Altersarmut. Nun macht sich aber Freude nicht per se verdächtig. Es gibt einen Arbeitsbereich, in dem Freude zu einem unerlässlichen Faktor wird. Die Arbeit unterscheidet sich von der Arbeit aller anderen Bereiche und zeichnet sich durch einen außerordentlichen Inhalt aus: das Lernen.
Über Jahrhunderte wurde diese Arbeit behandelt wie jede andere Arbeit nach der industriellen Revolution: systematische und disziplinierte Abläufe mit maximaler Triebunterdrückung, schematisierte Anforderungen, schematisierte Überprüfungen, kontrollierte Ergebnissicherungen. Es gab einen zentralen Punkt, von dem aus organisiert und bewertet wurde. Das gilt im Prinzip bis auf den heutigen Tag. Damit wird der Inhalt der Arbeit in der Schule systematisch verfehlt. Lernen im humanen Sinne funktioniert so nicht. Dass wir so lange damit leben, hat verschiedene Gründe: der Output entsprach lange Zeit den gesellschaftlichen Bedarfen, sowohl was die kognitive als auch was die psychische Ausrichtung anging; die Schulfolklore verbrämte diese Vorgänge in vielen lustigen und traurigen Geschichten; die Profis gingen wie selbstverständlich davon aus, dass man die Arbeit auf der Basis dieses Zentralismus allenfalls besser machen kann, aber nicht wesentlich anders.
Wenn Lernen Bildung sein soll, dann müssen wir uns radikal von diesem Muster traditionellen Lernens abwenden. Einige Schulen haben das bereits gemacht, viele Einzelkämpfer unter den Lehrkräften auch. Wenn Lernen Bildung sein soll, dann ist es Bewegung, die Bewegung des ganzen Selbst. Es ist die Bewegung an einen anderen Ort, zu mehr Licht. Aufklärung! Aufklärung nach innen und außen. In jedem erfolgreichen Lernakt bewegt sich das Selbst und ändert sich selbst. Die Bewegung aus den Höhlen der Schattenwelt dürfen wir uns ruhig konkret vorstellen, aber auch metaphorisch, als Bewegung aus den Befangenheiten des Selbst. Manchmal haben diese den Charakter von Gefangenschaften, dann nämlich, wenn die Unfähigkeit unüberwindlich scheint, sich selbst und die Welt so bewusst in den Blick zu nehmen, dass man beides auch anders denken könnte. Wir befinden uns dann im Schatten unseres Selbst und haben die Kraft verloren, dieses Selbst zu entwickeln, sozusagen über uns hinauszuwachsen. Wie oft haben wir den Satz gehört, der jegliche Hoffnung zunichte macht: Er ist nur noch ein Schatten seiner selbst.
Wirkliches Lernen ist ein Selbst-Lernen im doppelten Sinne. Es ist immer ein Selbst, das lernt, und ein Selbst, das im Lernen entsteht. Jedes Kind besitzt seine eigene Zentrale, die entscheidet, ob und was gelernt wird. Wir können sie als Lehrende anregen, also stärken, oder schrumpfen lassen, also schwächen. Das berührt die Frage der demokratischen oder obrigkeitsstaatlichen Haltung. Wie müssen Förderkonzepte aussehen, die das berücksichtigen?5
Ich muss einmal auf mich selbst zu sprechen kommen, um das zu verdeutlichen. Ich sehe einen Zwölfjährigen, ausgestattet mit einer ausreichenden Selbstdisziplin, der die Küstenformationen an Nord- und Ostsee kennenlernen soll. Er lebt aber im deutschen Mittelgebirge und hat diese Küstenlandschaften nie gesehen. Er hat auch nicht die Spur einer Sehnsucht nach dieser Fremde und Ferne. Er fühlt sich auch nicht wie Nils Holgersson auf den Rücken von Wildgänsen, um mit dieser Welt in Kontakt zu kommen. Dummerweise stehen da ein paar Seiten im Erdkundebuch und die müssen durchgegangen werden. Es gelingt diesem Zwölfjährigen nicht, dran zu bleiben. Er schweift immer wieder ab und hat die neuralgischen Verstehensschritte verpasst. Er möchte aber gut sein. Er wendet alle Energie auf, einmal eine Frage zu erhaschen, auf die er ohne sachliche Kenntnis richtig antworten kann. Er hat es nicht geschafft, sich auf die Kontinuität des Geschehens einzulassen. Als Lernsubjekt fühlte er sich in keiner Phase, in der er auch nur in Ansätzen den Rhythmus einer Lernbewegung bestimmt hätte.
Die Prozentzahl von Beispielen dieser Art ist eher groß. Beispiele dieser Art stehen nicht für Bewegungen ans Licht, sondern – zumeist unmerklich – für Bewegungen in eine Schattenexistenz. Im Lernen, reduziert auf das Streben nach einer guten Note, geschehen fatale Prägungen. Was ist, wenn die gute Note nicht in Aussicht steht? Wenn man selbstbildend aus seinem eigenen Schatten treten will, dann müssen positive Emotionen ins Spiel kommen. Erst dann werden Lernakte zu kleinen Geburtsvorgängen.
Ich spreche noch einmal von mir selbst. Als Kind ging es mir vermutlich wie den meisten Kindern. Man musste mir nicht das positive Denken einreden. Ich wollte stets etwas gewinnen, aber auch retten, meine kleinen Welten, meine nächsten Menschen, meine Überzeugungen. Im Grunde ging es immer um den Sieg des Guten über das Böse. Alle realen oder fiktiven Unternehmungen waren dementsprechend emotional aufgeladen. Irgendwelche Visionen hatte ich immer, die mich antrieben. In meiner katholischen Dorfschule hatten wir fast jeden Tag Religion. Die Heldengeschichten von Jesus Christus habe ich aufgesogen. Als ich mit Scharlach im Bett lag, habe ich ein Buch über den Bekennermut eines Missionars gelesen. In dem Moment war dieser ein inspirierendes Vorbild. Schon vorher habe ich mit Hänsel und Gretel und vielen anderen Märchengestalten deren Leben in die Hand genommen und am Ende gewonnen. Die Bücher von Fritz Walter habe ich verschlungen. Ich las, dass er schon vor der Arbeit allein auf dem Fußballplatz trainiert hat. Nach der Lektüre habe ich meine Mutter gebeten, mich ganz früh zu wecken, um es schon vor der Schule Fritz Walter auf dem Sportplatz gleichzutun. Ich lernte Trompete zu spielen und hörte in mir den strahlenden, manchmal herzerweichenden Sound der Stars, an dem ich mich messen wollte. Als ich als Elfjähriger ein Jahr im Internat einer Klosterschule war, habe ich das Silentium am Nachmittag bei der individuellen Arbeit genossen. Ich habe einen Blick auf mich selbst bekommen und mich als Lernenden wahrgenommen. In diesem Blick habe ich mich selbst entdeckt und gut gefühlt. Im Alter von 14 bis 18 Jahren habe ich mich weitgehend aus dem Auge verloren. Etwas traurig denke ich an diese Jahre zurück.
Im Studium kam es zur Wiederentdeckung. Auch wenn es nun wissenschaftlich zuging, habe ich doch zugleich mit Schiller und Goethe die großen Selbstbefreiungsversuche der Epoche des Sturm und Drang miterlebt und mit Büchner die Menschen aus dem materiellen und psychischen Elend erretten wollen. In der kleinen Blume habe ich mit Adalbert Stifter das Lebensgefühl für den großen Zusammenhalt zu entdecken versucht. Und aus den Verwirrungen des jungen Törleß habe ich mit der humanistischen Vision einer besseren Schule und einer besseren Welt herausgefunden. Diese bessere Welt zu bauen war nicht nur literarische Fiktion, sondern immer auch eine politische Vision. Die Krisen begleiteten aber diese Hochzeiten stetig. Das kirchlich-religiöse Bett zerbrach. Dass ich nicht in die Fußstapfen von Fritz Walter getreten bin, lag natürlich nur an den frühen Knieverletzungen. Als meine spätere Frau mich fragte, ob Miles Davis und ich eigentlich das gleiche Instrument spielen, überkam mich eine heillos-heilsame Ernüchterung. Das ändert nichts an der Tatsache, dass immer große Visionen, große Emotionen im Spiel waren, wenn ich über mich hinausgewachsen bin. Das Alter von 14 bis 18 Jahren war eine armselige Zeit, mit wenig Inspiration. In dieser Zeit habe ich verdammt wenig gelernt. Ich war im Schatten meiner selbst. Was mir gefehlt hat, wird in diesem Buch auch Thema sein.
Ich bin sicher, dass Sie Ihre Geschichte ähnlich erzählen könnten, wenngleich die emotionalen Kraftquellen vermutlich ganz andere sind. Aber Emotion wird immer eine Rolle gespielt haben. E-Motion ist die Kraft, die Bewegung ermöglicht. Jeder große Roman, der mehr ist als eine Übung im kreativen Schreiben, beruht auf starken Emotionen und Ergriffenheit. Selbst der rationale Immanuel Kant richtet dem Verstand ein emotionales Bett her. Er fordert dazu auf, den Mut zu haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Ohne eine emotionale Kraft, den Mut, geht es auch bei ihm nicht.
Manche Kinder und Jugendliche meinen schon sehr früh zu wissen, was ihre spätere Arbeit sein wird. Sie sind in ihrer Gegenwart ergriffen von der Vision des Helfens, des Forschens, des Umgangs mit Technik, des sportlichen Erfolges usw. Das ändert sich in der Regel im Laufe der Entwicklung. Entscheidend ist, dass Visionen nicht in erster Linie trügerische Zukunftshoffnungen sind, sondern gegenwärtige Kraftspender. Dabei entstehen zwei Qualitäten, die für erfolgreiche Lernbewegungen eine Schlüsselrolle einnehmen: Selbstdisziplin und der lange Atem.
Selbstdisziplin steht bei manchen im Ruf, Gewalt gegen sich selbst zu sein. In der deutschen Geschichte ist Disziplin zu Recht in Verruf geraten. Diszipliniert wurden die schlimmsten Barbareien begangen. Nun gibt es aber kaum einen Begriff, der nicht für überholt erklärt wurde, dem nicht irgendwann das Etikett „Illusion“, „Denkfehler“ oder „kontaminiert“ angeheftet wurde. Das gilt für „Humanismus“, „Freiheit“, „Emanzipation“, „Kritik“ etc. Ich will auf diese Begriffe nicht verzichten und auch nicht auf „Selbstdisziplin“. Selbstdisziplin entsteht nicht, indem ein anderer sie einfordert. Selbstdisziplin ist eine Kraft, die sich unter günstigen Bedingungen entwickelt. Sie muss in der Auseinandersetzung mit den Widerständen des Lebens gelernt werden. Sie ist die entscheidende Bedingung für menschliche Wirksamkeit, für Selbstwirksamkeit. Diese ist aber auf Produktivkräfte angewiesen, die im Lernprozess zur Geltung kommen müssen. Der lange Atem ist ein anderer Ausdruck für das, was Selbstdisziplin meint. Mit diesem Ausdruck schauen wir aber aus einer anderen Perspektive auf die Qualität, eine Sache konzentriert zu beginnen und zu Ende zu bringen. Während die Selbstdisziplin sich noch des Verdachtes erwehren muss, sehr normativ zu sein, steht der lange Atem für innere Ruhe und Kraft. Wenn ich meine Aufmerksamkeit auf meinen Atem lenke, wird er automatisch lang. Ich behaupte an dieser Stelle: Das gilt für Aufmerksamkeit immer.
Ich werde zunächst darstellen, warum wir nicht ohne Optimismus auskommen können und dass es trotz aller Widrigkeiten gute Gründe für Optimismus gibt. Dann schauen wir den Tatsachen ins Gesicht, die die Schule mit dem Effekt erzeugt, dass die Produktivkräfte des Lernens schwach bleiben. Schließlich werde ich die Produktivkräfte porträtieren, die dafür sorgen, dass Selbstdisziplin und langer Atem und damit Selbstwirksamkeit entstehen. Wer wissen möchte, wie ein Rahmen für erfolgreiche Lernprozesse konkret aussehen könnte, der sollte sich die Ausführungen zu „meiner Schule“ nicht entgehen lassen.
Es geht um Schule, aber nicht nur. Schulen sollten heute (in der Demokratie) die Kathedralen der Gesellschaft sein. In Schulen entscheidet sich ganz wesentlich, ob Menschen eine glückliche Zukunft haben und die Gesellschaft eine dynamische demokratische Kraft entwickelt. Es soll allgemein vom Lernen die Rede sein, von dem es heißt, dass es lebenslang stattfindet. Damit geht diese Rede nicht nur von mir aus, sie ist auch an mich adressiert.
Ich möchte mit diesem Buch dazu ermutigen, die elementare Ebene in den Blick zu nehmen, auf der sich die Kräfte der Selbstwirksamkeit und des Selbstbewusstseins bilden. Ich bin sicher, dass Lehren viel leichter sein könnte, als es gegenwärtig der Fall ist. Es geht um mehr Leichtigkeit, um Lernen als subjektive Selbstanimation, um den notwendigen Schritt von der Didaktik zur Autodidaktik, um die Gewinnung von Selbstdisziplin als Glücksbedingung. Trotzdem ist es schwer, die Schulfolklore, die sich eher an den Kuriositäten der Schattenwelt ergötzt, zum Verstummen zu bringen. Pädagogische Theorie und Praxis der Vergangenheit haben durchaus viele Gewinne hervorgebracht. Sie konnten aber offenbar viele, ja zu viele pädagogische Vergeblichkeiten nicht verhindern. Diesen Vergeblichkeiten gehe ich nach. Wenn ich sie in den Blick nehme, entsteht ein Bild, das mehr verlangt, als an Stellschrauben zu drehen. Das Positive, theoretisch und praktisch, ist aber immer vorausgesetzt.
Ich bemühe mich um kritische Meditationen. Meditationen sind es deshalb, weil ich helfen möchte, sich von Mustern zu befreien, die handlungsunfähig machen. Meditationen sind Entleerungen, Befreiungsakte, Befreiung von Schulfolklore, falscher Professionalität und Angst. Es sind Unterbrechungen, kein bloßes Weitermachen. Kritisch sind sie, weil sie anknüpfen an der Aufklärung und damit an dem Wunsch, Einzelwohl und Gemeinwohl in Harmonie zu bringen. Wenn Sie mich fragen, welche der porträtierten Produktivkräfte am wichtigsten für einen erfolgreichen Lernprozess sind, kann ich das nicht beantworten. Ich kann nur sagen, welche der Produktivkräfte am stärksten vernachlässigt sind und besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. Das sind die Produktivkräfte „Selbstwahrnehmung“ und „Gelassenheit, Muße und Meditation“. Sie sind sträflich unterbelichtet in unserer Alltagspraxis. Aber erst in der Betrachtung aller Kräfte entsteht ein Bild, das Ansporn für eine bessere Schule sein kann.
Meine Essays haben den großen Wunsch, zur Reanimation des Menschen als Subjekt seines Lebens beizutragen. Ich gebe dabei Einblick in meinen eigenen Lernprozess und bemühe mich darum, eine Sprache zu finden, in der die schulische Wirklichkeit nicht gebannt und die Menschen nicht in die Enge getrieben werden. Ich möchte Grenzen durchlässig machen und eine Offenheit zum Ausdruck bringen, in der Menschen sich selbst fordern und damit sich selbst ernst nehmen können. Lehren und Lernen unterliegen in manchen Verlautbarungen noch immer einem kruden Naturalismus und Positivismus. Dabei sind sie kulturelle Höchstleistungen. Die folgenden Texte enthalten die Behauptung, dass Lernen, das man ernst nimmt, gar nicht anders kann, als das Ziel der Selbstwirksamkeit anzusteuern. Es geht um die (Wieder-)Entdeckung des Lernsubjekts. Dabei darf kein einzelner Schüler und keine einzelne Schülerin ausgenommen sein. Wer sich nicht als Lernsubjekt entdeckt, ist für den Bildungsprozess im humanen Sinne verloren. Er verharrt in seinem Schatten. Das sollte niemandem egal sein, vor allem keinem Pädagogen und keinem Politiker. In der Schattenexistenz liegt nicht nur der traurige Verlust individueller Möglichkeiten, sondern auch der Grund für Fanatismus. Er ist zu Hause in den Vorstädten vieler Metropolen, zeigt sich aber auch in der Obszönität eines Reichtums, der in ihrer Gier jede menschliche Regung fremd geworden ist. Das hat alles nichts mit der „materialen Chancengleichheit“ zu tun, von der Dahrendorf gesprochen hat. Es gibt gute gesellschaftliche Gründe, sich auf elementare Produktivkräfte des Lernens zu besinnen.
1 Georg Picht, Die deutsche Bildungskatastrophe, Analyse und Dokumentation, Freiburg 1964
2 Julian Nida-Rümelin/Klaus Zierer, Auf dem Weg in eine neue deutsche Bildungskatastrophe, Freiburg 2015.
3 Ralf Dahrendorf, Eine geplante Bildungsrevolution, in: DIE ZEIT, 12. November 1965.
4 Sabine Donauer, Faktor Freude. Wie die Wirtschaft Arbeitsgefühle erzeugt, Hamburg 2015.
5 Man kann diesen Aspekt gar nicht wichtig genug nehmen. In der Geschichte pädagogischer Alltagspraxis (und ich meine hier „Alltagspraxis“) ist es noch nicht so lange her, dass wir uns an Kants Auffassung, dass ein humanes Gemeinwesen das souveräne Individuum voraussetzt, orientieren und nicht an Hobbes‘ absoluten Herrscher, den es geben muss, weil der Mensch des Menschen Wolf sei. Allzu lange waren wir in der pädagogischen Praxis nahe bei Hobbes.
I. Warum es sich lohnt, optimistisch zu sein
1. Erste Einstimmung auf pädagogischen Optimismus
Lernen als erfüllte Gegenwart
Wir sind in der Gegenwart gefangen. Wenn wir zurückschauen oder vorausschauen, sind das gegenwärtige Akte. Wenn wir Langeweile empfinden, tun wir das gegenwärtig. Wenn wir froh sind, dass die Zeit verstreicht, ist das ein gegenwärtiges Empfinden. Lernen ist ein besonderer Modus des Gegenwärtigseins. Glückendes Lernen ist ein Vorgang geistig-körperlicher Bewegung. Manchmal entstehen Geistesblitze. Mit ihnen widerfährt uns höchstes Glück und intensivste Gegenwärtigkeit. In der Regel sind diese Geistesblitze durch Lernbereitschaft vorbereitet.
Schule ist der Ort des Lernens. Wie kann es sein, dass er so häufig als Ort der Erstarrung wahrgenommen wird? Er müsste der Ort der Freiheit sein. Wieso wird es von so vielen als Befreiung empfunden, wenn man diesen Ort verlassen darf?
Es gibt kaum eine Tätigkeit, die so sehr auf ein Zukunftsversprechen ausgerichtet ist, wie das Lernen im traditionellen Verständnis. Die Belohnung in der Gegenwart liegt gemeinhin in einer guten Note. Wenn die Note aber nicht gut ist, womöglich sogar schlecht, kann das Zukunftsversprechen nicht ernsthaft aufrechterhalten werden.1 Wenn das Glück des gegenwärtigen Lernens an das Glück der gegenwärtigen guten Note gekoppelt wird, wird Lernen für viele ein Desaster. Aus dem Vorgang des Lernens wird zumindest kein Optimismus gewonnen, der wiederum Bedingung für neues Lernen ist.2 Wenn Lernende alltäglich den Grund erleben, warum sie später erfolglos sein werden, kann bei ihnen kaum mit konstruktiven Handlungen gerechnet werden. Wenn man aber sieht, wie trotz alledem „schlechte“ Schülerinnen und Schüler Momente des Aufblühens erleben, wenn ihnen etwas gelingt, das dann auch bei Lehrenden auf eine positive Resonanz trifft, dann weiß man, was eigentlich möglich sein könnte. Es gibt also gute Gründe, in unserem Zusammenhang über Gegenwart zu sprechen und Lernen als gegenwärtiges Ereignis genauer in den Blick zu nehmen.
Wir sind in der Gegenwart gefangen. Und doch hat diese Gegenwart alles, was uns an Freiheit möglich ist. Was immer wir tun, wir tun es in unserer Gegenwart. Worauf immer wir uns konzentrieren, wir haben alles dabei, unsere Wünsche und unsere Ängste, unsere Neurosen und unsere Produktivkräfte. Sie sind immer in spezifischen Mischungen anwesend. Und sie entscheiden darüber, wie sehr wir uns konzentrieren können.
Lernen ist ein glücklicher Vorgang. Insofern ist „glückliches Lernen“ eine Tautologie. Er ist glücklich, weil er ein produktiver Vorgang ist. Was sind aber die Produktivkräfte des Lernens? Wie kommt die Bewegung des Lernens zustande? Da Lernen konkret ist: Wie können wir lernen, uns zu konzentrieren? Wie muss der Haushalt unserer Affekte, denn diese sind immer im Spiel, gefügt sein, dass er die Kraft zur Konzentration bereitstellt?
Den Haushalt der Affekte – man könnte auch sagen, die Totalität der eigenen Gegenwart – verliert die Schule in ihrer Standardkonstruktion aus dem Auge und damit verhindert sie das, wofür sie da ist: Lernen. Die Schulfolklore hat sich daran gewöhnt, das nicht so ernst zu nehmen. Sie würde sich aber womöglich irritiert zeigen, wenn sie wüsste, dass noch anderes verfehlt wird: Glück, Würde, Autonomie, Selbstbewusstsein. Das alles sind keine absoluten, keine metaphysischen Kategorien. Das alles sind Sensationen der Gegenwart. Und Gegenwart ist immer sensationell. Selbst im Versandungsprozess des Lebens, in dem die Wahrnehmungen immer schwächer werden und der Lernvorgang allmählich erstirbt, gibt es keine Entlassung aus der Gegenwart. Aber eine Wiederaufnahme des Lernprozesses ist jederzeit möglich. Das könnte der tiefere Sinn des Satzes sein: Für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät.3 Insofern ist mein Reden über die Schule immer ein Reden über das Leben. Wenn Lernen eine glückliche Art des Gegenwärtigseins ist, dann ist dieses Glück abhängig von der Anwesenheit der Selbstdisziplin. Sie entscheidet darüber, welche Sensationen die Gegenwart erfüllen.
Wie kann man Selbstdisziplin lernen? Ich meine nicht nachlernen, ich meine primär lernen, in Elternhaus und Schule. Kann man es lernen, aus seinem eigenen Schatten zu treten, Subjekt seines Lebens zu werden? Manche sprechen auch von der Autorschaft des eigenen Lebens. Ich frage also nach den Fähigkeiten, den Blick auf uns selbst zu richten, um so dieses Selbst zu stärken und zu entwickeln, und den Blick nach außen zu richten, um auf die äußere Welt einzuwirken, dort Spuren seines Selbst zu erzeugen und zu hinterlassen. Die Frage beantwortet sich nicht von selbst. Von Selbstwirksamkeit wird in der Pädagogik viel gesprochen, aber gleichzeitig wird allseits – auch in der Schule selbst – viel getan, dass es ein Trugbild bleibt. Ich möchte zeigen, wie Selbstdisziplin gelernt werden kann, ohne dass eine weitere Bildungstheorie entstehen muss. Es ist heute möglich. An manchen Orten ist es bereits gelungen.
Wie in den großen Ideen die Pädagogik übersehen wird
Man muss sich einmal die Mühe machen, die Bücher der letzten Zeit zu sichten, in denen sich gefragt wird, wer der Mensch sei, wie er sein solle, wie er sein Leben in die eigene Hand nehmen könne, wie die Welt zu verbessern sei und wie das eigene Leben glücklicher werden könne. Themen sind zum Beispiel „Selbstdenken“, „Aufbrechen“, „Gelassenheit“, „Glück“, „Muße“, „Selbstveränderung“, „Freiheit“, „Gerechtigkeit“, „Autonomie“, „Kreativität“, „Würde“, „Entschleunigung“. Sie richten sich an Erwachsene und verlangen im Grunde von diesen Erwachsenen ein Nachlernen. Die Kräfte, die mit diesen Themen aufgerufen werden, sind in der Regel unterentwickelt. Die Themen sollen ins Licht führen. Aber sie werden so lange den Schattenwelten verhaftet bleiben, wie die Ideen keine praktische Wirksamkeit bekommen, wie sie nur eine Ahnung von besserem oder erfüllterem Leben erzeugen. Die Themen sind einfach nur interessant. Sie haben nichts Drängendes und brechen nichts praktisch auf, führen also nicht aus der Unmündigkeit heraus. Sie formulieren Sehnsuchtspunkte, ohne Praxis zu forcieren.
Nach meinem Eindruck waren Menschen in ihrem Subjektsein lange Zeit völlig unterbelichtet, in der Philosophie, in den Sozialwissenschaften und in ihrem Alltag. Und ich muss nicht besonders originell sein, um festzustellen, dass Kinder einem geheimen gesellschaftlichen Lehrplan folgen, einem inoffiziellen Masterplan. In diesem Masterplan gibt es die Leitziele Konsum und ökonomisch-affirmative Effizienz. Die Kräfte der Selbstverantwortung und der Selbststeuerung stehen auf dem Papier, werden in der alltäglichen Lernpraxis aber nur scheinbar aufgerufen. Sie werden jedenfalls nur unzureichend wirksam. Wenn etwas als schädlich erkannt wird, behalten doch sehr oft die egoistischen, gesellschaftlich blinden Triebkräfte die Vorherrschaft. Man kann bei McDonald’s sitzend die zukunftsgefährdenden Trends der Agrarindustrie beklagen. Der geheime Masterplan hat eine maximale, aber undurchschaute Wirksamkeit. Es geht um das Funktionieren in dieser Gesellschaft, nicht um das Gestalten von Gesellschaft, nicht um die Entwicklung von Demokratie, nicht um die Sicherung von Zukunft und nicht um die Kultivierung von Lebenskunst. In der Schule wird dem Homo oeconomicus in die Hände gespielt.
Nun kommen aber die eingangs genannten neuen Themen ins Spiel. Man erinnert sich daran, dass Leben mehr ist als das, was man dem Homo oeconomicus zuschreibt.
Erstaunlicherweise gibt es nur wenige Bücher, die sich der Frage annehmen, wie man denn die Qualitäten primär erlernt, mit denen die Welt und das individuelle Leben verbessert werden können. Wo ist die Auseinandersetzung darüber, wie Menschen/Kinder lernen, in ihrem Lernprozess einen Bezug zu sich selbst zu bekommen, der ihnen ermöglicht, aktiv zu werden, einzugreifen, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen, innere Ruhe zu finden? Man tut so, als würde der Nachvollzug eines noch so intelligenten Gedankenganges reichen, um praktische Konsequenzen zu ziehen. Das ist aber nicht so. Es war für mich immer erstaunlich, dass der fehlende Link nicht bemerkt wird, der Link zwischen großer Kultur und den Ansprüchen der Intellektuellen einerseits und der pädagogischen Praxis andererseits.4 Es erscheint manchmal so, als gäbe es ideale Menschen, die gleichsam direkt vom Himmel gefallen sind. Wir sind aber empirische Kinder der Evolution aus Fleisch und Blut mit einer je individuellen Bildungsgeschichte. Wenn in Büchern nun Mängel in der Welt festgestellt werden und Mängel im Verhalten und in der Befindlichkeit der konkreten Menschen, dann fragt man sich, wer die Impulse für eine Veränderung aufnehmen soll. Ist in der Schule gelernt worden, sich immer wieder neu zu denken und neu zu handeln? Das bezweifle ich ganz entschieden. Die Lernenden haben in ihrer Zeit, in der sie professionell gelernt haben, nicht das Entscheidende gelernt. Die Selbstwahrnehmung der Lehrenden unterliegt – und hier mache ich mich gewiss unbeliebt – einer Selbsttäuschung. Der Philosoph Wilhelm Schmid appelliert in einem Titel an die Welt der Erwachsenen: „Dem Leben Sinn geben“5. Aber was muss Schule beachten, damit ein Leben Erfüllung findet? Annemarie Pieper schreibt über die vielen Formen und Aspekte des Glücks, aber die Frage nach dem Glück im Lernvorgang kommt bei ihr nicht vor.6
Schulen sind so organisiert, dass wir leicht vergessen, worauf es eigentlich ankommt. Schulisches Lernen haben wir in sehr kleine Päckchen geschnürt. Das ist zwar nicht unbedingt falsch, aber was es heißt, Leben zu lernen, verlieren wir aus dem Auge und damit die entscheidende Lernmotivation. Ein Reden über Toleranz zum Beispiel ist nichts wert, wenn man Toleranz nicht lernt, wenn man nicht als Kind schon Toleranz als Lebensmodus erfährt und sich bewusst macht. Ein Reden über Glück ist nichts wert, wenn man Glück nicht lernt, es nicht als Möglichkeit schon als Kind zu realisieren versucht. Dafür ist das Leben in der Regel zu widersprüchlich und schmerzhaft, als dass es sich dabei um Selbstgänger handelte. Also: Toleranz und Glück kann man, ja muss man lernen. Wie soll das aber gelingen? Darauf müssen Lehrende, ob in der Schule oder zu Hause als Eltern, eine Antwort geben. In den kleinen Päckchen der Schule finden sich in der Regel diese Antworten nicht. Der Fachunterricht ist allzu häufig dort angesiedelt, wo ein Mensch zum Belehrten, aber nicht zum Lernenden wird. Den autodidaktischen Impuls, lebenslang zu lernen, bekommt er dort nur selten. Um es schon an dieser Stelle zu sagen: Die Totalfixierung der Schulen auf Fächer, also die Präsentation des Weltwissens in Fächerform, führt zu einem unendlichen Mangel an Selbstwahrnehmung und Selbsterkenntnis. Dabei steht diese Selbsterkenntnis an der Wiege unseres aufgeklärten Denkens. Weil dieser Pol in der Persönlichkeitsentwicklung zu kurz kommt, ist auch der Zugriff auf die Welt gehandicapt.
Ein kleiner Sidestep und ein neues Blickfeld
Noch etwas anderes kann man in den Diskussionen der letzten Jahre bemerken. Von Kindern und Jugendlichen wird gesagt, sie seien in einem beklagenswerten Zustand. Sie seien ohne Disziplin, ohne Konzentration, ohne Werte, antriebsschwach, übergewichtig. Das sagen die Vertreter jener Welt, die alles dafür getan haben, dass die Einflüsse systematischer medialer Verdummung auf Kinder und Jugendliche größer und größer wurden, dass die Fähigkeit, verzichten zu können, für jedes kommerzielle Interesse geopfert wurde, dass Besinnung und Muße als konsumfreie Zeit nicht erwünscht sind, dass Eltern sehr häufig weder ausreichend Zeit noch Energie für intensive Zuwendung haben. Das alles wird verstanden als Privatangelegenheit. Gibt es ein öffentliches, ein politisches Interesse an Zielen wie Toleranz, Engagement, Nachdenklichkeit, Gelassenheit (als Produktivkraft gegen Fanatismus), individuellem Glück, Selbstwirksamkeit? Ich kann es nur hoffen. Auf diese Ziele kommt es nämlich eigentlich an. Alles haben zu wollen und zu einem großen Teil auch haben zu können, tut nicht gut. Es führt zu einem Verlust an Lebensqualität und auch an Demokratiefähigkeit. Ich setze Qualitäten dagegen, die aber eine andere Schule verlangen: Engagement, Selbstwahrnehmung, praktische Intelligenz, Klima der Freundlichkeit, Gelassenheit, Muße und Meditation, selbstbewusste Bewegung. Wie eine neue Sicht auf diese Qualitäten Schule positiv verändern muss, ist Thema der folgenden Essays. Auch wenn es sich plakativ anhört, bleibt festzustellen, dass Kinder sich in unserer Gesellschaft allzu sehr angewöhnt haben, Glück und Intensität in Konsum, Drogen und medialer Selbststeigerung zu suchen. Man kann es ihnen nur schwer verübeln, wenn wir es ihnen vormachen und ihnen nicht – nicht einmal in der Schule – andere Lebensmöglichkeiten bieten. Die üblichen Arrangements geben diese anderen Möglichkeiten nicht her. Sie sind vielmehr so, dass man meint, Schule müsse in erster Linie die Klugen von den Dummen unterscheiden und voneinander scheiden. Es ist schon von vielen gesagt, und ich sage es noch einmal: Wir denken Pädagogik nicht radikal genug und deswegen leiden viele einzelne Menschen und die Gesellschaft insgesamt. Wie müssen Lernorte sein, damit die genannten positiven Lernziele erreicht werden?
Die Schule der Zukunft wird ambitioniert sein oder sie wird ein Ort des Elends sein. In letzterem Fall werden sich kaum noch Lehrkräfte finden. Kultur wird in erster Linie eine Kultur der Vermeidung sein. Sozialkompetenzen werden in überforderten Familien nicht mehr gewonnen. Wenn Schule die Funktion haben soll, konstruktiv in gesellschaftliches Leben einzuführen – und eine andere Institution ist nicht in Sicht –, dann muss sie Bindungskräfte entfalten, die nicht durch Fachunterricht und Fachkompetenz allein entfaltet werden können. Wenn Schule nicht bindet und positive Leidenschaften ermöglicht, werden sich Kinder von der Gesellschaft entfernen und scheitern. Eine konstruktiv-kritische Haltung bildet sich nur, wenn ein ideeller Rahmen fasziniert.
Es gibt noch einen weiteren Grund für dieses Buch. Vermutlich ist kein nachgeburtlicher Vorgang komplexer als der des Lernens. Komplexität muss immer vereinfacht oder reduziert werden, damit sie im Alltag erträglich wird. Aber sie darf nicht so reduziert werden, dass sie verfälscht wird. Man muss Komplexität aushalten, selbst wenn man sie reduzieren will. Ich habe großen Zweifel, dass die Komplexität des Lernens in der Schule richtig reduziert wird. Die komplexe Struktur wird vielmehr in eine lineare übersetzt und damit nicht vereinfacht, sondern verfälscht. Es werden irreführende Kausalitäten unterstellt. Es werden falsche Konstruktionen von Input und Output erzeugt. Selbst im Begriff des Curriculums wird letztlich eine Linearität gedacht. Auch wenn dieses Denken zunehmend in eine Krise gerät, bleibt die Schule in ihren Standards doch im Bann dieser Linearität. Es gibt Schulen, die mutig andere Wege gehen. Die Regel ist aber, dass das Empfinden dessen, was für normal gehalten wird, eine große Macht besitzt. Ich werde versuchen, in meiner Darstellung von Produktivkräften des Lernens aus dem Bann der Normativität des Lehrens herauszukommen und eine Vereinfachung der Komplexität vorzunehmen, ohne sie zu verfälschen. Julian Nida-Rümelin verdeutlicht das Problem aus einem anderen Blickwinkel: „Die Persönlichkeit ist aber eine Einheit, ein komplexe Einheit, die wir nur oberflächlich durchschauen, da darf man sich nichts vormachen.“ Etwas später heißt es: Die humane Bildung „bietet Optionen zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit an und richtet nicht ab, sie achtet vor allem darauf, dass Vielfalt gegeben ist und Kinder und Jugendliche sich nicht nur noch als Lernmaschinen wahrnehmen, die mehr oder weniger erfolgreich sind, je nachdem, welchen Test sie wie gut bestehen. Humanitäts- und Bildungsverlust bilden auf diese Weise eine Einheit.“7





























