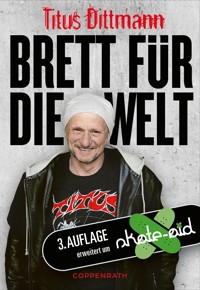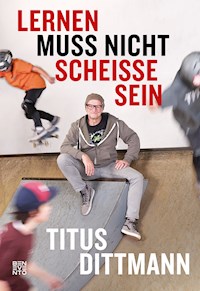
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Benevento
- Sprache: Deutsch
Starke Persönlichkeiten – wie ein Skateboard das Leben unserer Kinder verändert Ganztagsschule, Förderunterricht, Ferienbetreuung – der Alltag unserer Kinder folgt oft einem strengen Stundenplan. Raum für jugendlichen Übermut, für kindliche Neugier, für ein zielloses Sich-treiben-Lassen bleibt kaum. Nie wurden Selbstbestimmung und persönliche Freiheit in der Erwachsenenwelt so großgeschrieben wie heute – und nie hatten unsere Kinder weniger davon. Titus Dittmann tritt dafür ein, dass wir unseren Kindern wieder mehr Freiräume im Alltag zugestehen. Provokant, aber mit großer Herzenswärme macht er deutlich, wie wir sie um wertvolle Erfahrungen betrügen, wenn wir sie vom Sandkasten bis zum Abitur kontrollieren, korrigieren und zensieren. Denn der Unternehmer und ehemalige Lehrer ist überzeugt: Zu viel Eltern ist für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes genauso katastrophal wie zu viel Schule. Mehr Freiraum, mehr Kreativität, mehr Energie Titus Dittmann zeigt, wie es besser geht. Der begeisterte Pädagoge und energiegeladene Skateboarding-Pionier macht mit »skate-aid« weltweit Kinder stark. In seinem Buch erzählt er von Jungen mit ADHS-Diagnose, die im Skatepark stundenlang immer wieder denselben Trick üben, und von Mädchen in Afghanistan, die mit dem Rollbrett unter den Füßen wieder Kind sein können. Sie sind vereint durch einen Sport, der wie kaum ein anderer mit dem Leben verbunden ist. Erfahren Sie, - wie Lernen auch ohne den negativen Beigeschmack von Langeweile und Zwang funktioniert - wie Skateboarden Eigenverantwortung fördert und Orientierung gibt - warum Kinder erwachsenenfreie Räume brauchen, um stark und selbstbewusst zu werden Wie finden unsere Kinder mehr Mut, Dinge einfach auszuprobieren? Was macht sie stark und glücklich? Wie können sie eine Auszeit vom Erfolgsdruck nehmen und die Freude am Lernen wiederentdecken? All diese Fragen beantwortet Titus Dittmann in seinem Buch – und natürlich mit seinem Skateboard! »Titus, der ist verrückt, der hat ein großes Herz, und ja: durchgeknallter Typ, geiler Typ!« Thomas D
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
TITUS DITTMANN
mit Leo G. Linder
LERNENMUSS NICHTSCHEISSESEIN
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
Die Fotografien im Innenteil stammen aus dem Privatarchiv von Titus Dittmann, mit Ausnahme von: S. 9 (M. Frost), 40, 142 (bd. Stefan Lehmann), 149 (Maurice Ressel), 150 (Thomas Diekmann), 155, 159 (bd. Thomas Gentsch).
1. Auflage
© 2019 Benevento Verlag bei Benevento Publishing München – Salzburg, eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus der Palatino, Knockout
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagfoto: Martin Lukas Kim, Hamburg
ISBN 978-3-7109-0068-6
eISBN 978-3-7109-5077-3
INHALT
Prolog: Dieses Brett kann mehr als rollen
Von echten Kindern und kleinen Robotern
Die ollen, tollen Fünfzigerjahre
Aus Liebe gängeln?
For Kids only
Ein bisschen Anarchie darf schon sein
Weder Sturm noch Drang
An alle Erwachsenen: Haltet euch raus!
Langeweile? Her damit!
Mit kleinen Zielen anfangen, mit großen enden
Wer die Gefahr meidet, kommt darin um
Non scholae, sed vitae?
Begeisterung – Dünger fürs Gehirn
Schule ganz anders – eine Träumerei
Ja, genau. Sie machen, was sie wollen
Und wo bleiben die Mädchen?
Ehrgeiz und Solidarität – eine ziemlich seltene Mischung
Skaten statt Ritalin
Bitte nicht stören!
Gut gemeint ist noch lange nicht gut
Nein heißt Nein
Weltuntergang? Mit mir nicht zu machen
Epilog: Pizza Sahara
PROLOGDIESES BRETT KANN MEHR ALS ROLLEN
Als die tagesschau Anfang der Siebzigerjahre zum ersten Mal über Skateboardfahrer berichtete, klang es, als ob Aliens unklarer Herkunft und mit fragwürdigen Absichten unsere Städte infiltrieren würden. Die deutsche Öffentlichkeit war befremdet, und das Befremdliche daran war keine Einbildung – Skateboarden unterscheidet sich tatsächlich von allen bekannten Sportarten. Allein dass sich die jungen Leute auf ihren rollenden Brettern unter die Passanten mischten. Allein dass sie für ihre Auftritte keine andere Bühne brauchten als das, was eine Stadt an Straßen und Plätzen, Treppen und Mäuerchen so bietet. Dann aber auch, was jeder Skateboarder natürlich wusste, uns Älteren aber erst nach und nach klar wurde: wie eng dieser merkwürdige Sport mit dem Leben verbunden ist – enger, behaupte ich, als jede andere Sportart.
Es fängt schon damit an, dass das Skateboard wie alles irdische Leben aus dem Wasser kommt, denn ursprünglich war es ein Surfbrett. Irgendwann in den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts aber ging es an Land, passte sich der neuen Umgebung an, schrumpfte auf handliche Maße, ließ sich vier Räder wachsen und vermehrte sich rasant – viel rasanter als seine im Wasser lebenden Vorfahren.
Seine Abstammung allerdings konnte es nicht verleugnen. Wie die Wellenreiter es mit dem aufgewühlten Meer aufnahmen, so die Skateboarder mit dem Alltagsgewühl der Städte. Skateboarden war auch nicht weniger anspruchsvoll als Wellenreiten. Wie sich zeigte, besaß das unscheinbare Rollbrett die gleichen ungestümen, draufgängerischen Gene wie das Surfbrett und verlangte nach wahren Artisten. Aber jetzt auf dem Festland kamen auch neue Eigenschaften dazu.
Anfangs wusste ja niemand, was alles in einem Skateboard steckt. Man konnte es höchstens ahnen. Also wurde ausprobiert und drauflosexperimentiert, und siehe da: Das Skateboard belohnte die Unerschrockenen und Waghalsigen. Die, die sich nicht einschüchtern und nicht abschrecken ließen. Und es belohnte sie nicht nur, es beflügelte sie auch, es inspirierte sie geradezu, sodass das Skateboard bald zum Wahrzeichen einer bestimmten Lebenseinstellung wurde: freiheitsliebend, selbstbewusst, unangepasst, womöglich rebellisch – jedenfalls alles andere als brav. Das Skateboard war damit zur rollenden Unabhängigkeitserklärung einer Jugend auf der Suche nach Eigenständigkeit geworden. Zu einer Gesinnung.
Mit anderen Worten: Skateboardfahren verändert einen jungen Menschen. Wen es gepackt hat, der bleibt nicht derselbe. Ich bin das beste Beispiel dafür. Dabei war ich schon Ende zwanzig, als ich 1977 auf einem Spaziergang in Münster beim Anblick einer Gruppe Skateboardfahrer die Luft anhielt. Es war keine Erkenntnis, die mich da traf. Es war eine Art instinktiver Faszination. Damals hätte ich keine Worte dafür gefunden, aber heute würde ich sagen: Der leicht verpeilte Studienreferendar Titus Dittmann war für das Freiheitsversprechen der rollenden Bretter außerordentlich empfänglich. Vielleicht hat ihn in diesem Moment auch eine Ahnung von den grenzenlosen Möglichkeiten des Skateboards gestreift. Dabei war gar nichts Spektakuläres vorgefallen, keine sensationellen Tricks, kein atemberaubender Slide ein Treppengeländer hinunter; man war halt so dahingerollt, aber das hatte vollauf gereicht: Ich war nicht mehr derselbe.
Erste Skateboardingversuche am Aaseehügel in Münster, 1977
Heute, vierzig ereignisreiche Jahre später, weiß ich, was das Skateboard kann. Und bin immer noch fasziniert, wenn ein Achtjähriger mit ADHS-Diagnose plötzlich die Willenskraft aufbringt, stundenlang bei uns im Skaters Palace ein und dasselbe zu machen, nämlich Skateboardfahren, auf die Schnauze fliegen, wieder aufstehen und denselben Trick erneut versuchen. Oder dreißig, vierzig Mädchen in unserem Skateboardpark in Afghanistan sich um die Bretter reißen und dann in eine lachende, fröhliche Meute verwandeln, so unbekümmert, wie Kinder sonstwo auf der Welt nur sein können – obwohl hinter den Bergen der Bürgerkrieg tobt. Skateboardfahren ist eben keine gewöhnliche Sportart. Es verändert uns. Und davon wird dieses Buch handeln.
VON ECHTEN KINDERN UND KLEINEN ROBOTERN
Als Kind war es mein größter Wunsch gewesen, mir die Erwachsenen vom Leib zu halten. Alle. Es war auch mein einziger Wunsch gewesen, weitere Wünsche hatte ich nicht, denn wo kein Erwachsener war, ging es mir blendend. Da fühlte ich mich frei und konnte Blödsinn machen – wie es dieselben Erwachsenen nannten, wenn man als Kind seine Fantasie ins Kraut schießen ließ und einfach tat, was man sich gerade ausgedacht hatte. Genau das also erschien mir als größtes anzunehmendes Glück: ungestört mein Ding zu machen. Was hätte es darüber hinaus noch zu wünschen gegeben? Nichts. Und ich war keine Ausnahme. Meinen Altersgenossen ging es ähnlich wie mir.
So war es in den Fünfzigerjahren, so war es auch noch in den Sechzigerjahren. Natürlich hätte ich damals nicht von Freiheit gesprochen; das Wort war viel zu groß für mich. Ich wollte einfach nur, dass sie sich raushielten, die Erwachsenen, dass sie mich so oft wie möglich und so lange wie möglich in Ruhe ließen. Recht machen konnte ich es ihnen sowieso nie. Dafür fehlte mir jede Begabung, und daran ließen die Erwachsenen auch keinen Zweifel. Einmal, im vierten oder fünften Schuljahr, holte mich mein Lehrer nach vorn, stellte mich vor die Klasse und sagte an meine Mitschüler gewandt: »Wenn ihr es im Leben einmal zu nichts bringen wollt, müsst ihr so werden wie Titus.«
Titus’ erster Schultag, 1954
Immerhin, dazu taugte ich, zum abschreckenden Beispiel. Titus, der Versager. Dass ich ADHS hatte, wusste ich nicht, niemand wusste es; das heute berühmt-berüchtigte Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom gab es seinerzeit noch nicht, aber was es gab, war diese offenkundige Unverträglichkeit zwischen mir und den Erwachsenen. Das Verrückte war: Die Erwachsenen dachten im Prinzip nicht anders als ich. Sie fanden es genauso wünschenswert, mich los zu sein, wie ich es umgekehrt kaum erwarten konnte, aus ihrem Blickfeld zu verschwinden. Deshalb war ich daheim entlassen, sobald die Hausaufgaben erledigt waren, und trollte mich ins Freie. Bis zum Wald, wo mich die Kumpels erwarteten, war es von uns aus nur ein kurzes Stück, und für den Rest des Tages fühlte ich mich für die Frömmigkeit meiner Mutter, die Wutausbrüche meines Vaters und die Züchtigungen meines Lehrers vollauf entschädigt. So trug jede Seite unabsichtlich zum Wohlbefinden der anderen bei, indem man die gemeinsam verbrachte Zeit auf das Nötigste beschränkte. Ich will nicht sagen, dass die Verhältnisse optimal gewesen wären. Aber ich fand sie doch so weit ganz in Ordnung.
Mit anderen Worten: Wir waren Kinder und durften es zumindest nachmittags sein. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis mir solche Verhältnisse wieder begegneten, und zwar in einem weit entfernten Teil der Welt, im Westen Afghanistans.
2012 hatten wir, unterstützt von Rupert Neudeck, in diesem von Krieg und Terror zerrissenen Land einen Skateboardpark angelegt. Sobald er fertig war, konnte er genutzt werden, und er wurde genutzt – von unbefangenen, ausgelassenen, neugierigen, zu Faxen aufgelegten, spitzbübisch grinsenden Jungen und Mädchen mit unternehmungslustigen Augen. Von richtigen Kindern eben. Was habe ich mich unter ihnen wohlgefühlt! Es war wie in den Fünfzigerjahren bei uns im Westerwald.
Zu solchen Kindern gehören natürlich Erwachsene, die sich nicht groß um ihren Nachwuchs kümmern. Im Skaters Palace müssen wir besorgte Mütter oft aus der Halle herauskomplimentieren, damit sich ihre Kinder ungestört ins Skateboardfahren vertiefen können. Hier in Afghanistan aber dachten die Eltern gar nicht daran, mitzukommen und zuzugucken. Vermutlich sagten sie sich: »Die Kleinen werden noch früh genug mit dem Ernst des Lebens Bekanntschaft machen, aber bis dahin sollen sie ihren Willen haben; da pfuschen wir ihnen nicht in ihre Angelegenheiten rein.« Jedenfalls ließen sich weder Väter noch Mütter jemals draußen am Skateboardpark blicken, um über das Wohlergehen ihrer Sprösslinge zu wachen.
Man glaubt gar nicht, wie Kinder aufblühen, wenn sich nicht der Schatten der Erwachsenenwelt auf sie legt! Der gleichen Art von Kindern bin ich später dann auch in Palästina, in Uganda, in Südafrika, in Syrien und Namibia begegnet, überall, wo in den letzten Jahren unter skate-aid-Regie Skateboardanlagen entstanden sind. Selbstverständlich trifft man dort auf andere soziale Verhältnisse und andere Gesellschaftsordnungen als bei uns, natürlich gibt es auch dort keine paradiesische Kinderexistenz. In Afghanistan etwa spielen die Jungs mit Spielzeugwaffen, und ihre Eltern fördern das womöglich, weil gut schießen zu können in einem Land wie Afghanistan später kein Nachteil sein dürfte. Die Verhältnisse sind dort so, dass ein Kind die größte Anerkennung erfährt, wenn es mit einem Gewehr umgehen kann und auch kämpfen will, aber seltsamerweise: Nicht einmal in Afghanistan, nicht in Syrien und nicht in Palästina hören die Kinder deswegen auf, Kinder zu sein. Sie sind erfrischend offen, zutraulich, unkompliziert und begeisterungsfähig. Auch zuvorkommend übrigens. Selbst die vorwitzigsten unter ihnen erkennen an, dass jemand wie ich von weit her gekommen ist, eine lange Reise hinter sich hat und schon deshalb ihre ungeteilte Aufmerksamkeit verdient. Mit anderen Worten: Diese Kinder sind selbstbewusst, aber nicht selbstgefällig. Sie sind nicht cool.
Für mich ist das eine großartige Erfahrung. Ich arbeite wahnsinnig gern mit solchen Kindern, weil der Umgang mit ihnen so erfreulich ist. Wohl auch, weil sie mich an die viel gescholtenen Fünfzigerjahre erinnern, als Mütter höchstens ein halbes Auge auf ihre drei bis fünf Kinder hatten, weil sie die anderen anderthalb Augen für den Haushalt brauchten und den Laden und alles, was sonst noch zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang getan werden musste. Als es, kurz gesagt, für Kinder noch eine ganze Menge erwachsenenfreie Räume gab.
Unbeobachtet sein … Heute ist nicht mehr dran zu denken. Nicht bei uns. Nicht in Münster und nicht im Rest der Republik. Die Welt der Erwachsenen hat sich seit jener Zeit vor- und fürsorglich über die Welt der Kinder gestülpt wie einer dieser Kaffeekannenwärmer, die es früher gab. Eine schnelle Eingreiftruppe aus Eltern, Lehrern und Betreuern aller Art liegt vom Sandkasten bis zum Abitur auf der Lauer und registriert, kommentiert, korrigiert und zensiert, was so ein junger deutscher Mensch von morgens bis abends treibt. Sie alle fördern und fordern. Engagieren sich und setzen sich ein. Sorgen sich und kümmern sich. Und dabei nimmt die Zahl der kleinen, gut geölten Roboter immer weiter zu. Auch die Zahl der kleinen, schlecht geölten Roboter.
Es war in den Achtzigerjahren, noch zu meiner Zeit als Lehrer, als mir die ersten Anzeichen für einen mentalen Klimawandel auffielen. Damals tauchten in der Schülerschaft die ersten Apostel einer spießigen Korrektheit auf. Ich werde nie vergessen, wie ich als Pausenaufsicht mit meinem Jo-Jo auf dem Schulhof stand, in farbenfrohen Surf-Shorts, mit Skatebordsocken an den Beinen, und eine Zwölfjährige sich vor mir aufbaute, zu mir hochschaute und den Kopf schüttelte. »So läuft man doch als Lehrer nicht herum!«, sagte sie, warf mir im Umdrehen schnell noch einen missbilligenden Blick zu und verschwand.
Ich war gewarnt. Aber auf Kinder, die im selben Netz wie die Erwachsenen zappeln, war ich nicht vorbereitet. Mittlerweile sind wir so weit. Ich habe ja ständig mit Kindern und Jugendlichen zu tun, ich kann es einigermaßen beurteilen, und meine Erfahrung ist: Immer häufiger glaubt man, kleine Erwachsene vor sich zu haben – mit fünf moralischen Zeigefingern an jeder Hand.
Die meisten Kinder heute wissen sehr genau, was gut und was ganz, ganz böse ist, was sich gehört und was voll abartig ist. Ein Erwachsener, der auch nur leicht aus dem Rahmen fällt, muss inzwischen jedenfalls damit rechnen, von ihnen belehrt oder sogar gemaßregelt zu werden. Der bekommt womöglich zu hören, dass er sich gegen die heiligsten Wahrheiten des Umweltschutzes oder des Tierschutzes oder der Gesundheitsvorsorge versündigt, sich also unverantwortlich, ja unverzeihlich verhält. Wird der Rasen im Sommer gesprengt, heißt es: »Man darf aber kein Wasser verschwenden!«, und im Restaurant faucht die kleine Veganerin vom Nachbartisch »Mörder!«, wenn man eine Scholle Finkenwerder Art bestellt.
Aus diesen Kids sind kleine Missionare geworden, rundum indoktriniert und auf das gepolt, was ihre erwachsenen Mitmenschen für gut und richtig und fürchterlich wichtig halten – neunmalgescheit, neunmalkorrekt, neunmalperfekt, als würde die ganze Welt gegen die Wand fahren, wenn sich nicht jeder ihrer einstudierten Vernünftigkeit anschließt. Jugendlicher Übermut, kindliche Naivität? Fehlanzeige. Diese Kinder sind auf die gerade gängigen Ideale ihrer Erzieher programmiert.
Mir mit meiner Westerwälder Vergangenheit, mit meiner Erfahrung mit jungen Leuten außerhalb Europas fällt dieser Verlust an Unbefangenheit auf. Anderen vielleicht nicht. Die Werbung allerdings hat längst spitzgekriegt, wie der Hase mittlerweile läuft, und sich drauf eingestellt. Einer der perfidesten Werbespots, die ich kenne, zeigt einen Vater beim Zähneputzen im Badezimmer bei aufgedrehtem Wasserhahn. Kaum bemerkt er im Spiegel seine Tochter, dreht er den Wasserhahn zu, und tatsächlich kommt das Kind vorbei und kontrolliert mit einem schnellen Blick, ob sein Daddy das Wasser auch wirklich abgestellt hat … Die Macher dieses Werbefilms greifen damit allerdings nur auf, woran man sich längst gewöhnt hat: Kinder als Gesinnungspolizei, damit beauftragt, die Welt zu retten, und deshalb auch dazu berechtigt, selbst den eigenen Erzeugern ein schlechtes Gewissen einzuflößen.
Kinder lassen sich eben wunderbar für die Zwecke von Erwachsenen einspannen, man muss sie nur genügend bearbeiten. Hierzu ein besonders krasser Fall aus dem realen Leben, das Paradebeispiel einer kleinen moralischen Perfektionistin – auf diversen Veranstaltungen selbst erlebt.
Bei ihrem Auftritt war sie vielleicht zwölf Jahre alt. Sie löste einen Jungen ab, der aufgrund seines fortgeschrittenen Alters zu diesem Zeitpunkt wohl nicht mehr für die Rolle taugte, aber die Show war die gleiche: Das Mädchen betrat die Bühne und machte Propaganda für eine gemeinnützige Organisation, deren Gründer sich als Regisseur im Hintergrund hielt. Die Idee dahinter war, Bäume zu pflanzen, um die Erde zu retten – eigentlich nichts Verwerfliches, aber dieses Mädchen präsentierte sich als Einpeitscherin, absolut professionell, perfekt dressiert, perfekt gedrillt, schon beinahe fanatisch. Sie hatte es zur Meisterschaft darin gebracht, Prominente bei ihrem Gewissen zu packen und mit Charme und Zähigkeit für die Idee ihres Mentors zu gewinnen. Das war superclever gemacht, aber ich fand diese Masche abstoßend. Mich störte schon die Sturzflut auswendig gelernter Argumente, aber mehr noch, dass bei ihr von Kindheit überhaupt nichts mehr zu spüren war. In eine der gängigen Moralschablonen gepresst, war sie das perfekte Produkt ihres Schöpfers, der ihr obendrein schöne, große Scheuklappen verpasst hatte, um zu verhindern, dass sie vom umweltpolitischen Pfad der Tugend abkam.
Um nicht missverstanden zu werden: Nein, ich habe nichts gegen hehre Ziele. Ich habe nichts gegen Bäumepflanzen und Wassersparen, wo solche Maßnahmen sinnvoll sind. Aber mich beunruhigt die wachsende Zahl kleiner Klugscheißer, die bloß noch nachplappern, was Erzieherinnen, Eltern und Lehrer ihnen einflüstern. Mich beunruhigt, wie lückenlos schon die Kleinsten von der Erwachsenenwelt vereinnahmt und auf Linie gebracht werden. Mich beunruhigt, wie früh sie mental in die Abhängigkeit von Erwachsenen geraten und wie lange sie darin verharren, wie wenig Platz da noch für Neugier, selbstständiges Denken und Selbstbestimmung bleibt. Und ich bezweifele, dass derart genormte Kinder das Zeug dazu haben werden, die Zukunft zu gestalten. Ob die Eltern zu meiner Zeit – pädagogisch unbeleckt, wie sie waren – nicht doch gut daran getan haben, uns stattdessen einfach mal Blödsinn machen zu lassen?
DIE OLLEN, TOLLEN FÜNFZIGERJAHRE
Inzwischen ist es kein Geheimnis mehr, worum es mir geht. Um Selbstbestimmung und Fremdbestimmung natürlich und darum, wie viel wir durch Selbstbestimmung gewinnen und welche katastrophalen Folgen andererseits ein Übermaß an Fremdbestimmung hat. Aber vermutlich wird mancher doch stutzen. Ausgerechnet unsere Gegenwart als Schreckenszeit der Fremdbestimmung – wo Selbstbestimmung nie größer geschrieben wurde als heute? Und ausgerechnet die Fünfziger- und Sechzigerjahre als Beispiel für Selbstbestimmung – wo jeder weiß, dass da der Rohrstock regierte? Dass in den Schulen frontal unterrichtet und zu Hause Gehorsam erwartet wurde? Ist dieser Titus ein nostalgischer Narr?
Ja. Das heißt, nein. Man leitet keine mittelgroße Firma mit den Flausen einer angeblich besseren Vergangenheit im Kopf. Als Unternehmer muss man nicht nur auf der Höhe der Zeit, man muss ihr um eine Nasenlänge voraus sein, und für mich ist die Gegenwart voller faszinierender Möglichkeiten und Chancen. Nostalgie liegt mir also fern. Und trotzdem werde ich es in diesem Buch nicht lassen können, immer wieder auf die Vergangenheit einzugehen, soweit ich sie als Jugendlicher erlebt habe. Nicht, um sie zu verklären, sondern um die Sicht der Erwachsenen mit der Sicht von Kindern zu konfrontieren. Anders gesagt: Dieses Buch ist zwar für Erwachsene geschrieben, aber sein Blick auf die Welt ist über weite Strecken der Blick von Heranwachsenden.
Und dann macht man eine erstaunliche Entdeckung: Was Freiheit und Selbstbestimmung angeht, sind unsere Kinder die Verlierer der Nachkriegsgeschichte. Die Gewinner sind die Erwachsenen. Und da es immer die Sieger sind, die die Geschichte schreiben, erscheint uns das Heute in hellerem Licht als das Gestern. Wenn Kinder die Geschichte schreiben würden, sähe die Sache aber erheblich anders aus. Dann würden sich die Zeiten immer weiter verdüstern, weil für Kinder die Fremdbestimmung über die Jahre kontinuierlich zugenommen hat, und so gesehen gäbe es an den Fünfzigerjahren dann doch einiges in Schutz zu nehmen. Wie wir noch sehen werden.
Das ist der eine Grund, warum ich zunächst einen Blick zurück werfen will, bevor wir zu den großen Fragen und den möglichen Antworten kommen. Der andere Grund ist, dass meine Leserschaft ein Recht hat zu erfahren, welche Erfahrungen es genau sind, auf die ich zurückgreife. Es sind ja dieselben Erfahrungen, die meinen Blick für die Gegenwart geschärft haben.
Also, man stelle sich vor: Vater ist Elektromeister und auf der Baustelle, Mutter schmeißt den kleinen Laden (Glühbirnen, Batterien, Taschenlampen) zusätzlich zum Haushalt, wir drei Kinder sind irgendwie Teil des Haushalts, und der Haushalt muss irgendwie funktionieren. Tut er auch, hauptsächlich deshalb, weil Problematisieren und Debattieren noch nicht erfunden sind. Wir befinden uns in der pädagogischen Steinzeit, da wird gegessen, was auf den Tisch kommt, da wird das Maul gehalten, solange Erwachsene sich unterhalten, und wenn unten die Ladenglocke bimmelt, reicht ein Satz meiner Mutter: »Benehmt euch, sonst setzt es was, ich warne euch …« – schon eilt sie die Treppe hinab, und wir Kinder sind unter uns. Fällt in der Zwischenzeit was vor, heißt es hinterher: »Wie oft soll ich dir das noch sagen?«, und es setzt was hinter die Löffel. Alles erziehungstechnisch ergreifend schlicht, aber als Kinder kommen wir gut damit klar. Man weiß, woran man ist, es gibt hier ja nichts zu durchschauen. So simpel funktionieren Eltern nun mal.
Titus’ Elternhaus mit Elektroladen und Werkstatt
Erzählen würde ich meinen Eltern bloß das Allernötigste. Sie genießen mein Vertrauen nur insoweit, als dass auf sie als Ernährer und Beschützer Verlass ist. Okay, immer wieder nennen sie mich »Sonnenschein«, das rechne ich ihnen durchaus an. Aber man hängt nicht so fürchterlich aneinander, und mein wahres Leben spielt sich sowieso hauptsächlich im Verborgenen ab, schon weil mein Vater unglaublich schnell die Wände hochgeht. Ich bin ja der Typ, der jeden Farbeimer umschmeißt, der jeden Gipstopf fallen lässt – noch spricht man nicht von ADHS, noch heißt es Zappelphilipp oder Tollpatsch –, und jedes Mal rastet mein Vater aus. Einmal besonders spektakulär, da rennt er einen Hammer schwingend zwei Häuserblocks weit über die Dorfstraße hinter mir her. Aber er hält den Hammer falsch herum, er hat ihn beim Kopf gefasst, das entschärft diese Drohgeste schon mal, und außerdem würde er nicht zuschlagen, das weiß ich, das hat er noch nie. Genauso schnell, wie sie auftreten, sind seine Ausraster auch wieder vorbei, und kaum ist er außer Atem, beruhigt er sich wieder. Übel nehme ich ihm diese Auftritte nicht. Ich bin ja selbst einigermaßen aufbrausend, ich weiß ja selbst, wie die Wut in einem hochkocht und wie schnell sich das aufgewühlte Innenleben wieder glättet. Diese kleinen Familiendramen vom Typ »Vater verzweifelt an seinem Sohn« erschüttern mich deshalb nicht weiter, auch weil das Happy End bei meinem Vater stets abzusehen ist.
Eher fühle ich mich von meiner Mutter bedrängt. Sie ist eine Oberfromme, sie nimmt es mit der Moral extrem genau. Mit fünfzehn küssen? Ich käme in die Hölle, da bin ich sicher. Direkt sagt sie es zwar nicht, dass mir der Pimmel abfällt, wenn ich wichse, aber sie gibt mir deutlich zu verstehen, dass ich damit das Reich des Bösen betrete. Nein, sie lässt nichts durchgehen – anders als mein Vater, der hin und wieder ein Auge zudrückt, und irgendwann kommt es zu einer stillen Übereinkunft zwischen ihm und mir: Nur ja die Mutter raushalten, sie braucht nichts zu wissen … Auch meine fleischlichen Gelüste kann mein Vater besser nachvollziehen.
Die Lehrer sind ein anderer Fall. Denen kommt man zwangsläufig in die Quere, an jedem Schultag aufs Neue, also versuche ich es mit Anpassung – immer schön unauffällig. Doch der Versuch scheitert. Ich, das liebste Kerlchen der Welt, würde meine Lehrer ja gern glücklich machen, stattdessen mache ich sie verrückt. Weil ich mich nicht auf Kommando konzentrieren kann, weil ich unter meinem Tisch mit Lineal, Füller, Zirkel und Schulheft Erster Weltkrieg spiele – Luftkampf! –, gelte ich als Störenfried und werde vor der ganzen Klasse als Prototyp eines Versagers bloßgestellt; es ist demütigend. Aber als Erwachsener hat der Lehrer natürlich immer recht.
Kurz und gut, die Schule wirkt aus heutiger Sicht pädagogisch-didaktisch antiquiert und ist es auch, aber sie hat einen enormen Vorzug: Spätestens um zwölf Uhr mittags ist der Spuk vorbei, da klingelt es, und die Schule ist aus. Jetzt gilt es noch eine letzte Hürde zu nehmen, die Hausaufgaben. Manchmal ist meine Mutter dahinterher, dann dauert es, dann quäle ich mich über die Zeit, aber früher oder später heißt es: Ab auf die Straße, ab in den Wald, beschäftige dich selbst – meine Mutter will die Blagen jedenfalls nicht am Hals haben, weil die Wäsche wartet und das Essen sich nicht von allein kocht und zwischendurch ständig die Ladentür klingelt. Das heißt: Ich bin frei. Es gibt ein Leben nach der Schule, und es hat soeben begonnen!
Und plötzlich bin ich sogar fähig, etwas Sinnvolles zu tun – und es obendrein noch gut und richtig zu machen. Zum Beispiel Briketts im Kohlekeller stapeln. Hätte ich die Anweisung erhalten, würde es schiefgehen – ohne Bock geht bei mir alles schief. Aber ich bin freiwillig hier unten und stelle fest: Lernen muss nicht scheiße sein. Briketts stapeln will nämlich gekonnt sein, denn wenn man es nicht richtig macht, fangen sie von einer gewissen Höhe an zu wackeln, und die ganze mühsam errichtete Brikettwand droht einzustürzen. Das passiert auch, macht aber nichts, weil kein Mensch zuguckt und kommentiert, kritisiert und zensiert, was ich da treibe. Ja, genau, ich arbeite da unten selbstbestimmt, zum ersten Mal an diesem Tag. Ich habe mir diese Aufgabe gesucht, ich habe mir dieses Ziel gesetzt, ich muss mir etwas einfallen lassen, damit auch die zweite und dritte Wand hält, und keiner redet mir rein, keiner platzt mit Vorschlägen oder Warnungen dazwischen, weil er es nicht mehr mit ansehen kann, wie blöd ich mich anstelle. Und es macht Spaß.
Es muss aber nichts »Sinnvolles« sein. Gegen eine Runde Verwahrlosen ist auch nichts zu sagen. Im Herzen bin ich zwar Skateboarder, aber es gibt dummerweise noch keine Skatboards, nicht bei uns. Dafür gibt es Tretroller mit Ballonreifen, die man auch freihändig fahren und durch Gewichtsverlagerung steuern kann – und die man auf den steilen Straßen des Westerwalds manchmal nur zum Stehen bringt, indem man abspringt und auf dem Lederhosenboden über den Asphalt rutschend bremst. Dafür gibt es aber vor allem draußen im Wald die Felsenburg, ein kleines Massiv am Hang zwischen hohen Tannen, gut geschützt und von uns längst als Hauptquartier und Ausgangspunkt aller möglicher Aktivitäten in Beschlag genommen. Also nichts wie hin. Irgendwann sind alle eingetroffen – und nun? Was tun?
Irgendwas Martialisches. Irgendwas mit Abschießen und Überleben. Klar, das hier ist nicht der Wilde Westen, das ist der Westerwald, aber es muss Sieger und Verlierer geben, und die Verlierer sollten am besten tot sein. Natürlich nicht wirklich. Aber wenn schon kämpfen, dann auf Leben und – gespielten – Tod, und gekämpft werden muss, das versteht sich von selbst. Keine Ahnung, was Kinder anderswo auf der Welt unter diesen Umständen spielen – wir spielen jedenfalls Dännegaggeln, eine Westerwälder Variante von Gotcha. Unsere Geschosse sind Tannenzapfen (»Dännegaggeln« auf Wäller Platt). Unsere Gegner sind die Jungs aus denjenigen Vierteln meines Heimatdorfs, mit denen wir in Fehde liegen, weil sie katholisch oder sonst was Unmögliches sind. Und unser Ziel ist das Ausschalten des Gegners. Das heißt: Wer von einem feindlichen Tannenzapfen getroffen wird, scheidet aus, und wer bei Einbruch der Dunkelheit die meisten Überlebenden aufzuweisen hat, ist Sieger. Anschließend geht es ab nach Hause, und jetzt kommt das Schönste: Meine Eltern wollen nicht einmal wissen, wo ich gewesen bin. Sie fragen höchstens, wo das Loch in der Hose herkommt … Und so ist aus Morgen und Abend ein Tag in den Fünfzigerjahren geworden.
Ich will die Moral von der Geschichte kurz halten. Vorweg etwas, worüber ich schmunzeln musste. Navid Kermani, der allseits beliebte Schriftsteller persischer Herkunft, schreibt über seine Jugend in den Siebzigerjahren: Seine deutschen Freunde hätten es vorgezogen, im Haus der Familie Kermani zu spielen, da waren nämlich die Gesetze klar und einfach, da gab es keine verbotenen Räume, keine festgelegten Essenszeiten und keine Eltern, die sich in alles einmischten, nur Brüder, die schon deshalb nicht störten, weil sie mit Freundinnen, Feten, Fußball und Rockmusik beschäftigt waren. Und diese Freiheit fanden die deutschen Freunde ausgerechnet in einem persischen Haushalt, wo es zum guten Ton gehörte, dass Kinder ihre Eltern mit Sie anredeten! Ein wunderschönes Beispiel dafür, dass strenge Formen durchaus mit einem entspannten Lebensgefühl einhergehen können, wenn es klare Regeln und selbstbestimmte Freiräume gibt. Und bei uns war es im Prinzip nicht anders.
Ja, es ging streng zu – aber nach simplen Regeln, die man an einer Hand abzählen konnte. Da war noch nichts pädagogisch hochgezüchtet. Man schoss noch nicht mit Erziehungsbüchern auf Kinder. Schon deshalb nicht, weil Eltern sich damals zutrauten, das bisschen Erziehung mit links hinzukriegen. Das ging schon mal daneben, lief aber in der Regel auf viel elternfreie Zeit und jede Menge lehrerfreie Räume hinaus.
Keiner, der Kinder hatte, hätte im Traum daran gedacht, ausgerechnet sein Kind für einzigartig zu halten – dafür gab es einfach zu viele, dafür war man auch zu realistisch. Und keinem hätte der rundum sozialverträgliche Vorzeigemensch als Erziehungsziel vorgeschwebt – dafür traute man der Erziehung gar nicht genug zu. Die moderne Auffassung, der Mensch sei beliebig formbar, quasi bloß ein Produkt seiner Erziehung, hatte sich noch nicht durchgesetzt. Man billigte jedem seinen Charakter zu, der war von der Natur halt mitgegeben. Allenfalls konnte man Kindern etwas aberziehen, Unarten zum Beispiel – aber durch Erziehung den ganzen Menschen modellieren, womöglich Einfluss auf sein späteres Lebensglück nehmen? Absurd. Die schlichte Kernfrage lautete: Ist mein Kind bockig oder nicht? Wenn ja, setzte es was. Wenn nein, war im Prinzip alles gut.
Bei aller Derbheit äußerte sich in der Erziehung der Fünfzigerjahre also ein bemerkenswertes Zartgefühl, ein instinktiver Respekt vor der individuellen Eigenart eines Kindes, mit dem Erfolg, dass sein Persönlichkeitskern unangetastet blieb. Auf diese Weise konnte man sich als Kind einen inneren Raum der Freiheit und Selbstverantwortung bewahren, in den eine psychologisch ausgefeilte Erziehung dann später immer tiefer – ich möchte sogar sagen: immer brutaler – eingedrungen ist.
Heute zerbricht sich die ganze Gesellschaft – Jugendämter, Beratungsstellen, Politiker, Pädagogen – unablässig den Kopf darüber, wie man noch richtiger, noch kindgerechter, noch gezielter, noch effektiver und psychologisch raffinierter erziehen könnte. Wenn Kinder wüssten, wie da die Köpfe rauchen, würden sie sich wie Kaninchen in einem Versuchslabor vorkommen. Was sie tatsächlich auch sind – und wir gottlob noch nicht waren. Was nicht bedeutet, dass die Verhältnisse idyllisch gewesen wären. Mit ihrer religiösen Engstirnigkeit brachte mich meine Mutter regelmäßig in Gewissensnöte, das gab Stoff für viele Stunden des Grübelns. Mit Ohrfeigen des Lehrers, mit Ausrastern des Vaters musste man rechnen. Aber eindeutig waren diese Verhältnisse immerhin. In meiner Familie wusste einer vom anderen, woran er bei ihm war, und stellte sich drauf ein. Bei meinem Vater war jederzeit klar: Das duldet er, das duldet er nicht. Beide Eltern waren auf ihre Art berechenbare Faktoren, stabile Größen. Diese Klarheit ist für Kinder ein Glück, nämlich eine wunderbare Orientierungshilfe in einer Welt, die sie noch kaum durchschauen. Was mir aber an den Fünfzigerjahren uneingeschränkt gefällt: Man war diesem autoritären System zu keiner Zeit mit Haut und Haar ausgeliefert. Da klafften beträchtliche Lücken, weil uns Kindern weniger als die halbe Aufmerksamkeit der Eltern galt. Über weite Strecken erzogen wir uns selbst.