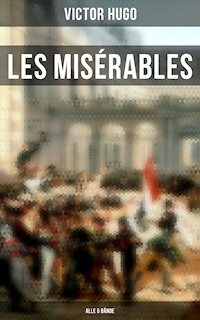1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Victor Hugos monumentales Werk 'Les Misérables' entfaltet sich über fünf Bände und bietet einen tiefen Einblick in die soziale Ungerechtigkeit des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Mit einer meisterhaften Mischung aus Realismus und romantischen Elementen gewährt Hugo den Lesern nicht nur einen fesselnden Handlungsstrang, sondern auch ein Panorama menschlicher Emotionen und Schicksale. Die reichhaltige Sprache und komplexen Charaktere, insbesondere die Entwicklung von Jean Valjean, schaffen ein eindringliches Porträt einer Gesellschaft im Umbruch, die von Armut, Verzweiflung und dem Streben nach Erlösung geprägt ist. Victor Hugo, einer der bedeutendsten Schriftsteller der Französischen Literatur, lebte von 1802 bis 1885 und war nicht nur als Dichter und Dramatiker bekannt, sondern auch als leidenschaftlicher Sozialreformer. Seine persönliche Erfahrung mit den sozialen Missständen seiner Zeit und sein eigenes Leben als Exilant prägten seine Schriftstellerei maßgeblich. 'Les Misérables' ist nicht nur ein literarisches Meisterwerk, sondern auch ein leidenschaftlicher Aufruf zur Empathie und zum sozialen Wandel. Dieses epische Werk wird allen Leserinnen und Lesern empfohlen, die sich für die tiefen Fragen der Menschlichkeit und Gerechtigkeit interessieren. Hugos eindringliche Sprache und seine fesselnden Erzählstränge garantieren eine anregende Auseinandersetzung mit Themen, die bis in die Gegenwart relevant sind. Tauchen Sie ein in die Welt von 'Les Misérables' und entdecken Sie eine Geschichte, die Herzen bewegt und zum Nachdenken anregt. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine Autorenbiografie beleuchtet wichtige Stationen im Leben des Autors und vermittelt die persönlichen Einsichten hinter dem Text. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Les Misérables (Alle 5 Bände)
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Im Spannungsfeld zwischen Gesetz und Barmherzigkeit entscheidet sich, wie menschlich eine Gesellschaft wirklich ist. Victor Hugos Les Misérables legt diese Spannung frei, indem es die Wege von Menschen verfolgt, die vom Recht gezeichnet und von Mitgefühl verwandelt werden. Das Werk schaut ohne Scheu dorthin, wo Not, Schuld und Hoffnung aufeinandertreffen, und macht sichtbar, wie Institutionen und Gewissen miteinander ringen. Es ist ein Roman über moralische Entscheidungen, deren Folgen sich weit über einzelne Schicksale hinaus ausbreiten. Was beginnt als Geschichte eines Gestrauchelten, entfaltet sich zu einem Panorama, das das Private mit dem Politischen untrennbar verbindet.
Verfasst wurde Les Misérables von Victor Hugo, einem der bedeutendsten französischen Autoren des 19. Jahrhunderts, geboren 1802 und gestorben 1885. Erste Arbeiten am Stoff reichen in die 1840er Jahre zurück; die Ausarbeitung erfolgte nach einer langen Unterbrechung im Exil, vor allem auf Guernsey. 1862 erschien der Roman in fünf Bänden und wurde rasch ein europaweiter Erfolg. Mit dieser Publikation festigte Hugo seinen Rang als Romancier, der gesellschaftliche Dringlichkeit mit literarischer Kühnheit verbindet. Die Größe des Unternehmens zeigte sich nicht nur am Umfang, sondern an der erklärten Absicht, das soziale Elend seiner Zeit nicht nur abzubilden, sondern als moralische Aufgabe zu benennen.
Der Roman spielt im Frankreich des frühen 19. Jahrhunderts und begleitet einen ehemaligen Strafgefangenen, der nach Jahren harter Haft in die Freiheit entlassen wird und um einen Neubeginn ringt. Sein Weg kreuzt sich mit dem eines pflichtstrengen Beamten, dessen Verständnis von Ordnung jede Abweichung misstrauisch beäugt. In Fabriken, Hospitälern, Klöstern, Vorstädten und in den Straßen von Paris werden Lebensentwürfe auf die Probe gestellt. Begegnungen mit Kindern, Arbeiterinnen, Studierenden und Außenseitern verdichten das Panorama. Ohne den Verlauf vorwegzunehmen: Der Roman fragt, ob ein Mensch mehr ist als seine Vergangenheit und wie Gesellschaft Verantwortung und Gnade austariert.
Als Klassiker gilt Les Misérables wegen seiner epischen Spannweite, seiner erzählerischen Energie und seines kompromisslosen moralischen Ernstes. Hugo verbindet das Tempo des Abenteuerromans mit der Sorgfalt des Gesellschaftsporträts. Er erweitert die Form des Romans, indem er Handlung, Reflexion und historische Exkurse zu einer Einheit fügt. Die Charaktere sind nicht nur Figuren eines Plots, sondern Träger von Ideen, die im Konflikt ihre Überzeugungskraft beweisen müssen. Dass das Buch Generationen bewegt, hat mit dieser Verbindung aus unmittelbarer Erzählwirkung und gedanklicher Tiefe zu tun, die selten so geschlossen erreicht wurde.
Zentrale Themen sind Gerechtigkeit und Gnade, Schuld und Vergebung, Armut und Würde. Der Roman zeigt, wie soziale Strukturen Menschen prägen und wie einzelne Gesten der Menschlichkeit Schicksale verschieben können. Er beleuchtet die Macht des Gewissens, die Versuchung der Selbstgerechtigkeit und die Grenzen staatlicher Gewalt. Liebe erscheint in unterschiedlichen Formen: fürsorglich, leidenschaftlich, elterlich, freundschaftlich. Bildung, Arbeit, Solidarität und Verantwortung bilden den Gegenentwurf zur Verrohung. Diese Themen bleiben nicht abstrakt, sondern werden in Alltagsszenen, Entscheidungen und Konsequenzen verankert, die die Leserinnen und Leser in die Lage versetzen, eigene Maßstäbe zu prüfen.
Stilistisch setzt Hugo auf einen allwissenden Erzähler, der Szenen lebendig ausmalt und zugleich kommentiert. Detailreiche Beschreibungen von Stadtlandschaften, Armenvierteln und Innenräumen schaffen die sinnliche Grundlage für moralische Fragen. Symbolische Kontraste zwischen Licht und Dunkelheit, Enge und Weite, Stille und Lärm strukturieren die Wahrnehmung. Längere Einschübe – etwa zu historischen Schlachten, religiösen Praktiken oder städtischer Infrastruktur – sind mehr als Abschweifungen: Sie verankern die Handlung in einem dichten kulturellen Kontext. So entsteht ein Text, der die Leserinnen und Leser zugleich unterhält, belehrt und zur Stellungnahme herausfordert.
Historisch verortet der Roman die Lebensläufe seiner Figuren zwischen Restauration und Julimonarchie. Er streift die Nachwirkungen von 1815, die soziale Frage der entstehenden Industriegesellschaft und die Spannungen, die in den Pariser Erhebungen der frühen 1830er kulminieren. Polizei, Justiz und das Strafsystem erscheinen als Instrumente einer Ordnung, die Sicherheit verspricht, aber Menschen leicht festschreibt. Ebenso präsent ist die vital wachsende Metropole, deren Viertel eigenständige Welten bilden. Diese Kulisse ist nicht bloß Hintergrund, sondern Wirkungsmacht: Sie erklärt, verführt, bedrängt und eröffnet zugleich die Möglichkeit, sich zu wandeln.
Die Wirkungsgeschichte ist außergewöhnlich. Seit 1862 wurde Les Misérables weltweit gelesen, vielfach übersetzt und immer wieder neu interpretiert. Der Stoff inspirierte Theaterfassungen, Stumm- und Tonfilme sowie ein international erfolgreiches Musical, das die Grundkonflikte in einem anderen Medium weitertrug. In Schulen und Universitäten dient der Roman als exemplarischer Text für den sozialen Realismus und für die Frage, wie Literatur gesellschaftliche Debatten mitgestaltet. Auch jenseits akademischer Kontexte prägt er das kollektive Bild von Armut, moralischer Erneuerung und dem Anspruch, dass Kunst Empathie stiften kann.
Ein Grund für die anhaltende Faszination liegt in der ethischen Imaginationskraft des Romans. Er lädt dazu ein, das Leiden anderer nicht zu übersehen und soziale Kategorien zu hinterfragen. Er macht verständlich, wie leicht Menschen auf Rollen reduziert werden, und zeigt Wege, diese Reduktion zu durchbrechen. Dabei verteidigt er die Würde der Schwachen, ohne das Problem zu romantisieren. Die Erzählung plädiert für Verantwortung, aber auch für eine Gerechtigkeit, die den Menschen nicht auf seine Fehltritte begrenzt. In diesem Sinn ist Les Misérables ein Plädoyer für eine Menschlichkeit, die Institutionen verwandeln kann.
Die fünf Bände entfalten sich mit wechselnden Geschwindigkeiten: rasanten Passagen folgen meditative Reflexionen, auf intime Dialoge großräumige Tableaus. Wer das Werk liest, darf die Exkurse als Kompass verstehen, der die moralische Geografie klärt. Sie sind Teil des Plans, nicht nur Schmuck. Die Architektur des Buches erlaubt, Figuren aus unterschiedlichen sozialen Sphären miteinander zu verschränken, sodass Zufall, Entscheidung und Geschichte ineinandergreifen. Diese Komposition eröffnet eine Lektüre, die zugleich geduldig und neugierig ist: geduldig gegenüber Tiefe und Kontext, neugierig auf die Wendepunkte, an denen Charaktere sich bewähren.
Heute bleibt Les Misérables aktuell, weil es Mechanismen beschreibt, die noch immer wirken: die Verhärtung von Systemen, die Stigmatisierung von Armut, die Verletzbarkeit von Kindern und die Frage nach zweiter Chancen. Der Roman zeigt, wie Sprache, Bildung und Solidarität Wege aus der Ausgrenzung öffnen können. Er hilft, Debatten über Strafvollzug, soziale Sicherung, öffentliche Gesundheit und Zugang zu Arbeit in ein größeres ethisches Koordinatensystem zu stellen. In einer Zeit beschleunigter Urteile erinnert das Buch daran, dass wahre Gerechtigkeit Geduld, Kontext und Mitgefühl braucht.
Wer Les Misérables heute liest, begegnet einem Werk, das zugleich historisches Dokument, moralische Untersuchung und spannungsreiche Erzählung ist. Seine bleibende Kraft liegt in der Verbindung von Empathie und Klarheit, Weite und Präzision. Indem es den Einzelnen ernst nimmt und die Gesellschaft in die Pflicht, hält es einen Spiegel vor, der nicht verblasst. Das Buch ist ein Klassiker, weil es über Zeitläufe hinweg zum Handeln im Hier und Jetzt ermutigt. Es verspricht keine einfache Erlösung, aber es vertraut auf die Möglichkeit des Besseren – im Menschen und in den Institutionen, die ihm dienen sollten.
Synopsis
Victor Hugos Les Misérables, 1862 in fünf Bänden erschienen, entfaltet ein Panorama Frankreichs nach der Revolution und unter der Restauration. Im Zentrum steht Jean Valjean, ein entlassener Zwangsarbeiter, dessen Vergangenheit ihn stigmatisiert. Auf der Suche nach Unterkunft und Arbeit erlebt er die Härte einer Gesellschaft, die Gesetz und Ordnung über Barmherzigkeit stellt. Zu Beginn legt Hugo die soziale Topografie offen: Dörfer, Werkstätten und Armenhäuser, in denen Hunger, Willkür und fromme Strenge nebeneinander bestehen. Eine zufällige Begegnung mit einem Geistlichen, dessen unkonventionelles Mitgefühl Regeln übersteigt, eröffnet Valjean die Möglichkeit eines neuen Lebens und begründet den Grundkonflikt von Recht und Gnade.
Durch die empfangene Geste wandelt sich Valjeans Selbstverständnis. Er nimmt eine neue Identität an, baut in Montreuil-sur-Mer eine Fabrik auf und steigt zum geachteten Bürgermeister auf. Seine Stärke richtet sich auf praktische Hilfe: Arbeit, Ordnung, Almosen ohne Demütigung. Doch seine Vergangenheit bleibt ein Schatten. Der pflichtstrenge Inspektor Javert, Inbild des unpersönlichen Gesetzes, wittert Widersprüche und beginnt zu misstrauen. Zugleich führt Hugo Fantine ein, eine junge Arbeiterin, deren Abstieg exemplarisch die Verstrickung von Geschlechterrollen, Moralvorstellungen und ökonomischer Not zeigt. Sie vertraut ihr Kind Cosette den Wirtsleuten Thénardier an, was Schutz verspricht, tatsächlich aber neue Formen von Ausbeutung eröffnet.
Als Fantines uneheliche Mutterschaft ruchbar wird, verliert sie ihre Stelle und fällt schrittweise durch die Netze der Wohlanständigkeit: Schulden, Erniedrigung, Krankheit. Ihre Lage spiegelt den moralischen Rigorismus einer Gesellschaft, die die Schwächsten am härtesten trifft. Valjean erkennt eine Mitverantwortung, weil seine Fabrikleitung sie entlassen ließ, und versucht, den angerichteten Schaden zu mildern. Er nimmt Fantines Sorge um Cosette ernst und verspricht Hilfe. Gleichzeitig verdichtet sich Javerts Verdacht: Der rechtschaffene Bürgermeister gleicht in Haltung und Kraft dem gesuchten Sträfling. Zwischen der Forderung des Gesetzes und dem Drang zur Wiedergutmachung bereitet sich eine Gewissensprüfung von weitreichender Tragweite vor.
Ein folgenschwerer Irrtum verschärft die Lage: Ein Unbekannter wird für den flüchtigen Jean Valjean gehalten und angeklagt. Der echte Valjean steht vor der Wahl, zu schweigen und viele zu retten, oder sich zu offenbaren und sein mühsam aufgebautes Leben zu riskieren. Fantines Schicksal hängt an verlässlicher Hilfe für Cosette. Valjean beschließt, das Kind zu suchen und von den Wirtsleuten Thénardier loszukaufen, deren scheinbare Fürsorge längst zum Geschäft mit Angst und Zwang verkommen ist. Die Befreiung führt ihn und Cosette auf eine Reise in Richtung Paris, wo neue Verstecke, neue Namen und ein hartnäckiger Verfolger ihr Dasein prägen.
In Paris sucht Valjean Schutz in der Anonymität der Großstadt und in abgeschirmten Räumen, die asketische Zurückgezogenheit mit Sicherheit verbinden. Cosette wächst aus einem verängstigten Kind zu einer jungen Frau heran; zwischen beiden entsteht ein stilles, zärtliches Verhältnis von Fürsorge und Dankbarkeit. Doch der Frieden ist brüchig: Javert bleibt unbeirrbar, und zufällige Begegnungen drohen Masken zu lüften. Hugo weitet den Blick auf Märkte, Gassen und Hinterhöfe, in denen Elend und Erfindungsgabe koexistieren. Die Stadt wird zur Bühne, auf der individuelle Lebensentwürfe auf politische Spannungen treffen, und jede Entscheidung, verborgen getroffen, unvermittelt öffentliche Konsequenzen annehmen kann.
Marius Pontmercy tritt als Vertreter einer neuen Generation auf. Zwischen dem monarchistischen Großvater und der Erinnerung an einen republikanisch geprägten Vater ringt er um Identität und soziale Zugehörigkeit. Über Freunde, die von politischer Reform und Bürgerrechten träumen, nähert er sich den Problemen seiner Zeit. In einem Park begegnet er Cosette, und eine schüchterne, tiefe Liebe entsteht, deren Erfüllung jedoch Diskretion und Mut verlangt. Éponine, Tochter der Thénardiers, kreuzt ihren Weg und zeigt eine widersprüchliche Mischung aus Härte und Loyalität. Ein von Thénardier eingefädelter Überfall bringt Valjean in Gefahr; das Entkommen verdankt sich überraschenden, moralisch ambivalenten Handlungen.
Die wachsende soziale Not und eine Welle politischer Unruhe münden im Pariser Aufstand von 1832. Junge Idealisten errichten Barrikaden, getragen von der Hoffnung auf Würde und Mitbestimmung. Hier kreuzen sich die Lebenslinien: Marius ringt zwischen persönlicher Liebe und öffentlicher Pflicht; Valjean betritt eine Sphäre, in der sein Streben nach Schutz und seine Schuldgeschichte kollidieren; Javert sucht die finale Bestätigung des Gesetzes. Freundschaft, Verrat, Opferbereitschaft und Zufall verdichten sich in engen Straßen zu Momenten, in denen Überzeugungen auf die Probe gestellt werden. Entscheidungen, die an diesem Ort getroffen werden, prägen die Zukunft der Überlebenden nachhaltig.
Über die Handlung hinaus entfaltet Hugo ein Ideenroman: Er konfrontiert positives Recht mit moralischer Gerechtigkeit, Pflicht mit Gewissen, Besitz mit Bedürfnis. Valjean verkörpert die Möglichkeit zur Erneuerung durch Mitgefühl, Javert die Konsequenz der Regel ohne Blick für Ausnahme. Paris erscheint als lebendiger Organismus, dessen Katakomben, Klöster und Abwasserkanäle nicht nur Räume, sondern Metaphern für verborgene Wahrheiten sind. Abschweifungen zu Schlachten, Gefängniswesen und Sprache vertiefen den historischen und sozialen Kontext. Die Thénardiers stehen als zähe Opportunisten für ein Elend, das sich anpasst und profitiert, während Nebenfiguren zeigen, wie kleine Gesten der Solidarität große Wirkungen entfalten.
Am Ende laufen private Geschichten und öffentliche Ereignisse zusammen und offenbaren, wie Entscheidungen im Verborgenen weitreichende Folgen haben. Les Misérables argumentiert für die Würde des Menschen, selbst dort, wo Institutionen scheitern, und plädiert für eine Gerechtigkeit, die das Gesetz menschlich überbietet. Liebe, in ihren vielen Formen, erscheint als Gegenmacht zur Kälte der Verhältnisse; Erinnerung und Reue werden zu Kräften der Läuterung. Die letzten Kapitel bringen Konsequenzen, die zugleich schmerzlich und hoffnungsvoll sind, ohne einfache Erlösung zu behaupten. Hugos Werk bleibt als umfassende Anklage gegen soziale Ausgrenzung und als Aufforderung zu Mut und Barmherzigkeit dauerhaft bedeutsam.
Historischer Kontext
Les Misérables verortet sich in Frankreich zwischen 1815 und den frühen 1830er Jahren, mit Paris als zentraler Bühne und Provinzstädten als Kontrastfolie. Dominante Institutionen sind die wiederhergestellte Monarchie, die katholische Kirche, die zentralisierte Verwaltung und ein streng hierarchisches Justiz- und Polizeisystem. Der Code civil prägt Familien- und Eigentumsverhältnisse, der Code pénal kriminalisiert Vagabundage und Kleindiebstahl hart. Zunftzwänge sind seit der Revolution aufgehoben, doch soziale Sicherung bleibt lückenhaft. In dieser Ordnung beobachtet das Werk Reibungen zwischen konservativer Restauration, aufkommendem Liberalismus und republikanischen Strömungen—eine Gemengelage, die Hugos Figurenwelten und Milieus historisch realistisch unterlegt, ohne reine Chronik zu sein.
Der Roman spiegelt die Nachwirkungen der Französischen Revolution und des Empire: Gleichheitsversprechen und Bürgerrechte stehen neben Kriegserfahrungen, Militarisierung und Verwaltungszentralismus. Die napoleonischen Gesetzeswerke sichern Rechtsklarheit, verstärken aber auch patriarchale und proprietäre Normen. Zugleich hatte die Revolution das Armenwesen säkularisiert und die Wirtschaft liberalisiert; viele Schutzmechanismen der Ständegesellschaft waren verschwunden, ohne durch tragfähige Sozialpolitik ersetzt zu werden. Diese Ambivalenz—emanzipatorische Ideale versus soziale Härte—bildet die historische Matrix, in der das Buch Fragen von Gerechtigkeit, Verantwortung und gesellschaftlicher Schuld verhandelt und die Grenzen individueller Moral gegenüber struktureller Not auslotet.
Die Niederlage Napoleons bei Waterloo 1815 leitete die Bourbonen-Restauration ein. In den Provinzen kam es phasenweise zur „Weißen Schreckensherrschaft“ gegen frühere Revolutionäre; in Paris stabilisierten Polizei und Bürokratie die Ordnung. Unter Louis XVIII. und später Charles X. formieren sich Legitimisten, Liberale und stille Republikaner. Presseregime, Wahlzensus und Religionspolitik erzeugen anhaltende Spannungen. Das Werk nutzt dieses Klima, um Loyalitäten und soziale Abstiege zu erzählen: ehemalige Soldaten, entwurzelte Landbewohner und städtische Arme stehen einer Gesellschaft gegenüber, die Ordnung priorisiert und soziale Frage, Rehabilitierung und Bildung nur zögernd adressiert.
Das Strafsystem des frühen 19. Jahrhunderts ist geprägt von den bagnes (Zwangsarbeitsanstalten), dem Stigma der Vorbestrafung und strikter Überwachung. Der gelbe Entlassungspass oder ähnliche Papiere brandmarken Ex-Sträflinge und schränken Mobilität und Beschäftigung drastisch ein. Die Pariser Sûreté, professionalisiert im frühen Jahrhundert, steht für den Aufstieg moderner Kriminalpolizei. Zeitgenossen erkannten in dieser Welt Parallelen zu Eugène-François Vidocq, einem ehemaligen Sträfling und späteren Polizeichef, dessen Biografie Debatten über Schuld, Besserung und staatliche Kontrolle befeuerte—Motivlagen, die das Romangespräch über Recht, Gesetz und Gnade historisch erden.
Armut ist allgegenwärtig und institutionell nur prekär abgefedert. Seit der Revolution existieren kommunale bureaux de bienfaisance; Hospize und Waisenhäuser nehmen Bedürftige auf, doch Mittel und Plätze sind knapp. Gesetzgebung gegen Bettelei führt zu Einweisungen in dépôts de mendicité, was Armut kriminalisiert statt lindert. Wohltätigkeit bleibt oft privat-religiös organisiert und zufällig verteilt. Diese Gemengelage macht soziale Abstiege lebensgefährlich: Krankheit, Jobverlust oder Stigmata führen rasch in Elend. Der Roman verknüpft diese Strukturen mit individuellen Schicksalen und zeigt, wie institutionelle Härte und moralistische Normen die Armen doppelt bestrafen.
Wirtschaftlich beginnt Frankreich behutsam zu industrialisieren. Textilmanufakturen, Metallverarbeitung und frühe Fabriken entstehen besonders im Norden und Osten; im Handwerk dominieren noch Kleinbetriebe. Löhne schwanken, Arbeitszeiten sind lang, Sicherheitsstandards gering. Frauen und Kinder arbeiten häufig in Werkstätten; der rechtliche Schutz ist minimal. Die Abschaffung der Zünfte fördert Unternehmerfreiheit, mindert aber auch kollektive Absicherungen. Wanderarbeit und Saisonbeschäftigung prägen Biografien. In dieser Lage entfaltet das Werk seine Kritik an einem Produktionsregime, das Effizienz über Menschen stellt, und spiegelt zugleich Reformhoffnungen, die im öffentlichen Diskurs der 1820er und 1830er Jahre an Gewicht gewinnen.
Paris wächst rasant: Zwischen 1800 und 1850 verdoppelt sich die Bevölkerung ungefähr. Enge Gassen, Mietskasernen und improvisierte Quartiere begünstigen Kriminalität, Krankheit und eine lebendige Schattenökonomie der chiffonniers (Lumpensammler) und Straßenverkäufer. Vor der haussmannschen Umgestaltung sind die Quartiere verwinkelt—günstig für Barrikaden und Rückzugsräume, aber fatal für Hygiene. Die Kanalisation ist ausgebaut, jedoch uneinheitlich; Überschwemmungen und Fäulnisdünste sind verbreitet. Der Roman nutzt diese Topografie—Dächer, Gassen, Abwasserkanäle—als historisch stimmigen Resonanzraum, in dem soziale Unsichtbarkeit, Verfolgung und Zuflucht konkrete städtische Gestalt annehmen.
Bildung bleibt bis in die 1830er Jahre ungleich verteilt. Vor 1833 gibt es keine landesweite Pflichtschule; Alphabetisierung steigt, bleibt aber regional und sozial stark unterschiedlich. Die Guizot-Gesetze von 1833 verpflichten Gemeinden, Primarschulen zu unterhalten, und fördern Lehrerbildung—ein entscheidender, aber gradueller Fortschritt. Lesekultur wächst durch erschwinglichere Drucke; Volksbibliotheken und Leihbüchereien verbreiten sich langsam. Diese Bildungsdynamik bildet den Hintergrund für Hugos pädagogische Passagen: Er argumentiert, dass Wissen und Alphabetisierung soziale Mobilität ermöglichen können, und kontrastiert sie mit einem Strafsystem, das Ungebildete unverhältnismäßig trifft.
Die katholische Kirche gewinnt nach 1801, gestützt durch das Konkordat, erneut Einfluss in Erziehung und Wohlfahrt. Religiöse Erneuerung und Klosterrevival prägen Frömmigkeit und Sozialpraxis der Restauration; zugleich wachsen liberale und antiklerikale Gegenstimmen. Wohltätigkeit, Beichte und Gemeindeleben wirken als soziale Netze, ohne strukturelle Ungleichheit grundsätzlich zu beheben. Der Roman verortet Gewissensentscheidungen in diesem Spannungsfeld: Geistliche Nächstenliebe steht neben institutioneller Starrheit. So werden Gnade und Pflicht, Askese und Weltverantwortung nicht als abstrakte Theologie, sondern als historische Kräfte sichtbar, die Verhalten steuern und Handlungsspielräume eröffnen oder verschließen.
Die Julirevolution von 1830 stürzt Charles X. nach pressefeindlichen Verordnungen und Wahlrechtsmanipulationen. Der „Bürgerkönig“ Louis-Philippe etabliert eine konstitutionelle Monarchie, gestützt auf Besitzbürgertum und städtische Eliten. Politische Partizipation bleibt begrenzt; Arbeiter und Kleinbürger fühlen sich weiterhin ausgeschlossen. Die Pressefreiheit erweitert sich, wird aber nach Attentaten 1835 wieder stärker reguliert. Diese Zwischenordnung—liberaler als die Restauration, aber sozial exklusiv—prägt die politische Atmosphäre, die das Werk in Szenen aus Hörsälen, Salons und Werkstätten einfängt: Hoffnungen auf Bürgerrechte treffen auf die Erfahrung, dass Eigentum über Einfluss entscheidet.
Republikanische Zirkel, Studentengruppen und Geheimbünde knüpfen an Traditionen der Carbonari an. In den frühen 1830ern organisieren sie Demonstrationen, publizieren Pamphlete und pflegen eine symbolische Politik der Barrikade. Der Roman spiegelt diese Milieus in idealistischen Diskussionszirkeln, deren Sprache und Rituale zeitgenössischen Vereinen ähneln. Ihre Verankerung in Kaffeehäusern, Schulen und Druckereien verweist auf städtische Öffentlichkeit als Motor politischer Mobilisierung. Dass diese Gruppen häufig polizeilich überwacht und strafverfolgt werden, erklärt die Mischung aus Konspiration, Pathos und juristischer Gefährdung, die die politische Kultur dieser Jahre durchzieht.
Die Choleraepidemie von 1832 trifft Paris hart und verschärft soziale Spannungen. Mangelhafte Wasserversorgung, überfüllte Quartiere und medizinisches Unwissen fördern Misstrauen; Gerüchte über Brunnenvergiftung kursieren, und Elendsviertel werden stigmatisiert. Die Behörden reagieren mit Quarantänen, Notspitälern und Desinfektionsmaßnahmen, die als repressiv empfunden werden können. Der Tod des populären Generals Lamarque wird zum Auslöser großer Trauerkundgebungen; die aufgeheizte Stimmung fließt in einen Aufstand, der das republikanische Lager schwächen wird. Das Werk bindet diese Konjunktur aus Seuche, Trauer und Protest schlüssig ein, ohne die komplexen Ursachen auf Heldentum zu reduzieren.
Rechtsreformen 1832 führen das Prinzip der mildernden Umstände ein und markieren eine Abkehr von starren Strafpraktiken, ohne das System grundlegend zu humanisieren. Die Debatte um die Todesstrafe gewinnt an Fahrt; Guillotinierungen bleiben öffentlich, wirken aber zunehmend anstößig für liberale Kreise. Victor Hugo engagiert sich publizistisch gegen die Todesstrafe und für Rehabilitierung, was die moralische Perspektive des Romans informiert. Die Spannung zwischen strafender Abschreckung und sozialer Besserung prägt die Rechtspraxis der Zeit und erklärt, weshalb das Thema „zweite Chance“ nicht nur literarisch, sondern als politische Forderung in den 1830er Jahren relevant ist.
Geschlechterordnung und Familienrecht sind durch den Code civil stark patriarchal: Uneheliche Kinder tragen Stigmata, Mündel und Frauen unterliegen männlicher Vormundschaft, und Scheidung ist lange eingeschränkt. Moralpolizei und kommunale Ordnungen treffen Straßenhandel, Prostitution und alleinstehende Mütter besonders hart. Kinderarbeit und informelle Pflegearrangements sind verbreitet; Waisen- und Findelhäuser sind überlastet. Das Werk spiegelt diese Fakten in Geschichten über soziale Verwundbarkeit von Frauen und Kindern, ohne sensationell zu werden. Es verweist auf eine Gesellschaft, die Tugend kontrolliert, aber Fürsorge unzureichend organisiert—ein Missverhältnis, das den Boden für Tragödien bereitet.
Die Veröffentlichung 1862 erfolgt im Kontext neuer Medientechniken und Vertriebswege. Dampfdruckpressen und Eisenbahnen ermöglichen hohe Auflagen und weite, schnelle Verbreitung. Der Verleger A. Lacroix, Verboeckhoven & Cie organisiert eine internationale Markteinführung mit erheblicher Werbung; Vorabdrucke und Übersetzungen folgen rasch. Unter dem Zweiten Kaiserreich sind Presse und Theater zwar reglementiert, doch der Roman erscheint und entfaltet enorme Resonanz. Kritiken schwanken zwischen moralischer Entrüstung, politischer Skepsis und Bewunderung für erzählerische Kraft. Die massenhafte Rezeption selbst wird zum historischen Fakt: soziale Fragen erreichen ein bürgerliches Lesepublikum in nie dagewesener Breite.
Hugos politischer Werdegang rahmt das Projekt. Vom royalistisch geprägten Jungautor entwickelt er sich zum liberalen und schließlich republikanischen Kritiker der Macht. Nach dem Staatsstreich Louis-Napoléons 1851 geht er ins Exil, zunächst nach Jersey, dann nach Guernsey. Dort überarbeitet und vollendet er ein bereits in den 1840ern begonnenes Manuskript. Distanz zum Pariser Alltag und Freiheit von Zensurerwartungen erleichtern die umfassenden Reflexionen über Geschichte, Gewissen und Elend. Das Vorhaben ist explizit moralisch-politisch: den Begriff „soziale Frage“ literarisch zu veranschaulichen, Missstände zu dokumentieren und die Möglichkeit individuellen Handelns gegenüber anonymen Strukturen zu behaupten.
Indem der Roman die Topografie des vorhaussmannschen Paris bewahrt, fixiert er ein Gedächtnis der engen Gassen, Zufluchtsorte und Schattenökonomien, die wenig später städtebaulich getilgt werden. Er kommentiert eine Übergangszeit, in der Rechtsstaatlichkeit wächst, aber Armut bleibt; Bildung expandiert, aber Ausschluss fortwirkt; Religion tröstet, aber Institutionen versagen. Les Misérables kritisiert Justiz, Verwaltung und bürgerliche Moral dort, wo sie soziale Not produzieren oder verfestigen, und plädiert für Gnade, Bildung und Reform. Damit wird das Buch weniger zur Chronik eines Aufstands als zum Kommentar über die Kräfte, die frühindustrielle Gesellschaften spalten oder versöhnen können.
Autorenbiografie
Einleitung
Victor Hugo (1802–1885) gilt als einer der prägenden Schriftsteller des 19. Jahrhunderts: Dichter, Romancier, Dramatiker und öffentlicher Intellektueller. Als führende Stimme der französischen Romantik verband er formale Kühnheit mit moralischer Leidenschaft. Seine Romane Notre-Dame de Paris und Les Misérables, seine Lyrik von Les Contemplations bis La Légende des siècles und seine Theaterstücke wie Hernani prägten Literatur, Bühne und politisches Denken weit über Frankreich hinaus. Hugo verband Gesellschaftskritik mit erzählerischer Opulenz, schuf ikonische Figuren und Bilder und verstand Kunst als Handlung im Dienst des Gemeinwohls. Sein Werk wurde in viele Sprachen übersetzt und global rezipiert.
Geboren in Besançon in der Umbruchzeit der napoleonischen Epoche, wuchs Hugo zwischen militärischer Disziplin und bürgerlich-literarischem Milieu auf. Dieser doppelte Horizont – Macht und Moral, Geschichte und Gewissen – prägte sein Verständnis von Literatur als Kraft gesellschaftlicher Transformation. Er schrieb über Außenseiter und Gewissensentscheidungen, entwarf historische Panoramen und verteidigte zugleich die Würde des Einzelnen. Literarisch steht er für die Emanzipation von Normen, für Bildreichtum, Rhythmus und dramaturgischen Schwung. Historisch verkörpert er den engagierten Autor, dessen Stimme in politischen Debatten Gewicht erhält und dessen Bücher öffentliche Vorstellungen von Gerechtigkeit und Humanität mitformten.
Bildung und literarische Einflüsse
Hugo erhielt eine sorgfältige, von klassischer Lektüre geprägte Ausbildung in Paris und zeigte früh außergewöhnliches dichterisches Talent. Er verfasste bereits als Jugendlicher preisgekrönte Oden und Balladen und bewegte sich rasch in literarischen Kreisen. Ein begonnenes Jurastudium festigte sein Sprach- und Argumentationsvermögen, doch die Literatur wurde rasch zur eigentlichen Berufung. Der sichere Umgang mit Versmaß, Rhetorik und historischen Stoffen resultierte aus intensiver Lektüre und einer rigorosen Schulbildung, die antike Autoren ebenso wie französische Klassiker einbezog. Früh gewann er Mäzene und Anerkennung, was ihm künstlerische Unabhängigkeit und die Möglichkeit systematischer literarischer Arbeit eröffnete.
Seine Einflüsse umfassen die romantische Erneuerung um François-René de Chateaubriand, die dramatische Größe Shakespeares, biblische Bildwelten sowie die Faszination für Mittelalter, Geschichte und Architektur. Die Beobachtung historischer Monumente – besonders gotischer Kathedralen – nährte seine Vorstellung von Kunst als kollektiver Schrift der Zeit. Philosophisch schloss er an humanistische Ideen und aufklärerische Freiheitsvorstellungen an, ohne deren pathetische Zuspitzung der Romantik zu scheuen. Aus diesen Impulsen entwickelte er eine Poetik des Weiten: die Synthese aus epischer Fülle, lyrischem Pathos und dramatischer Spannung, die gesellschaftliche Konflikte in symbolkräftigen Szenen sichtbar macht.
Literarische Laufbahn
Als Lyriker etablierte sich Hugo mit frühen Oden und Balladen und als Theoretiker des neuen Stils mit dem Vorwort zu Cromwell, das der französischen Romantik ein emphatisches Programm gab. Im Theater suchte er den Bruch mit klassizistischen Regeln. Die Uraufführung von Hernani 1830 wurde zum kulturgeschichtlichen Ereignis: Die sogenannte Schlacht um Hernani markierte den Durchbruch des romantischen Dramas, dessen freie Form, gemischte Stilebenen und emotionale Wucht eine junge Generation begeisterten und Konventionen erschütterten. Hugo behauptete sich damit als führender Dramatiker, der politisches und ästhetisches Aufbegehren auf die Bühne brachte.
Sein Roman Notre-Dame de Paris (1831) zeigte Hugos Meisterschaft, Historie, Architektur und menschliches Schicksal zu verweben. Das mittelalterliche Paris erscheint als lebendiger Organismus, dessen Kathedrale Gedächtnis und Bühne zugleich ist. Indem er eine packende Handlung mit kulturhistorischer Reflexion verband, trug Hugo zur Wiederentdeckung und zum Schutz gotischer Bausubstanz bei und prägte das Bild der Epoche im europäischen Bewusstsein. Die Verbindung von sozialem Blick, düsterer Poetik und spektakulärem Erzählen machte den Roman zu einem internationalen Erfolg und begründete Hugos Ruf als Romancier von seltener Imaginationskraft.
In den 1830er und 1840er Jahren setzte Hugo seine dramatische Arbeit fort und erlebte zugleich Zensur und Anfeindungen. Er wurde 1841 in die Académie française aufgenommen, was seine kanonische Stellung festigte. Neben Theater und Lyrik wandte er sich sozialen und juristischen Fragen zu; sein frühes Prosawerk Der letzte Tag eines Verurteilten positionierte ihn deutlich gegen die Todesstrafe. Die Revolution von 1848 führte ihn auf die politische Bühne. Nach dem Staatsstreich von 1851 ging er ins Exil, das zur produktiven Werkstatt wurde: Hier entstanden die vehemente Satire Les Châtiments und die elegische Sammlung Les Contemplations, tief geprägt von familiärer Trauer.
Die Reifephase kulminierte in Les Misérables (1862), einem Roman von epischer Breite über Gesetz, Gnade und gesellschaftliche Verantwortung. Das Buch verband populäre Erzählung mit moralischer Reflexion und stieß international eine Debatte über soziale Reformen an. Es folgten Romane wie Les Travailleurs de la mer und L’Homme qui rit sowie der späte Revolutionsroman Quatrevingt-treize. Parallel entwarf Hugo mit La Légende des siècles einen lyrischen Weltentwurf, der Menschheitsgeschichte poetisch ordnet. Zeitgenössische Kritik schwankte zwischen Bewunderung und Vorbehalten gegenüber dem Pathos; die Leserbindung und der langfristige Einfluss sind jedoch unbestritten.
Überzeugungen und Engagement
Hugos Überzeugungen kreisen um Freiheit, Menschenwürde und soziale Gerechtigkeit. Er trat für Presse- und Gewissensfreiheit ein, verteidigte die Rechte der Armen und Ausgeschlossenen und sah Bildung als Hebel des Fortschritts. Die Abschaffung der Todesstrafe war ihm zentrales Anliegen; sein Werk macht die moralische Problematik staatlicher Gewalt anschaulich. In Reden, Vorworten und offenen Briefen verband er juristische Argumente mit empathischer Darstellung individueller Schicksale. Seine Literatur dient dabei nicht nur der Illustration, sondern der Prüfung von Gewissensfragen, indem sie Leserinnen und Leser mit der Zumutung konkreter Not, aber auch mit Möglichkeiten tätiger Solidarität konfrontiert.
Im Exil erhob Hugo die Stimme gegen das Zweite Kaiserreich und machte die Inseln des Ärmelkanals zum Resonanzraum politischer Publizistik. Mit polemischer Schärfe attackierte er Autoritarismus und Korruption, zugleich appellierte er an ein europäisches Bewusstsein, das er mit der Idee einer künftigen Gemeinschaft von Nationen verband. Pamphlete wie Napoléon le Petit, politische Gedichte und eine umfangreiche Korrespondenz richteten sich an ein internationales Publikum. Seine Haltung verband Prinzipientreue mit pragmatischer Empathie: Er suchte nicht nur Schuldige zu entlarven, sondern gesellschaftliche Strukturen zu verändern, die Elend und Ausgrenzung hervorbringen.
Letzte Jahre und Vermächtnis
Nach dem Sturz des Zweiten Kaiserreichs kehrte Hugo 1870 nach Frankreich zurück und wurde als moralische Instanz empfangen. In den Jahren der Belagerung und der politischen Umbrüche engagierte er sich öffentlich und blieb literarisch präsent. Sein spätes Hauptwerk Quatrevingt-treize verhandelt die Logik revolutionärer Gewalt mit historischer Nüchternheit und dichterischer Energie. Daneben setzte er sein poetisches Großprojekt fort und veröffentlichte weitere Zyklen. Er nahm nochmals Mandate in nationalen Gremien an, blieb jedoch vor allem Symbol eines republikanischen Gewissens. Die Vereinigung von Autorprestige und bürgerlicher Autorität machte ihn zu einer Leitfigur der Dritten Republik.
Victor Hugo starb 1885 in Paris. Sein Tod löste landesweite Trauer aus; die öffentliche Aufbahrung und die Überführung in das Panthéon machten die Bestattung zur staatlichen Huldigung. Die nachhaltige Wirkung seines Werks zeigt sich in Übersetzungen, Schulkanons, Bühnen- und Filmadaptionen bis hin zu weltweit erfolgreichen Musiktheaterfassungen. Er prägte den Blick auf das Mittelalter, auf Architektur als Gedächtnis, auf soziale Verantwortung als politische Pflicht und auf Literatur als moralische Instanz. In Frankreich und darüber hinaus gilt er als Stimme, die Ästhetik und Ethik dauerhaft verschränkt hat und damit Generationen von Künstlerinnen, Lesern und Bürgern beeinflusste.
Les Misérables (Alle 5 Bände)
Erster Theil. Fantine
Inhaltsverzeichnis
“Fantine” (Margaret Hall)
Erstes Buch. Ein Gerechter
Inhaltsverzeichnis
I. Myriel
Inhaltsverzeichnis
Im Jahre 1815[1] war Charles François Bienvenu Bischof von Digne[1q]. Er zählte damals fünfundsiebzig Jahre und hatte sein hohes Amt seit 1806 inne.
Letzterer Umstand steht eigentlich in keiner wesentlichen Beziehung zu dem Inhalt unsrer Erzählung, aber vielleicht ist es nicht überflüssig, – wäre es auch nur der Genauigkeit wegen – hier zu berühren, was über ihn bei seiner Ankunft in der Diöcese erzählt und gemuthmaßt wurde. Was man von einem Menschen sagt, spielt ja, gleichviel ob es wahr oder falsch ist, in seinem Leben oft eine ebenso wichtige Rolle wie seine Thaten und Handlungen. Myriel war der Sohn eines Parlamentsraths der Stadt Aix, gehörte also zu dem Beamtenadel. Man erzählte sich, sein Vater, der ihm sein Amt vererben wollte, habe ihn schon, als er erst achtzehn oder zwanzig Jahr alt war, verheiratet, wie dies bei dem Parlamentsadel gebräuchlich war. Trotz dieser Heirat hätte aber Charles Myriel viel von sich reden gemacht. Er war gut gewachsen, wenn auch von kleiner Statur, hielt sehr auf sein Aeußres, hatte feine Manieren und viel Geist und brachte den ersten Abschnitt seines Lebens mit weltlichen Zerstreuungen und Liebesabenteuern hin.
Da brach die große Revolution von 1789 aus, und als bald wurden auch die Familien des Parlamentsadels in den Strudel hineingerissen und decimirt, aus dem Lande gejagt, verfolgt, auseinander gesprengt. Auch Charles Myriel emigrirte gleich zu Anfang der Revolution nach Italien. Hier starb seine Frau an einer Brustkrankheit, an der sie schon seit Jahren gelitten hatte. Kinder hatten sie nicht. War es der Zusammenbruch der alten Weltordnung, der Niedergang seiner Familie, die Dramen des Schreckensjahres 1793, die den Emigrirten aus der Ferne noch entsetzlicher erschienen als sie in Wirklichkeit waren, kurz, waren es die äußerlichen Umwälzungen, die ihn der Welt und ihren Freuden entfremdeten? Oder traf mitten in dem Strudel seiner Vergnügungen ihn persönlich ein Unglück, das die tiefsten Tiefen seines Herzens aufwühlte und seinem Denken eine andere Richtung wies? Diese Fragen wußte Niemand zu beantworten; nur so viel stand fest, daß er, aus Italien zurückgekehrt, Priester war.
Im Jahre 1804 war Myriel Pfarrer von Brignolles, wo er ein sehr zurückgezogenes Leben führte. Zu dieser Zeit, kurz nach Napoleons Kaiserkrönung[2], kam er einmal behufs Erledigung eines Amtsgeschäftes nach Paris und mußte unter Andern auch dem Kardinal Fesch[3] seine Aufwartung machen. Während nun unser wackrer Pfarrer im Vorzimmer wartete, kam zufällig auch der Kaiser um den Kardinal, seinen Oheim, zu besuchen. Ihm fiel ein gewisser Ausdruck von Neugierde auf, mit dem die Augen des Pfarrers ihm folgten, und, sich umwendend, fragte er barsch:
»Wer ist denn der gute Mann, der mich so ansieht?«
»Majestät, sagte Myriel, sehen einen guten, und ich einen großen Mann. Beide Teile können profitiren.«
Der Kaiser fragte nachher den Kardinal sofort nach dem Namen dieses Pfarrers, und kurze Zeit darauf erfuhr Myriel zu seiner großen Verwundrung, daß er auf den Bischofssitz von Digne berufen sei.
Im Uebrigen wußte Niemand, ob an den Gerüchten, die über Myriels Vorleben in Umlauf waren, etwas Wahres sei. Nur wenige hatten seine Familie gekannt.
Selbstredend ging es Myriel wie jedem Neuangekommnen in jeder Kleinstadt, wo Jedermann einen Mund zum Reden, aber nur Wenige ein Hirn zum Denken haben. Er mußte die Leute reden lassen, obgleich und weil er Bischof war. Was man sich über ihn erzählte, waren nur Reden, nur leeres Wortgeklingel, und als er neun Jahre in Digne residirt hatte, war all der Klatsch, der anfangs alle kleinen Geister in dieser kleinen Stadt in große Aufregung versetzt hatte, der Vergessenheit anheimgefallen. Niemand wagte mehr davon zu sprechen, Niemand ihn zu gehässigen Zwecken auszubeuten.
Myriel brachte nach Digne ein altes Fräulein Namens Baptistine, mit, die seine Schwester und zehn Jahre jünger war als er. Die ganze Dienerschaft der beiden Geschwister bestand in einer Magd desselben Alters wie Fräulein Baptistine, Namens Frau Magloire, die ehedem nur die »Magd des Herrn Pfarrers« gewesen und nun zugleich als Kammerfrau des Fräulein Baptistine und als Wirtschafterin Sr. Bischöflichen Gnaden fungirte.
Fräulein Baptistine war eine hoch gewachsene, blasse, hagre Dame von sanftem Wesen, eine Verkörperung alles dessen, was ein weibliches Wesen achtungswert macht; denn auf Ehrfurcht Anspruch machen darf ja wohl nur das Weib, das Mutter ist. Hübsch war sie nie gewesen, aber da ihr ganzes Leben mit Werken frommer Liebestätigkeit ausgefüllt worden war, so war jetzt über ihre äußere Erscheinung eine Art lichter Klarheit ausgegossen, etwas, das man die Schönheit des Gemüths nennen kann. Was in ihrer Jugend Magerkeit gewesen, hatte sich jetzt zu engelhafter Durchsichtigkeit verklärt. Sie war mehr Seele noch als jungfräuliches Weib, gleichsam ein Schatten mit so viel Körper, daß man ihm noch ein Geschlecht beilegen konnte; ein wenig Stoff, der einen lichten Glanz einhüllte. Dazu große Augen, die sie immer zur Erde gesenkt hielt, als suche diese Seele einen Vorwand noch hienieden zu verweilen.
Frau Magloire war eine kleine, dicke Alte, die immer keuchte, weil sie sich im Hause tüchtig tummelte, und zweitens, weil sie engbrüstig war.
Als Myriel seinen Einzug in Digne hielt, wurde er mit den üblichen hohen Ehrungen, gemäß den kaiserlichen Dekreten, laut denen die Bischöfe im Range unmittelbar den Brigadegenerälen folgen, in dem bischöflichen Palast installirt. Der Maire und der Präsident machten ihm zuerst ihre Aufwartung, und er seinerseits besuchte zuerst den General und den Präfekten. Dann, nachdem die Installation vollzogen war, wartete die Stadt, wie ihr neuer Bischof seines Amtes walten würde.
II. Herr Myriel wird der Herr Bischof Bienvenu
Inhaltsverzeichnis
Der bischöfliche Palast in Digne lag neben dem Hospital. Es war ein großes, schönes Gebäude, das zu Anfang des 18. Jahrhunderts von Henri Puget, Doktor der Theologie und 1712 Bischof von Digne, errichtet worden war. Alles in diesem wahrhaft fürstlichen Schlosse war in großem Stile angelegt: die Wohnzimmer des Bischofs, die Säle, die Kammern, der große Ehrenhof nebst den Wandelgängen, die sich, von altflorentinischen Arkaden überwölbt, um ihn herumzogen, die mit herrlichen Bäumen bepflanzten Gärten. In dem Speisesal, einer langen und prachtvollen Galerie, die im Erdgeschoß belegen war und sich nach den Gärten hinaus öffnete, hatte einst Henri Puget sieben hohe Würdenträger der Kirche feierlichst bewirtet. Die Bildnisse dieser sieben ehrfurchtgebietenden Prälaten schmückten den Sal, und das denkwürdige Datum, der 29. Juli 1714, war mit goldnen Buchstaben auf einer weißen Marmortafel eingegraben.
Das Hospital war ein enges, niedriges, einstöckiges Haus mit einem kleinen Garten.
Drei Tage nach seiner Ankunft besichtigte der Bischof das Hospital. Nach Beendigung der Visitation ließ er sofort den Direktor zu sich bescheiden.
»Herr Direktor, redete er ihn an, wieviel Patienten haben Sie gegenwärtig?«
»Sechsundzwanzig, Ew. Bischöfliche Gnaden.«
»Soviel habe ich auch gezählt«, bemerkte der Bischof.
»Die Betten«, hob der Direktor wieder an, »stehen recht dicht aneinander.«
»Das ist mir auch aufgefallen.«
»Statt Säle haben wir nur Stuben, die schwer zu lüften sind.«
»Das scheint mir auch so.«
»Und fällt einmal ein Sonnenstrahl in den Garten, so ist er zu klein, die vielen Rekonvalescenten zu fassen.«
»Das habe ich mir auch gesagt.«
»Wenn Epidemieen umgehen, wie z. B. dieses Jahr der Typhus[5] und vor zwei Jahren Friesel und Schweißfieber, haben wir bisweilen an die hundert Kranke und wissen dann nicht, wo wir mit ihnen hin sollen.«
»Der Gedanke ist mir auch in den Sinn gekommen.«
»Aber allen diesen Uebelständen ist nun einmal nicht abzuhelfen«, sagte der Direktor. »Man muß sich fügen.«
Dieses Zwiegespräch fand in dem Speisesal des Erdgeschosses statt.
Der Bischof schwieg einen Augenblick und wandte sich dann wieder an den Direktor mit der hastigen Frage:
»Herr Direktor, wieviel Betten, meinen Sie, würde wohl dieser Sal allein schon fassen?«
»Der Speisesal Ew. Bischöflichen Gnaden?« rief der Direktor in maßlosem Erstaunen.
Der Bischof überschaute den Sal und schien mit den Augen Messungen anzustellen.
»Zwanzig Betten würden hier wohl Platz finden,« flüsterte er leise, als spreche er für sich. Dann, zu dem Direktor gewendet, fuhr er laut fort:
»Ich will Ihnen was sagen, Herr Direktor. Es liegt offenbar ein Irrthum vor. Ihr seid sechsundzwanzig Menschen in fünf bis sechs winzigen Zimmerchen. Unserer sind hier drei, und wir haben Platz für sechzig. Da liegt ein Irrthum vor, sage ich Ihnen noch einmal. Sie haben meine Wohnung, und ich die Ihrige. Geben Sie mir mein Haus wieder. Sie gehören hierhin.«
Am folgenden Tage waren die sechsundzwanzig armen Kranken in dem Palast des Bischofs untergebracht und der Bischof in das Krankenhaus übergesiedelt.
Myriel hatte, da seine Familie durch die Revolution ruinirt war, kein Vermögen. Seine Schwester bezog eine Leibrente von fünfhundert Franken, die seiner Zeit im Pfarrhause für ihre persönlichen Bedürfnisse ausgereicht hatten. Myriel erhielt vom Staate als Bischof ein Gehalt von fünfzehn Tausend Franken. Ueber diese Summe verfügte Myriel laut einer von ihm selber aufgestellten Rechnung, deren Original uns vorliegt, ein für alle Mal folgendermaßen:
Ausgaben für meinen Haushalt.
Für das kleine Seminar
1500
Franken
Für die Missionskongregation
100
“
Für die Lazaristen zu Montdidier
100
“
Für das Seminar der auswärtigen Missionen in Paris
200
“
Für die Kongregation des Heiligen Geistes
150
“
Für die religiösen Anstalten im Heiligen Lande
100
“
Für die Frauenvereine zur Unterstützung armer Wöchnerinnen
300
“
Für den Verein in Arles außerdem noch
50
“
Für die Verbesserung der Gefängnißeinrichtungen
400
“
Zur Unterstützung und Befreiung Gefangner
500
“
Für die Befreiung von Familienvätern aus dem Schuldgefängniß
1000
“
Zuschuß zu den Gehältern der armen Schullehrer der Diöcese
2000
“
Für das Getreidemagazin der Oberalpen
100
“
Für die Kongregation der Damen von Digne, Manosque und Sisteron zur Erteilung von unentgeltlichem Unterricht an bedürftige Mädchen
1500
“
Für die Armen
6000
“
Für meine persönlichen Ausgaben
1000
“
_____
Summa
15,000
“
An dieser Einrichtung »seines sogenannten Haushaltes« änderte er nichts, so lange er den Bischofssitz zu Digne inne hatte.
Dieser Anordnung unterwarf sich auch Fräulein Baptistine ohne den geringsten Widerspruch. Für diese fromme Dame war Myriel nicht allein ihr Bruder, sondern auch ihr Bischof, ein Freund, den die Natur ihr zugesellt, und ein Vorgesetzter, den die Kirche ihr übergeordnet hatte. Sie brachte ihm nur Liebe und Ehrfurcht entgegen. Allen seinen Worten pflichtete sie bei; was er that, hieß sie gut. Nur die Magd, Frau Magloire, murrte ein wenig. Hatte doch, der Herr Bischof, – wie aus der oben angeführten Rechnung erhellt,– sich nur tausend Franken vorbehalten, was mit Fräulein Baptistines Pension fünfzehn Hundert Franken jährlich ergab. Mit diesen fünfzehn Hundert Franken bestritten die beiden Frauen und der alte Herr ihren ganzen Lebensunterhalt.
Und wenn ein Dorfpfarrer nach Digne kam, brachte es der Bischof noch fertig ihn anständig zu bewirten, dank Frau Magloire’s großer Sparsamkeit und Fräulein Baptistine’s weiser Haushaltungskunst. Eines Tages – er war damals seit etwa drei Monaten in Digne – sagte der Bischof: »Meine Einkünfte wollen doch gar nicht recht zulangen!«
»Das wollte ich meinen! rief Frau Magloire. Wenn Bischöfliche Gnaden sich wenigstens noch das Geld auszahlen ließen, das Ihnen das Departement als Vergütigung für Equipage[12] und Reiseunkosten schuldig ist. Die Vorgänger Ew. Bischöflichen Gnaden haben’s doch immer so gehalten!«
»In der That, Sie haben Recht, Frau Magloire, stimmte ihr der Bischof bei und reichte ein Gesuch bei der Stadtverwaltung ein.
Der Generalrath zog auch das Gesuch in Erwägung und warf einen Posten von dreitausend Franken jährlich aus, als Vergütung der Unkosten, die der Herr Bischof für seine Equipage in der Stadt und für seine Reisen mit der Post zu bestreiten habe.
Natürlich erhoben die Freidenker ein Zetergeschrei und ein Senator namentlich, ein ehemaliges Mitglied des Rathes der Fünfhundert, der dem Staatsstreich vom 18. Brumaire[4] zugestimmt und von Napoleon ein bei Digne gelegnes großes Gut als Dotation erhalten hatte, erließ an den Kultusminister Bigot de Préameneu einen entrüsteten Schreibebrief, dem wir folgende Zeilen entnehmen:
»Wozu eine Equipage in einer Stadt, die keine viertausend Einwohner hat? Und Unkosten für Rundreisen? Was sollen denn solche Rundreisen für einen Zweck haben? Und wie reist man denn per Post in einem Gebirgslande? Wir haben hier ja überhaupt keine Chausseen. Man reist hier nur zu Pferde. Kaum daß die Brücke über die Durance bei Chateau-Arnoult ein Ochsenfuhrwerk tragen kann! Aber so sind die Priester alle! Geldgierig und geizig. Der hier hat sich Anfangs auf den Heiligen ausgespielt. Jetzt macht er’s wie die Andern. Er muß in einer Equipage fahren und in einer Postkutsche reisen! Er braucht Luxus wie die Bischöfe des alten Regime. O über dieses Pfaffengeschmeiß! Glauben Sie nur, Herr Graf, ehe uns der Kaiser die Schwarzröcke nicht vom Halse schafft, werden die Zustände nicht besser. Nieder mit dem Papst! (Frankreich stand damals mit Rom auf gespanntem Fuße). Ich für mein Theil bin dafür, daß Cäsar allein regiert. U.s.w. U.s.w.«
Desto mehr freute sich Frau Magloire.
»So ist’s recht, sagte sie zu Fräulein Baptistine. Se. Bischöfliche Gnaden haben bis jetzt nur für Andere gesorgt, aber schließlich haben Sie doch endlich auch an sich denken müssen. Die Armen sind nun versorgt, und die dreitausend Franken bleiben für uns. Es war auch Zeit, daß wir was kriegten!«
An dem Abend desselben Tages stellte der Bischof wieder eine Rechnung auf und gab sie seiner Schwester. Sie lautete folgendermaßen:
Unkosten für Equipage und Amtsreisen.
Zu Bouillon für die Kranken unseres Hospitals
l,500
Franken
Für den Frauenverein zu Arles
250
“
Für den Frauenverein zu Draguignan
250
“
Für die Findelkinder
500
“
Für die Waisenkinder
500
“
_____
Summa
3,000
Franken
Das war Myriels Budget.
Was die Nebeneinkünfte anbelangt, die Einnahmen für Abkauf von Aufgeboten, für Dispensationsscheine, Nothtaufen, Predigten, Einweihungen von Kirchen und Kapellen, Hochzeiten u.s.w., so trieb der Bischof diese Gelder von den Reichen mit um so größrer Strenge ein, da er sie sämtlich den Armen zuwandte.
Nach Verlauf einer kurzen Zeit flossen ihm denn auch Liebesgaben in reicher Menge zu. Begüterte und Bedürftige, Alle klopften an Myriels Thür, die Einen um Spenden bei ihm zu hinterlegen, die Andern um sie in Empfang zu nehmen. Aber so beträchtliche Summen ihm auch durch die Hände gingen, so fand er sich doch nicht veranlaßt seine Lebenshaltung in irgend einem Punkte zu ändern und sich außer dem Notwendigen auch Ueberflüssiges zu gestatten.
Im Gegentheil. Da in der menschlichen Gesellschaft allzeit unten mehr Elend als oben Wohlthätigkeitssinn vorhanden ist, so war alles schon weggegeben, ehe er es bekommen hatte, so fiel alles wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Man konnte ihm noch so viel Geld geben, nie hatte er etwas. In solchen Fällen gab er noch mehr von dem Seinigen her.
Der dankbare Instinkt des Volkes wählte denn auch unter den Vornamen, die sein Bischof dem Brauche gemäß in seinen Erlassen und Hirtenbriefen vollständig aufzählte, denjenigen heraus, der einen bedeutungsvollen Sinn darbot. Die armen Leute nannten ihn nur den Bienvenu (Willkommen, Segensreich). Wir wollen diesem Beispiel folgen und ihn gelegentlich gleichfalls so nennen. Ihm selber sagte übrigens diese neue Bezeichnung zu. »Der Name gefällt mir,« ließ er sich vernehmen. Er mildert, was der Titel Bischöfliche Gnaden zu Stolzes hat.«
Daß diese Schilderung, die wir hier entwerfen, die Wahrscheinlichkeit für sich habe, wagen wir nicht zu behaupten, wohl aber ist sie der Wahrheit gemäß.
III. Ein tüchtiger Arbeiter findet viel zu thun
Inhaltsverzeichnis
Der Bischof hatte zwar seine Equipage in Almosen umgewandelt, bereiste aber gleichwohl fleißig seinen Amtssprengel, was mit erheblichen Strapazen verbunden war. Die Diöcese Digne ist ein Land mit wenig Ebenen und viel Bergen, dabei fast ohne Chausseen, wie schon erwähnt. Sie umfaßt zweiunddreißig Pfarreien, einundvierzig Vikariate und zweihundert fünfundachtzig Filialkirchen. Dies Alles zu bewältigen, erheischte keine geringe Summe von Arbeitskraft, die aber unser Bischof aufzubringen verstand. War der betreffende Ort in der Nachbarschaft gelegen, so ging er zu Fuß; in den ebenen Gegenden fuhr er in einer Halbkutsche, im Gebirge ritt er auf einem Maulthier. Die beiden Frauen begleiteten ihn gewöhnlich, außer wenn die Strapazen das billige Maß überstiegen. In diesem Fall reiste er allein.
Eines Tages ritt er in Senez, einer alten Bischofsstadt, auf einem Esel ein. Ein andres Transportmittel hatte er wegen der starken Ebbe, die in seiner Börse aufgetreten war, nicht genehmigen können. Als er nun von seinem Esel abstieg, maß ihn der Bürgermeister, der sich zu seinem Empfange vor dem Bischofspalais eingefunden, mit Blicken, aus denen tiefe sittliche Entrüstung sprach, und einige Vorübergehende, die ihrer Kleidung nach zu urtheilen den bessern Ständen angehörten, blieben stehen und lachten.
»Meine Herren, sagte der Bischof, ich kann mir das Motiv Ihres Unwillens denken: Sie finden es anmaßlich, daß ein armer Priester sich des Reitthieres Jesu Christi bedient. Ich versichere Sie aber, ich thue es aus Noth, nicht aus Eitelkeit.«
Wohin er auch bei einer solchen Rundreise kam, stets zeigte er sich milde und nachsichtig gegen seine Untergebnen und in seinen Predigten schlug er vorzugsweise einen gemüthlichen Gesprächston an. Weither geholte Gründe und Beispiele liebte er nicht. Dagegen ermahnte er die Leute an einem Ort sich die Bewohner eines andern, benachbarten, zum Vorbild zu nehmen. Wo man hart gegen die Bedürftigen war, sagte er z.B.: »Nehmt Euch Eure Nachbarn in Briançon zum Vorbild. Sie haben den Armen, den Wittwen und Waisen die Erlaubnis ertheilt, ihre Wiesen drei Tage vor den Andern abmähen zu lassen und repariren ihnen ihre Häuser, wenn sie baufällig geworden sind, unentgeltlich. Deshalb hat aber auch der liebe Gott das Land gesegnet, denn volle hundert Jahre lang ist daselbst kein Mord vorgekommen.«
Zu Leuten, die bei der Ernte zu genau verfuhren, sagte er. »Seht Euch mal an, wie sie’s in Embrun machen. Hat ein Familienvater Söhne beim Militär oder Töchter, die in der Stadt dienen, und kann er wegen Krankheit oder aus einem andern Hindrungsgrunde die Einbringung seiner Ernte nicht besorgen, so empfiehlt ihn der Pfarrer der Gemeinde, dann kommen am Sonntag alle Leute aus dem Dorfe, die Männer, die Frauen, die Kinder, mähen ihm sein Getreide und schaffen es ihm, Korn und Stroh, in seine Scheune.« – Zu den Familien, die wegen Geld- und Erbschaftsangelegenheiten uneinig waren sagte er: »Schaut mal, wie sie’s in Devolny anfangen. Es ist das eine rauhe Gebirgsgegend, wo man den Gesang der Nachtigall kaum einmal in fünfzig Jahren zu hören bekommt. In diesem Lande also gehen die Söhne, wenn der Vater stirbt, in die Fremde, und überlassen das Erbe ihren Schwestern, damit diese sich verheirathen können.« – In den Kantonen, wo viel prozessirt wurde, sagte er: »Nehmt Euch die braven Bauern in Queyras zum Vorbild. Es sind ihrer dreitausend Seelen, und die Leute leben dort einträchtig, als bildeten sie eine kleine Republik für sich. Richter und Exekutor giebt’s dort nicht. Der Schulze besorgt da alles. Er veranlagt die Steuern, schätzt Jeden ein, wie er’s vor seinem Gewissen verantworten kann, schlichtet unentgeltlich Streitigkeiten, theilt Erbschaften ohne Honorar zu fordern, fällt Urteilssprüche ohne den Leuten Unkosten zu verursachen, und er findet Gehorsam, weil er ein gerechter Mann ist und unter einfachen Leuten lebt.« In den Dörfern, wo kein Schullehrer war, verwies er wieder auf das Beispiel der Bauern in Queyras: Wißt Ihr, wie die’s machen? »Da ein Dorf mit nur zwölf bis fünfzehn Häusern nicht immer die Mittel besitzt einen Magister zu ernähren, so thun sich die Bewohner des ganzen Thales zusammen und halten sich Schulmeister. Die gehen von Dorf zu Dorf und geben hier acht, dort zehn Tage lang Unterricht. Diese Magister finden sich ein, wo Jahrmarkt ist, und ich habe selber welche gesehen. Sie sind an den Schreibfedern, die sie in einer Schnurschleife am Hute tragen, zu erkennen. Die nur Unterricht im Lesen ertheilen, haben eine Feder; die im Lesen und Rechnen unterrichten, zwei; die Lesen, Rechnen und Latein lehren, drei. Diese Letzteren sind große Gelehrte. Aber welche Schande unwissend zu sein! Ahmt den Leuten in Queyras nach.«
In dieser eindringlichen und väterlichen Ausdrucksweise pflegte er mit den Leuten zu reden. Und die Ermanglung von Beispielen erfand er Gleichnisse, hob deutlich das hervor, worauf es an kam, und brauchte wenig Redensarten, aber desto mehr bildliche Wendungen, wie Jesus Christus, dessen Beredsamkeit zu Herzen ging, weil sie aus dem Herzen kam.
IV. Uebereinstimmung von Thaten und Worten
Inhaltsverzeichnis
Im Gespräch war er leutselig und heiter. Er paßte sich dem Verständniß der beiden Frauen an, die bei ihm lebten. Lachen konnte er so herzlich wie ein Schulknabe.
Frau Magloire nannte ihn gern Hoher Herr. Eines Tages nun erhob er sich von seinem Sessel, um ein Buch zu holen, konnte es aber, da es auf einem oberen Regal lag und er zu kleiner Statur war, nicht langen. Da rief er Frau Magloire: »Bringen Sie mir doch einen Stuhl. Die Hoheit des hohen Herrn reicht nicht bis an das Brett da.«
Eine entfernte Verwandte von ihm, die Gräfin von Lô, ließ es sich selten entgehn, in seiner Gegenwart die »Hoffnungen« ihrer drei Söhne ausführlich aufzuzählen, nämlich all die Glücksgüter und Vortheile, die sie von reichen alten Verwandten binnen voraussichtlich kurzer Zeit erben würden. Der jüngste Sohn erwartete von einer Großtante ein Jahreseinkommen von nicht weniger als hunderttausend Franken; dem zweiten mußte der Herzogstitel seines Oheims zufallen; der Aelteste hatte Anwartschaft auf die Pairie seines Großvaters. Diesen unschuldigen und verzeihlichen Prahlereien der zärtlichen Mutter hörte meistentheils der Bischof mit musterhaftem Stillschweigen zu. Bei einer Gelegenheit indeß hing er seinen eigenen Gedanken nach, während die Gräfin sich in weitschweifigen Erörterungen aller dieser Successionen und »Hoffnungen« erging. Plötzlich brach sie ungeduldig ab und fragte ärgerlich: »Aber, Vetter, woran denken Sie denn?« »An einen sonderbaren Ausspruch, versetzte er, der, wenn ich nicht irre, sich in den Werken des heil. Augustin findet: Setzet Eure Hoffnung auf Den, dem Niemand succedirt.«
Ein andres Mal, als er eine Todesanzeige mit einem langathmigen Verzeichnis der Würden des Verstorbnen und der Adelstitel aller Verwandten desselben erhalten hatte, rief er aus: »Was für einen starken Rücken Freund Hein haben muß, daß man ihm soviel gewichtige Titel aufpacken kann, und wie gescheidt die Menschen sind, da sie sogar in einem Grabe Gelegenheit zur Befriedigung ihrer Eitelkeit finden!«
Er verstand auch zu spotten, in harmloser Weise, aber fast immer mit einem ernsten Hintergedanken. So kam einmal während der Fastenzeit ein junger Vikar nach Digne und hielt eine recht beredte Predigt über die Mildthätigkeit. Er forderte die Reichen auf den Armen zu geben, um der Hölle zu entgehen, deren Schrecknisse er ihnen in den grellsten Farben ausmalte, und sich das Himmelreich zu erobern, das er als überaus lieblich und erstrebenswert hinstellte. Diese Schilderung machte auf einen seiner Zuhörer, der im Handel zwei Millionen zusammengerafft hatte, einen so nachhaltigen Eindruck, daß er von seiner Gepflogenheit niemals Almosen zu geben abließ und von der Zeit an jeden Sonntag an der Kirchenthür eine kleine Kupfermünze für sechs Bettlerinnen spendete. Eines Tages nun, als er wieder diesen Akt hochherziger Mildthätigkeit vollzog, sah ihn der Bischof und bemerkte lächelnd zu seiner Schwester: »Sieh mal, da kauft sich Herr Geborand für einen Sou ewige Seligkeit.«
Handelte es sich um Mildthätigkeit, so ließ er sich selbst durch eine abschlägige Antwort nicht abschrecken und verstand es mit einer treffenden, geistreichen Entgegnung den Widerspenstigen andern Sinnes zu machen. Einmal sammelte er in einer Gesellschaft für die Armen. Unter den Anwesenden befand sich der Marquis von Champtercier, ein reicher alter Geizhals, der das Kunststück fertig gebracht hatte zugleich ultraroyalistisch und ultravoltairianisch gesinnt zu sein. Denn es hat auch solche Käuze gegeben. Als der Bischof zu ihm gelangt war, berührte er ihn am Arm und sagte: »Herr Marquis, Sie müssen mir etwas geben.« Der Marquis wandte sich um und antwortete trocken: »Bischöfliche Gnaden, ich habe schon meine Armen.« »Dann geben Sie mir die,« entgegnete der Bischof.
Eines Tages hielt er im Dom folgende Predigt: »Theuerste Brüder, liebe Freunde, es giebt in Frankreich 1,320,000 Bauernhäuser mit nur drei, 1,817,000 mit zwei Oeffnungen, der Thür und einem Fenster, und endlich 346,000 Hütten mit einer einzigen Oeffnung, der Thür. Schuld daran ist etwas, das man die Thür- und Fenstersteuer nennt. Denkt Euch nun arme Familien, alte Frauen, kleine Kinder in solchen Behausungen und stellt Euch vor, was für Fieber, was für Krankheiten da herrschen müssen! Gott schenkt, das Gesetz verkauft den Menschen die Luft. Ich klage das Gesetz nicht an, aber Gottes Güte preise ich. In den Departements Isére, Bar, Ober- und Unteralpen haben die Landleute nicht einmal Schubkarren und tragen den Dünger auf dem Rücken; keine Talglichter, und brennen Kienspäne oder mit Harz bestrichene Stricke. So macht man es in dem ganzen Ober-Dauphiné. Das Brod backen sie auf ein halbes Jahr und heizen den Backofen mit getrocknetem Kuhmist. Im Winter zerschlagen sie dies Brod mit der Axt und lassen es vierundzwanzig Stunden in Wasser weichen, um es essen zu können. Seid barmherzig, liebe Brüder; bedenkt, wieviel Elend Euch umgiebt!«
Als geborner Provenzale war es ihm leicht geworden sich mit allen südfranzösischen Dialekten gründlich vertraut zu machen. Das gefiel dem gemeinen Volk sehr und trug nicht wenig dazu bei, daß er seine Gedanken dem Verständniß Aller näher bringen konnte. Er war in der Hütte und im Gebirge zu Hause. Er verstand es, die erhabensten Dinge mittels der trivialsten Redewendungen auszudrücken, und da er Jedermanns Sprache redete, so fand er auch Mittel und Wege seinen Ideen Eingang in Jedermanns Herz zu schaffen.
Uebrigens benahm er sich gleich gegen die Vornehmen und Geringen.
Nie übereilte er sich mit Verdammungsurtheilen, sondern zog stets die Umstände in Erwägung. »Erst wollen wir uns den Weg ansehen, pflegte er zu sagen, den das Vergehen entlang gekommen ist.«
Als »Exsünder«, wie er sich im Scherz nannte, trug er keine Strenge zur Schau und lehrte mit großem Freimuth und ohne seine Stirn nach Art der Tugendhelden in finstre Falten zu legen, Grundsätze, die man in folgenden Worten zusammenfassen könnte:
»Der Mensch ist ein Geist, der mit Fleisch bekleidet ist. Dieses Fleisch ist eine Last und eine Versuchung. Der Mensch trägt es und giebt ihm nach.«
»Er soll es im Auge behalten, es zurückdrängen, es niederhalten und ihm nur im äußersten Nothfall willfahren. Solch ein Gehorsam kann mit Schuld behaftet sein, aber solch eine Schuld findet Vergebung. Wer so nachgiebt, fällt, aber auf die Knie und kann sich mit Gebet loskaufen.«
»Ein Heiliger zu sein ist die Ausnahme, ein Gerechter zu sein ist die Regel. Irret, fehlet, sündiget, aber seid Gerechte.«
»So wenig Sünde wie möglich, lautet das Gesetz für den Menschen. Gar nicht zu sündigen ist das Ideal des Engels. Alles Irdische ist der Sünde unterworfen. Wir können uns von ihr ebenso wenig frei machen wie von dem Gesetz der Schwere.«
Hörte er ein allgemeines Zetergeschrei, sah er die große Menge ein hastiges Tadelsvotum abgeben, so spottete er: »Hier liegt gewiß eine Sünde vor, die Jedermann begeht. Sonst würden die Heuchler es nicht so eilig haben zu protestiren, um den Verdacht von sich abzulenken.«
Gegen die Frauen und die Armen, auf denen mit ihrer ganzen Wucht die menschliche Gesellschaft lastet, war er nachsichtig: »An den Vergehen der Frauen, der Kinder, des Gesindes, der Schwachen, der Bedürftigen und Unwissenden sind die Männer, die Eltern, die Herrschaften, die Starken, Reichen und Gelehrten Schuld.«
Ferner: »Die Unwissenden belehret, so gut Ihr es vermöget; die Gesellschaft ist zu tadeln, daß sie nicht den öffentlichen Unterricht unentgeltlich ertheilen läßt; sie ist verantwortlich für die Finsterniß, der sie die Entstehung giebt. Ist eine Seele umnachtet, so schleicht sich die Sünde in sie hinein. Nicht derjenige ist der Schuldige, der die Sünde begeht, sondern der die Nacht geschaffen hat.«
Man sieht, er hatte eine absonderliche und eigne Art die Dinge zu beurtheilen. Ich habe ihn stark in Verdacht, daß er diese Gedanken dem Evangelium entnommen hatte.
Eines Tages war er gerade zugegen, als in einer Gesellschaft von einem Kriminalprozeß gesprochen wurde, der damals die Gerichte beschäftigte. Ein armer Mensch hatte sich aus Liebe zu einer Frau und zu dem Kinde, das sie ihm geboren, der Falschmünzerei schuldig gemacht, da er sie auf andre Weise vor dem Hungertode nicht zu bewahren wußte. Dieses Verbrechen wurde damals noch in Frankreich mit der Todesstrafe geahndet. Die Frau war bei dem ersten Versuch ein von dem Manne fabrizirtes Geldstück in Umlauf zu setzen, verhaftet worden, aber Beweise um sie einer Schuld zu überführen, hatte man nicht. Sie allein konnte gegen ihren Liebhaber aussagen und durch ein Geständniß seine Verurtheilung ermöglichen. Sie leugnete aber aufs hartnäckigste. Da hatte der Staatsanwalt einen gescheidten Einfall. Er legte der Unglücklichen geschickt ausgewählte Bruchstücke aus Briefen des Mannes vor und brachte sie auf diese Weise zu dem Glauben, sie habe eine Nebenbuhlerin, mit der er sie hintergehe. Da klagte sie, getrieben von sinnloser Eifersucht, ihren Geliebten an, und lieferte die nöthigen Beweise. Nun war der Mann verloren und nächster Tage sollte ihm, samt seiner Mitschuldigen in Aix der Prozeß gemacht werden. Dieser Vorfall also bildete den Gegenstand der Unterhaltung, und Alle bezeigten das höchste Entzücken über die Schlauheit des Staatsanwalts. Dadurch, daß er die Eifersucht ins Spiel gezogen, auf die Rachsucht der gekränkten Eitelkeit spekulirt, habe er der Wahrheit und Gerechtigkeit zum Siege verholfen. Allen diesen Lobeshebungen hörte der Bischof bis zu Ende schweigend zu. Dann fragte er:
»Vor welches Gericht werden die Beiden gestellt werden?«
»Vor die Assisen.«
»Und der Staatsanwalt?«
Wir müssen hier noch einen andern tragischen Vorfall erwähnen, der sich in Digne zutrug. Es wurde ein Mann wegen Mordes zum Tode verurtheilt, ein Unglücklicher, der nicht gerade ein gebildeter Mann, aber auch nicht ganz unwissend war, und der sich als Akrobat und öffentlicher Schreiber sein Brod auf den Jahrmärkten verdiente. Der Prozeß erregte große Sensation. An dem Tage vor der Hinrichtung wurde der Gefängnißgeistliche krank, und da man einen Priester brauchte, der den armen Sünder auf seinem letzten Gange begleiten sollte, so schickte man nach dem Stadtgeistlichen. Dieser aber weigerte sich, wie es heißt, mit rücksichtsloser Deutlichkeit: »Das geht mich nichts an«, ließ er sich vernehmen, »ich werde es bleiben lassen, mich mit dem Hanswurst zu befassen. Außerdem bin ich selber krank, und es ist Überhaupt nicht mein Beruf.« Seine Aeußerungen wurden dem Bischof hinterbracht, und dieser sagte: »Der Herr Pfarrer hat Recht. Es ist nicht sein Beruf. Aber es ist der meinige.«