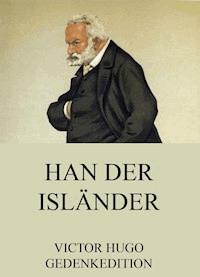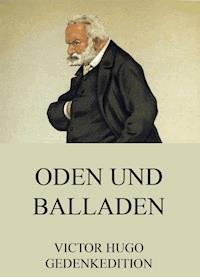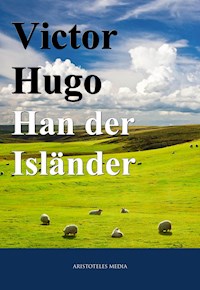8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jean Valjean kehrt nach neunzehn Jahren Bagno nach Frankreich zurück. Ein freundlicher Bischof nimmt ihn gastlich auf, und als Jean der neuerlichen Versuchung nicht widerstehen kann und seinem Wohltäter das Tafelsilber stiehlt, vertuscht dieser den Diebstahl vor der Polizei, indem er Jean noch zwei silberne Leuchter dazuschenkt. Überwältigt von so viel Güte, beschließt Valjean, fortan ein anständiges Leben zu führen. Er baut sich unter falschem Namen eine neue Identität auf, gründet mit dem Erlös aus den Silbersachen eine bald prosperierende Glasfabrik, wird ein reicher Mann und gibt sein Vermögen für die Unterstützung armer und entrechteter Menschen aus. So setzt er auch alles daran, die todkranke Fantine, eine junge Arbeiterin, und ihre kleine Tochter Cosette zu retten. Doch da holt ihn die Vergangenheit in Gestalt des Polizeiinspektors Javert ein, der seine wahre Identität herausgefunden hat ...
Victor Hugos großer Roman ist auch die Vorlage für ein einzigartiges Filmereignis. Getragen von der Sprache der Musik setzt Regisseur Tom Hooper atemberaubende Bilder in Szene. Vor großartiger Kulisse laufen Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Sacha Baron Cohen, Helena Bonham Carter, Amanda Seyfried und Eddie Redmayne zu schauspielerischer wie gesanglicher Höchstform auf und nehmen den Zuschauer mit auf eine emotionsgeladene Reise ins revolutionäre Frankreich des 19. Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 932
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Victor Hugo
DIE ELENDENLes Misérables
Roman
Aus dem Französischen von Edmund Th. Kauer
Impressum
Titel der Originalausgabe
Les Misérables
ISBN 978-3-8412-0551-3
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Februar 2013
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Bei Aufbau Taschenbuch erstmals 2000 erschienen
© der deutschen Übersetzung Atrium Verlag AG, Zürich
(nach der gekürzten und überarbeiteten Fassung von E. Th. Kauer, erschienen 1933 im Peter J. Oestergaard Verlag, Berlin)
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Covermotiv © Universal Pictures Germany GmbH
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
Erster TeilFantine
Erstes Buch Ein Gerechter
Zweites Buch Der Fall
Drittes Buch Im Jahre
Viertes Buch Anvertraut – ausgeliefert
Fünftes Buch Der Abgrund
Sechstes Buch Javert
Siebentes Buch Der Fall Champmathieu
Achtes Buch Der Gegenstoß
Zweiter TeilCosette
Erstes Buch Der Kreuzer »Orion«
Zweites Buch Einlösung eines Versprechens, das der Toten gegeben wurde
Drittes Buch Das Haus Gorbeau
Viertes Buch Jagd im Dunkeln, stumme Meute
Fünftes Buch Die Friedhöfe nehmen, was man ihnen gibt
Dritter TeilMarius
Erstes Buch Der Großbürger
Zweites Buch Großpapa und Enkel
Drittes Buch Die Freunde des ABC
Viertes Buch Lehrmeister Unglück
Fünftes Buch Begegnung zweier Sterne
Sechstes Buch Der schlechte Arme
Vierter TeilEine Idylle in der Rue Plumet und eine Epopöe in der Rue Saint-Denis
Erstes Buch Eponine
Zweites Buch Das Haus in der Rue Plumet
Drittes Buch dessen Anfang nicht dem Ende gleicht
Viertes Buch Der kleine Gavroche
Fünftes Buch Freude und Leid
Sechstes Buch Wohin?
Siebentes Buch Der 5. Juni
Achtes Buch Ein Atom verbrüdert sich mit dem Orkan
Neuntes Buch Corinthe
Zehntes Buch Die Großtaten der Verzweiflung
Elftes Buch Die Rue de l'Homme Armé
Fünfter TeilJean Valjean
Erstes Buch Eine Schlacht zwischen vier Wänden
Zweites Buch Im Reich des Kotes
Drittes Buch Enkel und Großvater
Viertes Buch Die Nacht des 16. Februar
Fünftes Buch Dämmerung
Sechstes Buch Dunkelheit und letztes Licht
Vorwort
Solange es kraft Gesetz und Sitte eine soziale Verdammnis gibt, die inmitten unserer Zivilisation künstlich Höllen schafft und der göttlichen Vorsehung ein menschliches Fatum hinzufügt, solange die drei Probleme des Jahrhunderts, die Entwürdigung des Mannes durch das Proletarierdasein, die Schändung des Weibes durch den Hunger, die Verwahrlosung des Kindes durch die geistige Finsternis, in der es gehalten wird, solange diese drei Probleme nicht gelöst sind, solange in gewissen Lebensbezirken der soziale Erstickungstod möglich ist oder, von einem noch allgemeineren Gesichtspunkt aus betrachtet, solange auf Erden Unwissenheit und Elend herrschen, dürften Bücher wie dieses hier nicht überflüssig sein.
Victor Hugo, 1862
Erster TeilFantine
Erstes BuchEin Gerechter
Myriel
Im Jahre 1815 war Charles-François-Bienvenu Myriel Bischof von Digne. Er zählte damals etwa fünfundsiebzig Jahre und hatte sein Amt seit 1806 inne.
Obwohl dieser Umstand nicht eigentlich zu unserer Erzählung gehört, ist es vielleicht nicht überflüssig, und wäre es auch nur um der Genauigkeit willen, hier gewisse Bemerkungen und Gerüchte zu erwähnen, die im Umlauf waren, als er in seiner Diözese eintraf. Was von Menschen gesagt wird, gilt ja in ihrem Leben, mag es wahr oder falsch sein, ebensoviel wie ihre Handlungen. Nun, Myriel war der Sohn eines Rates beim Parlamentsgericht zu Aix, entstammte also dem Beamtenadel. Man erzählte, sein Vater habe ihm sein Amt vererben wollen und habe ihn darum schon mit achtzehn oder zwanzig Jahren verheiratet, wie dies wohl bei den Beamtenfamilien der Brauch ist. Trotz dieser Heirat hatte Charles Myriel, wie behauptet wurde, viel von sich reden gemacht. Er war von gefälligem Äußern, wenn auch von kleiner Statur, elegant, geschmeidig, geistvoll; der erste Teil seines Lebens war zur Gänze weltlichen Dingen und galanten Abenteuern gewidmet.
Da brach die Revolution aus, die Ereignisse überstürzten sich, die Beamtenfamilien wurden blutig verfolgt, verjagt, außer Landes getrieben. Charles Myriel wanderte schon zu Beginn der Revolution nach Italien aus. Seine Frau erlag dort einem Lungenleiden, an dem sie schon seit Jahren krankte. Kinder hatten sie nicht.
Was ging damals in Myriel vor? War es der Zusammenbruch der alten französischen Gesellschaft, der Sturz seiner eigenen Familie, waren es die tragischen Ereignisse des Jahres 93, die den Ausgewanderten in der Fremde noch schrecklicher und ungeheuerlicher erscheinen mußten, war es dies, was ihn der Welt entfremdete und zur Einsamkeit trieb? Oder hatte ihn inmitten seiner Zerstreuungen und Vergnügungen, die sein Leben ausfüllten, plötzlich einer jener geheimnisvollen Schicksalsschläge getroffen, die zuweilen selbst den Mann ins Herz treffen, den allgemeine Katastrophen nicht zu erschüttern vermochten – wenn sie auch sein Glück und seine Existenz vernichteten? Niemand hätte diese Frage zu beantworten gewußt; bekannt war nur, daß er, aus Italien zurückkehrend, Priester war.
1804 war er Pfarrer von Brignolles. Er war bereits alt und führte ein sehr zurückgezogenes Leben.
Zur Zeit der Kaiserkrönung führte ihn ein unbedeutendes Amtsgeschäft seiner Pfarrei – es ist darüber nichts Näheres bekannt – nach Paris. Unter anderen einflußreichen Persönlichkeiten mußte er auch den Kardinal Fesch aufsuchen. Eines Tages also, als der Kaiser seinen Onkel besuchte, wartete der würdige Pfarrherr zufällig gerade im Vorzimmer, und so traf es sich, daß er unvermittelt Seiner Majestät gegenüberstand. Napoléon sah, daß der Alte ihn mit einer gewissen Neugierde anstarrte, wandte sich um und fragte brüsk:
»Wer ist der gute Mann, der mich so ansieht?«
»Sire«, erwiderte Myriel, »Sie sehen einen guten Mann und ich einen großen. So kommen wir beide auf unsere Rechnung.«
Am selben Abend fragte der Kaiser den Kardinal nach dem Namen dieses Pfarrers, und einige Zeit später war Myriel nicht wenig verwundert, zu hören, daß er zum Bischof von Digne ernannt worden sei.
Was an allen diesen Geschichten strenge Wahrheit war, konnte niemand angeben, denn nur wenige Familien hatten vor der Revolution mit den Myriels in Verbindung gestanden.
So mußte Myriel das Schicksal aller teilen, die in einer Kleinstadt neu angekommen sind, wo viel gesprochen und wenig gedacht wird. Er mußte es über sich ergehen lassen, obwohl er Bischof war, ja gerade weil er Bischof war. Aber schließlich war alles Gerede, das sich mit ihm beschäftigte, eben nur auf vage Vermutungen gestützt – Geschwätz, leere Worte; Palaver, wie man in der energischen Sprache des Südens sagt.
Wie dem auch sei, nach neun Jahren, die er in Digne zugebracht hatte, war all das Geschwätz, das in kleinen Städten zuerst die kleinen Leute beschäftigt, verstummt, und niemand wagte es mehr aufzurühren.
Myriel war in Begleitung eines alten Fräuleins, Mademoiselle Baptistine, seiner Schwester, die zehn Jahre jünger war als er, nach Digne gekommen. Seine ganze Dienerschaft bestand aus einer Magd, desselben Alters wie Fräulein Baptistine, Frau Magloire, die seinerzeit Wirtschafterin des Pfarrers Myriel gewesen war und jetzt das Doppelamt der Kammerfrau Fräulein Baptistines und der Haushälterin von Monsignore versah.
Mademoiselle Baptistine war eine hochgewachsene, blasse, hagere, sanfte Person; sie war die Verkörperung alles dessen, was man ehrbar nennen möchte; denn um auf Ehrfurcht Anspruch zu haben, muß eine Frau Mutter sein. Hübsch war sie nie gewesen; aber ihr Leben, das nur aus einer langen Reihe wohltätiger Werke bestand, hatte ihr schließlich eine gewisse Reinheit und Klarheit des Wesens verliehen, die man die Schönheit der Güte nennen möchte. Wenn sie in ihrer Jugend mager gewesen war, so konnte man jetzt, in ihrem reiferen Alter, fast von Durchsichtigkeit sprechen. Sie war eher eine Seele als ein jungfräulicher Körper; gerade noch genug Leib, daß man ihr ein Geschlecht beilegen konnte – ein Minimum an Materie, das in Glanz gehüllt schien. Ihre großen Augen hatte sie immer zu Boden gerichtet, als suche ihre Seele einen Vorwand, noch auf Erden zu verweilen.
Frau Magloire war eine kleine Alte, blaß, beleibt, stets geschäftig, immer außer Atem, und das, einmal weil sie zu jeglicher Zeit beschäftigt war, dann aber auch infolge ihres Asthmas.
Als Herr Myriel eintraf, wurde er im bischöflichen Palais mit allen Ehren untergebracht, die von den kaiserlichen Dekreten festgesetzt waren; denn die Staatsweisheit wies den Bischöfen den Rang gleich nach den Marschällen zu. Der Bürgermeister und der Präsident machten ihm sofort ihre Aufwartung, er aber, seinerseits, besuchte zuerst den General und den Präfekten.
Myriel wird Bischof Bienvenu
Das bischöfliche Palais in Digne lag neben dem Hospital. Es war ein geräumiges, schönes Gebäude, das zu Beginn des vorigen Jahrhunderts von Henri Puget, Doktor der Theologie an der Universität Paris, Abbé von Simore, seit 1712 Bischof von Digne, erbaut worden war. Es machte durchaus den Eindruck eines richtigen Herrensitzes. Alles darin war groß angelegt, die Gemächer des Bischofs, die Zimmer, der Festsaal mit den Wandelgängen, die ihn, zu altflorentinischen Arkaden ausgestaltet, umliefen, und die mit herrlichen Bäumen bepflanzten Gärten. In dem Speisesaal, einem prächtigen Raum, der im Erdgeschoß lag und zu den Gärten hinausführte, hatte Monsignore Puget am 29. Juli 1714 die hochwürdigen Herren Charles Brûlard de Genlis, den Erzbischof Prinz d’Embrun, Antoine de Mesgrigny, Bischof von Grasse, Philippe de Vendôme, Großprior von Frankreich, Abbé von Saint-Honoré de Lérins, François de Berton de Grillon, Bischof von Vence, César de Sabran de Forcalquier, Bischof von Glancève, Jean Soanen, Hofprediger und Bischof von Senez, bewirtet. Die Bildnisse dieser sieben hochwürdigen Herren schmückten den Saal, und das denkwürdige Datum, der 29. Juli 1714, war mit goldenen Buchstaben auf einer Marmortafel eingegraben.
Das Hospital war ein enges, niedriges Gebäude, einstöckig, mit einem kleinen Gärtchen.
Drei Tage nach seiner Ankunft besichtigte der Bischof das Hospital. Dann ließ er den Direktor zu sich bitten.
»Herr Direktor«, sagte er, »mit wieviel Kranken ist Ihr Spital augenblicklich belegt?«
»Wir haben sechsundzwanzig Patienten, Monsignore.«
»Soviel habe ich auch gezählt.«
»Wir haben die Betten recht eng aneinanderrücken müssen«, meinte der Direktor.
»Ich habe es bemerkt.«
»Die Krankensäle sind nur kleine Zimmer und schwer zu lüften.«
»Das scheint mir auch so.«
»Selten fällt ein Sonnenstrahl in den Garten, und dann ist zu wenig Platz da, die Kranken darin unterzubringen.«
»Das habe ich mir auch gesagt.«
»Wenn Epidemien ausbrechen – wir hatten heuer den Typhus und vor zwei Jahren das Fieber –, zählen wir manchmal bis zu hundert Kranke und wissen nicht, wo wir sie unterbringen sollen.«
»Dieser Gedanke ist mir auch gekommen.«
»Was wollen Sie, Monsignore? Man muß sich darein schicken.«
Dieses Gespräch fand in dem Speisesaal im Erdgeschoß statt.
Der Bischof schwieg einen Augenblick, dann wandte er sich unvermittelt an den Direktor.
»Wieviel Betten könnte man wohl in diesem Saal unterbringen?«
»Im Speisesaal des bischöflichen Palais?« fragte der Direktor verblüfft.
Der Bischof überschaute den Saal und schien die Maße zu überschlagen.
»Man könnte hier ganz gut zwanzig Betten unterstellen«, sagte er leise, als ob er mit sich selbst spräche; dann wieder laut:
»Ich will Ihnen etwas sagen, Herr Direktor. Hier liegt offenbar ein Irrtum vor. Sie sind sechsundzwanzig Leute in fünf oder sechs kleinen Zimmern, wir sind unser drei und haben Platz für sechzig; das kann nur ein Irrtum sein, finde ich. Also: Sie haben mein Haus und ich das Ihre, so wird es sein. Geben Sie mir mein Haus zurück, dieses hier gehört Ihnen.«
Am nächsten Tag wurden die sechsundzwanzig armen Kranken im bischöflichen Palais untergebracht, und der Bischof bezog das Hospital.
Da die Revolution seine Familie ruiniert hatte, besaß Myriel kein Vermögen. Seine Schwester bezog eine Rente von fünfhundert Franken, die, solange sie bei ihrem Bruder wohnte, für ihre persönlichen Ausgaben ausreichten. Myriel empfing vom Staat als Bischof ein Gehalt von fünfzehntausend Franken. An dem Tage, als er das Hospital bezog, setzte er fest, wie diese Summe ein für allemal aufgeteilt werden sollte. Wir geben hier eine von ihm eigenhändig geschriebene Aufstellung wieder.
Ausgaben meines Haushaltes:
für das kleine Seminar 1 500 Livres
für die Missionskongregation 100 ”
für die Lazaristen von Montdidier 100 ”
für das Seminar der auswärtigen Missionen in Paris 200 ”
für die Kongregation des Heiligen Geistes 150 ”
für die Kirchen im Heiligen Lande 100 ”
für die Gesellschaft zur Pflege der Wöchnerinnen 300 ”
für die gleiche Gesellschaft in Arles 50 ”
Hilfswerk für die Verbesserung der Gefängnisse 400 ”
Hilfswerk für entlassene Sträflinge 500 ”
für die Befreiung von Familienvätern aus dem Schuldgefängnis 1 000 ”
Unterstützungsfonds für schlechtbezahlte Schullehrer der Diözese 2 000 ”
für die Getreidespeicher des Departements Hautes Alpes 100 ”
Kongregation zu Digne, Manosque und Sisteron zur Erteilung unentgeltlichen Unterrichts an mittellose Mädchen 1 500 ”
für die Armen 6 000 ”
persönliche Aufwendungen 1 000 ”
Summa 15 000 Livres
Solange Myriel Bischof von Digne war, änderte er nichts an dieser Bestimmung. Das nannte er seinen Haushalt führen.
Fräulein Baptistine unterwarf sich dieser Anordnung vorbehaltlos. Für diese fromme Frau war Myriel zugleich Bruder und Bischof, ein Freund, den die Natur ihr bestimmt hatte, und ein Vorgesetzter, dem die Kirche sie unterstellte. Sie liebte und verehrte ihn. Wenn er sprach, unterwarf sie sich; was er tat, war wohlgetan. Nur die Haushälterin, Frau Magloire, murrte ein wenig. Hatte doch der Bischof, wie der Leser wohl bemerkt hat, nur tausend Livres sich selbst vorbehalten, was – mit Fräulein Baptistines Rente – fünfzehnhundert Franken jährlich ausmachte. Damit sollten die beiden alten Frauen und der Greis ihren Lebensunterhalt bestreiten.
Und wenn ein Landpfarrer nach Digne kam, fand der Bischof noch Mittel und Wege, ihn zu bewirten, dank der Haushaltungskunst Frau Magloires und der geschickten Wirtschaftsführung Fräulein Baptistines.
Eines Tages, er war damals schon fast drei Monate in Digne, sagte der Bischof:
»Mit dieser Summe bin ich denn doch ein wenig beengt.«
»Das denke ich wohl auch!« rief Frau Magloire. »Monsignore haben ja nicht einmal die Rente in Anspruch genommen, die Ihnen das Departement für die Kosten einer Equipage und Reisespesen schuldet. Früher pflegten die Bischöfe dieses Geld zu beheben.«
»Allerdings«, sagte der Bischof, »Sie haben recht, Frau Magloire.«
Und er forderte seine Rente an.
Der Generalrat prüfte einige Zeit später seine Ansprüche und bewilligte ihm eine jährliche Zuwendung von dreitausend Franken unter dem Titel: Gebühren des Herrn Bischofs für Kosten einer Equipage, Postfahrten und Aufwendungen bei Reisen in der Diözese.
Bei der Bürgerschaft gab es großes Geschrei, und ein Senator des Kaiserreichs, der ehemals Mitglied des Rats der Fünfhundert gewesen war, am 18. Brumaire für Napoléon gestimmt und dafür in der Nähe von Digne ein prächtiges Gut geschenkt bekommen hatte, schrieb dem Kultusminister, Bigot de Préameneu, einen sehr entrüsteten, vertraulichen Brief, dem wir folgendes wörtlich entnehmen:
»Kosten einer Equipage? Wozu eine Equipage in einer Stadt mit viertausend Einwohnern? Reisen in der Diözese? Wozu sollen die dienen? Und seit wann reist man in diesem Gebirgsland mit der Postkutsche? Es gibt ja gar keine befahrbaren Straßen hier! Hier reist man zu Pferd. Sogar die Durancebrücke bei Château-Arnoux trägt kaum ein Ochsenfuhrwerk! Aber so sind diese Geistlichen – habsüchtig und geizig. Der hier hat sich zuerst als Apostel aufgespielt. Jetzt macht er es wie die anderen, braucht eine Equipage und eine Postkutsche! Will Luxus haben wie die Bischöfe von Anno dazumal. Ach, dieses ganze Pfaffenpack! Herr Graf, es wird uns nicht besser gehen, solange der Kaiser uns diese Kerle nicht vom Halse schafft. Nieder mit dem Papst!« (Man stand damals schlecht mit Rom.) »Ich für meinen Teil brauche nur den Kaiser und sonst nichts« usw. usw.
Dagegen war Frau Magloire sehr erfreut.
»Gut«, sagte sie zu Fräulein Baptistine, »zuerst hat Monsignore für die andern gesorgt, jetzt denkt er auch an sich. Für Wohltätigkeit ist genug geschehen. Diese dreitausend Livres bleiben für uns. Endlich!«
Am selben Abend stellte der Bischof einen neuen Haushaltungskalkül auf und übergab ihn seiner Schwester.
Kosten der Equipage und Reisespesen:
für Bouillon dem Spital 1 500 Livres
für die Gesellschaft zur Pflege der Wöchnerinnen in Aix 250 ”
für die Gesellschaft zur Pflege der Wöchnerinnen in Draguignan 250 ”
für Findelkinder 500 ”
für Waisenkinder 500 ”
Summa 3 000 Livres
Das war Myriels Budget.
Was die Nebeneinkünfte des Episkopats betraf, Aufgebote, Dispensen, Taufgelder, Predigtgebühren, Einweihungen von Kirchen und Kapellen, Hochzeiten usw., so trieb der Bischof sie von den Reichen um so strenger ein, als er sie insgesamt den Armen zuwandte.
Nach einiger Zeit flossen ihm auch reichliche Hilfsgelder zu. Besitzende und Bedürftige klopften an seine Tür, um milde Gaben zu spenden oder zu empfangen. Binnen Jahresfrist war der Bischof der Schatzmeister der öffentlichen Wohltätigkeit, der Bankier des Elends. Beträchtliche Summen flossen durch seine Hände, aber nichts konnte ihn veranlassen, auch nur im geringsten seine Lebenshaltung zu verändern und dem Notwendigsten Überflüssiges hinzuzufügen.
Weit entfernt davon! Immer war – da in der menschlichen Gesellschaft mehr Elend als Brüderlichkeit herrscht – alles bereits vergeben, bevor es eingegangen; es war mit dem Gelde wie mit einem Tropfen, der auf einen heißen Stein fällt. Soviel Myriel auch bekam, nie hatte er etwas. Oft beraubte er sich selbst.
Es ist Sitte, daß die Bischöfe ihre Taufnamen an die Spitze ihrer Sendschreiben und Hirtenbriefe setzen; mit einem Instinkt der Dankbarkeit wählten die armen Leute von Digne unter allen Vornamen ihres Bischofs den, der ihnen am sinnvollsten schien, und nannten ihn Monsignore Bienvenu – Bischof Willkommen. Ihm gefiel diese Benennung.
»Ich habe diesen Namen gern«, sagte er. »Bienvenu klingt besser als Monsignore.«
Wir wollen nicht behaupten, daß das Bild, das wir hier entworfen haben, sehr viel Wahrscheinlichkeit für sich hat; darum müssen wir uns darauf beschränken, zu versichern, daß es wahrheitsgetreu ist.
Ein guter Bischof hat es nicht leicht
Obwohl der Bischof seine Equipage in Almosen verwandelt hatte, war er oft amtlich auf Reisen. Und die Diözese von Digne ist ein Distrikt, in dem man nicht bequem reist. Es gibt dort wenig Ebene und viel Gebirge, überdies fast keine Straßen, wie schon erwähnt wurde; und dabei umfaßt sie zweiunddreißig Pfarreien, einundvierzig Vikariate und zweihundertfünfundachtzig Filialkirchen. Sie alle im Auge zu behalten, ist keine Kleinigkeit. Aber der Bischof brachte es zustande. Er ging zu Fuß, wenn sein Ziel in der näheren Nachbarschaft lag, fuhr in einem Bauernwägelchen, wenn er auf dem flachen Lande zu tun hatte, ritt auf einem Maultier ins Gebirge. Oft begleiteten ihn die beiden Frauen. Wenn die Reise zu anstrengend war, blieb er allein.
Eines Tages ritt er auf einem Esel in Senez, einer alten Bischofsstadt, ein. Das Geld war besonders knapp, und so hatte er sich kein anderes Transportmittel leisten können. Der Bürgermeister empfing ihn am Tor des Bischofspalais und maß ihn, wie er so von seinem Esel abstieg, mit empörten Blicken. Einige Bürgersleute blieben stehen und lachten.
»Herr Bürgermeister«, sagte der Bischof, »und Sie, meine Herren Bürger, ich verstehe schon, warum Sie empört sind; Sie finden es unverschämt, daß ein armer Geistlicher sich des Reittiers Jesu Christi bedient. Aber seien Sie versichert, ich tat es aus Not, nicht aus Eitelkeit.«
Auch auf seinen Amtsreisen war er immer geduldig und nachsichtig, seine Predigten klangen eher wie Plaudereien. Bei den Haaren herbeigezogene Argumente konnte er nicht ausstehen.
Im Gespräch war er freundlich und heiter. Lachen konnte er wie ein Schuljunge.
Frau Magloire liebte es, ihn »hoher Herr« anzureden. Eines Tages wollte er ein Buch von einem Regal holen, konnte es aber nicht erreichen, da er von kleiner Statur war. »Frau Magloire«, rief er, »bringen Sie mir einen Stuhl! Der hohe Herr reicht nicht bis zu dem Brett da oben.«
Eine entfernte Verwandte, die Gräfin von Lô, ließ sich selten eine Gelegenheit entgehen, vor ihm von den »Hoffnungen« ihrer drei Söhne zu sprechen. Sie hatte mehrere Verwandte, die schon an der Schwelle des Grabes standen und deren Erbe ihren Söhnen zufallen sollte. Der jüngste der drei sollte von seiner Großtante hunderttausend Livres Rente bekommen; der zweite sollte sogar den Herzogstitel seines Onkels erben; der älteste schließlich sollte in die Pairschaft seines Großvaters eintreten. Der Bischof pflegte den unschuldigen und verzeihlichen Prahlereien einer liebenden Mutter schweigsam zuzuhören. Einmal allerdings war er versonnener als je, während Madame de Lô sich wieder in weitschweifigen Erörterungen all ihrer Hoffnungen erging. Ungeduldig unterbrach sie sich:
»Großer Gott, Vetter, woran denken Sie nur?«
»Mir fällt da«, sagte der Bischof, »ein sonderbarer Ausspruch ein, den ich, wenn ich mich recht erinnere, in den Schriften des heiligen Augustinus gefunden habe: ›Setzet eure Hoffnung in Ihn, der ohne Nachfolger ist.‹«
Bei passender Gelegenheit verstand er es, harmlos zu spotten, aber fast nie war sein Scherz ohne ernsten Sinn. Während der Fastenzeit kam einst ein junger Vikar nach Digne und predigte in der Kathedrale. Er war sehr beredt. Seine Predigt galt der Mildtätigkeit. Er forderte die Reichen auf, den Notleidenden zu Hilfe zu kommen, denn nur so könnten sie der Hölle entgehen, die er ihnen ebenso schauerlich schilderte, wie er das Paradies lieblich und erstrebenswert darstellte. Unter seinen Zuhörern war ein reicher Kaufmann, der sich bereits zur Ruhe gesetzt hatte, ein gewisser Géborand, ein Wucherer, der mit seiner Tuchweberei zwei Millionen verdient hatte. Zeit seines Lebens hatte Géborand keinem Unglücklichen ein Almosen gegeben. Seit jener Predigt aber wurde beobachtet, daß er jeden Sonntag für die alten Bettlerinnen am Tor der Kathedrale einen Sou spendete. Und dabei waren es sechs, die sich in diesen Betrag zu teilen hatten! Der Bischof sah ihn eines Tages, wie er solchermaßen Wohltätigkeit übte, und sagte lächelnd zu seiner Schwester:
»Sieh doch den Herrn Géborand, wie er für einen Sou Paradies kauft.«
Wenn es galt, Spenden einzutreiben, ließ er sich auch durch eine abschlägige Antwort nicht zurückschrecken und fand oft kluge Einwände. Einmal sammelte er in einem Salon für die Armen. Auch der Marquis de Champtercier war zugegen, ein reicher alter Geizhals, der es fertigbrachte, zugleich Ultraroyalist und Ultravoltairianer zu sein. Auch das gibt es. Der Bischof berührte seinen Arm und sagte:
»Herr Marquis, Sie müssen mir etwas geben.«
Der Marquis wandte sich um und erwiderte trocken:
»Monsignore, ich habe meine Armen.«
»Gut, geben Sie sie mir.«
Da er in der Provence geboren war, verstand er die Dialekte des Südens gut. Das gefiel den Leuten und trug nicht wenig dazu bei, daß seine Worte bei ihnen galten. Er war in der Hütte und auf der Alm zu Hause. Die erhabensten Dinge vermochte er in die gewöhnlichsten Worte zu kleiden. Er sprach alle Dialekte und drang ein in alle Herzen.
Niemals urteilte er voreilig und ohne die Umstände zu prüfen. Gern sagte er: »Wir wollen sehen, welchen Weg die Sünde genommen hat.«
Sich selbst nannte er scherzhaft einen Exsünder; niemals gab er sich streng oder zog nach Art der Tugendbolde seine Stirn in düstere Falten; offen bekannte er sich zu seinen Fehlern und hielt sich an einen Lehrsatz, den man ungefähr so zusammenfassen konnte:
»Der Mensch ist von Fleisch, darum trägt er seine Last und seine Versuchung immer bei sich. Sie lauert, und er gibt ihr nach.«
Gab es ein allgemeines Entrüstungsgeschrei, so sagte er wohl auch: »Oh, das muß ja eine Sünde sein, die von vielen Leuten begangen wird, daß alle Heuchler so heftig protestieren und ihr Alibi nachweisen.«
Gegen die Frauen und gegen die Armen, auf denen das Unrecht der Gesellschaft am schwersten lastet, war er stets nachsichtig. »Die Sünden der Frauen, der Kinder, der Bedienten, der Schwachen, der Elenden und der Unwissenden«, sagte er, »sind immer die Schuld der Männer, der Eltern, der Brotgeber, der Starken, Reichen und Wissenden.«
Oder: »Man muß die Unwissenden belehren, so gut man kann; die Gesellschaft lädt eine große Schuld auf sich, indem sie den Unterricht nicht unentgeltlich erteilt; sie ist verantwortlich für die Finsternis des Geistes, in der sie die Menschheit verharren läßt. Wenn die Seele in Dunkelheit schmachtet, ist sie der Sünde zugänglich. Nicht der ist schuldig, der die Sünde begeht, sondern der die Finsternis erzeugt hat.«
Eines Tages hörte er in einem Salon von einem Kriminalprozeß sprechen, der damals in Vorbereitung war. Ein Unglücklicher hatte aus Liebe zu einer Frau und dem Kinde, das sie von ihm hatte, falsches Geld gemacht, weil er keinen anderen Ausweg sah, dem Elend zu entgehen. Falschmünzerei wurde zu jener Zeit noch mit dem Tode bestraft. Man hatte die Frau bei ihrem ersten Versuch, das Falschgeld an den Mann zu bringen, verhaftet. Man hielt sie gefangen, aber Beweise konnte man nur gegen sie nicht erbringen. So lag es an ihr, ob sie ihren Liebhaber belasten und durch ein Geständnis dem Tode überliefern wollte oder nicht. Sie leugnete. Man drang in sie. Aber sie beharrte auf ihrer Aussage. Da hatte der königliche Prokurator einen guten Einfall. Er konstruierte eine Untreue des Mannes und verstand es, Bruchstücke aus Briefen von ihm so geschickt zusammenzustellen, daß die Unglückliche glauben mußte, sie habe eine Nebenbuhlerin und würde von jenem Manne betrogen. In der Tat ließ sie sich von ihrer Eifersucht verführen, ihren Liebhaber zu verraten, alles zu gestehen und sogar Beweise zu liefern. Der Mann war verloren. Er sollte demnächst zusammen mit seiner Mitschuldigen in Aix abgeurteilt werden. Man unterhielt sich darüber, und alle rühmten die Geschicklichkeit des Beamten. Indem er die Eifersucht erregt hatte, war es ihm gelungen, den Zorn zu seinem Verbündeten zu machen und die Wahrheit zu erfahren. Er hatte die Rachsucht in den Dienst der Justiz gestellt. Schweigend hörte der Bischof dies alles an. Endlich fragte er:
»Welches Gericht urteilt über diesen Mann und diese Frau?«
»Die Assisen.«
»Und welches über den Herrn Prokurator?«
Ein tragischer Fall ereignete sich in Digne. Ein Mann wurde wegen Mordes zum Tode verurteilt. Es war ein Unglücklicher, der nicht wirklich gebildet, aber auch nicht ganz unwissend war; auf Jahrmärkten hatte er sich als Clown zur Schau gestellt, war aber auch als öffentlicher Schreiber tätig gewesen. Der Prozeß erregte in der Stadt großes Aufsehen. Am Vorabend der Hinrichtung erkrankte der Gefängnisgeistliche. Da aber ein Priester den Delinquenten auf seinem letzten Gange begleiten mußte, sandte man nach dem Pfarrer. Es wurde berichtet, er habe sich mit der Begründung geweigert, die Sache gehe ihn nichts an. »Mit Possenreißern habe ich nichts zu tun«, hatte er gesagt, »übrigens bin ich auch krank, und dies ist nicht meines Amtes.«
Diese Antwort wurde dem Bischof hinterbracht, und dieser sagte:
»Der Herr Pfarrer hat recht. Dies ist nicht sein Amt, sondern meines.«
Unverzüglich begab er sich in das Gefängnis, stieg in die Zelle des Possenreißers hinab, redete ihn mit Namen an und bot ihm die Hand. Den ganzen Tag blieb er bei ihm, vergaß zu essen und zu schlafen, betete für die Seele des Verurteilten und ermahnte ihn, an sein Heil zu denken. Er sagte ihm die besten Wahrheiten – nämlich die einfachsten. Er war Vater, Bruder, Freund; Bischof nur, um zu segnen. Er belehrte ihn, gab ihm die Sicherheit wieder und tröstete ihn. Dieser Mensch war im Begriff, verzweifelt zu sterben. Für ihn war der Tod ein Abgrund, ein gähnender Schlund, vor dem er entsetzt zurückbebte. Er war nicht so roh, daß er stumpf geblieben wäre. Seine Verurteilung hatte ihn schwer erschüttert und ihn einen Blick tun lassen in jene geheimnisvolle Tiefe, die wir das Leben nennen und die sich zumeist unserer Erkenntnis entzieht. Er suchte um sich zu blicken und sah nur Finsternis. Der Bischof ließ ihn das Licht erkennen.
Als der Delinquent am nächsten Tage abgeholt wurde, war der Bischof bei ihm. Er wich nicht von seiner Seite und zeigte sich der Menge in seinem violetten Kleid, mit dem Bischofskreuze am Halse, neben dem gefesselten Verbrecher. Mit ihm bestieg er den Karren und das Schafott. Der Unglückliche, der noch am Vorabend niedergeschmettert und verzweifelt gewesen war, hatte Fassung gewonnen. Vielleicht empfand er, daß seine Seele Gnade gefunden hatte. Der Bischof umarmte ihn und flüsterte ihm, als das Fallbeil stürzte, noch zu:
»Wen der Mensch tötet, den erweckt Gott zu neuem Leben; wen die Brüder von sich stoßen, den nimmt der Vater auf. Geh ein in das ewige Leben, der Vater erwartet dich!«
Als er vom Schafott herabstieg, war etwas in seinen Augen, wovor die Menge scheu zurückwich. Man wußte nicht, was erstaunlicher war, seine Blässe oder der heitere Frieden, den sein Antlitz ausstrahlte.
Gerade das Erhabene wird selten verstanden; viele Leute hielten das Betragen des Bischofs für Affektation. Das war die Meinung der Salons. Das Volk allerdings, das fromme Handlungen nicht mißdeutet, war gerührt und bewunderte den Bischof.
Ihn hatte der Anblick der Guillotine aufs tiefste erschüttert, und lange konnte er sich davon nicht erholen.
In der Tat hat das Schafott, wenn es hoch aufgerichtet vor uns steht, eine unheimliche, die Phantasie erregende Wirkung. Man mag über die Todesstrafe keine eigene Meinung haben, sich des Urteils enthalten, sie bejahen oder verneinen, solange man die Guillotine nicht mit eigenen Augen gesehen hat; ist man ihr aber gegenübergestanden, so muß man sich entscheiden und Partei nehmen. Der eine wird sie bewundern wie de Maistre, der andere sie verabscheuen wie Beccaria. Die Guillotine ist das verwirklichte Gesetz, die materialisierte Rache; sie ist nicht neutral und gestattet uns nicht, neutral zu bleiben. Bei ihrem Anblick können wir uns nicht dem geheimnisvollen Schauer entziehen. Rings um das Fallbeil haben die sozialen Probleme ihre Fragezeichen wirksam vor unser Auge gerückt. Das Schafott ist eine Vision. Es ist nicht ein Gerüst, eine Maschine, ein toter Mechanismus aus Holz, Eisen und Seil. Es ist ein Lebewesen, scheint es, ein Lebewesen, das irgendeinem dunklen Trieb folgt. Es ist, als ob es sähe, höre, begreife, als ob diesem Eisen, diesem Holz, diesen Seilen ein Wille innewohne. Unserer beängstigten Phantasie erscheint es als furchtbarstes Wesen, das wissentlich handelt. Denn es ist der Komplize des Henkers, es frißt Fleisch und säuft Blut. Es ist ein Ungeheuer, das der Richter und der Zimmermann heraufbeschworen haben und das mit dem Tode, den es gibt, sein scheußliches Leben bestreitet.
So war der Eindruck tief und schrecklich gewesen; am Tage nach der Hinrichtung und noch viele Tage später war der Bischof bedrückt. Die fast erzwungene Heiterkeit, die ihn in dem schrecklichen Augenblick beherrscht hatte, war wieder verschwunden; das Schreckgespenst der Justiz lastete auf ihm. Er, der sonst mit so strahlender Zufriedenheit auf alle seine Handlungen zu blicken pflegte, schien sich Vorwürfe zu machen. Zuweilen sprach er mit sich selbst, murmelte düster vor sich hin. Seine Schwester hörte ihn eines Abends sagen:
»Ich dachte nicht, daß es so gräßlich wäre. Es ist ein Unrecht, nur an das göttliche Gesetz zu denken und das Menschengesetz zu vernachlässigen. Den Tod festzusetzen, ist Gottes Sache. Nur ihm kommt es zu. Mit welchem Recht maßen die Menschen sich an, eine Strafe zu verhängen, die sie selbst nicht kennen?«
Cravatte
Hier fügt sich eine Begebenheit ein, die wir nicht unerwähnt lassen dürfen, denn sie gehört zu jenen, die den Charakter des Bischofs von Digne am deutlichsten erkennen lassen.
Nachdem die Bande des Gaspard Bès auseinandergetrieben worden war, der die Täler um Ollioules unsicher gemacht hatte, floh einer seiner Unterführer, ein gewisser Cravatte, ins Gebirge. Er verbarg sich mit einigen versprengten Banditen geraume Zeit in der Grafschaft Nizza, entkam nach Piemont und tauchte plötzlich wieder in Frankreich, bei Barcelonnette, auf. Zuerst sah man ihn in Jauziers, dann in Tuiles. Er verbarg sich in den Höhlen des Joug de l’Aigle, stieg von dort durch die Schluchten der Ubaye und Ubayette zu den Hügeln und Dörfern herab. Schließlich kam er nach Embrun, drang des Nachts in die Kathedrale ein und plünderte die Sakristei. Seine Raubzüge versetzten das ganze Land in Schrecken. Die Gendarmen waren ihm auf den Fersen, aber vergeblich. Immer wieder entkam er; zuweilen leistete er sogar bewaffneten Widerstand. Er war tollkühn und elend.
Inmitten dieser Schrecken traf der Bischof ein. Er befand sich gerade auf einer Amtsreise nach Chastelar. Der Bürgermeister besuchte ihn und empfahl ihm, umzukehren. Cravatte hielt das Bergland bis zur Arche und darüber hinaus in Atem; selbst mit einer Eskorte zu reisen sei gefahrvoll. Es bedeute, nutzlos drei oder vier Gendarmen in Gefahr zu bringen.
»Allerdings«, sagte der Bischof, »ich wünsche auch ohne Eskorte zu reisen.«
»Aber was fällt Ihnen ein!« rief der Bürgermeister.
»Doch, ich lehne es ab, mit Gendarmen zu reisen, und ich breche in einer Stunde auf.«
»Sie brechen auf?«
»Allerdings.«
»Und allein?«
»Allein.«
»Monsignore, das werden Sie nicht tun.«
»Ich habe da«, erwiderte der Bischof, »oben in den Bergen eine kleine Gemeinde, die ich seit drei Jahren nicht besucht habe. Die Leute dort sind mir gute Freunde. Sanfte, rechtschaffene Hirten. Von dreißig Ziegen, die sie hüten, gehört ihnen eine, und sie flechten sehr hübsche Wollschnüre und spielen auf kleinen Flöten mit sechs Klappen Lieder aus den Bergen. Ich muß ihnen von Zeit zu Zeit etwas von Gott erzählen. Was sollten sie von einem Bischof denken, der sich fürchtet, was sollen sie von mir halten, wenn ich nicht komme?«
»Aber, Monsignore, die Räuber – –?«
»Halt«, sagte der Bischof, »die darf ich auch nicht vergessen. Sie haben recht. Ich könnte ihnen begegnen. Die haben es besonders nötig, daß ich ihnen von Gott spreche.«
»Monsignore, das sind Banditen! Eine Horde Wölfe!«
»Herr Bürgermeister, vielleicht hat Jesus mich über sie zum Hirten eingesetzt. Wer begreift die Vorsehung?«
»Monsignore, sie werden Sie ausrauben.«
»Ich habe ja nichts.«
»Dann werden sie Sie totschlagen.«
»Einen alten Priester, der landein zieht und Gebete murmelt? Wozu?«
»Mein Gott, wenn Sie ihnen begegnen!«
»Ich werde sie um ein Almosen für meine Armen bitten.«
Man mußte ihn gewähren lassen. Nur in Begleitung eines Knaben, der sich ihm als Führer angeboten hatte, machte er sich auf den Weg. Seine Unbeugsamkeit erregte im ganzen Lande großes Aufsehen und gab Anlaß zu schlimmen Befürchtungen.
Weder seine Schwester noch Frau Magloire nahm er mit. Auf einem Maultier ritt er über das Gebirge, begegnete niemand und kam wohlbehalten bei seinen Freunden, den Hirten, an. Er blieb vierzehn Tage bei ihnen, predigte, erledigte seine Amtsgeschäfte, gab ihnen nützliche Lehren. Als er abreisen sollte, beschloß er, ein feierliches Tedeum abzuhalten. Er sprach darüber mit dem Pfarrer. Es ergab sich, daß kein bischöfliches Ornat aufzutreiben war. Man konnte ihm ein einfaches Meßgewand, wie es die Landpfarrer benützen, mit verbliebenen Damastverbrämungen und falschen Goldtressen anbieten.
»Nun, Herr Pfarrer«, sagte der Bischof, »kündigen wir unser Tedeum an. Alles wird sich finden.«
»Man fragte ringsum in den Kirchen an, aber alle diese dürftigen Landpfarreien zusammen konnten nicht genug Paramente in ihren Sakristeien aufbringen, um einen Domkantor anständig zu bekleiden.
Während man sich noch den Kopf zerbrach, wie diesem Mangel abzuhelfen wäre, wurde von zwei unbekannten Reitern, die sich sofort wieder davonmachten, eine mächtige Truhe in das Pfarrhaus gebracht und für den Herrn Bischof abgegeben. Man öffnete sie und fand darin einen Chorrock aus goldgewirktem Tuch, eine diamantenbesetzte Mitra, das Kreuz eines Erzbischofs, einen prunkvollen Krummstab, kurz, alle die bischöflichen Gewänder, die einen Monat vorher aus der Schatzkammer von Notre Dame zu Embrun geraubt worden waren. In der Truhe lag ein Zettel, auf dem geschrieben stand:
»Dies sendet Cravatte dem Bischof Bienvenu.«
»Habe ich nicht gesagt, daß sich alles finden wird!« rief der Bischof. Und lächelnd fügte er hinzu: »Wer sich mit dem Pfarrerrock begnügt, dem sendet Gott das Ornat eines Erzbischofs.«
Neues Licht
Einige Zeit später tat der Bischof etwas, worüber die ganze Stadt noch mehr in Erstaunen geriet als über die Reise durch das Gebiet der Banditen.
In der Umgebung von Digne führte ein Mann ein einsames Leben. Dieser Mensch, um das Furchtbare kurz herauszusagen, war ein ehemaliges Mitglied des Konvents. Er hieß G. Von dem Konventsmitglied G. sprach man in der kleinen Welt, die Digne hieß, nur mit Abscheu. Ein Mitglied des Konvents! – Wer hielte das für möglich?! Das hatte es zur Zeit gegeben, als jeder den andern duzte und Bürger nannte. Dieser Mensch war fast ein Ungeheuer. Er hatte nicht für den Tod des Königs gestimmt, aber viel hatte nicht gefehlt! Fast ein Königsmörder! Es war schrecklich. Warum hatte man ihn nicht nach der Rückkehr der angestammten Familie vor das Profosengericht gestellt? Man hätte ihn ja nicht aufs Schafott bringen müssen, um jeden Preis, man hätte Milde walten lassen können, gut, aber eine anständige Verbannung auf Lebensdauer war doch das mindeste, was man verlangen durfte. Man hätte schließlich ein Exempel statuieren sollen! Überdies war dieser Mensch noch dazu ein Atheist, wie sich das ja bei seinesgleichen von selbst versteht.
Gänsegeschnatter über einen Geier.
War übrigens dieser G. ein Geier? Ja, wenigstens nach der Wildheit zu schließen, mit der er sich in der Einsamkeit vergrub. Da er nicht für den Tod des Königs gestimmt hatte, war er ja von den Verbannungsdekreten nicht betroffen und durfte sich in Frankreich aufhalten.
Er wohnte drei viertel Stunden von der Stadt entfernt, abseits von jeder menschlichen Siedlung, fern von allen Wegen, in einem versteckten Winkel eines einsamen Tales. Dort hatte er, wie es hieß, ein Stück Acker, eine Höhle – einen Zufluchtsort. Keine Nachbarn; nicht einmal, daß jemand dort vorüberkam. Seit er in jenem Tal wohnte, war das Gras über den Pfad gewachsen. Man sprach von jenem Ort wie vom Hause des Henkers.
Der Bischof jedoch dachte an den Mann, sah von Zeit zu Zeit hinab in jenes Tal und ließ seinen Blick auf der Baumgruppe verweilen, die am fernen Horizont das Haus des alten Konventsmitgliedes bezeichnete. Dort ist eine Seele, dachte er, die einsam ist.
Ich schulde ihm einen Besuch, empfand er.
Doch wollen wir es offen einbekennen, dieser Gedanke schien ihm, so natürlich er auch im ersten Augenblick war, nach kurzer Überlegung seltsam und unmöglich, ja widerwärtig. Im Grunde genommen teilte er die allgemeine Meinung, und das Konventsmitglied flößte ihm, ohne daß er sich dessen klar bewußt war, ein Gefühl ein, das an der Grenze des Hasses liegt.
Indessen, darf die Räude des Schafes den Hirten zurückscheuchen? Nein. Aber welch ein Schaf war das nun!
Der gute Bischof befand sich in einer schwierigen Lage. Manchmal machte er sich auf den Weg, um dorthin zu gehen, kam aber unverrichteterdinge wieder zurück.
Eines Tages hieß es in der Stadt, ein junger Hirt, der dem alten G. diente, sei um einen Arzt gekommen; der alte Schuft sterbe, er sei bereits gelähmt und werde die Nacht nicht überleben.
Gott sei Dank, meinten manche.
Der Bischof nahm seinen Stock, schlüpfte in den Mantel, denn seine Soutane war bereits allzu schäbig, oder auch, um sich nicht dem kalten Abendwind auszusetzen, und machte sich auf den Weg.
Die Sonne berührte bereits den Horizont, als der Bischof den fluchbeladenen Ort erreichte. Nicht ohne Herzklopfen sah er sich endlich der Hütte gegenüberstehen. Er überquerte einen Graben, stieg über eine Hecke, gelangte durch einen Vorgarten an einen Platz, von dem aus er zwischen hohem Gesträuch die Behausung erkannte. Es war eine niedrige, einfache, saubere Hütte mit einer vergitterten Fassade. Vor der Tür saß in einem Rollstuhl, wie ihn die Landleute gebrauchen, ein Mann mit weißen Haaren, der der Sonne zulächelte. Neben ihm stand ein junger Bursche, wohl jener Hirt, und reichte ihm eine Schale Milch.
Während der Blick des Bischofs auf ihm ruhte, wandte sich der Greis an den Knaben.
»Danke«, sagte er, »ich brauche nichts mehr.« Sein freundlicher Blick hatte sich von der Sonne gelöst und ruhte jetzt auf dem Burschen.
Der Bischof trat näher. Das Geräusch seiner Schritte veranlaßte den Greis, sich umzuwenden, und sein Gesicht zeigte alle Verwunderung, die man nach einem langen Leben noch zu empfinden vermag.
»Seit ich hier bin«, sagte er, »ist dies das erstemal, daß man zu mir kommt. Wer sind Sie, mein Herr?«
»Ich heiße Bienvenu Myriel.«
»Bienvenu Myriel. Diesen Namen habe ich gehört. Sind Sie der, den das Volk Bischof Bienvenu nennt?«
»Derselbe.«
Der Greis lächelte leise.
»Demnach sind Sie mein Bischof?«
»In gewissem Sinne …«
»Treten Sie ein, mein Herr.«
Das Konventsmitglied bot dem Bischof die Hand, aber der nahm sie nicht. Er sagte nur:
»Ich freue mich zu sehn, daß man mich falsch unterrichtet hat. Sie scheinen mir nicht krank zu sein.«
»Ich werde bald ganz gesund sein«, erwiderte der Greis. Und nach einer Pause: »In drei Stunden sterbe ich. Ich verstehe mich ein wenig auf Medizin. Ich weiß, wie der Tod sich vorbereitet. Gestern waren nur die Füße kalt, heute ist die Kälte bis zu den Knien hinaufgestiegen; jetzt fühle ich, wie sie langsam zum Leib hinansteigt. Sobald sie das Herz erreicht, wird es mit mir aus sein. Schönes Wetter heute, ja? Ich habe mich herausfahren lassen, um einen letzten Blick auf all diese Dinge zu werfen. Sprechen Sie ruhig, es strengt mich nicht an. Sie taten recht, einen Mann zu besuchen, der stirbt. Es ist gut, in diesem Augenblick nicht allein zu sein. Man hat so seine besonderen Wünsche. Ich hätte gern bis Tagesanbruch gelebt, aber ich weiß, daß meine Kraft kaum noch drei Stunden vorhält. Dann ist Nacht. Nun, was tut’s? Sterben ist eine einfache Sache. Man braucht dazu keine Morgensonne. Ich werde im Licht der Sterne sterben.«
Der Greis wandte sich dem Hirten zu.
»Geh schlafen, du. Du hast gestern nacht gewacht, du bist müde.«
Der Junge trat in die Hütte. Der Alte folgte ihm mit den Augen und sagte leise:
»Während er schläft, werde ich sterben. Gute Nachbarschaft für zwei Arten Schlaf.«
Der Bischof war nicht so tief gerührt, wie man es hätte vielleicht erwarten sollen. Das war eine Art zu sterben, in der nichts von Gott zu fühlen war. Und um alles zu sagen – denn auch die kleinen Widersprüche in großen Herzen dürfen nicht unerwähnt bleiben – , er, der lachte, wenn man ihn »hoher Herr« ansprach, empfand es doch ein wenig peinlich, daß er hier nicht »Monsignore« angesprochen wurde; fast fühlte er sich versucht, sein Gegenüber »Bürger« anzureden. Er hatte eine Anwandlung, mit dem Mann in jener groben Vertraulichkeit zu sprechen, die bei Priestern und Ärzten so gewöhnlich ist, ihm aber sonst fremd war. Dieser Mann, dieses Konventsmitglied, dieser Volksvertreter war ein Mächtiger der Erde gewesen, und vielleicht zum erstenmal in seinem Leben fühlte der Bischof eine Neigung, hart zu sein.
Der Alte dagegen ließ seinen Blick bescheiden und herzlich auf dem Fremden ruhen, und es war, als ob die Demut dessen in ihm fühlbar würde, der sich anschickt, in Staub zu zerfallen.
Der Bischof konnte sonst Neugierde nicht vertragen, sie galt ihm beinahe als Beleidigung; doch konnte er sich diesmal nicht versagen, das Konventsmitglied mit einer Aufmerksamkeit zu betrachten, die ihren Ursprung nicht in der Sympathie hatte und die er sich sonst, jedem anderen Menschen gegenüber, wohl selbst verargt hätte. Aber ein Konventsmitglied stand für ihn gewissermaßen außerhalb des Gesetzes, sogar außerhalb des Gebots der Liebe. Der alte G. mit seiner Ruhe, seiner fast aufrechten Haltung und kräftigen Stimme war einer jener imposanten Achtzigjährigen, die den Physiologen in Erstaunen setzen. Die Revolution hat viele Menschen hervorgebracht, die das Format ihrer großen Zeit hatten. Man spürte, daß dieser Greis seinen Mann gestanden hatte. Noch an der Schwelle des Todes hatte er seine männliche Kraft bewahrt. Sein klarer Blick, seine feste Sprache, sein kräftiges Achselzucken konnte den Tod in Verlegenheit setzen. Asrael, der Todesengel der Mohammedaner, wäre vor seiner Schwelle umgekehrt und hätte geglaubt, er stehe vor einer falschen Tür. G. schien zu sterben, weil er selbst einverstanden war. Auch sein Todeskampf hatte etwas Freiwilliges, Selbstgewolltes. Nur die Beine waren unbeweglich. Sie waren tot und kalt, während der Kopf noch in voller Kraft lebte, sie waren bereits ergriffen vom Reich der Schatten, während das Haupt noch in das Licht ragte. In diesem Augenblick glich G. jenem König aus dem orientalischen Märchen, dessen Oberkörper Fleisch, dessen Unterkörper aber Marmor ist.
Eine Steinbank war da, der Bischof setzte sich. Unvermittelt begann er zu sprechen.
»Ich beglückwünsche Sie«, sagte er nicht ohne Vorwurf, »denn Sie haben wenigstens nicht für den Tod des Königs gestimmt.«
Das Konventsmitglied schien den bitteren Beigeschmack des Wortes »wenigstens« nicht zu beachten. G. lächelte nicht mehr, als er sagte:
»Beglückwünschen Sie mich nicht zu voreilig, mein Herr: ich habe für den Tod des Tyrannen gestimmt.«
Das war hart gegen hart gesprochen.
»Was wollen Sie damit sagen?« fragte der Bischof.
»Daß der Mensch einen Tyrannen hat, die Unwissenheit. Gegen ihn habe ich gestimmt. Dieser Tyrann hat das Königtum, die verfälschte Autorität, ersonnen. Aber die Wissenschaft ist die wahre Autorität. Nur von ihr darf der Mensch sich führen lassen.«
»Und von seinem Gewissen«, fügte der Bischof hinzu.
»Das ist dasselbe. Das Gewissen ist jener Teil der Wissenschaft, der uns angeboren ist.«
Etwas erstaunt hörte der Bischof Bienvenu diese Sprache, die ihm neu war.
»Was Ludwig XVI. betrifft«, fuhr das Konventsmitglied fort, »so habe ich gegen seinen Tod gestimmt. Ich halte es nicht für mein Recht, Menschen zu töten, aber es ist meine Pflicht, das Übel auszurotten. Ich habe für den Tod des Tyrannen gestimmt, für das Ende der Prostitution der Frauen, der Sklaverei der Männer, der Unwissenheit der Kinder. Das war mein Ziel, als ich für die Republik stimmte, für Brüderlichkeit, Eintracht, Aufstieg! Ich wollte mitwirken am Sturz der Vorurteile und Irrtümer. Ihre Vernichtung soll uns das Licht bringen. Wir haben die alte Weltordnung gestürzt, dieses Gefäß allen Elends, und so ist aus ihr eine Freudenurne geworden.«
»Die Freude war gemischt«, meinte der Bischof.
»Sie mögen sagen, sie war getrübt; und heute, nach jener verhängnisvollen Wiederkehr des Vergangenen, ist sie vollends verschwunden. Ach, das Werk ist unvollendet, ich gebe es wohl zu. Wir haben das alte Regime zerstört, aber die Ideen, auf denen es fußte, konnten wir nicht unterdrücken. Es genügte nicht, den Mißbrauch abzuschaffen. Eine neue Gesittung mußte entwickelt werden. Die Mühle ist nicht mehr, aber noch immer weht derselbe Wind.«
»Sie haben zerstört. Das mag nützlich sein, aber ich mißtraue einer Zerstörung, die aus dem Zorn entsteht.«
»Auch das Recht kennt den Zorn, mein Herr; der Zorn beleidigten Rechtsgefühls ist ein Element des Fortschritts. Man mag sagen, was man will, die französische Revolution ist seit dem Erscheinen Christi der gewaltigste Schritt, den das Menschengeschlecht vorwärts getan hat. Sie hat alles soziale Unrecht ausgeglichen. Sie hat die Geister besänftigt. Sie hat beruhigt, versöhnt, aufgeklärt. Sie hat der ganzen Erde den Stempel ihrer Zivilisation aufgedrückt. Sie war gütig. Sie ist die Heiligung des Menschenbegriffs.«
»Und dreiundneunzig?«
Mit erhabener Feierlichkeit richtete sich das Konventsmitglied in seinem Stuhle auf und rief, so laut ein Sterbender zu sprechen vermag:
»Ach, da wären Sie also! 1793! Darauf habe ich gewartet! Oh, fünfzehn Jahrhunderte lang hat diese Wolke sich zusammengeballt, dann ist sie geborsten, und nun klagt ihr den Blitz an.«
Vielleicht fühlte der Bischof, ohne sich selbst dessen ganz bewußt zu werden, daß etwas in ihm unsicher wurde. Aber er bewahrte Haltung.
»Der Richter spricht im Namen der Gerechtigkeit, der Priester im Namen des Mitleids, das nur eine höhere Gerechtigkeit ist. Der Blitz darf sich nicht irren. Wie steht es mit Ludwig XVII.?«
Das Konventsmitglied streckte die Hand aus und ergriff den Arm des Bischofs.
»Ludwig XVII.? Nun, wen beklagen Sie? Das unschuldige Kind? Gut, ich beklage es mit Ihnen. Das Königskind? Das wäre zu erwägen. Für mich ist der Bruder des Cartouche, dieses unschuldige Kind, das auf dem Grèveplatz an den Achseln aufgehängt wurde, bis es starb, nur weil es eben der Bruder jenes Cartouche war, nicht minder beklagenswert als der Enkel jenes Ludwig XV., dieses unschuldige Kind, das im Temple zu Tode gemartert wurde, eben weil es der Enkel jenes Ludwig XV. war.«
»Mein Herr«, sagte der Bischof, »ich liebe es nicht, daß Sie diese Namen in einem Atem nennen.«
»Cartouche? Ludwig XV.? Welchen von beiden bevorzugen Sie?«
Eine Pause trat ein. Der Bischof bedauerte fast, hierhergekommen zu sein, und doch fühlte er sich seltsam berührt und ergriffen.
»Ja, mein Herr«, fuhr das Konventsmitglied fort, »Sie lieben nicht die Härte der Wahrheit. Christus … der liebte sie. Der nahm eine Geißel und trieb das Pack aus dem Tempel. Seine Geißel sagte rauhe Wahrheiten. Wenn er sagte, sinite parvulos, lasset die Kindlein zu mir kommen, so machte er zwischen den Kindern keinen Unterschied. Ihm war es nicht peinlich, den Jungen des Barabbas und den des Herodes einzuladen. Die Unschuld, mein Herr, krönt sich selbst. Sie bedarf keiner Auszeichnung. Sie ist an sich erhaben, herrlich – ob sie in Lumpen gekleidet ist oder in Seidengewänder, die mit den königlichen Lilien geschmückt sind.«
»Das ist wahr«, sagte der Bischof leise.
»Einen Augenblick«, sagte das Konventsmitglied, »Sie erwähnten Ludwig XVII. Verstehen wir uns richtig: sind es die Unschuldigen, alle die kleinen Märtyrer, die niedrigen und die hohen, die wir beklagen? Wenn es so ist, dann will ich einstimmen. Gut, aber dann dürfen wir nicht bei 1793 stehenbleiben, unsere Tränen müssen früher einsetzen. Ich will mit Ihnen die Kinder der Könige beklagen, wenn Sie mit mir einstimmen in die Klage um die Kinder des Volkes.«
»Ich beklage alle«, sagte der Bischof.
»Gut«, rief G., »und wenn die Waagschale sich senken soll, dann sei es auf der Seite des Volkes, denn es leidet seit längerer Zeit.«
Wieder trat eine Pause ein. Das Konventsmitglied brach sie. Der Greis stützte sich auf den Ellbogen, kniff mit Daumen und Zeigefinger eine Falte in seine Wange, wie man es wohl mechanisch tut, wenn man einen anderen verhört, und stellte den Bischof streng zur Rede.
»Ja, mein Herr, seit langem leidet das Volk. Sie aber kommen zu mir und sprechen mir von Ludwig XVII. Ich kenne Sie nicht. Seit ich in dieser Gegend lebe, bin ich einsam, setze meinen Fuß nicht vor meine Schwelle, sehe niemand als diesen Jungen, der mir hilft. Wohl ist Ihr Name zu mir gedrungen, ich muß sagen, er klang nicht übel, aber das beweist nichts. Geschickte Leute haben es nicht schwer, dem braven Volk etwas glaubhaft zu machen. Übrigens, ich habe Ihre Equipage nicht vorfahren gehört, Sie haben sie wohl da hinter dem Wald, am Kreuzweg stehengelassen? Ich kenne Sie nicht, sage ich Ihnen. Sie erklären, Sie seien der Bischof, aber das gibt mir für Ihre moralische Persönlichkeit keine Gewähr. Darum wiederhole ich meine Frage. Wer sind Sie? Sie sind ein Bischof, ein Kirchenfürst, einer dieser mit stattlichen Renten ausgestatteten Herren, denen es nicht an fetten Pfründen fehlt, Sie haben als Bischof von Digne fünfzehntausend Franken Gehalt und zehntausend Franken Nebeneinkünfte, also zusammen fünfundzwanzigtausend Franken! Sie gehören zu jenen, die eine gute Küche führen, denen es an livrierten Dienern nicht fehlt, die freitags Wasserhühner essen, die in einer Galakutsche, Lakaien hintenauf, einherfahren – und das im Namen Jesu Christi, der barfuß ging. Sie sind ein Prälat. Renten, Palast, Pferde, Diener, einen guten Tisch, alle Annehmlichkeiten des Lebens, all das genießen Sie, aber das sagt mir nur wenig. Über Ihren inneren, wesentlichen Wert weiß ich nichts, obwohl Sie doch zu mir gekommen sind, um mir die Tröstungen der Weisheit zu bringen. Mit wem spreche ich? Wer sind Sie?«
Der Bischof senkte den Kopf und sagte:
»Vermis sum.«
»Ein Erdenwurm, der in der Karosse fährt«, murmelte das Konventsmitglied. Jetzt war der alte Rebell herrisch und der Bischof demütig.
»Mein Herr«, sagte der Bischof, »sagen Sie mir doch, wieso meine Equipage, die dort hinter den Bäumen wartet, mein wohlbestellter Tisch mit den Wasserhühnern, die ich freitags esse, und meine Rente von fünfundzwanzigtausend Livres, wieso schließlich mein Palast mit meinen Lakaien beweist, daß das Mitleid keine Tugend, die Milde keine Pflicht und das Jahr 93 nicht verabscheuungswürdig ist?«
Das Konventsmitglied strich sich über die Stirn, wie um eine Wolke zu verscheuchen.
»Bevor ich Ihnen antworte, bitte ich Sie um Verzeihung. Ich tat unrecht, mein Herr. Sie sind hier in meinem Hause, Sie sind mein Gast. Ich bin Ihnen Höflichkeit schuldig. Sie erörtern meine Gedanken, also habe ich mich darauf zu beschränken, Ihre Argumente zu bekämpfen. Ihr Reichtum und Ihr behagliches Leben bieten mir im Kampf einen Vorteil, den ich nicht benützen darf. Es wäre gegen den guten Geschmack. Ich verspreche Ihnen, es in Zukunft nicht mehr zu tun.«
»Ich danke Ihnen«, sagte der Bischof.
»Gut, Sie sagen also, das Jahr 93 sei verabscheuungswürdig? Wir seien erbarmungslos gewesen?«
»Erbarmungslos, das ist es. Was halten Sie von Marat, der in die Hände klatschte, als er die Guillotine sah?«
»Und was halten Sie von Bossuet, der die Protestantenmetzeleien mit einem Tedeum feierte?«
Diese Antwort war hart, aber sie traf scharf wie eine Degenspitze. Der Bischof fuhr zusammen und fand keine Erwiderung. Es war ihm schmerzlich, Bossuet in diesem Zusammenhang nennen zu hören. Auch die besten Geister haben ihren Fetisch und fühlen sich verletzt, wenn die Logik mit ihnen respektlos umspringt.
Der alte Revolutionär begann schwer zu atmen; die Atemnot des Todeskampfs würgte ihn in der Kehle; noch immer strahlte das Licht in seinen Augen.
»Wir können noch ein wenig sprechen. Sie verabscheuen das Jahr 93 und finden es erbarmungslos, aber wie war die Monarchie? Oh, ich beklage das Schicksal Marie Antoinettes, aber auch jene arme Hugenottin verdient mein Mitleid, die 1685 unter Ludwig dem Großen, obwohl sie noch ihr Kind nährte, nackt bis zum Gürtel an einen Pfahl gebunden und vor die Wahl gestellt wurde, ihr Kind vor ihren Augen töten zu lassen oder gegen ihr Gewissen ihrem Glauben abzuschwören. Wie beurteilen Sie diese einer Mutter bereitete Tantalusqual? Mein Herr, beachten Sie es wohl, die französische Revolution hatte ihren großen Sinn. Die Zukunft wird die Verirrungen ihres Zorns entschuldigen, denn ihr Ergebnis war eine Verbesserung der Welt. Sie hat grausam zugeschlagen, aber sie hat dem Menschengeschlecht Wohltaten erwiesen. Doch ich will nicht weitersprechen, ich bin es allzu leid, und der Tod ist nahe.«
Er ahnte nicht, daß er Schritt für Schritt die inneren Verschanzungen des Bischofs gestürmt hatte. Eine nur blieb ihm noch, ein letzter Hort des Widerstandes.
»Der Fortschritt muß an Gott glauben«, sagte er. »Das Gute verträgt keine unfrommen Diener. Der Atheist ist ein schlechter Führer des Menschengeschlechts.«
Der alte Volksvertreter antwortete nicht. Ein Zittern durchschauerte ihn. Er blickte zum Himmel auf, und eine Träne trat in sein Auge. Fast stammelnd, den Blick in die Tiefe des Himmels gesenkt, flüsterte er:
»O du, Ideal, nur du bist!«
Der Bischof empfand eine unaussprechliche Erschütterung.
Nach einem Schweigen wies der Greis zum Himmel hinauf und sagte:
»Es gibt eine Unendlichkeit dort droben. Wenn sie von keinem Ich belebt wäre, wäre das Ich ihre Begrenzung; sie wäre nicht mehr unendlich; mit anderen Worten, sie wäre nicht mehr. Aber sie ist. Darum gibt es ein Ich in ihr, das Ich der Unendlichkeit – Gott!«
Der Sterbende hatte diese letzten Worte mit erhobener Stimme gesprochen, in ekstatischer Verzückung, als ob er jenes höhere Wesen erschaue. Als er ausgesprochen hatte, schlossen sich seine Augen. Die Anstrengung hatte ihn erschöpft. Offenbar hatte er in einer Minute die Kraft verbraucht, die ihm verblieben war. Seine Worte hatten ihn jenem genähert, der im Tode ist. Der letzte Augenblick war nahe.
Der Bischof begriff; als Priester war er hierhergekommen, war von kalter Ablehnung stufenweise bis zu höchster Rührung gelangt; jetzt nahm er diese zerfurchte, eisige Hand und beugte sich über den Sterbenden.
»Dies ist die Stunde Gottes. Wäre es nicht beklagenswert, wenn wir einander vergeblich begegnet wären?«
Der Revolutionär blickte auf. Ernst, den Mißmut überschattete, lag auf seiner Stirn.
»Herr Bischof«, sagte er mit einer Langsamkeit, die vielleicht mehr seiner Würde als der Schwäche seiner Todesstunde entsprang, »mein ganzes Leben war dem Studium und der Betrachtung gewidmet. Sechzig Jahre war ich alt, als mein Vaterland mich rief und befahl, daß ich mich in seine Angelegenheiten mische. Ich habe gehorcht. Ich sah Mißbräuche und bekämpfte sie. Ich sah Tyrannei, und ich habe sie niedergerungen. Für Recht und Gesittung habe ich gekämpft. Unser Land war vom Feinde bedrückt, ich habe es verteidigt. Frankreich war bedroht, ich habe mein Leben eingesetzt. Ich war nicht reich, und ich bin jetzt arm. Ich war einer der Führer des Staates, die Schatzkammern waren gefüllt mit Gold und Silber, so daß wir die Mauern stützen mußten, aber ich aß zu Mittag für zweiundzwanzig Sous in der Rue de l’Arbre-Sec. Ich habe den Unglücklichen geholfen, habe die Bedrückten aufgerichtet. Wenn ich Altartücher zerriß – und das habe ich getan –, so geschah es, um die Wunde des Vaterlandes zu verbinden. Sooft das Menschengeschlecht dem Licht entgegenstrebte, war ich auf seiner Seite. Wenn der Fortschritt erbarmungslos war, stellte ich mich ihm entgegen. Es geschah, daß ich meine eigenen Feinde, Leute von euch, beschützte. In Peteghem, in Flandern, dort, wo die Könige aus dem Merowingergeschlecht den Winterpalast hatten, gibt es ein Kloster der Urbanistinnen, die Abtei der Ste. Claire en Beaulieu – die habe ich 1793 gerettet. Ich tat meine Pflicht, so gut ich konnte. Man hat mich verjagt, gehetzt, verfolgt, böser Dinge bezichtigt, verleumdet, verflucht, proskribiert. Seit vielen Jahren schon sehe ich, ein Greis mit weißen Haaren, wie viele Leute auf mich verächtlich herabblicken, der armen, unwissenden Menge bin ich ein Gezeichneter; gut, ich nehme mein Schicksal an, ich hasse niemand. Aber jetzt zähle ich sechsundachtzig Jahre und werde sterben. Was wollen Sie noch von mir?«
»Ihren Segen«, sagte der Bischof. Er kniete nieder.
Als er aufblickte, hatte das Antlitz des Konventsmitglieds einen erhabenen Ausdruck angenommen. Der Greis war tot.
Eine Einschränkung
Es wäre verfehlt, wollte man aus dem Gesagten schließen, Monsignore Bienvenu sei ein »philosophisch veranlagter Geistlicher« oder ein »patriotischer Pfarrer« gewesen. Seine Begegnung mit dem Konventsmitglied G. hatte ihn in Staunen versetzt und noch weicher gestimmt als je. Das war alles.
Obwohl Monsignore Bienvenu kein Mann der Politik war, muß vielleicht an dieser Stelle doch in aller Kürze gesagt werden, wie er zu den Ereignissen seiner Zeit Stellung nahm.
Gehen wir einige Jahre zurück.
Kurz nach seiner Ernennung zum Bischof hatte der Kaiser Herrn Myriel zum Baron erhoben, zugleich mit einigen anderen Bischöfen. Wie bekannt, wurde der Papst in der Nacht vom 5. auf den 6. Juli 1809 verhaftet. Bei dieser Gelegenheit wurde Myriel von Napoléon in die Synode der französischen und italienischen Bischöfe berufen, die in Paris zusammentreten sollte. Diese Synode tagte in Notre-Dame und trat am 15. Juni 1811 unter dem Vorsitz des Kardinals Fesch zusammen. Myriel war einer der fünfundneunzig Bischöfe, die an dieser Sitzung teilnahmen. Er erschien noch drei- oder viermal bei den Sitzungen, aber als Bischof einer Diözese im Hochland, als Mensch, der fast unmittelbar in der Natur lebte, an ländliche Sitten gewohnt, brachte er in diese Gesellschaft erhabener Herren Ideen mit, die dort peinlich auffielen. Er wurde bald nach Digne zurückgeschickt. Man fragte ihn, warum er so rasch heimgekehrt sei, und er sagte:
»Ich war ihnen peinlich. Die Luft der Außenwelt kam mit mir in den Saal. Ich war ihnen unangenehm wie eine offene Tür. Was wollen Sie, diese Herren sind Fürsten, ich bin nur ein armer Bauernbischof.«
Er hatte in der Tat Mißfallen erregt.
Da wir nichts verheimlichen wollen, müssen wir hinzufügen, daß er Napoléons Niedergang kalt aufnahm. Seit 1813 nahm er an den gegen den Kaiser gerichteten Kundgebungen teil und spendete ihnen Beifall. Als Napoléon von der Insel Elba zurückkehrte, wollte der Bischof ihn nicht besuchen und weigerte sich, während der Hundert Tage in den Kirchen für den Kaiser beten zu lassen.
Außer seiner Schwester, Fräulein Baptistine, hatte er noch zwei Brüder; der eine war General, der andere Präfekt. Er stand mit ihnen in lebhaftem Briefwechsel. Zu dem ersteren aber hatte er einige Zeit lang die Beziehungen abgebrochen, weil er nach Napoléons Landung in Cannes an der Spitze von zwölfhundert Mann, die den Kaiser verfolgen sollten, es so angestellt hatte, daß Napoléon ihm entwischte. Mit dem anderen Bruder, dem ehemaligen Präfekten, einem wackeren und würdigen Manne, der in Paris lebte, wechselte er freundschaftliche Briefe.
Im übrigen war er in allen Dingen gerecht, wahr, klug, bescheiden und würdig. Ein guter Priester, ein Weiser und ein Mann. Auch in seinen politischen Ansichten war er – von jener Einzelheit abgesehen, die wir berichteten und die wir hart verurteilen – tolerant und einsichtsvoll, vielleicht mehr als wir.
Der Torwart des Stadthauses war vom Kaiser in Amt und Würden eingesetzt worden. Es war ein ausgedienter Unteroffizier der alten Garde, einer, der Austerlitz mitgemacht und dort das Kreuz der Legion bekommen hatte, Bonapartist vom Scheitel bis zur Sohle. Gelegentlich entschlüpften diesem armen Teufel unbedachte Äußerungen, die damals als aufrührerische Reden bewertet wurden. Seit das Bildnis des Kaisers von dem Kreuz der Ehrenlegion entfernt worden war, trug er nie mehr Uniform, um nicht das Kreuz anlegen zu müssen. Er hatte das kaiserliche Bildnis ehrfürchtig aus dem Kreuz entfernt, das Napoléon ihm selbst an die Brust geheftet hatte, aber die freie Stelle ließ er leer. »Lieber sterben«, sagte er, »als die drei Kröten auf meinem Herzen tragen.«
Oft machte er sich laut über Ludwig XVIII. lustig.
»Wenn der Alte mit seinem Podagra doch zum Teufel ginge! Wenn er sich doch mit seinen englischen Gamaschen und seiner Perücke zu den Preußen scheren möchte!« So verstand er es, in einem einzigen Fluch die beiden Dinge zu vereinen, die er auf der Welt am meisten verabscheute, England und Preußen. Er trieb es so toll, daß er aus seinem Amt gejagt wurde. Jetzt lag er brotlos mit Weib und Kindern auf der Straße. Der Bischof ließ ihn kommen, schalt ihn milde aus und machte ihn zum Türhüter der Hauptkirche. So war er in neun Jahren dank seinen frommen Handlungen und seinem gütigen Verfahren in ganz Digne Gegenstand zärtlicher Verehrung. Sogar sein Verhalten gegen Napoléon wurde von dem Volk, das seinen Kaiser anbetete, aber auch seinen Bischof liebte, verziehen und schweigend übergangen.