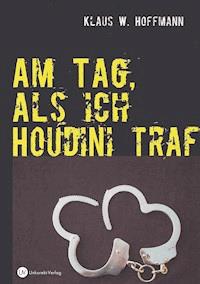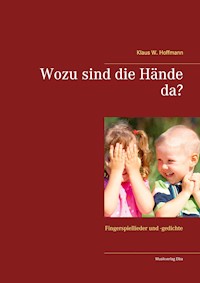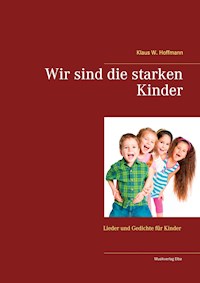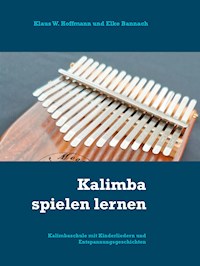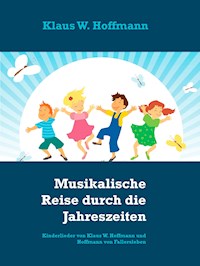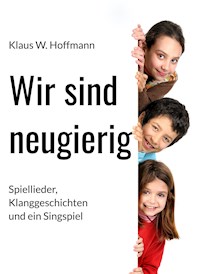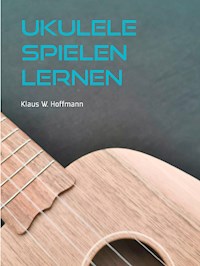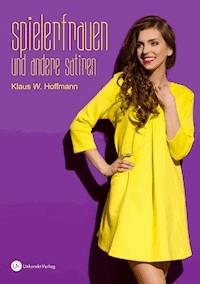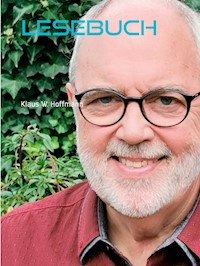
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Lesebuch enthält eine Auswahl Texte des literarischen Schaffens des Klaus W. Hoffmann. Es sind Satiren, Erzählungen und Romanauszüge aus Büchern, die er für jugendliche und erwachsene Leserinnen und Leser in den vergangenen 20 Jahren geschrieben hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Lesebuch
TitelseiteÜber den AutorVorwortFormen der LyrikDie Pyro-ShowPausenSpielerfrauenHelges LebenDie eitle KlobürsteDer kleine LieblingIhr HoroskopStartverzögerungWeginsjenseitsGefährliches OpferDie BefreiungAusbruch aus der TodeszelleFahnenfluchtDer FreispruchDer geheimnisvolle NovizeImpressumLesebuch
Klaus W. Hoffmann
Über den Autor
Ich bin seit 1981 als freiberuflicher Autor und Liedermacher tätig. In dieser Zeit schrieb ich Romane, Novellen, Erzählungen und Lieder, die in Büchern, auf Tonträgern, im Rundfunk, im Fernsehen („Sendung mit der Maus“) und auf Youtube-Kanälen veröffentlicht wurden.Ich erhielt im Laufe der Jahre einige Auszeichnungen, wie z.B. den „Deutschen Schallplattenpreis der Fachkritik“ für Hörbücher. Ich bin Mitglied im PEN, im VS, im FBK, in der Gema und in der VG Musikedition. Mehr über mich auf meiner Wikipedia-Seite!
Vorwort
Dieses Lesebuch enthält eine Auswahl Texte meines literarischen Schaffens der vergangenen 20 Jahre. Es sind Satiren, Erzählungen und Romanauszüge aus Büchern, die ich für jugendliche und erwachsene Leserinnen und Leser geschrieben habe. „Bilanz ziehen“ nennt man solch ein Vorhaben auch, aber es muss nicht unbedingt eine „Schlussbilanz“ sein.
Ich habe die Auswahl der Texte für dieses E-Book selbst zusammengestellt und mich nicht mit den Verlegern, die das eine oder andere Buch, aus dem die Texte stammen, mit mir herausgebracht haben, abgestimmt. Ich hoffe, das ist mir gelungen.
Und weil ich das so entschieden habe, wollte ich mein Lesebuch auch als Self-Publisher veröffentlichen. Korrektorat war manchmal nötig, weil nach der Reform der deutschen Rechtschreibung von 1996 zahlreiche Aktualisierungen erfolgt sind. Für die Gestaltung des Buchblocks und des Covers nahm ich die Hilfe der Self-Publishing-Plattform BoD in Anspruch. BoD führte auch die Herstellung und die Publikationsdienstleistungen durch.
In meinem Lesebuch fehlen Geschichten, Lieder, Hörspiele, Theaterstücke und Gedichte, die ich im Laufe von 46 Jahren für Kinder geschrieben habe. Grund: Eine Mischung dieser Texte mit den Lesebuch-Texten schien mir nicht sinnvoll zu sein.
Viel Freude beim Schmökern in meinem Lesebuch!
Klaus W. Hoffmann
Formen der Lyrik
Der Chefredakteur des Salzland-Kuriers hatte mich gestern Abend schon zum dritten Mal zur Kreisvolkshochschule geschickt. Ich sollte wieder mal über den Kurs „Formen der Lyrik“ berichten. Seine Frau nahm daran teil.
Zehn Minuten vor Kursbeginn traf ich im Raum 7 der VHS ein. Bis auf den Referenten Rolf Meyer war noch niemand anwesend. Ich begrüßte ihn. Er äußerte sich darüber erfreut, dass der Salzland-Kurier nun schon zum dritten Mal über seinen Kurs berichten würde. Das hätte er noch nie erlebt. „Ich auch nicht“, stimmte ich ihm zu.
Meyer erzählte mir, dass sie in der vergangenen Woche den Schlagertext als lyrische Form besprochen hätten und dass er einige beliebte Texte dieser Art vorgestellt habe. Am heutigen Abend sollten die sechs verbliebenen, von anfangs zwölf Teilnehmern des Kurses, jeweils Inhalt und Aufbau eines Schlagers besprechen.
Ich setzte mich auf einen der Stühle, die an drei aneinandergestellten Tischen standen. Als erste Kursteilnehmerin erschien die Frau unseres Chefredakteurs Moser. Sie begrüßte mich flüchtig und verwickelte dann den Referenten in ein Gespräch.
Frau Moser war immer sehr eifrig bei der Sache, wusste alles besser und korrigierte oft auch den Referenten. Kritik an ihren Texten ließ sie nicht gelten. Mit dem ältesten Kursteilnehmer, dem 85-jährigen Bollstädt, sprach sie kein Wort mehr. Warum? Weil er vor einigen Wochen ihre Ballade von den Kupferkabeldieben, im Stile von Schillers Glocke, als dämlichen Schmarren bezeichnet hatte. An diesem Abend war ich als Journalist dort anwesend.
Frau Moser hatte zitiert: „Es verschwanden riesengroße Stapel allerwertvollsten Kupferkabels. Haben die Diebe denn kein Gewissen? Sie wissen doch, dass sie büßen müssen.“ Bollstädts Kommentar dazu: „Dümmer geht’s nümmer!“
Bollstädt hatte auch nach dem Abend, der unter dem Motto stand „Wir schreiben einen „Gangsta-Rap“, herausgefunden, dass der Text der jüngsten Kursteilnehmerin, Tanja Kallmeyer, nicht von ihr stammte, sondern vom Rapper DJ Knastking: Wenn du hier bist, du Spast, überleg, was du machst. Leg dich nicht mit mir an, sonst bist du dran …
Der Referent wollte, nachdem Bollstädt die Plagiatsvorwürfe belegen konnte, Tanja Kallmeyer vom Kurs ausschließen. Das verhinderten aber die Teilnehmer Bär und Spiegel, die beide ein Auge auf die attraktive Tanja geworfen hatten. Es wurde abgestimmt und das Mädchen bekam eine zweite Chance. Sie schrieb einen Gangsta-Rap im Stile einer Hasspredigt aus der Neuköllner Al-Nur-Moschee und trug ihn im Kreis der Kursteilnehmer vor.
Der alte Bollstädt hatte keine Lust mehr, nachzuprüfen, ob auch dieser Text geklaut war. Er sagte aber: „Die Zeilen habe ich irgendwo schon einmal gelesen.“
Ich war gespannt, was mich am heutigen Abend erwarten würde. Der Raum füllte sich, und nachdem alle sechs Kursteilnehmer ihre Plätze eingenommen hatten, stellte der Referent das Motto des Abends vor: Inhalt und Aufbau eines Schlagers.
Tanja Kallmeyer besprach Wencke Myrhes Lied „Er hat ein knallrotes Gummiboot“. Ich hatte nicht gedacht, dass dieser Text ein Kleinod der Dichtkunst ist. Aber Tanja Kallmeyer hat mich davon überzeugt.
Der alte Bollstädt besprach Christ Roberts Text „Du kannst nicht immer siebzehn sein“, Frau Mahler-Ronstadt „Splitternackt“ von Andrea Berg und Toni Bär Karel Gotts „Biene Maja“.
Jens Spiegel entschuldigte sich dafür, dass er seine Textbesprechung des Liedes „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ von den Flippers noch nicht vortragen könne, weil er ihn nicht ausdrucken konnte. Er müsse erst neue Druckerpatronen kaufen.
Und dann kam der Höhepunkt des Abends: Frau Mosers Besprechung des Textes „Marmor, Stein und Eisen bricht“. Ich musste sehr aufmerksam sein, denn mein Chefredakteur erwartete von mir, dass ich den Text seiner Frau in meinem Zeitungsartikel ausreichend und sehr positiv einbauen würde.
Frau Moser erhob sich und las: „Der Dichter Drafi Deutscher hat den Text seines Werkes ,Marmor, Stein und Eisen bricht‘ so angelegt, dass jeder vierzeiligen Strophe ein ebenfalls vierzeiliger Refrain folgt. Warum? Weil er dieses Meisterwerk der Dichtkunst vertonen und als Lied, über Schallplatten und CD, vor allem bildungsfernen Menschen vermitteln wollte. So kam es dann auch. Aber schauen wir uns mal den Aufbau seiner Vierzeiler näher an. Den Refrain hat er geschickt als Paarreim aufgebaut. Raffiniert hat Deutscher aber nicht auf das Reimwort der Zeile drei, ‚vorbei‘, ,einerlei‘ oder ,hart wie Blei‘ gereimt, sondern unrein ,uns treu‘. Genial!
Marmor, Stein und Eisen bricht,
aber unsere Liebe nicht.
Alles, alles geht vorbei,
doch wir sind uns treu.
In der ersten Zeile des Refrains setzt sich der Dichter Deutscher gekonnt über die Regeln der deutschen Grammatik hinweg. Er textet nicht ,Marmor, Stein und Eisen brechen‘, sondern ,Marmor, Stein und Eisen bricht‘. Die Liebe bricht nicht. Sie hält.
Nur so kann er in der zweiten Zeile das so wichtige Reimwort ,nicht‘ platzieren. In den folgenden Zeilen bringt er zum Ausdruck, dass ,unsere Treue‘ alles überdauern wird – auch das Ende des Seins.
Am Ende des Gedichts wird der Refrain wiederholt. Vor der Wiederholung baut der Dichter ein ,Everybody now!‘ ein. Was soll diese Aufforderung bedeuten? Sie richtet sich an alle Menschen, diesen genialen Refrain mitzusingen.
In den Strophen des Gedichtes reimen sich die Zeilen A und C. In die Zeilen B und D hat der Dichter gekonnt den Namen der von ihm angesprochenen Schönen platziert: Dam Dam!
Wenden wir uns nun der ersten Strophe zu: Weine nicht, wenn der Regen fällt, Dam Dam, Dam Dam. Es gibt einen, der zu dir hält, Dam, Dam, Dam Dam. Der Dichter weiß, dass der Regen das Mädchen Dam Dam zum Weinen bringt. Er bittet sie, nicht zu weinen. Und wenn, dann verspricht er ihr nicht, sie trockenzuhalten, sondern zu ihr zu halten. So als wollte er sagen: Lass es geschehen, lass die Tränen, raus, aber nur, wenn der Regen fällt. Ich halte zu dir. Der Dichter macht dem Mädchen klar, dass es zwar dumm ist, wenn es regnet in Tränen auszubrechen, dass er aber trotzdem zu ihr hält. Genial!
In der zweiten Strophe versucht Deutscher dem Mädchen Dam Dam klarzumachen, dass es auch nicht allein ist, wenn er mal nicht bei ihr sein kann. Er versucht ihr das Gefühl zu vermitteln, dass sie ihn spüren, hören, sehen und riechen kann – durch Visualisierung.
In der dritten Strophe bietet der Dichter dem Mädchen Dam Dam einen goldenen Ring an. Der Ring kann sprechen. Immer wenn sie traurig ist, soll er ihr sagen: Dam Dam. Ihren Namen! Worte des Trostes. Fazit: ,Marmor, Stein und Eisen bricht‘ ist wahrlich ein Meisterwerk der deutschen Lyrik.“
Der alte Bollstädt meinte: „Diesen ausgemachten Schwachsinn kann man doch nicht zum Meisterwerk der deutschen Lyrik hochjubeln.“
„Natürlich“, rief Frau Mahler-Ronstadt. „Zu diesem Lied habe ich früher immer so gern getanzt.“
Während dieser Diskussion verließ ich den Raum 7 der VHS. Ich überlegte ernsthaft, ob ich nicht den Beruf wechseln und Schlagersänger werden sollte. Meine gesanglichen Fähigkeiten waren zwar etwas unterentwickelt, doch auch bei den Volkslieblingen der seichten Liedchen schienen sie nicht viel besser zu sein. Meinen Namen Achim Großknecht müsste ich natürlich durch einen Künstlernamen ersetzen. In dieser Branche war ja auch vor allem die Wirkung auf das weibliche Geschlecht wichtig. Aber als ich mich dann im Spiegel anschaute, dachte ich, dass ich mit meinem Aussehen in der Schlager-Szene wohl keine Aussicht auf Erfolg hätte.
aus: „Spielerfrauen und andere Satiren, Unkorekt-Verlag, E-Book: Thalia u.a.“
Die Pyro-Show
Der Ultra ist ein besonderes Exemplar aus der Gattung der Fußballfans. Bleibt er allein, verkümmert er. Lebt er im Rudel, dann blüht er auf und versprüht viel Lebensfreude.
„Wir sind der Verein“, sagt der Ultra und weiß dass die anderen Ultras, seine Meinung teilen. In den Ohren der Vereinsoberen klingt dieser Spruch aber wie eine Drohung.
Den Ultra erkennt man daran, dass er, als Protest gegen die Kommerzialisierung des Fußballs, nicht die herkömmlichen Fan-Utensilien seines Vereins trägt. Er kleidet sich gern mit einem Polohemd, einem Sweatshirt, oder einem T-Shirt, liebt auch Kappen und Schals, die mit Logos oder den Schriftzügen seines Ultra-Rudels verziert sind. Ultra zu sein, ist für ihn eine Lebenseinstellung. Während eines Bundesligaspiels macht er als Teil seines Rudels vor allem durch das Schwenken riesiger Blockfahnen und das Zünden von Pyrotechnik auf sich aufmerksam. Auch seine gesanglichen Leistungen sind im Chor herausragend. Es geht einem das Herz auf, wenn das „Ohöh, ohöh, ohöh, ohöh“ des Ultra-Chores durch das Stadion schallt. Der Ultra tritt dann nicht immer als Chorknabe, sondern auch als Vorsänger mit Megaphon oder als Vortrommler in Erscheinung. Diesem Einpeitscher macht es nichts aus, dass er wenig vom Spiel sieht.
Der Ultra bastelt gern. Vor allem bengalische Fackeln. Diese pyrotechnische Wunderwerke versuche er, weil sie in den Stadien verboten sind, mit allen Tricks einzuschleusen.
Und wenn der Ultra dann während des Spiels die Pyro-Show inszeniert und das Ultra-Rudel in Rauchwolken gehüllt ist, ist er glücklich und denkt: „Das ist traditionelle Fankultur“.
Für den Ultra gehört zu dieser Fankultur auch das Bedrohen und Verprügeln missliebiger Artgenossen eines anderen Ultra-Rudels. Manchmal richtet er seine Aggressionen auch gegen Polizisten oder Spieler und Trainer des Vereins, mit dem er sympathisiert.
Der Ultra weiß, dass das Abbrennen von Bengalos in den Stadien verboten ist, setzt sich darüber aber oft hinweg. Er wird ja dafür meist nicht bestraft. Nur sein Verein muss mit einer Geldstrafe rechnen. Deshalb fordern viele Experten, das kontrollierte Abbrennen von Bengalos zu erlauben. Warum nicht?
Und so eine Aktion durfte ich, Achim Großknecht, als Sportreporter der GZ im Tipico-Sportwetten-Stadion erleben. Vor dem Anpfiff des Bundesligaspiels wurde von Feuerwehrleuten der Rasen des Spielfeldes mit einer feuersicheren Plane abgedeckt. Sie diente auch als Werbefläche für Tipico-Sportwetten mit dem Konterfei von Oliver Kahn.
Dann kündigte der Stadionsprecher die Pyro-Show an und interviewte den Leit-Ultra des Ultra-Rudels, der das Feuerwerk gestalten durfte. Er fragte ihn, ob die Feuerwerkskörper, die gleich entzündet werden sollen, auch bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung zugelassen worden seien und ob der Anzündende auch über eine Berechtigung verfüge. Ich hatte den Eindruck, dass der Leit-Ultra die Fragen nicht verstand. Er beantwortete sie aber mit „Ja“.
Danach eskortierten das Vereinsmaskottchen – eine Großfigur und zwei erfahrene Feuerwehrleute, den Leit-Ultra und die Feuerwerker seines Rudels auf das Spielfeld. Tanzende Cheerleader bildeten ein Spalier und schwangen ihre Wedel. Dazu tönte aus der heimischen Fankurve aus zigtausend Ultrakehlen das Lied „Kleine Fackel, brenn!“.
Dann zählte der Stadionsprecher von 10 rückwärts bis 0. Und die bengalischen Fackeln wurden entzündet. Heller Rauch hüllte das Spielfeld ein. Da ging mir das Herz auf. Unter dem tosenden, vom Stadionsprecher geforderten Beifall, verließen nach dieser Aktion der Leit-Ultra, sein Rudel und die Feuerwehrleute, angeführt vom Vereinsmaskottchen und umschwärmt von den tanzenden Cheerleadern, das Spielfeld.
aus: „Spielerfrauen und andere Satiren, Unkorekt-Verlag, E-Book: Thalia u.a.“
Pausen
Als Grundschulkinder haben wir Jungen uns vom langen Sitzen im Klassenzimmer auf dem Schulhof erholt. Die Erholung sah so aus, dass wir mit kleinen Bällen „Köppen“ spielten oder uns kurze Stöcke zuwarfen, die in Kreisen landen mussten – sogenannte Pinnchen.
Manchmal wenn die Lehrkraft, die Pausenaufsicht hatte und nicht so genau hinsah, prügelten wir uns auch gern. Die Mädchen vergnügten sich mit Kreis- und Reigen-Spielen und Hinkeln. So erholt, konnten wir wieder voll konzentriert am Unterricht teilnehmen.
Später, als ich beruflich in verschiedenen Zeitungsredaktionen tätig war, erlebte ich, dass sich Kollegen in der Mittagspause mit Skat und Poker von der Arbeit erholten.
Pausen dienen der Erholung. Ich sehe aber immer häufiger, dass sie mit Unterhaltung oder Werbung gefüllt werden. Im Fernsehen und auch in den Stadien.
Vor einiger Zeit las ich in einer Zeitung, dass die New York Giants die England Patriots mit 21:17 besiegt haben. Es war das Football-Endspiel um den Super Bowl 2012.
„Na und?“, fragt da der deutsche Fußball-Fan.
„Wen interessiert denn diese blöde Sportart?“
„Alle Amerikaner!“, kann da die Antwort nur lauten.
In Deutschland schenkt man den sportlichen Großereignissen des American-Football nur wenig Beachtung. Die Fernseh-Einschaltquote hierzulande läge sicher weit unter der von Rennrodel-Wettbewerben.
Die Berichterstattung über das Super-Bowl-Endspiel in deutschen Tageszeitungen stellte vor allem den Halbzeit-Auftritt der sogenannten „Queen of Pop“, Madonna, heraus. Sie soll, von zahlreichen Tänzerinnen begleitet, im Stile einer antiken Göttin in das mit fast 70.000 Zuschauern ausverkaufte Lucas-Oil-Stadion von Indianapolis eingezogen sein und die Zuschauer mit einer glitzernden Show begeistert haben. Sicher wünscht sich auch der eine oder andere deutsche Fußballvereins-Präsident so einen Halbzeitauftritt im heimischen Stadion.
Madonna, die für ihren zwölfminütigen Pausenauftritt, drei Millionen Dollar erhielt, dürfte allerdings als weiblicher Pausenclown für Bundesliga-Spiele zu teuer sein. Selbst wenn noch außerhalb der Halbzeit Werbeblöcke über die Stadion-Lautsprecher und Großleinwände laufen würden, wäre eine solche Gage für die Vereine unerschwinglich. Ob Madonnas musikalische Tanzshow deutsche Fußballfans zu Begeisterungsstürmen hinreißen würde, wäre auch noch nicht sicher.
Mit Show-Programmen in den Halbzeit-Pausen haben Bundesliga-Fußballvereine sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Im Dortmunder Signal-Iduna-Park habe ich vor einigen Jahren die „Ich-mach-mich zum-Affen-Spiele“ erlebt. Fans mit Chips-Kostümen liefen auf das Spielfeld. Sie mussten eine bestimmte Zahl auf einem Roulette-Feld erreichen, durften sich aber durch Rempeln, Schubsen und Beinstellen daran hindern. Das sollte die Zuschauer zu Lachsalven hinreißen, entlockte mir und den meisten anderen Stadionbesuchern aber nur einige ironische Bemerkungen oder ein Gähnen.
Ich erinnere mich auch noch an die Gesangs-Darbietungen einiger Ballermann-Troubadoure, die die Zuschauer mit ihrem furchtbaren Gesang genervt haben: Jürgen Drews und Co. Sie kamen nicht an. Einige wurden sogar ausgepfiffen, wie Heidi Klum, die ihre „Germany’s Next Topmodels“ in schwarzgelben Bikinis bei Minustemperaturen über die Mittelfeldlinie staksen ließ.
Eine Pausenshow im Fußballstadion muss ja nicht so, aber auch nicht wie beim Super-Bowl des Football, von Mega-Stars der Pop Musik gestaltet werden. Veranstalter von Musicals würden sich bestimmt freuen, wenn sie in der Spielpause die Gelegenheit hätten, Werbevorführungen für „Der König der Löwen“ oder „Ich war noch niemals in New York“ aufführen zu lassen. Musik und Tanz kommen immer gut an. Vor allem bei den Zuschauerinnen.
Auch an die kulturell interessierten Fans, die modernes Regietheater mögen, sollten die Vereinsoberen denken. Ich höre schon den Einwand: Das sind ja höchstens drei oder vier Stadionbesucher! Na gut, aber man kann auch Menschen aus kulturfernen Schichten an klassisches Ballett oder Musiktheater heranführen.
Solch eine Inszenierung wurde in der Targo-Arena als Pausenfüller vorgeführt. Der Chefredakteur der OZ, bei der ich zu der Zeit als Kulturjournalist tätig war, schickte mich dorthin, um darüber zu berichten.
Professionelle Tänzer und Tänzerinnen des städtischen Musiktheaters tanzten zu einer Techno-Version von Tschaikowskis Ballettmusik Schwanensee-Szenen. Eine Light-Show zauberte das Ufer des Schwanensees auf das Spielfeld und tauchte es in Mondlicht. Zauberhafte, nur mit Vereinsfarben bemalte, Schwanenmädchen traten aus dem Wasser und tanzten. Dann erschien der Prinz als Biathlet und versuchte auf sie zu schießen. Aber die Schwanenkönigin hinderte ihn daran und überreichte ihm einen Vereinsschal. Von ihrem Liebreiz und der Energie, die von dem Schal ausging, überwältigt, legte der Prinz seine Biathlon-Kleidung ab und schwor ihr und dem Verein ewige Treue. Dann tanzten der Prinz, die Schwanenkönigin und die Schwanenmädchen Pogo und animierten die Zuschauer, mitzutanzen. Das kam gut an!
Spielerfrauen
Böse Zungen behaupten, eine Spielerfrau sei eine Mischung aus einem Boulevard-Girl, einer Go-go-Tänzerin, einem drittklassigen Model und einem Boxenluder. Noch bösere Zungen setzen ihren IQ unter 0 an und sind davon überzeugt, dass herausragende Exemplare dieser Berufsgruppe die Namen eines halben Kaders einer Fußball-Spitzenmannschaft im Bettpfosten verewigt haben.
Das mag ja alles sein, aber das Mädchen, das einmal Spielerfrau werden will, muss, um sein Berufsziel zu erreichen, eine harte Ausbildung absolvieren. Und die erfordert schon ein Minimum an Intelligenz, aber auch Fleiß, Zielstrebigkeit, Exhibitionismus und Kenntnisse im Intrigenspiel. So einfach ist es für die angehende Spielerfrau nicht, sich in den verschiedenen Ausbildungsstätten als Disco-Tänzerin, als Bild-Zeitungs-Pin-up-Girl, als Germanys Next Topmodel und im Dschungelcamp – also in der Welt des Boulevard – bekanntzumachen.