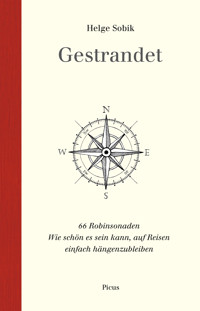9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Picus Lesereisen
- Sprache: Deutsch
Die Menschen in Kanadas Westen haben es geschafft, fast alles unter einen Hut zu bringen, was ihnen wichtig ist: Segeln und Skifahren in derselben Jahreszeit, Wolkenkratzerwohlstand in der Multikulti-Metropole Vancouver, in Edmonton oder Calgary und Lagerfeuerromantik in einem der zahllosen Wildnisdörfer – oder am besten alles auf einmal. Wo es Natur im Überfluss gibt, ist sogar Platz für Legenden von Nixen und Waldmenschen – und ohnehin für die geheimnisvolle Mythologie der Haida-Indianer, in der der Rabe der Schöpfer der Welt ist.Helge Sobik hat Ureinwohner getroffen, sich von ihren Geheimnissen erzählen lassen, war mit den Stadtindianern Vancouvers unterwegs, begegnete dem berühmtesten Pop-Art-Künstler der Westküstenmetropole ebenso wie einem Food-Designer aus Chinatown. Er hat genau hingesehen und berichtet mit dem Blick fürs Detail von dort, wo Kanada am schönsten ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Helge Sobik
Lesereise Kanadas Westen
Copyright © 2005 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien
Umfassend überarbeitete Neuausgabe 2017
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien
Umschlagabbildung: © mauritius images/robertharding/Miles Ertman
ISBN 978-3-7117-1079-6
eISBN 978-3-7117-5348-9
Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unter
www.picus.at
Helge Sobik, 1967 in Lübeck geboren, schreibt Reportagen aus aller Welt. Er publiziert in zahlreichen Medien. Im Picus Verlag erschienen seine Reportage Persischer Golf sowie die Lesereisen Kanada, Kanadas Norden, Finnland, Mallorca, Côte d’Azur, Dubai und, gemeinsam mit Fabian von Poser, Abu Dhabi.www.sobikpress.com
Helge Sobik
Lesereise Kanadas Westen
Wo bitte geht es hier zum Grizzly?
Picus Verlag Wien
Inhalt
Die heimliche Rückkehr des Raben
Queen Charlotte Islands: Unterwegs auf den vergessenen Inseln der Haida-Indianer
Freier Flug für den unsichtbaren Drachen
»Hongcouver«: Asien greift nach Kanadas Westküste
Piratenflagge über Spanish Banks
Das Strandleben an der »kanadischen Riviera«
Der gefiederte Bote des Schöpfers
Bei den Stadtindianern von Vancouver
Alles andere als Durchschnitt
Pop-Art-Künstler Joe Average aus Vancouver: Sterben, um zu leben
Kumpel mit Hang zur Wildnis
Der Westkanadier: Lagerfeuer vorm Wolkenkratzer
Erste Hilfe für die Adler
Hausbesuch bei Seeadler-Doktorin Rory Paterson auf Vancouver Island. Eine Erinnerung
Zwei Millionen für Ogopogo
Von Nixen, Waldmenschen und Seeungeheuern: Auf Monstersuche in Westkanada
Kreuzfahrt hinter den Horizont
Wo die Wale tanzen und die Bären wohnen: Durch die Inside Passage von Vancouver in den Norden
Betonwellen auf dem Mackenzie River
Die Wildnis der Northwest Territories per Wasserflugzeug entdecken und den eigenen Magen kennenlernen
Königin Silvia in der Bauernstube
Wie Goldgräber im Yukon Territory wohnen
Kantholz mit Klang
Souvenir mit dem Sound eines Kontinents
Durch Mittelerde ans Eismeer
Der Dempster Highway: Kanadas legendäre einzige Straße ans Eismeer
Metallica an der Eisgrenze
Wo Amerika zu Ende ist: Tuktoyaktuk ist das coolste Kaff am Nordrand des Kontinents
Sechshundertfünfzig Meter Anlauf bis in den Himmel
Darf eine Buschpilotin in den Northwest Territories schön sein?
Ausgesetzt im Abenteuerland
Hüttenferien in der Wildnis der Northwest Territories
»Wo bitte geht es hier zum Grizzly?«
Mit welchen Fragen sich Ranger im meistbesuchten kanadischen Nationalpark herumschlagen müssen
Die heimliche Rückkehr des Raben
Queen Charlotte Islands: Unterwegs auf den vergessenen Inseln der Haida-Indianer
Wenn man leise ist und in die Stille horcht, dann kann man ihre Trommeln noch hören. Wenn man ganz genau hinschaut, kann man sie manchmal noch tanzen sehen. Die Bäume, das Wasser der Bäche, die Luft, der Himmel – all das hat ihre Geräusche konserviert, ihre Schritte für die Ewigkeit erhalten. Tow Hill am Nordzipfel der Queen Charlotte Islands ist seit Jahrhunderten ein spiritueller Ort der Haida-Indianer. Eine Stätte, die sich anders anfühlt. Ein Ort, den man im Magen spürt und der eine Gänsehaut bereitet. Einer, der zum Hinsetzen auf einen der umgestürzten Baumstämme zwingt, ohne dass etwas Sichtbares geschieht. Es ist ein Platz der Geheimnisse mitten im jahrtausendealten Märchenwald. Diesen Morgen schwingt dort ein Weißkopfseeadler auf. Er hat auf der Bruchstelle eines Baumstamms gehockt, zieht steil in den Himmel und anschließend in einer Westkurve Richtung McIntyre Bay davon.
»Der Seeadler war schon immer da«, sagt Uncle Watson später. »Nur der Rabe ist noch älter, denn er hat die Welt erschaffen.« Der fünfundneunzig-jährige Watson ist einer der Häuptlinge der Haida. Er kennt ihre Ursprünge, ihre Mythologie, all ihre Geheimnisse. Und so freundlich und verbindlich er ist, so wenig gibt er preis: »Die Geschichte erzählen, wie alles begann? Ich kann es nicht. Ich habe sie vergessen«, sagt er, während seine linke Hand auf dem Reifen und die rechte auf der Armlehne seines Rollstuhls ruht.
Die einst kriegerischen Haida, Schrecken vieler anderer Indianerstämme entlang der Küste British Columbias, zählen zu den noch immer verschlossensten First Nations. Watson wird die Geschichte nicht vergessen haben. Er hat sie im Laufe seines Lebens viele hundert Mal den jüngeren Stammesbrüdern erzählt. Und er hat vor drei Jahren hoch betagt seinen Highschool-Abschluss gemacht. »Früher war ich Fischer und hatte keine Zeit dafür. Jetzt habe ich viel Zeit und konnte plötzlich zur Schule gehen.« Auf das Diplom ist er sehr stolz. Das ist es, wovon er Besuchern als Erstes erzählt.
Die Gegend ist leer, auf der Südinsel Moresby mehr noch als auf der Nordinsel Graham Island. Nur am Anleger der Fähre Kwuna ist ein paar Mal am Tag etwas los: Mal sind es drei, mal zwölf Geländewagen, manchmal sind ein, zwei Laster dazwischen, und morgens steht auch der Schulbus an. Sie alle warten darauf, von der Nord- auf die Südinsel oder in umgekehrter Richtung übergesetzt zu werden. Rund siebenhundert Haida leben in Skidegate, weitere siebenhundert in Old Masset ganz oben im Norden, dazu knapp dreieinhalbtausend Zugezogene – die Forstarbeiter, ein paar Fischer, der Tierarzt, die Leute vom Supermarkt. Fast alle leben sie auf der Nordinsel. Auf der Südinsel sind weniger als fünfhundert Menschen zu Hause.
Der Märchenwald im äußersten Norden bei Tow Hill sieht so unwirklich aus, als hätte ihn ein Kulissenbauer für die Haida erschaffen und Tonnen grün eingefärbter Zuckerwatte über den Ästen der Tannen verteilt, die kleinen dunklen Tümpel am Weg in Schleier aus Disconebel gehüllt, zwischen all dem ein unentwirrbares Dickicht aus schwarzen, braunen und grünen Girlanden gespannt und in manche Astgabel einen Kunstfaserfarn geklebt. Es ist der Wald, in dem die Geister wohnen. Ein mystischer Ort, der die Seele auflädt. Einer, von dem es keine wirklich zutreffende Karte gibt. Ein Zipfel Land, dessen Netz aus Pfaden nur die Einheimischen kennen und durch das nur eine einzige Straße führt. Sie ist so feucht wie der Wald, übersät von Schlaglöchern und führt vorbei an wilden Skulpturen aus hellgrünem Moos um die Skelette umgestürzter Zedern.
Mitten im Wald steht ein Haus aus fast verwittertem grauen Holz. Es ist so stark umwuchert, dass kaum mehr Tageslicht durch die Fenster ins Innere dringen kann, und auch das »Bakery«-Holzschild vor der Tür muss immer wieder vom wuchernden Grün befreit werden. Offenbar gibt es Leute, die den Weg von mindestens neunzehn Kilometern aus dem nächsten Ort bis hier heraus fahren, um ihr Brot zu kaufen oder Bananenmuffins für zwei Dollar fünfzig zu erstehen. Aus dem Nichts tauchen diesen Morgen durchnässte Wanderer auf, Hippies auf Hiking-Pause, die auf eine Kanne Tee Station machen.
»Unser Land lockt eine Menge merkwürdiger Gestalten an«, sagt Vince Collinson, der selbst Haida ist und das Wirtschaftsförderungsbüro des nördlichen Reservats in Old Masset leitet. »Sie laufen barfuß durch den Wald und suchen ihr Ich. Sie wollen die spirituelle Kraft von Haida Gwaii spüren und jagen nach etwas, das uns gehört.« Die Indianer lehnen es ab, von den »Queen Charlotte Islands« zu sprechen. Der Name kam mit den Schiffen der weißen Siedler hier an. Es ist nicht ihrer, sondern die Bezeichnung derer, die sie von ihrem Land vertrieben und in Reservate gedrängt haben. »Die Inseln sind Haida Gwaii«, sagt Vince. »Und sie sind das Zentrum des Universums.« Er nimmt einen kräftigen Schluck aus seinem Kaffeebecher.
Die Arbeitslosenquote im Reservat liegt bei achtzig Prozent, das größte Problem ist der Alkohol, und trotzdem freut Vince sich nicht über die spirituellen Ferienfährtensucher im Wald, die Geld und Arbeit nach Old Masset bringen könnten. Sie scheinen ihn vielmehr zu stören. Fast alles scheint ihn zu stören. Er gehört nicht zu den Leuten, die wie die Stadtindianer Vancouvers das Beste aus der neuen Zeit zu machen versuchen und um Verständnis und Freundschaft werben. Vince’ Zukunft ist die Vergangenheit. Am liebsten möchte er das Rad der Zeit zurückdrehen, von vorne beginnen und alle Regeln allein bestimmen.
Er hat große Pläne, will ein Krankenhaus bauen, ein Museum, einen Souvenirshop und versucht, die Gelder dafür aufzutreiben. Und gleichzeitig blickt er herab auf die Fremden, denen er kaum zugesteht, seine Insel schön finden zu dürfen. Sie könnten es nicht wirklich beurteilen, die Spiritualität nicht spüren, weil es für sie nicht Heimat sei. Es gibt offenbar nichts, was Besucher sagen könnten, das Vince’ Wohlwollen fände. Er kann stundenlang lächeln, ununterbrochen in jedem Punkt anderer Meinung sein und alle Aussagen umdeuten oder um mindestens eine Nuance verschieben, und es scheint, als wohnte hinter diesem Lächeln ein verbitterter Mensch.
Gerade erst hat er Völkerkundemuseen rund um den Globus angeschrieben und die Rückgabe aller Ausstellungsstücke über Haida-Indianer gefordert: der Totempfähle, der Masken, der Gebrauchsgegenstände. Vince ist der Kopf der sogenannten »Repatriierungskommission für Kulturgüter« der Haida. »Was in den Museen steht, ist uns gestohlen worden. Es gehört uns. Es gehört hierher. Nirgendwo anders hin. Niemand anderem.«
Wahrscheinlich hat er damit sogar Recht und verkennt doch völlig, dass Museen in Vancouver, in Hamburg oder Berlin die Artefakte nicht im Rummelplatz-Amüsierbudenstil dem Spott preisgeben, sondern Interesse und Verständnis für eine vom Untergang bedrohte Kultur wecken. Vince ist so sehr Haida, dass er sich weigert, die Welt um ihn herum wahrzunehmen.
In Old Masset steht er mit dieser Sichtweise nicht allein da, doch hundertzehn Kilometer weiter südlich schütteln schon die Haida aus Skidegate den Kopf darüber. Sie sind erheblich offener, freuen sich wie Uncle Watson über das Interesse der wenigen Fremden, die die umständliche Anreise auf die Pazifikinseln auf sich nehmen und das, natürlich, nicht aus Desinteresse tun. Die Indianer aus Skidegate haben bereits ihr Museum, dazu ein traditionelles Versammlungshaus direkt am Meer, ein kleines Haida-Seniorenzentrum. Sie mussten nichts repatriieren, sondern sie bauten einfach und füllten mit Leben, was sie errichteten.
»Oben in Masset«, erzählen sie hinter vorgehaltener Hand und nehmen ihre verbitterten Stammesbrüder gleichzeitig in Schutz, »ist das Leben immer schon rauer gewesen. Dort haben sie den kalten Wind, die aufgewühlte See, den meisten Regen. Bei uns ist es milder. Wir nehmen die Dinge leichter, weil unser Leben leichter ist.« Der Rabe hat es gut gemeint, als er Skidegate erschaffen hat.
Abseits des einen Highways, der Queen Charlotte City im Süden über Skidegate mit Masset und Old Masset im Norden verbindet, gibt es nichts als Geröllpisten, nur Forstwirtschaftswege ohne Ausschilderung. Wer sich dort nicht auskennt, ginge verloren und könnte nicht einmal Hilfe rufen. Es gibt nur eine lückenhafte Netzabdeckung für Mobiltelefone auf den Queen Charlottes. Die wenigen Orte sind unsortiert, wie hingewürfelt, ohne Zentrum, ohne Einkaufsstraße, ohne Fastfood-Imbiss, mit nur einer einzigen Ampel. Und doch gibt es dort alles – nur muss man wissen wo. Jeder scheint dort gebaut und sein Geschäft eröffnet zu haben, wo es ihm gerade passte. Der Baustil war Sache der künftigen Bewohner. Architektonisch ist das nicht schlimm, weil ohnehin fast alles aus Holz ist und diese Gemeinsamkeit für ein stimmiges Bild sorgt.
Weißkopfseeadler sind derweil fast so zahlreich wie Tauben auf europäischen Marktplätzen: Sie hocken auf den Masten der Fischerboote im Hafen, auf den Stegen, auf den Dachfirsten, den Strommasten, im Gras am Straßenrand, und sie flattern nicht einmal auf, wenn ein Auto vorüberfährt.
Im Sand an der Mündung des Tlell River prangen diesen Morgen frische Abdrücke von Bärentatzen. Sie können nur ein paar Minuten alt sein, denn diesen Strandsaum hat die Ebbe gerade erst freigegeben. Berge von Treibholz türmen sich am Rand der Dünen, bügeln den Strandhafer, bis die nächste Flut gemeinsam mit dem nächsten Sturm die vom Meersalz weiß gewaschenen Stämme neu sortiert. Es ist, als ob Ozean und Wind sich zum Mikadospiel der Giganten auf den Queen Charlotte Islands verabredeten.
Draußen vor der Küste kämpft sich die Fähre aus Prince Rupert durch den fast immerwährenden Sturm. Sieben Stunden braucht sie für die wenig mehr als hundert Kilometer der Meerenge. Die Hecate Strait, die die Ostküste der Queen Charlottes vom Festland trennt, ist meist windgepeitscht. In Sichtweite der Küstenstraße schießen Wale ihre Fontänen in den Himmel. Uncle Watson hat unzählige von ihnen aus nächster Nähe gesehen, wenn er mit seinem Fischerboot Vagabound auf dem Ozean unterwegs war: »Ich kenne die meisten von ihnen. Sie kommen aus Mexiko, wandern im Frühling nach Alaska und kehren im Spätsommer wieder um. Zweimal im Jahr sind sie hier. Und manche bleiben.« Er rollt näher an den Tisch, nimmt einen Schluck Tee und einen Bissen von seiner Octopusfrikadelle, danach ein Stück gebackenen Sockeye-Lachs.
Um die Mittagszeit versammelt sich das Wissen der Haida im Seniorenzentrum: Die Alten kommen zusammen, essen traditionelle Speisen miteinander, reden von damals, als es noch mehr Kanus gab, mehr Fischerboote, mehr Tänze. Als Adler und Rabe ihnen noch näher waren. Die Alten erinnern sich an Zeiten, als es die hundertzehn Kilometer Asphalt auf Graham Island nicht gegeben hat und sie noch als Nomaden über die Inseln zogen. Sie erinnern sich an die Tänze und Gesänge ihrer Eltern und dass all das irgendwann verboten war. Den stolzen Haida sollte die Vergangenheit abgewöhnt werden.
Claude Jones aus Old Masset wurde damals in ein Internat aufs Festland geschafft, spielte in einer Marschmusikband, ging in Prince Rupert ins Kino, sah die Western, in denen die Indianer immer die Bösen, immer die Verlierer waren und nahm es hin: »Es galt nicht als schick, Indianer zu sein. Sie haben dich erzogen, es zu verleugnen. Sie wollten, dass du deine Wurzeln vergisst.«
Claudes Vergangenheit steht gerahmt und in Schwarz-Weiß auf seinem Wohnzimmerschrank hinter einer Bierflasche mit aufgesetzter Kerze: ein über siebzig Jahre altes Familienfoto. Er wischt den Staub vom Glas, zeigt, wer seine Mutter, wer sein Vater, wer sein Onkel ist. Die Rückbesinnung auf die eigene Kultur ist keine dreißig Jahre alt. Damals war Claude bereits Pensionär. Er hat den neuen Anschluss ans Damals nicht mehr geschafft: »Was unsere jungen Leute heute singen und tanzen, ist nicht meine Musik. Ich bin nicht damit aufgewachsen, nicht damit alt geworden. Ich kannte diese Musik nur noch vom Hörensagen meiner Eltern und meines Onkels. Ich habe in einer Marschmusikband gespielt. Die Jungen halten die Haida-Kultur nicht am Leben. Sie bringen sie zurück, denn sie war tot.«
Sein Saxofon hat er inzwischen eingemottet. Es steckt in einem Karton im Wohnzimmer. Die Geschichte vom Raben? Ja, die kannte er wohl, hatte er mal gehört. Jetzt hat er sie vergessen. »Sie haben bei mir gründliche Arbeit geleistet.« Die Erzieher, die Missionare. Ob er Christ sei? Er lacht. Immer mehr. Der Oberkörper biegt sich, und Claude wippt auf dem weichen Wohnzimmersofa. »Ja«, sagt er irgendwann und zeigt durchs Fenster auf den erst ein paar Jahre alten Totempfahl vor seinem Haus. Er lacht weiter. Claude wohnt in der Raven Avenue 161. Wie konnte er da den Raben vergessen? Er hat es nicht. Aber er hat sein Leben lang geübt, den Raben zu verleugnen und nichts, gar nichts preiszugeben, wenn Fremde danach fragen.
Der alte Mann zählt zu dem einen Prozent der Haida, die noch ihre eigene Sprache fließend sprechen können. »Aber ich tue es nicht«, sagt er, lacht wieder und stellt das Schwarz-Weiß-Foto zurück auf den Wohnzimmerschrank. Vince hatte ihn gefragt, ob er an der Chief-Matthews-Grundschule an der Eagle Avenue Haida unterrichten wolle, damit die Kinder die Wurzeln nicht vergessen. Claude hat abgelehnt. Er habe mit dem Indianerkram nichts am Hut, hat er gesagt. Außerdem habe er das meiste sowieso vergessen. Und wahrscheinlich hat er heimlich gelacht. Vermutlich singt er mit seiner Familie die alten Lieder, tanzt die alten Tänze, wenn die Türen und Fenster in der Raven Avenue 161 geschlossen und die Vorhänge zugezogen sind. Zieht er sie wieder auf, rumpelt Marschmusik aus den Boxen seiner riesigen, silbrig lackierten Musikanlage.
Zwei Freiwillige für den Schulunterricht fanden sich dennoch. Die zweiundachtzigjährige Ethel ist eine von ihnen. Sie tut es für die Kinder, und es macht ihr offensichtlich keine Freude, darüber zu sprechen. Wie lange sie nun schon unterrichtet? »A number of years – ein paar Jahre.« Seit wann die Haida ihre Kultur wieder entdecken? »For a while now – seit einiger Zeit.« Ob sie von damals erzählen mag, wie es in Masset aussah, als sie klein war? »Don’t remember exactly