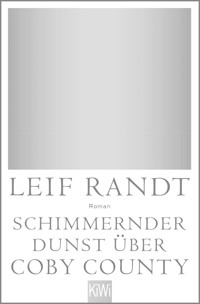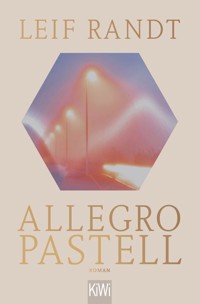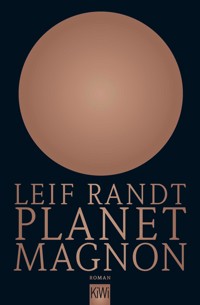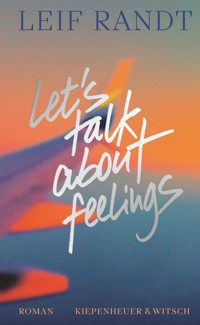
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein optimistisches Buch über traurige Abschiede: Leif Randt erfindet das Coming-of-Middleage. Marian Flanders, 41, verkauft in seiner Westberliner Boutique die vielleicht schönste Kleidung der Welt, aber finanziell erfolgreich ist der Kenting-Beach-Store nur selten. Als seine Mutter Carolina — ein einst ikonisches Fotomodell — nach langer Krankheit verstirbt, richtet Marian eine alternative Trauerfeier für ausgewählte Gäste aus. Auf dem ehemaligen Partyboot seines Vaters hält er eine entwaffnende Rede, co-formuliert von seinem besten Freund, und streut die Asche seiner Mutter auf den Wannsee. Marian glaubt, dass mit diesem Ereignis die freudlosere Hälfte des Lebens beginnt. Doch es folgt ein Jahr der Verwandlung. Erfolgreiche Halbgeschwister und ambivalente Flirts führen Marian u.a. an den Plaza Konami, nach Sapporo, Neu-Delhi und Wolfsburg. Aus falscher Freundlichkeit wird warmherziger Trotz, aus unterkühlter Traurigkeit erwächst stille Euphorie — Let's talk about feelings.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Leif Randt
Let’s Talk About Feelings
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Leif Randt
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Leif Randt
Leif Randt geboren 1983 in Frankfurt am Main, ist der Autor von fünf Romanen und einem Kinofilm. Bisher erschienen sind die Utopien »Planet Magnon« (2015) und »Schimmernder Dunst über CobyCounty« (2011), der London-Roman »Leuchtspielhaus« (2009) sowie die Lovestory »Allegro Pastell« (2020). Seine Prosa wurde vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg (2023). Seit 2017 co-kuratiert er das Onlineverlags-Label tegemedia.net.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Marian Flanders, 41, verkauft in seiner Westberliner Boutique die vielleicht schönste Kleidung der Welt, aber finanziell erfolgreich ist der Kenting-Beach-Store nur selten. Als seine Mutter Carolina – ein einst ikonisches Fotomodell – nach langer Krankheit verstirbt, richtet Marian eine alternative Trauerfeier für ausgewählte Gäste aus. Auf dem ehemaligen Partyboot seines Vaters hält er eine entwaffnende Rede, coformuliert von seinem besten Freund, und streut die Asche seiner Mutter auf den Wannsee. Marian glaubt, dass mit diesem Ereignis die freudlosere Hälfte des Lebens beginnt. Doch es folgt ein Jahr der Verbundenheit. Erfolgreiche Halbgeschwister und ambivalente Flirts führen Marian u. a. an den Plaza Konami, nach Sapporo, Neu-Delhi und Wolfsburg. Aus falscher Freundlichkeit wird warmherziger Trotz, aus unterkühlter Traurigkeit erwächst stille Euphorie – Let’s talk about feelings.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Kosmos Design, Münster
ISBN978-3-462-31336-9
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
WANNSEE
KENTING BEACH
BABELSBERG
RÜGEN
PLAZA KONAMI
OSAKA
SAPPORO
SCHLOSSPARK
SAN ANDRÉS
CINEMA LULUCHI
OLYMPIASTADION
WOLFSBURG
NEU-DELHI
DIE GÄRTEN DER WELT
Dank
WANNSEE
KENTING BEACH
BABELSBERG
RÜGEN
PLAZA KONAMI
OSAKA
SAPPORO
SCHLOSSPARK
SAN ANDRÉS
CINEMA LULUCHI
OLYMPIASTADION
WOLFSBURG
NEU-DELHI
DIE GÄRTEN DER WELT
»Du wirst wahrscheinlich mal so ein Mann, der über sich selbst sagt, er sei sensibel.«
*Carolina Flanders
WANNSEE
Die Trauergäste hatten sich gegen 18 Uhr am Westufer versammelt, eine Kleiderordnung bestand nicht, nur etwa die Hälfte trug Schwarz. Auf dem breiten Holzsteg lagen abgezählte Blumensträuße bereit, man hatte sich gegen Vasen entschieden und für ein möglichst bescheidenes Büfett – es gab gekühltes Mineralwasser in kleinen Glasflaschen, hellgrüne Apfelschnitze sowie lauwarme Salzbrezeln, die in Stoffservietten eingeschlagen waren. Die Notwendigkeit von Salzbrezeln war wiederholt infrage gestellt worden, insbesondere von Marians Vater, aber nun schienen sich doch alle darüber zu freuen. Für viele war es ein Wiedersehen, andere lernten sich gerade erst kennen. Freundinnen und Verwandte trafen auf langjährige Fans. Marian, dem die Nachmittagssonne an diesem heißen Junitag bereits die Stirn gerötet hatte, empfand die Stimmung als regelrecht ausgelassen. Seine Mutter hätte es sich genauso gewünscht, dachte er, auch wenn es niemandem je leichtgefallen war, die Wünsche von Carolina Flanders richtig zu lesen.
Sobald das Schiff ablegen würde, sollte an Deck auch etwas Schaumwein angeboten werden, denn der Gedanke, dass man Abschiede zelebrieren und genießen sollte, hatte sich in den Familien Coen und Flanders längst etabliert. Nach der Urnenbeisetzung von Marians Großvater Valentin Coen im Spätsommer 2011 war in einem rheinländischen Landgasthof sogar getanzt worden. Diverse Angehörige waren spontan aus sich herausgegangen, und Carolina hatte das auf dem Heimweg lobend erwähnt, wenngleich sie selbst überhaupt nicht aus sich herausgegangen war, oder zumindest nicht auf eine erkennbare Weise. Marian hatten die Tänze älterer Menschen seinerzeit noch befremdet, während er nun hoffte, dass sich auf dem Wannsee und etwas später im Ballsaal Kopernikus eine vergleichbare Dynamik entwickeln würde. Seine Verwandtschaft immerhin gab sich die allergrößte Mühe.
Marians Halbbruder Colin hatte seine fünfeinhalbjährigen Zwillingstöchter respektvollerweise einer Babysitterin überlassen, sodass Colin und seine Frau Lucia als tatsächliche Bestattungsgäste anwesend waren, und mal nicht als diese raumgreifende Familienperformance, die ständig alles andere unter sich begrub. Marian fand, dass Colin und Lucia, die ihm seit Jahren nicht mehr zu zweit begegnet waren, in ihren dunkelgrauen Hosenanzügen und mit den leicht erschöpften Gesichtern und mit den Salzbrezeln in der Hand so liebenswert aussahen wie noch nie.
Marians Halbschwester Teda, die gerade von einer zehntägigen Australientournee zurückgekehrt war, trug einen Fischerhut aus dunklem Nylon, der bei den meisten anderen Personen unfreiwillig komisch ausgesehen hätte, der Teda aber wahnsinnig gut stand. Seiner Mutter wäre dieser Hut positiv aufgefallen – davon war Marian überzeugt, denn seine Halbschwester war vielleicht die einzige Person, die Fischerhüte überhaupt noch tragen konnte – und womöglich hätte Carolina das sogar erwähnt, um Teda nach den zehrenden Gigs in Sydney und Brisbane ein gutes Gefühl zu geben, und Teda wäre geschmeichelt gewesen, von Carolina Flanders ein Kompliment zu erhalten. Und so wäre das Eis zwischen den beiden vielleicht gebrochen. Die Einsicht, dass es dafür nun endgültig zu spät war, hätte Marian eine Woche zuvor sicherlich noch zum Weinen gebracht, doch ausgerechnet am Tag der alternativen Seebestattung fühlte er sich so stabil wie lange nicht. Er hielt eine kleine Flasche Mineralwasser in der Hand und lächelte.
Wie viele Jahre Carolina bereits an ihrer mysteriösen Krankheit gelitten hatte, wusste sehr wahrscheinlich nur ihre Hausärztin Selin Odün. Für Selin, die erst Mitte dreißig war, aber schon seit vier Jahren eine eigene Praxis leitete, hatte Carolina so offensiv geschwärmt wie für niemanden sonst.
»Darf ich dir etwas Sonnenmilch anbieten?«, fragte Selin kurz nach der Begrüßung, ihr Blick war wiederholt zu Marians geröteter Stirn hinauf gewandert.
»Dafür könnte es schon zu spät sein«, sagte Marian. Aber die feingliedrige Selin, die ein bleigraues Jackett mit überlangen Ärmeln trug, reichte ihm das Sonnenmilchspray dann trotzdem.
Marian war Selin bislang nur ein einziges Mal begegnet, eineinhalb Jahre vor diesem Tag, in Carolinas Wohnzimmer. Die junge Medizinerin hatte ihrer mutmaßlichen Lieblingspatientin zwei Rezepte persönlich vorbeigebracht und musste dann auf einen Tee, den Carolina extra aufgesetzt hatte, aus Zeitmangel verzichten. In den kurzen Momenten ihres Aufenthaltes beschrieb Selin die Funktion der neu verschriebenen Tabletten so kristallklar und verständlich, dass Marian das Gefühl bekam, sie wisse auch auf Fragen, die nicht direkt etwas mit Gesundheit zu tun hatten, lebensbejahend-pragmatische Antworten.
»Sprüht man sich das besser zuerst in die Hände oder direkt auf die Stirn?« Ohne Selins Antwort abzuwarten, sprühte sich Marian die Sonnenmilch in die Hände.
Selin: »Deine Augen erinnern mich an Carolina.«
Marian: »Das könnte Projektion sein. Ich sehe ihr gar nicht so ähnlich.«
Selin: »Ich finde, du siehst ihr sehr ähnlich.«
Marian: »Danke.«
Marian war es peinlich, dass er sich bedankte. In seiner Jugend hatte er sich nie sonderlich attraktiv gefühlt, erst mit Anfang zwanzig war spürbar geworden, dass sich einige Frauen und Männer doch zu ihm hingezogen fühlten, was aber, davon ging er aus, eher an seinem freundlichen Verhalten lag und weniger an seinem Gesicht. Marian vermutete, dass er seine passiv-abwartende Art durch die schlichte Nachahmung seiner Mutter entwickelt hatte. Weil seine Passivität aber mit deutlich weniger Geheimnis und Glanz einherging als die Passivität seiner Mutter, versuchte er diesen Mangel durch eine ausgeprägte Höflichkeit auszugleichen.
»Carolina hat oft von dir erzählt«, sagte Selin und ließ das Sonnenmilchspray wieder in ihrer Jacketttasche verschwinden. »Vielleicht haben wir später noch mehr Gelegenheit, zu sprechen. Ich bin dankbar, dass ich hier sein darf.«
»Danke, dass du gekommen bist.«
Pünktlich um 19 Uhr 30 stand Marians Vater an Deck seines Schiffes, das einstmals als kommerzieller Partydampfer genutzt worden war, und winkte auf eine Weise, die man durchaus zu fröhlich finden konnte. Dass irgendwer Marians Vater einen Vorwurf machen würde, war jedoch weitgehend ausgeschlossen. Als Sprecher der ARD-Tagesthemen hatte Milo Coen ein halbwegs gebildetes Millionenpublikum durch die Newsgegenwart der Jahre 1997 bis 2014 begleitet, und es war immer spürbar gewesen, dass ihn diese News aus Deutschland und anderen Teilen der Welt auch persönlich tangierten. Realistisch betrachtet könnte Milo Coen der heimliche Schwarm von zwei bis drei, vielleicht auch von fünf bis sechs Millionen deutschsprachigen Frauen gewesen sein, sowie von vielleicht achthunderttausend schwulen Männern, wenn das nicht zu niedrig gegriffen war, weil Milo zwar nicht makellos, aber absolut charismatisch aussah und weil ihn seine latent rheinländische Sprachmelodie wohltuend von der Sterilität anderer Nachrichtensprecher abhob. Trotz seiner immensen Beliebtheit hatte Milo Coen – davon war sein Sohn Marian überzeugt – nie aufgehört, seine Expartnerin Carolina zu lieben. Sie war definitiv nicht der Mensch, mit dem Milo die glücklichste aller Zeiten verbracht hatte, aber wohl die Zeit, die er mit dem intensivsten Gefühl assoziierte. Eine so unbedingte Anziehung wie die zu Carolina – das hatte er Marian kurz nach dessen achtundzwanzigsten Geburtstag gestanden – hatte Milo nie davor und nie mehr danach erlebt. Marian hatte dieses Gespräch in einem thailändischen Restaurant zwar als durchaus unangenehm empfunden, löste es doch Kindheitserinnerungen an verstörende Atemgeräusche seiner Eltern aus, auf dem nächtlichen Weg ins Badezimmer, aber das Geständnis seines Vaters, dass eben seine Mutter, und nicht etwa die Mutter seiner Halbgeschwister oder irgendeine geheime Affäre, der Crush seines Lebens gewesen sei, machte Marian insgeheim stolz. Er war das ungeplante Ergebnis der immensen Anziehung zweier Menschen, die wie ein glamouröser Gegensatz wirken mochten – die unnahbare Modeikone der späten Siebziger und das freundliche Nachrichtengesicht der Zweitausender –, ein ständig streitendes Duo, das aber wirklich aufeinander geflogen war.
Carolinas Asche sollte von ihrer Nachbarin Irma auf den See gestreut werden. Irma war es auch gewesen, die Marian am Vormittag des dritten Juni angerufen hatte. Marian hatte noch im Bett gelegen und von einer mündlichen Abiturprüfung im Wahlpflichtfach Geschichte geträumt, die er mit Anfang vierzig freiwillig wiederholte, um nachträglich sein Abitur aufzubessern. Während dieses Traums konnte Marian wie selbstverständlich auf ein immenses Wissen über das 18. und 19. Jahrhundert zugreifen und stellte diverse Querverbindungen zur Gegenwart her, über die seine Prüferinnen, von der eine in Wahrheit seine Vermieterin war, begeistert lachten. Doch als Marian, vom Telefonklingeln aus diesem Traum gerissen, auf seinem iPhone 13 mini den Namen Irma C. las, war er sofort hellwach. Marian hatte sich manchmal telefonisch bei Irma erkundigt, wenn er seine Mutter nicht direkt erreicht hatte, aber ihrerseits angerufen hatte Irma ihn nie. Als sie ihm mit ruhiger Stimme mitteilte, dass Carolinas Hausärztin den Eintritt des Todes auf halb elf am Vorabend schätzte, überkam Marian zuallererst ein tiefes Mitgefühl für Irma. Obgleich sie und Carolina in fast identisch geschnittenen Apartments im selben Haus Wand an Wand lebten, hatte Irma bei Begegnungen oft mehr wie eine ältere Haushälterin gewirkt als wie eine gleichaltrige Vertraute. Irma war stolz auf ihre einst berühmte Nachbarin gewesen, und auch wenn diese ihre Einladungen zum Brunch nur sporadisch angenommen hatte, ging Irma ständig für sie einkaufen, brachte ihr Bücher und Zeitungen und schickte ihr Links zu vergleichsweise interessanten Radiofeatures. Marian, der seine Mutter immer dazu ermutigen wollte, ihre Restpopularität zu genießen, anstatt sie ständig scharf zu ironisieren, bedankte sich bei Irma C. für ihr aufrichtig ausgesprochenes Beileid, gab das Beileid postwendend zurück, äußerst aufrichtig sogar, und beendete kurz darauf das Telefonat.
Auf dem Schiff seines Vaters dachte Marian nun, dass Irma, wäre sie nur wenige Jahrzehnte später zur Welt gekommen, womöglich ein butch-lesbisches Leben geführt hätte. Eine Dame mit silbernem Haar und auffällig klobigen Schuhen, die in der Lage dazu war, andere aufrichtig zu bewundern. Marian nahm Blickkontakt auf, Irma nickte ihm zu, freundlich und tieftraurig zugleich.
Der Einsatz von Musik war lange diskutiert worden. Angelika und Willem von der Agentur Mayalisa, die Carolina bis zum letzten Tag vertreten hatte, hatten sich pro Musik ausgesprochen, Marian ebenso, darauf verweisend, dass Carolina zu Hause ja quasi ständig etwas angehört hatte, wenn auch, was nur Marian wusste, um sich von ihren Ohrgeräuschen abzulenken, die mit steigendem Alter wohl immer lauter geworden waren. Mit den ersten Klängen des Schumann-Klavierkonzerts, das Marian aus dem MP3-Archiv seiner Mutter herausgesucht hatte, verstummten sämtliche Gespräche, und mit dem Schweigen der Gäste – die aufgereiht in den weißen Sitzschalen am Deck des Schiffes saßen, mit Blumensträußen in der Hand – überkam Marian plötzlich dieselbe Traurigkeit, die ihn einige Minuten nach dem Anruf von Irma an seinem Küchentisch überkommen hatte. Vor seinem Frühstück (einer Schale voller Bio-Haferflocken, Aldi-Knusperone und Mandelmilch) hatte er sich mit einem Mal wie ein alleingelassener Erstklässler gefühlt. Und nun war Marian unsicher, ob der streckenweise heitere Ton seiner Rede wirklich angemessen war. Sein Co-Autor Piet, ein freischaffender Werbetexter und Marians augenblicklich wohl engster Freund, hatte davon gesprochen, dass es sehr stark auf die Vortragsweise ankommen würde, und Marian dazu geraten, die Rede testweise in sein Handy zu sprechen und diese Sprachaufnahme in verschiedenen Stimmungslagen so anzuhören, als wäre er selbst Teil des Publikums. »Wie würde der Sohn des verstorbenen Fotomodells auf dich wirken, wenn du ihn draußen auf dem Wannsee diese Sätze vorlesen hörtest?«, hatte Piet ungewöhnlich formell gefragt. Piet war in Windeseile durch Marians Notizen gepflügt und hatte aufgeräumte Sätze daraus geformt, die Marian im Anschluss noch einmal mit sich und seinen Gefühlen in Einklang bringen sollte. Beim Probehören einige Stunden später war Marian einverstanden mit seinen Betonungen gewesen. Dass er die Aufnahme kein zweites und drittes Mal geprüft hatte, bereute er jetzt. Er hatte seinen Vortrag in einer einzigen Stimmung als richtig empfunden, und das vielleicht nur, um nicht noch länger darüber nachdenken zu müssen.
Während der Rede, die er von einem extra dafür gekauf- ten Tablet ablas, versagte Marian zweimal die Stimme. »Als meine Mutter vor gar nicht so langer Zeit bei mir zu Besuch gewesen ist, um sich meine neu gestaltete Küche anzuschauen, sagte sie, an meinem gelben Metalltisch sitzend: ›In diesen Räumlichkeiten kocht ein eleganter Clown.‹ Jedes Lob meiner Mutter ist immer auch als Kritik lesbar gewesen. Aber erst in den letzten Jahren, genau genommen seit 2020, als wir anfingen, deutlich mehr Zeit miteinander zu verbringen, habe ich gelernt, diese besondere Form des Lobs anzunehmen. Ab und zu habe ich mich sogar dafür bedankt. Es war doch eigentlich in Ordnung, ein eleganter Clown zu sein. Und wenn meine eigene Leitung schon so lang gewesen ist, dass ich das Lob meiner Mutter erst mit Ende dreißig richtig zu erkennen gelernt habe, so haben einige der hier Anwesenden vielleicht zu keinem Zeitpunkt bemerkt, dass Carolina gerade etwas zutiefst positiv gemeint hatte. Ich hoffe, dass niemand zu sehr unter dem strengen Blick meiner Mutter gelitten hat. Aber ich hoffe auch, dass meine Mutter ihrerseits nicht zu sehr darunter gelitten hat, von uns allen ständig falsch verstanden zu werden.«
Bei der Wendung falsch verstanden zu werden war Marian der Hals so eng geworden, dass er eine Sprechpause benötigte. Er trank einen Schluck und blickte auf den Wannsee.
»Im Alter von einundvierzig kann ich sagen, dass ich die meiste Zeit – trotz diverser Irritationen – ein Fan meiner Mutter geblieben bin. Manchmal hätte ich mir vielleicht bedingungsloseren Rückhalt gewünscht und weniger Skepsis, weniger implizite Forderungen ihrerseits. Unter diesen Umständen, die sich als mental gesunde Umstände hätten lesen lassen, wäre ich heute vielleicht eine entspanntere Person, aber ich habe gegen die Person, die ich geworden bin, nichts grundlegend einzuwenden. Ich habe sehr viel von meiner Mutter gelernt, sie war ein inspirierender Mensch. Und ich weiß, dass sie auch die meisten anderen, die heute auf diesem kleinen Schiff zusammengefunden haben, inspiriert hat. Manchmal hat sie Dinge gesagt, die sie später bereute, ohne sich jemals ausreichend dafür zu entschuldigen. Manchmal hat sie ihre eigene Autorität unterschätzt. Ich glaube, sie wollte viel zu oft vergessen, wer sie gewesen ist. Und ich selbst habe sie oft genug dafür kritisiert. Die unwirsche, kühle Mutter und ihr potentiell hypersensibler Sohn. Dass man sich auch im Streit sehr wohl mögen kann, ist etwas, das ich erst lernen musste.«
Und bei folgender Textstelle versagte Marians Stimme ein zweites Mal: »Liebe Mama, ich möchte mich in aller Form bei dir bedanken …« Faktisch hatte er seine Mutter nur in Ausnahmefällen Mama genannt, aber in einigen persönlichen Momenten dann eben doch, bis zuletzt, und einen solchen Moment wollte er für sich und die Zuhörenden und für seine Mutter mit den letzten Zeilen seiner Rede erzeugen. Marian schluckte. Er war froh, ein deutlich sichtbares Tablet in den Händen zu halten und nicht bloß sein Handy. Einige Jahre zuvor hatte es geheißen, dass Tablets keine Zukunft mehr hätten, aber das war offensichtlich Unsinn gewesen.
»Du bleibst ein Teil von uns allen, aber ein besonders großer Teil von mir. Ich werde die Summe deiner Aussagen, Gedanken und Meinungen, die mitunter so widersprüchlich gewesen sind, in mir aufbewahren und pflegen. Ich werde noch lange davon zehren.« Marian schaute nach diesem Satz von seinem Tablet auf und fixierte für drei Sekunden seine Gäste. »Und wir alle werden deine Grazie und Aura, die ich als dein spirituelles Erbe begreife, niemals vergessen.«
Marian nickte Irma zu, woraufhin Irma von ihrem Platz aufstand und sich der Schiffsreling näherte. Sie hielt die sandfarbene Box, in der sich Carolinas Asche befand, mit beiden Händen fest und ließ, so wie abgesprochen, von Marian die Verschlusskappe öffnen. Dieser Vorgang war nie geprobt worden. Nachdem die Asche auf den Wannsee hinuntergerieselt war, deutlich schneller, als es sich Marian ausgemalt hatte, setzte er mit tränennassen Wangen ein letztes Mal an: »Ich möchte mich dafür bedanken, dass ihr euch auf dieses Ritual eingelassen habt. Es fühlt sich trauriger an, als ich gedacht habe. Und trotzdem hoffe ich, dass wir auf diesem ehemaligen Partyschiff, auf dem schon immer gefeiert wurde, und auch später im Ballsaal Kopernikus noch, eine schöne Zeit haben werden. Für Carolina.«
Die Reihenfolge der Kondolenz-Umarmungen war nicht festgelegt, aber sie fühlte sich doch zwingend an. Zuerst die Nachbarin, die direkt neben Marian stand, dann sein Vater, der aus der Kapitänskabine herausgelaufen kam, dann Schwester und Bruder und Schwägerin. Es folgte eine überraschend auftretende Person, deren Namen Marian nicht mehr wusste und von der Marian eigentlich nicht umarmt werden wollte, dann sein guter Freund Sergej und dann seine Exfreundin Franca, von der er eigentlich auch nicht umarmt werden wollte. Niemand sagte etwas. Es waren wortlose Umarmungen auf einem leicht schwingenden Schiff.
Vom Westufer des Wannsees aus war der Ballsaal Kopernikus fußläufig gut erreichbar. Die wenigen, die mit Autos angereist waren, boten an, die älteren Gäste mitzunehmen, aber insbesondere die älteren wollten unbedingt zu Fuß gehen, um die blaue Stunde zu genießen. Vielfarbige Blumensträuße, die auf einem Fahrradweg in Richtung Ballsaal getragen wurden, vor einer grün leuchtenden Wiese im hellsten Monat des Jahres. Marian ging einige Schritte zur Seite, um die Gruppe aus einer Halbdistanz zu betrachten. Er zählte achtundzwanzig Sträuße voller Frühlingskraut und Osterlilien, sah Outfits in gedeckten Farben – Blazer, Hemden, lange Kleider – sowie orange-blauen Abendhimmel. Marian wünschte sich, dass seine Mutter eine Drohnenaufnahme von dieser Szenerie sehen könnte, aber dort, wo sie jetzt war, war vielleicht sogar etwas Besseres als eine Drohnenaufnahme verfügbar.
Im Ballsaal waren sechs runde Tische eingedeckt worden, umringt von Vasen, die für die Blumensträuße bereitstanden. An der Decke etwas schief hing ein pompöser, aber mutmaßlich nicht hochwertiger Kronleuchter, den Marians Mutter oft gelobt hatte (»Solange dieser Kronleuchter nicht runterkracht, ist Westberlin intakt«). Der erste Gang war ein üppiger Salat, der wahlweise mit Schafskäse und Cashewkernen oder mit Räuchertofu und Cashewkernen serviert wurde. Darauf folgte ein Thunfischsteak mit Grillgemüse bzw. Sojageschnetzeltes mit Grillgemüse. Carolina hatte seit ihrem dreißigsten Geburtstag abends meist auf Brot, Reis, Kartoffeln und Pasta verzichtet. Marian hatte sich die meiste Zeit seines Lebens an dieser Ernährungsweise orientiert, war aber trotzdem nie völlig schlank geworden. Dass Körperformen genetisch vordefiniert waren, man durch Ernährung und Sport nur Details daran verändern konnte, hatte er früh genug begriffen – seine um die Hüften etwas ausladendere Silhouette erinnerte Marian schon mit neunzehn an die seines Großvaters Valentin –, weshalb er seinen Fokus auf Bekleidung im weitesten Sinne, auf Materialien, Farben und Schnitte, gelegt hatte. Selbstverständlich konnte nicht jede Person mit jeder Körperform alles tragen. Doch waren durch Kleidung, Accessoires, Make-up und Schmuck Transformationen zu jedem Zeitpunkt möglich, in jedem Alter und in jeder Verfassung, ohne Diäten oder operative Eingriffe. Und obwohl Marian ein Modestudium letztlich verwerfen musste – er hatte Absagen aus London und Antwerpen erhalten –, hatte er sich nach einem etwas ärgerlichen Master in Curatorial Studies, der auf Kunstgeschichte und Soziologie gefolgt war, wieder zurück in Richtung Kleidung orientiert, weil ihm die Vermittlung von Mode weit wertvoller erschien als die Vermittlung von Kunst.
Während des Abendessens wurde durchgehend gesprochen. Als gäbe es infolge der langen Schweigephasen auf dem See konkreten Nachholbedarf. Marian, der Sergej und Anna neben sich platziert hatte, bestellte abwechselnd Negroni und Wodka Soda, er trank seltener als früher, aber vertrug es jetzt meistens besser. Sein Vater saß an einem anderen Tisch, recht weit entfernt, und dennoch hörte Marian seine Stimme deutlicher als alle anderen Stimmen. Es fiel ihm schwer, nicht zuzuhören, wenn sein Vater redete, doch was sein Vater sagte, war immerhin nicht peinlich. Niemand beanstandete, dass Marian im Laufe des Abends manchmal in sein Handy versank. Piet erkundigte sich via Textnachricht nach seinem Befinden und ob alles halbwegs gut verlaufen sei, und Marian schrieb sehr ausführlich zurück, aus einer fast heiteren Stimmung heraus, und fragte, wie es Piet mittlerweile gehe, der schnell und knapp antwortete: »Erhöhte Temperatur und Okinawa Sunrise, Staffel zwei.«
Es lief eine Playlist, die Marian zusammengestellt hatte, vorwiegend Musik aus den Jahren nach 2020, die vielen Gästen eher fremd gewesen sein dürfte. Getanzt wurde nicht. Aber Hausärztin Selin sagte, kurz bevor sie gegen eins das späte Abendessen verließ, dass ihr die Musikauswahl ziemlich gut gefallen habe und dass sie sich über einen Link zu der Playlist sehr freuen würde. Ein schöneres Kompliment konnte sich Marian kaum vorstellen. »Wenn du das nicht übergriffig findest, können wir uns gerne auch auf Spotify folgen, obwohl das ja eigentlich keiner macht«, sagte er und merkte daran, dass er doch ziemlich angetrunken war. Selin sagte, sie nutze gar kein Spotify, sondern iTunes, und dann umarmte sie Marian zum Abschied. Er fasste den Beschluss, den Todestag seiner Mutter fortan mit Dinners dieser Art zu feiern. Die Gruppe würde von Jahr zu Jahr kleiner werden und der Altersschnitt würde steigen, doch es galt, all diese lose mit Carolina Flanders assoziierten Menschen nicht gänzlich aus den Augen zu verlieren.
Die letzten Gäste verließen gemeinsam mit Marian den Ballsaal, als es draußen gerade hell wurde. Auf den Wiesen lag Morgentau und es wehte ein frischer Wind.
»Mittelfristig wirst du dich aus dem Knast deiner endlosen Freundlichkeit befreien.«
*Piet Fellbach
KENTING BEACH
Wenn Marian nun gefragt wurde, wie es ihm ging, was in den ersten drei Wochen nach der Seebestattung quasi täglich geschah, bemühte er sich, jedes Mal neu nachzudenken, bevor er antwortete. Zu Piet sagte er nach kurzem Zögern: »Mir geht es normal.« Es wusste, dass diese Antwort besonders merkwürdig wirken mochte, doch Piet gegenüber wollte er sich keinesfalls verstellen. Marian fühlte sich normal, weil die offenkundigsten Trauersymptome bereits abgeklungen waren. Er musste nicht mehr weinen, er war nicht antriebslos, er verlor sich nicht ständig in Erinnerungen. Auf Piets Nachfrage, ob Normalität für ihn etwas Gutes oder Schlechtes sei, präzisierte Marian: »Ich glaube, ich fühle mich so normal wie noch nie.« Es kam ihm vor, als würde seine Stimmung nun weniger stark schwanken, weshalb er sich als ausgeglichener wahrnahm, und so, als fiele es ihm leichter, sich zu fokussieren. Weil es ihm typisch erschienen wäre, sich abzulenken, versuchte er, Ablenkungen zu vermeiden. Er nahm sich wenig vor, verabredete sich seltener, ging nicht aus. Auf Rauschzustände verzichtete er ebenso wie auf übermäßiges Entertainment. In den Monaten und Jahren zuvor, als Marian noch regelmäßig seine Mutter in eher unpopulären Westberliner Lokalen zum Mittag- oder Abendessen getroffen hatte, war es Marian schwergefallen, nicht auszugehen. Er besuchte Multiplex- und Arthousekinos, Vernissagen, Sterne-Restaurants (selten), urige Lokale (oft), Imbisse (ständig), teure Bars, Eckkneipen, Partys in Ateliers, Filmpremieren, Galerie-Dinners, die Transmediale, poststudentische WG-Partys, kleine Diskos (für wenige Stunden), große Clubs (für bis zu neunzehn Stunden), die Aperitivo-Abende gleichaltriger Elternpaare, Hasenheiden-Raves von Anfang Zwanzigjährigen und mitunter sogar Theaterpremieren. Je weniger eine Veranstaltung zu ihm – dem Besitzer der Kenting-Beach-Boutique – zu passen schien, desto lieber ging er hin.
Manchmal hatte ihn seine Mutter gefragt, was er in letzter Zeit so unternommen habe, und dann konnte er berichten und bewerten, und es kam ihm vor, als würde er von seiner Mutter in diesen Momenten geprüft. Marian war sicher, dass sie auch in ihren letzten Wochen noch immer gemerkt hätte, wenn er nicht ehrlich mit ihr gewesen wäre, wenn er sich zum Beispiel den Besuch einer bestimmten Veranstaltung nur ausgedacht hätte, um sie zu unterhalten. Einmal, es musste 2016 gewesen sein, hatte er versucht, ihr von der Berlin-Biennale zu erzählen, die er aber nur flüchtig abgelaufen war, und Carolina kommentierte seine Berichterstattung mit: »Das haben ein paar deiner Klugscheißerfreunde so empfunden, nicht du.«
In der U7 zwischen Neukölln und Schöneberg bemühte er sich in den Wochen nach der Bestattung darum, auf die Menschen in seiner Umgebung zu achten anstatt auf sein Handy. Marian musterte Personen und versuchte, über ihre Biografien zu spekulieren, er versuchte, sich selbst als Teil der Berliner Gesellschaft zu betrachten, und nicht mehr nur als Teil einer Gruppe von vielleicht zweitausend Menschen, die bestimmte Vorlieben teilten. Einmal stand ein Mann in der U7 von seinem Sitzplatz auf, um Marian aggressiv zu fragen, ob er pervers sei. Und dann entschuldigte sich Marian, er habe nicht starren wollen, er habe nur sein Handy zu Hause vergessen. »Get a life!«, sagte der Mann und setzte sich wieder hin. Es war unangenehm für alle. Vielleicht – dieser Gedanke kam Marian beim Blick auf den U-Bahn-Boden – hatte mit dem Verschwinden seiner Mutter die eigentlich normale Zeit begonnen, der wahrscheinlich längere, aber vermutlich schneller vorbeiziehende Teil des Lebens.
Dass Carolina Flanders in den zurückliegenden Jahren kaum noch öffentlich in Erscheinung getreten war, hatte wohl dafür gesorgt, dass sich die Meldung über ihren Tod auf etwas stilvollere Art und Weise verbreitet hatte als vorab von Marian befürchtet. Am häufigsten war ein Farbfoto von 1982 geteilt worden, Marians Mutter in einem dunkelblauen Skianzug auf der Zugspitze, lächelnd, mit zusammengestecktem Haar und einer entspiegelten Sonnenbrille, die einen Blick in ihre schmalen Augen ermöglichte. Es war eines der weniger ikonischen Bilder aus dieser Zeit, aber fraglos eines der sympathischsten. Marian war froh, dass er in den Storys und TikToks zum Gedenken an seine Mutter nie verlinkt wurde – er wollte keine Beileidsbekundungen in seinen DMs und noch weniger in seiner Boutique, weshalb sich Marian dort für die bisher längste Zeit von Anna hatte vertreten lassen. Mit Anna, 37, war Marian seit neun Jahren befreundet, seit sechs Jahren arbeitete sie fest für Kenting Beach, sie war dunkelhaarig und vier Zentimeter größer als er. In seiner Abwesenheit hatte sie das Geschäft allein übernommen, und obwohl sie Mutter eines dreijährigen Jungen war und also häufig krank wurde, hatte sie in diesen Sommerwochen den höchsten Monatsumsatz der letzten zwei Jahre erzielt, wie Buchhalter Sergej betonte, und außerdem Newsletter Nr. 29 zusammengebaut, der einer der schönsten Newsletter überhaupt geworden war.
Am Tag seiner Rückkehr, einem Samstag im Juli – drückende Hitze, steil einfallende Nachmittagssonne im Schaufenster- und Eingangsbereich, Marian trug eine Sonnenbrille mit transparentem Bügel, die bei Kenting Beach auch verkauft wurde –, fragte er Anna, von deren 11:30-bis-15-Uhr-Schicht er sie gerade ablösen wollte, in einem etwas kleinlauten Tonfall: »Hattest du das Gefühl, dass wegen der Meldung zu Carolina mehr Leute in den Store gekommen sind?«
Anna, die komplett weiß angezogen war an diesem Tag – ein Hemd aus der Unisex-Kollektion von CG+ und eine Herrenjeans von Dropspot –, sagte: »In den ersten Tagen vielleicht. Es kamen vor allem Frauen, die ich hier noch nie gesehen hatte. Häufig suchten sie Geschenke für ihre Partner, oder es waren Mädels, die sich gerne maskulin kleiden. Ich ließ nie mit mir handeln, machte aber für Kunden eine Ausnahme, von denen ich wusste, dass du sie besonders magst. Für Jeremy und Lucas zum Beispiel. Die haben beide Jacken von Maison Special gekauft.« In diesem Moment lächelte Anna, und dann lächelte auch Marian. Er liebte Maison Special. »Es gab ständig Lob für das Sortiment. Ich denke, du hast einfach sehr, sehr gut eingekauft dieses Jahr.«
Nachdem Anna sich mit einer Umarmung verabschiedet hatte, stand Marian allein im Nachmittagslicht in seiner Boutique und blickte sich um. Die Hemden, T-Shirts und Longsleeves der Sommersaison hingen nun in noch etwas großzügigeren Abständen zueinander, und dadurch wirkte jedes einzelne Kleidungsstück noch etwas besonderer. Dass bereits Getragenes gleichberechtigt neben Neuware hing, mit einer teils grotesken preislichen Differenz, war eine von Marians Grundideen gewesen, als er den Laden konzipiert hatte. Wenn sich Kunden darüber wunderten (»Warum kosten diese Shorts zweihundertvierzig Euro mehr als die Shorts direkt daneben?«), sagte Marian manchmal mit übertrieben ernstem Gesicht »It’s fashion«, um kurz darauf lächelnd und ausführlich zu erklären, aus welch hochwertigen Materialien (Mohair, Viskose, Alpaca), an welch teuren Standorten (Italy, France, Belgium) und in welch geringer Stückzahl einige Labels ihre Kleidung herstellen ließen. (»Das ist europaweit die vorletzte Weste in Größe 48. Nur in Amsterdam gab es zumindest gestern noch eine zweite.«) Und dann sagte er oft noch Dinge wie: »Dieses T-Shirt war 2013 sicher genauso teuer, für die damaligen Verhältnisse. Heute kriegst du es für 40 €«, obwohl 45€ auf dem Preisschild stand.
Die Klimaanlage, die Marian im zweiten Jahr hatte installieren lassen, kühlte den Innenraum auf dreiundzwanzig Grad, sodass niemand, der leicht verschwitzt von draußen eintrat, das Gefühl bekam, eine Jacke überziehen zu müssen, und dennoch erfrischt aufatmete. Kühles Wetter war ein No-Go für Marian, zumal es am tatsächlichen Kenting Beach in Süd-Taiwan, wo Franca die vielleicht schönsten Fotos aller Zeiten von ihm gemacht hatte, das ganze Jahr über warm war. Taiwan war auch der Ort gewesen, an dem Marian auf der Rundreise mit Franca so viele Männermodeläden besucht hatte wie noch in keinem anderen Land. Zwar musste er rückblickend zugeben, dass er nur drei der acht dort gekauften Kleidungsstücke zurück in Berlin auch wirklich trug, dennoch erinnerte er sich gerne an die Shoppingtouren durch Taipeh, Kaohsiung und Tainan. Gefühlt hatte jedes Kleidungsstück umgerechnet nur etwa 40 € gekostet, und keines davon wäre in Europa erhältlich gewesen. Taiwan, so würde es Marian heute beschreiben, war der frühe Peak seiner Beziehung zu Franca, die in den Männermodeläden so geduldig mit ihm war wie noch niemand zuvor.