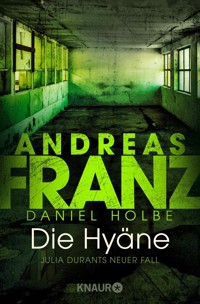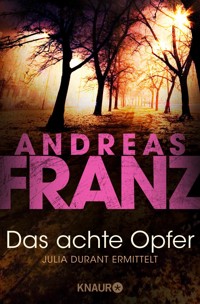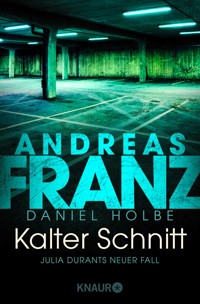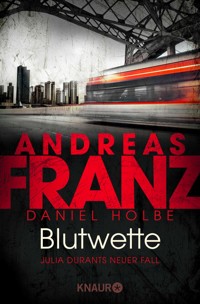Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Media Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Julia Durant ermittelt
- Sprache: Deutsch
Rätselhafte Mordfälle mit exotischen Giften! Innerhalb kürzester Zeit werden drei angesehene Mitglieder der Religionsgemeinschaft »Kirche des Elohim« ermordet aufgefunden. Als Hauptkommissarin Julia Durant und ihre Kollegen Nachforschungen über die Toten anstellen, erfahren sie, dass sich hinter deren Maske der Wohlanständigkeit Machtmissbrauch und Demütigungen, Misshandlungen und Lügengebäude verbargen. Mit eigenwilligen Methoden verfolgt die Kommissarin eine Spur, an deren Ende ein tragisches Schicksal steht. Ein subtiler psychologischer Thriller des Erfolgsautors von »Jung, blond, tot«! Letale Dosis von Andreas Franz: Spannung pur im eBook!
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Franz
Letale Dosis
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
14. Juni, 20.30 Uhr
Montag, 22.15 Uhr
Dienstag, 0.55 Uhr
Mittwoch, 7.45 Uhr
Donnerstag, 7.50 Uhr
Freitag, 0.45 Uhr
Samstag, 9.20 Uhr
Sonntag, 8.50 Uhr
Montag, 9.10 Uhr
Dienstag, 0.05 Uhr
Für meine Frau Inge
und meine Kinder Bernd, Andreas II,
Alexandra, Judith und Manuel,
die mit Gold nicht aufzuwiegen sind.
Für HKvS, einen Freund,
wie man ihn nur einmal im Leben findet.
Und für meine Mutter,
die mir mit ihrem unerschütterlichen Glauben
und ihrer grenzenlosen Liebe schon früh
gezeigt hat, daß es Gott gibt.
… Ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel und laßt das Wichtigste im Gesetz außer acht: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue …
Matthäus 23:23
Prolog
Sie hörte es bereits an den Schritten, die langsam die knarrenden Stufen zu ihrem Zimmer heraufkamen. Sie wußte, es war wieder soweit, er würde versuchen, so leise wie möglich die Tür zu öffnen, sich blitzschnell ins Zimmer drängen und die Tür genauso schnell wieder hinter sich schließen. Bis vor wenigen Minuten noch hatte sie Radio gehört, ein paar Eintragungen in ihr geheimes Tagebuch gemacht, das sie so gut versteckt hielt, daß keiner es bis jetzt gefunden hatte. Eintragungen, die ihr ein wenig halfen, über das, was ihr widerfuhr, einigermaßen hinwegzukommen. Seit vier Jahren war das Tagebuch ihr ständiger Begleiter, dem sie all ihre Wut und Verzweiflung und Ohnmacht, all ihren Schmerz und all die Demütigungen, die ihr zugefügt wurden, anvertrauen konnte. Heute hatte sie nicht viel zu schreiben gehabt, nur ein paar Zeilen mit ihrer Vorahnung, doch sie wußte, die nächste Eintragung würde länger und voller Tränen sein, Tränen, die nicht mehr über ihre Wangen flossen, sondern die sie still in sich vergoß. Tränen, die mittlerweile einen tiefen See voll Leid gefüllt hatten. Und manchmal fragte sie sich, ob sie jemals eine Zeit erleben würde, in der dieser See allmählich austrocknete. Sie glaubte an Gott, so wie alle in diesem Haus vorgaben, an Gott zu glauben. Doch sie wußte inzwischen, daß die andern nur logen und betrogen, daß Gott in ihrem Leben keine wirkliche Rolle spielte, denn hätte er das getan, hätten sie das nicht zugelassen.
Aber sie glaubte an Gott, wußte, er stand ihr selbst in der größten Not bei, und wenn sie Gott auch nie gesehen, nicht einmal seine Stimme gehört hatte, sie wußte, er war da und sie konnte jederzeit zu ihm kommen und all ihren Ballast bei ihm loswerden. Und manchmal verspürte sie in Momenten tiefster Traurigkeit und Verzweiflung, wie eine sanfte Hand sie berührte, die ihr die Kraft gab, dies alles zu erdulden.
Sie hatte die Tür abgeschlossen, weil sie schon beim Abendbrot gespürt hatte, was später am Abend geschehen würde, wenn alle andern schliefen; wie er sie immer für kurze Momente ansah, Blicke, die sie schon tausendmal gesehen hatte, die wie Speerspitzen in ihr Herz drangen. Er hatte ihr verboten, das Zimmer abzuschließen, er hatte gesagt, niemand in diesem Haus bräuchte sich einzuschließen, es sei denn, jemand hätte etwas zu verbergen, doch das wäre nicht gut, denn Gott würde so etwas nicht gutheißen.
Sie war acht gewesen, als ihr Vater das erste Mal nachts in ihr Zimmer geschlichen kam, und sie würde nie den unbeschreiblichen Schmerz vergessen, den er ihr zugefügt hatte. Sie hatte damals schreien wollen, damit alle hörten, was geschah, doch er hatte ihr den Mund mit brutaler Gewalt zugehalten. Schließlich hatte er gesagt, dies wäre nur der Anfang, und sie dürfte unter keinen Umständen irgend jemand etwas davon erzählen, sonst würde das furchtbare Strafgericht Gottes über sie kommen, und was das bedeuten würde, wüßte sie – keine Möglichkeit, eines Tages an der Seite Gottes zu wohnen, in seiner Herrlichkeit und seiner allmächtigen Güte. Sie hatte ihm in dieser Nacht versprechen müssen, nie ein Wort darüber zu verlieren, und sie hatte es versprochen, denn sie wollte nicht ungehorsam sein. Es folgten Hunderte von diesen Nächten, in denen sie innerlich schrie und flehte und Gott anbettelte, ihr doch zu sagen, warum er zuließ, daß ihr das angetan wurde. Aber sie war noch viel zu jung, um wirklich zu begreifen, was mit ihr geschah.
Sie saß im Schneidersitz auf dem Bett, nur die kleine Lampe neben dem Bett brannte. Sie hatte die Hände gefaltet, ihr Blick war zur Tür gerichtet. Die Schritte verstummten, kein Knarren mehr. Es war kurz nach elf und eigentlich hätte sie längst schlafen wollen, doch weil sie wußte, was passieren würde, war sie extra aufgeblieben. Sie sah, wie die Klinke heruntergedrückt und wieder losgelassen wurde. Sie rührte sich nicht, starrte nur wie gebannt auf die Tür. Ein weiteres Mal bewegte sich die Klinke nach unten, wurde von außen gegen die Tür gedrückt. Leises Klopfen, sie bewegte sich nicht von der Stelle. Dann klopfte er wieder, diesmal etwas lauter und es klang wütend, doch noch immer leise genug, daß niemand sonst im Haus etwas davon mitbekam.
»Mach bitte sofort die Tür auf«, sagte er in zischendem Flüsterton. »Du weißt, ich kann auch anders!«
»Ich will schlafen«, sagte sie. »Es ist spät.«
»Wenn du hättest schlafen wollen, dann hättest du schon vor zwei Stunden das Licht ausgemacht. Also, mach auf!«
Sie wußte, wenn sie seinem Befehl nicht nachkam, würde es beim nächsten Mal noch schlimmer kommen. Sie erhob sich von ihrem Bett, ging wie in Trance zur Tür, drehte den Schlüssel, zog ihn schnell ab und steckte ihn in die Hosentasche.
Er stand vor ihr, ein großer, mächtiger Mann, dessen Augen sie scharf und unerbittlich ansahen. Er schubste sie in die Mitte des Zimmers, schloß die Tür hinter sich. Seine Augen waren zu Schlitzen verengt, als er mit seinem typischen Gang auf sie zukam und direkt vor ihr stehenblieb.
»Habe ich dir nicht schon tausendmal gesagt, du sollst diese Tür nicht abschließen?! Sollte das noch einmal vorkommen, werde ich dich leider bestrafen müssen. Hast du mich verstanden?«
Sie nickte nur.
»Warum bist du noch nicht ausgezogen? Ich denke, du wolltest schlafen.«
»Ich wollte mich gerade ausziehen«, erwiderte sie leise und mit gesenktem Blick.
»Dann tu es, meine Kleine«, sagte er plötzlich sanft und streichelte mit einer Hand über ihr Gesicht. »Ich werde so lange hierbleiben und aufpassen, daß du auch wirklich ins Bett gehst. Komm, zieh dich aus.« Er setzte sich auf die Bettkante.
Sie gehorchte, knöpfte die Jeans auf, streifte sie von den Beinen und legte sie auf den Stuhl. Danach zog sie das Sweatshirt über den Kopf mit dem dichten, braunen Haar. Sie trug jetzt nur noch ein Trägerhemd und einen Slip und weiße Tennissocken.
»Du willst doch nicht etwa mit Strümpfen ins Bett gehen, oder?« fragte er. »Das ist sehr ungesund.«
»Nein«, erwiderte sie mechanisch und zog auch die Socken aus. Sie ging zum Bett, schlug die Decke zurück und legte sich hinein. Er wandte seinen Kopf in ihre Richtung, wartete, bis sie die Bettdecke bis zu ihren Schultern gezogen hatte. Er legte sich neben sie, streichelte über ihr Gesicht, sie fühlte Ekel in sich aufsteigen. Sie schloß die Augen, um ihn nicht sehen zu müssen.
»Weißt du, du bist meine süße Kleine. Ein Mädchen wie dich habe ich mir immer gewünscht. So zart und rein und makellos.« Seine Hand glitt tiefer, berührte ihre noch kleinen Brüste, massierte sie. Sie hielt die Augen geschlossen, nur so war es einigermaßen zu ertragen. Sie spürte, wie er zwischen ihre Schenkel faßte und ihren Slip und wenig später den Reißverschluß seiner Hose herunterzog. Dann war er mit einem Mal über ihr, sein Glied drang ruckartig und schmerzhaft in sie ein. Erst bewegte er sich langsam, schließlich immer schneller und schneller, bis er ejakulierte und sich kurz darauf zur Seite drehte. Er atmete wie immer schwer, sah sie von der Seite an, sagte: »Mach dich sauber und zieh dich wieder an. Du mußt morgen früh aufstehen. Du schreibst doch morgen die Englischarbeit, oder?«
»Ja«, sagte sie leise.
»Ich hoffe, du hast gut gelernt. Ich will keine Versager in meiner Familie haben. Und Gott hat uns, vor allem aber dich, mit so vielen Talenten ausgestattet, daß es deine Pflicht ist, gute Arbeiten zu schreiben. Klar?«
»Ja.«
»Gut, dann mach mir keine Schande. Es wäre schlecht, wenn ausgerechnet du …« Er winkte ab, lächelte auf einmal. »Nein, meine Kleine wird mir keine Schande machen. Das weiß ich. Wenn du gelernt hast, wird Gott schon dafür sorgen, daß alles gutgeht. Gute Nacht.«
Er verschwand, wie er gekommen war – leise, nur die Stufen knarrten ein wenig. Sie ging ins Bad, befreite sich von dem Schmutz, zog frische Unterwäsche an und legte sich ins Bett. Es war weit nach Mitternacht, als sie endlich einschlief.
14. Juni, 20.30 Uhr
Sie hatten zu Abend gegessen, und anschließend, wie immer Montags, eine Bibelstunde in dem weiträumigen Wohnbereich abgehalten. Trotz der seit Tagen anhaltenden Hitze, die sich wie eine riesige Glocke über die Stadt gelegt hatte, war es angenehm kühl in dem vollklimatisierten Haus. Joseph, der jüngste Sohn, las gerade ein paar Verse aus dem Matthäus-Evangelium vor, in denen Jesus seinen Jüngern sagt, wessen Glaube auch nur so groß wie ein Senfkorn ist, dem wird es möglich sein, zu einem Berg zu sagen: ›Rück von hier nach dort!‹, und er wird wegrücken, als das Telefon läutete. Alle blickten auf, bis der Vater sich nach dem dritten Klingeln erhob und den Hörer abnahm.
»Rosenzweig«, meldete er sich. Er hörte einen kurzen Moment zu, schließlich drückte er einen Knopf und legte den Hörer auf. Er wandte sich seiner Familie zu, sagte: »Ich muß nur kurz hoch ins Arbeitszimmer, ein wichtiges Gespräch. Ich bin gleich zurück.«
Mit langsamen, bedächtigen Schritten stieg er die Treppe hinauf, ein großgewachsener, schlanker Mann mit fülligem, grauem Haar. Im ersten Stock angelangt, ging er bis zum Ende des Flurs und öffnete die Tür, hinter der sich sein Arbeitszimmer befand. Er betrat es, schloß die Tür hinter sich, begab sich zum Schreibtisch, nahm den Hörer ab. Er sagte nur »Ja«, und »Sicher, gleich, ich dich auch« und »Bis morgen«.
Nach dem Telefonat setzte er sich auf seinen braunen Ledersessel, zog die rechte obere Schublade auf, holte die Spritze und das kleine Glas heraus, schraubte den Deckel ab, steckte die Nadel in die helle, opake Flüssigkeit und zog die Spritze auf. Er öffnete zwei Knöpfe an seinem Hemd, stach die Nadel unter die Haut über der Bauchdecke und drückte den Inhalt aus der Spritze. Er zog die Nadel heraus, blieb sitzen, legte die Spritze zusammen mit dem Glas zurück in die Schublade.
Er wollte gerade sein Hemd zuknöpfen, als er sich mit einem Mal an den Brustkorb faßte; er wollte schreien, rang nach Luft, sein Herz schien seinen Körper verlassen zu wollen. Seine Augen waren unnatürlich geweitet, er war nicht fähig, sie zu bewegen, nicht fähig, zu schlucken, seine Augenlider gehorchten nicht mehr, seine Augen waren starr auf einen Punkt im Zimmer gerichtet. Und was er sah, sah er doppelt. Er schmeckte das Blut, das aus irgendeiner winzigen Wunde in seinem Mund trat, sah, wie Blut aus seiner Nase auf den Schreibtisch tropfte. Er wollte sich von seinem Platz erheben, doch seine Beine gehorchten nicht, genauso wenig wie seine Hände, mit denen er zum Telefon greifen wollte. Sosehr er sich auch anstrengte, er vermochte kaum noch zu atmen, ein bleierner Gürtel, der immer enger um seine Brust gezogen wurde. Er schmeckte Blut, er sah Blut, spürte, wie alles in ihm sich allmählich auflöste. Er wollte schreien, seine ganze panische Angst hinausschreien, doch außer einem kaum hörbaren Krächzen drang kein Laut aus seiner Kehle. Er wußte, daß etwas Furchtbares mit ihm geschah, daß der Tod nur eine Frage von Minuten oder gar Sekunden sein würde. Doch er wußte nicht, warum er starb, warum er sterben mußte. Er versuchte ein weiteres Mal, aufzustehen, befahl seinen Beinen, ihn zu stützen, statt dessen sank er langsam nach vorn, sein Kopf schlug auf die Schreibtischplatte, ein Zittern und Zucken raste durch seinen Körper, ein letzter, verzweifelter Versuch, Luft zu bekommen, dann hörte sein Herz auf zu schlagen. Hans Rosenzweig war tot.
Als er auch nach einer Viertelstunde nicht wieder im Wohnzimmer erschien, ging Marianne Rosenzweig nach oben, um nach ihrem Mann zu sehen. Sie klopfte an die Tür, und als niemand antwortete, betrat sie das Zimmer. Das erste, was sie sah, war das zu einer Grimasse verzerrte Gesicht mit den weitaufgerissenen, starren Augen, das Blut, das aus seinem Mund und der Nase gelaufen war und sich über den Schreibtisch verteilt hatte. Sie schluckte schwer, trat näher an den Schreibtisch, sah ihren Mann an. Kaum eine Regung zeichnete sich in ihrem Gesicht ab. Sie sagte nur leise und fassungslos: »O mein Gott, warum?« Sie wagte nicht, noch einen Schritt näher an ihn heranzugehen, sie sah ihn nur an, regungslos, unfähig, sich zu bewegen. Nach einem Moment löste sie sich aus ihrer Starre; ohne etwas berührt zu haben, begab sie sich wieder nach unten, blieb vor ihren Söhnen stehen, sagte mit schwerer, bedächtiger Stimme: »Jungs, ihr müßt jetzt stark sein. Ich glaube, euer Vater ist tot.«
»Was?« fragte der dreizehnjährige Joseph entsetzt und ließ die Bibel auf den Tisch fallen. »Papa ist tot?«
»Ich fürchte ja. Es sieht fast so aus, als hätte er einen Herzinfarkt gehabt. Ich werde gleich Schwester Fink anrufen.«
»Dürfen wir nach oben gehen und …«
»Nein«, sagte Marianne Rosenzweig bestimmt. »Ihr geht nicht nach oben. Euer Vater ist tot, und ich möchte nicht, daß ihr ihn so seht.« Sie ging zum Telefon, nahm den Hörer in die Hand, wählte die Nummer von Dr. Laura Fink, ihrer Hausärztin. Nur der Anrufbeantworter meldete sich mit der Ansage, welcher Arzt in dieser Nacht Bereitschaftsdienst hatte. Sie legte auf, bevor die Ansage zu Ende war, griff nach ihrem braunen Telefonbuch, in dem sie die Privatnummer von Laura Fink notiert hatte, ein Vorzug, der nur einigen auserwählten Patienten vorbehalten war. Aber sie kannten sich schon so lange, daß sie ohne Bedenken bei ihr anrufen konnte. Sie meldete sich nach dem dritten Läuten.
»Fink.«
»Guten Abend, Laura. Hier ist Marianne Rosenzweig. Ich bitte dich … ich meine … könntest du so schnell wie möglich herkommen? Ich glaube, mein Mann ist tot.«
»Dein Mann? Wie … Einen Moment, ich ziehe mir nur schnell was über und werde so in zehn Minuten dasein.«
Laura Fink traf um kurz nach neun bei den Rosenzweigs ein. Die beiden Söhne Joseph und der achtzehnjährige Aaron saßen mumiengleich auf der Couch und blickten die junge Ärztin hilfesuchend an.
»Wo ist er?« fragte Dr. Fink, eine mittelgroße, eher unauffällige Erscheinung mit kurzen, braunen Haaren und einer fast knabenhaften Figur, die sie unter einem T-Shirt, Jeans und Leinenschuhen versteckte.
»Oben, in seinem Arbeitszimmer. Komm mit.« Marianne Rosenzweig schloß die Wohnzimmertür hinter sich und bat sie, ihr in den ersten Stock zu folgen. Sie öffnete die Tür, Laura Fink blieb kurz stehen, kniff die Augen zusammen, holte tief Atem und ging langsam auf den Schreibtisch zu, dessen halbe Platte mit Blut bedeckt war. Die Ärztin klappte wortlos ihre Tasche auf, holte eine Taschenlampe heraus, leuchtete in die Augen des Toten, dann zog sie Gummihandschuhe über und suchte nach dem Puls, der nicht mehr vorhanden war.
»Seltsam«, sagte sie nach einem Moment des Überlegens kopfschüttelnd und sah Marianne Rosenzweig an, die starr wie eine Statue in der Mitte des Raumes stand und mit ausdrucksloser Miene die Augen auf ihren Mann gerichtet hatte. »Wie du sicherlich weißt, war dein Mann noch vor einer Woche bei mir, um sich einem Generalcheck zu unterziehen. Bis auf seine Diabetes war er körperlich völlig in Ordnung, seine Blutwerte lagen im Normbereich, und auch sonst konnte ich keinen körperlichen Defekt wie zum Beispiel einen Herzfehler feststellen. Wir haben allerdings kein EKG gemacht, dazu bestand absolut kein Anlaß.« Sie stand jetzt direkt neben dem Toten, schüttelte erneut den Kopf. »Es ist dieser erhebliche Blutverlust, den ich mir beim besten Willen nicht erklären kann. Es gibt zwar einige eher seltene Krankheiten, die derartige Blutungen auslösen können, doch keine davon kommt bei deinem Mann in Frage. Wie gesagt, seine Laborwerte waren, bis auf den Blutzuckerspiegel, absolut in Ordnung, weshalb mir diese massiven Blutungen sehr rätselhaft sind. Wann hast du ihn gefunden?«
Marianne Rosenzweig blickte schnell auf, räusperte sich, sagte: »Bitte? Ah, Entschuldigung, ich bin etwas durcheinander. Vor etwa zwanzig Minuten. Wir hatten unseren Bibelabend, dann klingelte das Telefon, er ist in sein Zimmer gegangen, hat aber gesagt, er wäre gleich wieder da. Als er nach einer Viertelstunde nicht wieder herunterkam, wollte ich einfach sehen … Und dann habe ich ihn gefunden.«
»Und was hat er hier gemacht?«
»Ich nehme an, er hat sich wie immer nach dem Abendessen sein Insulin gespritzt.«
»Mit dem Pen?« fragte Laura Fink, die Stirn in Falten gezogen.
»Nein, seiner ist vor ein paar Tagen kaputtgegangen, und er hatte noch keine Zeit, sich einen neuen zu besorgen. Deshalb mußte er wieder die Spritze nehmen.«
»Und wo ist das Insulin?«
»Er bewahrt es in der rechten oberen Schreibtischschublade auf. Warum fragst du?«
Dr. Laura Fink zog die Schublade heraus, nahm das Glas mit der opaken Flüssigkeit zwischen zwei Finger, roch daran, schüttelte den Kopf. Sie stellte das Glas auf den Tisch und nahm die Spritze, betrachtete sie eingehend und legte sie schließlich neben das Glas. Sie blickte Marianne Rosenzweig ratlos an, zog die Handschuhe aus, fragte: »Wie geht es dir? Brauchst du irgend etwas, zur Beruhigung, meine ich?«
Sie bewegte kaum merklich den Kopf, in ihren Augen war eine unendliche Leere. »Nein, ich brauche nichts. Was geschieht jetzt mit ihm?«
»Ich werde auf dem Totenschein vermerken ›Todesursache ungeklärt‹ und dann die Polizei rufen …«
»Polizei?« fragte Marianne Rosenzweig ungläubig. »Warum die Polizei?«
»Nun, so leid es mir tut, aber ich kann die Todesursache deines Mannes nicht bestimmen. Zumindest fehlen mir dazu die Mittel. Ich bin nur eine einfache praktische Ärztin. Es muß herausgefunden werden, woran dein Mann gestorben ist.«
»Er ist tot, reicht das denn nicht?«
»Leider nein. Du siehst doch selber, daß hier kein natürlicher Tod vorliegt. Ich kann auf den Totenschein nicht einfach schreiben: ›Tod durch Herz- und Kreislaufversagen‹, denn diese Todesursache ist nur sekundär, schließlich ist jeder Tod letztendlich eine Folge von Herz- und Kreislaufversagen. Woran er primär gestorben ist, das muß eine Autopsie ergeben. Dein Mann hatte ungewöhnlich massive Blutungen, und jetzt müssen Gerichtsmediziner klären, wodurch diese Blutungen hervorgerufen worden sind. Und außerdem sollten das Insulin und die Spritze untersucht werden …«
»Heißt das, er wird aufgeschnitten?«
Laura Fink blickte achselzuckend zu Boden, schließlich nickte sie und antwortete: »Es wird sich leider nicht vermeiden lassen.«
Marianne Rosenzweig wandte sich ab, den Blick zur Tür gerichtet. Mit einem Mal begann sie leise zu schluchzen. Die Ärztin kam zu ihr, legte eine Hand auf ihre Schulter. »Hör zu, vielleicht wäre es doch besser, wenn ich dir etwas Valium geben würde. Es beruhigt, und vor allem wirst du damit heute nacht einigermaßen schlafen können.«
»Schlafen!« stieß sie mit bitterem Lachen hervor. »Wie soll ich jetzt schlafen? Wir hätten in genau einer Woche unseren zwanzigsten Hochzeitstag gefeiert. Aber er, was macht er? Er macht sich aus dem Staub …! Nein, entschuldige, das wollte ich so nicht sagen. Er kann ja nichts dafür. Irgendeinen Grund für seinen Tod wird es schon geben. Finde diesen Grund heraus. Auch wenn mir der Gedanke, daß mein Mann aufgeschnitten wird, alles andere als angenehm ist.«
»Ich kann dich verstehen, Marianne. Aber egal, was ist, er wird nicht wieder lebendig. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich möchte auch gerne wissen, woran er gestorben ist. Eine Frage – wie hat er sich das Insulin in der Regel injiziert, in den Arm, ins Bein, in den Bauch?«
»Ich weiß nicht, ich war nie dabei. Er hat nur einmal kurz erwähnt, daß er es meistens in den Bauch … Aber sieh doch selbst nach.«
»Tut mir leid, aber ich darf deinen Mann nicht bewegen, bevor die Polizei nicht alle Spuren gesichert hat.« Sie begab sich wieder zu dem Toten, bückte sich, sagte, ohne ihn zu berühren: »Du hast wohl recht. Die Knöpfe seines Hemdes sind noch offen.«
»Und?« fragte Marianne Rosenzweig, die sich wieder umgedreht hatte.
»Wie schon gesagt, eine Untersuchung in der Rechtsmedizin ist unumgänglich.«
»Was denkst du, woran er gestorben ist? Du vermutest doch etwas, oder?«
»Ich kann es nicht sagen, aber es könnte ein toxischer Schock gewesen sein.«
»Toxischer Schock? Was bedeutet das?«
»Es könnte, wohlgemerkt, es könnte Gift im Spiel gewesen sein. Was unter Umständen auch die Blutungen erklären würde. Aber erst eine Obduktion wird Klarheit bringen, was die Todesursache angeht.«
»Gift?!« Marianne Rosenzweig lachte schrill auf. »Wie soll Hans an Gift kommen?« fragte sie mit ungläubigem Blick. »Das ist absolut lächerlich, geradezu absurd!«
»Vielleicht irre ich mich auch …«
»Das tust du ganz bestimmt. In diesem Haus gibt es kein Gift, hier gibt es nicht einmal Tabak oder Alkohol, wie du weißt.«
»Natürlich weiß ich das, es ist auch nur eine Vermutung«, sagte Laura Fink und räusperte sich verlegen. »Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was die Todesursache ist. Aber ich werde jetzt die Polizei rufen und warten, bis die Beamten da sind. Alles weitere liegt dann nicht mehr in meinen Händen. Es tut mir leid, aber ich habe bestimmte Vorschriften … und wenn ich die nicht einhalte … Und du möchtest bestimmt nichts zur Beruhigung?«
»Nein«, erwiderte Marianne Rosenzweig, und mit einem Mal traten Tränen in ihre Augen und rollten langsam über die Wangen. Sie hatte den Blick zu Boden gerichtet, die Hände ineinander verkrampft. »Gott hat mir zwanzig wunderbare Jahre mit meinem Mann geschenkt, und Gott hat ihn jetzt zu sich gerufen … Auch wenn Hans gerade in der Mitte seines Lebens stand … Aber die Wege des Herrn sind für uns Menschen eben unergründlich. Ich werde darüber hinwegkommen, denn ich weiß, er wird auf mich warten, bis auch meine Zeit gekommen ist. Und eines Tages werden wir wieder vereint sein. Eine große, glückliche Familie. Er war ein guter Mann und ein liebevoller Vater.« Sie hielt kurz inne, sah Laura Fink an, lächelte auf einmal und fragte: »Ist es nicht schön zu wissen, daß es ein Leben nach dem Tod gibt?«
Die Angesprochene zuckte die Schultern. »Natürlich. Und egal wie lange es dauert, bis deine Zeit gekommen ist, er wird auf dich warten. Die ersten Tage oder Wochen werden nicht einfach für dich sein, aber du weißt ja, es gibt viele, die dir über diese schwere Zeit hinweghelfen werden.«
»Ja, das weiß ich. Und ich glaube fest daran, Hans eines Tages wiederzusehen. Wer Glauben hat, dem ist nichts unmöglich.«
»Sicher. Aber ich muß jetzt telefonieren. Kann ich das von hier machen?«
»Bitte, dort steht das Telefon.«
Laura Fink nahm den Hörer ab und wählte den Notruf 110 der Polizei. Als am andern Ende abgenommen wurde, meldete sie sich. »Hier ist Dr. Fink. Ich möchte Sie bitten, einen Wagen in die Weinbergstraße in Sindlingen zu Dr. Rosenzweig zu schicken. Ich habe hier einen männlichen Toten mit unklarer Todesursache.« Nach dem kurzen Gespräch legte sie auf, schaute zur Uhr.
»Der Wagen wird in wenigen Minuten hier sein. Ich warte solange.«
»Gehen wir nach unten«, sagte Frau Rosenzweig und begab sich zur Tür. Die junge Ärztin klappte ihre Tasche zu, nahm sie in die Hand und folgte Marianne Rosenzweig ins Wohnzimmer. Sie warteten fast schweigend auf den angeforderten Wagen, der bereits zehn Minuten später eintraf. Die beiden Streifenbeamten, ein etwa fünfunddreißigjähriger Mann und eine Endzwanzigerin, betraten das Haus. Laura Fink begleitete sie in das Büro des Toten. Der Mann kratzte sich am Kopf, fragte mit belegter Stimme: »Wie ist er gestorben?«
»Keine Ahnung, deshalb habe ich Sie ja gerufen. Die Todesursache ist nicht klar ersichtlich. Herr Rosenzweig litt an Diabetes, hat sich wohl auch Insulin gespritzt, doch Insulin bewirkt keine derartigen Blutungen.«
»Da müssen wir wohl die Kollegen vom KDD holen.«
»KDD?« fragte Dr. Fink.
»Kriminaldauerdienst. Ist hier irgendwas verändert worden?«
»Von mir nicht. Und soweit ich weiß, von Frau Rosenzweig auch nicht. Zumindest weist die Art und Weise, wie ich den Toten vorgefunden habe, darauf hin, daß er nicht bewegt worden ist. Der Blutstrom aus Nase und Mund verläuft sehr gleichmäßig.«
»Gut, dann werden wir die Kripo und die Spurensicherung rufen und den Tatort sichern. Mehr können wir auch nicht tun. Sie müssen allerdings hierbleiben, bis die Kollegen da sind. Sie werden wohl die eine oder andere Frage haben.« Und an seine Kollegin gewandt, sagte er: »Ruf doch mal über Funk beim KDD an. Und die sollen sich beeilen.«
Als die junge Beamtin den Raum verlassen hatte, fragte der Polizist: »Und was ist Ihre Vermutung?«
»Unter Umständen Gift, aber«, Laura Fink zuckte die Achseln, »beurteilen kann ich das nicht.«
»Okay, dann warten wir mal auf die andern.«
Nach weiteren zwanzig Minuten trafen die Beamten des KDD sowie die Spurensicherung und ein Fotograf ein.
»In Ordnung«, sagte einer der Beamten, ein noch junger Mann in Jeans und kurzärmeligem Hemd, nachdem er der Ärztin fast die gleichen Fragen gestellt hatte wie der Streifenbeamte, »dann werden wir als erstes den gesamten Raum fotografieren. Die Spurensicherung wird danach ihre Arbeit erledigen. Ich fürchte, wir müssen auch die Mordkommission einschalten. Irgendwie riecht’s hier gewaltig nach Mord, um nicht zu sagen, es stinkt. Mal sehen, wer heute Bereitschaft hat.« Er ging zum Auto, funkte die Zentrale an und bat um Unterstützung der Mordkommission. Wieder in Rosenzweigs Büro, sagte er: »Sie werden in etwa zwanzig Minuten hier sein. Wir sollen den Toten aber unter gar keinen Umständen anrühren.«
Laura Fink begab sich nach unten zu Frau Rosenzweig, sagte: »Es tut mir leid, was mit deinem Mann geschehen ist, aber ich wollte dir nur sagen, daß gleich auch noch ein paar Beamte von der Mordkommission kommen werden.«
»Das macht jetzt auch nichts mehr«, erwiderte Marianne Rosenzweig schulterzuckend. »Vielen Dank für deine Mühe. Wie und wann werde ich erfahren, woran mein Mann gestorben ist?«
»Ich denke, man wird die Todesursache recht schnell herausfinden. Vielleicht weiß man ja schon morgen früh etwas mehr. Womöglich ergibt sich ja allein schon aus der Untersuchung des Insulins etwas.«
»Woran ist Papa gestorben?« fragte Aaron, der ältere der beiden Söhne.
»Das weiß man noch nicht«, erwiderte seine Mutter.
»War es wegen seiner Zuckerkrankheit?«
»Frag mich nicht, aber morgen …«
»Ich werde Papa sehr vermissen …«
»Wir alle werden ihn vermissen. Aber ihr wißt ja, wir sehen ihn eines Tages wieder. So, und jetzt werde ich Bruder Schönau anrufen und ihm erzählen, was passiert ist.«
»Du bist sehr traurig, nicht?« sagte Aaron.
»Ja, ich bin traurig, sehr traurig sogar«, erwiderte Marianne Rosenzweig und strich ihm liebevoll mit der Hand übers Haar. »Und ich glaube, meine Traurigkeit wird in den nächsten Tagen noch schlimmer werden. Wir müssen jetzt zusammenhalten und gemeinsam diesen Weg der Trauer gehen.«
Sie umarmte ihre Söhne, lächelte ihnen aufmunternd zu, auch wenn ihr im Augenblick zum Heulen zumute war, ging zum Telefon und wählte die Nummer von Bruder Schönau. Sie sprach eine Viertelstunde mit ihm; er fragte, ob er vorbeikommen solle, doch sie wollte es nicht, nicht jetzt, wo das Haus von Polizei nur so wimmelte. Morgen früh vielleicht.
Montag, 22.15 Uhr
Julia Durant, Hauptkommissarin bei der Kripo Frankfurt, schlug den ihr von einer Kollegin so warm empfohlenen sogenannten Krimi zu und warf ihn auf den Tisch. Sie ärgerte sich über die vierundvierzig Mark, die sie für diese endlose Langeweile ausgegeben hatte; sie wußte, wenn es nicht spätestens nach fünfzig Seiten einigermaßen spannend und interessant wurde, würde auch der Rest des Buches eine einzige Quälerei sein. Sie hatte keine Ahnung, nach welchen Kriterien andere ihre Bücher auswählten, aber es waren mit Sicherheit nicht die gleichen, nach denen sie vorging. Für sie mußte ein Buch spannend, die Charaktere plastisch und die Handlung nicht zähflüssig wie Haferschleim und an den Haaren herbeigezogen sein, sie mußte sich statt dessen in die Gedanken- und Gefühlswelt der Protagonisten hineinversetzen und die Handlung miterleben können, als wäre sie direkt dabei. Das hatte sie jedoch bisher nur bei ganz wenigen Büchern vermocht, Bücher, die sie derart in ihren Bann zogen, daß sie gar nicht bemerkte, wie schnell die Zeit verflog, und enttäuscht war, wenn der Roman nach fünfhundert Seiten plötzlich zu Ende war.
Sie hatte die Beine hochgelegt, nahm die Fernbedienung in die rechte Hand und zappte sich durch ein paar Kanäle, bis sie bei Viva hängenblieb und sich einen Live-Mitschnitt von Bryan Adams ansah. Sie zündete sich eine filterlose Gauloise an, trank einen Schluck aus der Dose Bier, das jetzt warm und fade schmeckte. Sie erhob sich, schüttete den restlichen Inhalt in den Ausguß und ging zum Kühlschrank, um sich eine neue herauszuholen. Sie riß den Verschluß auf, stellte die Dose neben die Couch, nahm einen tiefen Zug an der Zigarette, schnippte die Asche in den Aschenbecher, sah kurz zum Fernseher, dann zum Fenster. Es war nicht ihr Tag gewesen; Büroarbeit, lange liegengebliebene Berichte fertigstellen, um halb fünf nach Hause fahren. Sie war kurz einkaufen gewesen, hatte ein wenig aufgeräumt, obgleich ein gründlicher Hausputz längst überfällig war. Die Fenster gierten nach Wasser, die Gardinen waren seit dem letzten Herbst nicht gewaschen worden, das letzte Mal, daß sie einen Staubsauger zur Hand genommen hatte, lag zwei oder drei Wochen zurück. Doch die seit nunmehr zwei Wochen anhaltende Hitze lähmte sie, und selbst jetzt, um diese Zeit, war es noch immer so warm und stickig in der Wohnung, daß sie bezweifelte, diese Nacht gut schlafen zu können.
Sie hatte ihren Vater anrufen wollen, doch der war wieder einmal nicht zu Hause, danach hatte sie es bei Susanne Tomlin in Südfrankreich versucht, aber auch dort hatte niemand den Hörer abgenommen, als letztes versuchte sie es bei Werner Petrol, auch hier nur der Anrufbeantworter. Sie hatte leichte, stechende Schmerzen in der linken Schläfe. Es war nicht viel Aufregendes passiert in den letzten sechs Wochen, einige Routineeinsätze, ein versuchter Mord an einer Prostituierten im Sperrbezirk nahe des Hauptbahnhofs, die nie wieder ein normales Leben würde führen können, da der Täter ihr das Gesicht und die Brust zerschnitten hatte, sowie ein Raubmord an einer dreiundachtzigjährigen Frau, die allein in einem winzigen Haus in einem alten, heruntergekommenen Viertel gelebt hatte und von deren Mörder bislang jede Spur fehlte. Was den Fall jedoch besonders grausam und sinnlos machte, war die Tatsache, daß die alte Frau vor ihrem Tod von ihrem Peiniger noch vergewaltigt worden war und es sich nach Meinung des Polizeipsychologen bei dem Mörder um einen Mann handelte, der nicht nur äußerst gewaltbereit war, sondern auch sexuell extrem perverse Neigungen hatte.
Der erste Fall war kaum lösbar, da er sich innerhalb eines Milieus abgespielt hatte, in dem eigene Regeln und Gesetze herrschten, und Julia Durant und ihre Kollegen Hellmer und Kullmer bei ihren Befragungen auf eine Mauer des Schweigens stießen. Selbst die junge Frau, die längst außer Lebensgefahr war, aber für den Rest ihres Lebens deutliche Zeichen der Tat in ihrem Gesicht und an ihrem Körper tragen würde, gab vor, sich an nichts erinnern zu können. Also würde man diesen Fall bald zu den Akten legen.
Sie rauchte die Zigarette zu Ende, drückte sie aus, nahm die Bierdose und ging damit zum Fenster, das weit offenstand. Es war beinahe windstill, der nächtliche Himmel wolkenlos, aus den Bäumen drang noch vereinzelt das zaghafte Zwitschern von Vögeln. Aus einem Nachbarhaus erklang Klaviermusik, von irgendwoher kamen laute, sich zankende Stimmen. Sie wollte gerade einen Schluck nehmen, als das Telefon klingelte. Nach dem dritten Läuten hob sie ab, meldete sich. Sie hörte dem Beamten vom KDD zu, sagte nur, sie würde in etwa einer Viertelstunde mit einem Kollegen da sein. Sie trank die Dose halbleer, stellte sie in den Kühlschrank, rief kurz bei Hauptkommissar Frank Hellmer an, zog sich Jeans, eine blaue Bluse und Tennisschuhe an, nahm ihre Handtasche vom Sofa, machte den Fernsehapparat aus und verließ die Wohnung. »Scheißbereitschaft«, murmelte sie verärgert, während sie die Treppe hinunterging.
Hellmer, der seit knapp einem Jahr mit seiner Frau Nadine in einer noblen Villa in Hattersheim wohnte und nur ein paar Minuten zum Ort des vermeintlichen Verbrechens brauchte, war bereits da. Er stand zusammen mit den Beamten des KDD auf dem Flur.
»Und?« fragte sie ihn. »Was ist passiert?«
Er zuckte die Achseln. »Wenn ich das wüßte. Es sieht auf jeden Fall nicht nach einem natürlichen Tod aus. Aber schau’s dir selber an.«
Julia Durant betrat zusammen mit Hellmer den Raum, in dem drei Kollegen von der Spurensicherung bei der Arbeit waren.
»Wer hat ihn gefunden?« fragte sie, während sie sich auf den Schreibtisch zubewegte.
»Seine Frau.«
»Und wann?«
»Vor etwa anderthalb Stunden. Sie hat sofort ihre Hausärztin angerufen, die allerdings gleich die Polizei verständigte. Tja, und jetzt sind wir hier.«
»Wo ist die Ärztin?« fragte sie und warf einen langen Blick auf den Toten, dessen Gesicht in einer Lache aus geronnenem Blut lag.
»Ich bin Dr. Fink«, sagte die Frau, die jetzt hinter der Kommissarin stand.
Sie drehte sich zu ihr um, musterte die junge Frau, die zwar kein schönes, aber ein hübsches und sehr markantes Gesicht hatte, einen Augenblick, fragte: »Sie haben nichts berührt?«
»Nein. Ich habe lediglich seinen Puls gefühlt und ihm in die Augen geleuchtet. Alles andere wollte ich Ihnen überlassen.«
»Und, haben Sie eine Vermutung? Ich meine, was die Todesursache sein könnte?«
»Sicher, aber es ist nur eine Vermutung. Die extreme Blutung kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, doch keine der, sagen wir ›normalen‹ Möglichkeiten, trifft auf Herrn Rosenzweig zu …«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Nun, Herr Rosenzweig war bei mir in Behandlung, er litt seit etwa drei Jahren unter Diabetes mellitus und hat sich regelmäßig den notwendigen Untersuchungen unterzogen. Er war, bis auf seinen erhöhten Blutzuckerspiegel, ein kerngesunder Mann. Er war erst letzte Woche bei mir. Deshalb …«
Wieder wurde sie von der Kommissarin unterbrochen. »Welche normalen Faktoren können zu derartigen Blutungen führen?«
»Es gibt verschiedene Ursachen. Zum Beispiel eine extrem verminderte Zahl der Thrombozyten, das heißt der Blutplättchen, die für die Blutgerinnung verantwortlich sind, eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung, Leukämie, und einiges mehr. Doch bei der letzten Untersuchung lagen Herrn Rosenzweigs Blutwerte absolut im Normbereich. Seine Thrombozytenzahl war normal, es gab auch keinerlei Hinweise, die auf eine ernsthafte innere Erkrankung hindeuteten. Deshalb kommt mir dieser Tod, der offensichtlich durch Verbluten eingetreten ist, bei ihm mehr als merkwürdig vor. Ein potentieller Herzinfarkt oder ein Schlaganfall kann nie mit Sicherheit ausgeschlossen werden, wenn man lediglich die üblichen Laborwerte zugrunde legt. Aber Herr Rosenzweig ist weder an einem Herzinfarkt noch an einem Schlaganfall gestorben.«
»Und an was ist er Ihrer Meinung nach gestorben?«
»Es gibt bestimmte Toxinmischungen, die derartige Blutungen auslösen können …«
»Was für Toxine?«
»Nun, zum Beispiel Schlangengifte. Es gibt unter anderem einige sehr hochwirksame Schlangengifte, die ganz erheblich in die Blutgerinnung eingreifen und das Blut praktisch ungerinnbar machen. In solchen Fällen kommt es dann zu einer sogenannten Verbrauchskoagulopathie, bei der selbst geringste, mit bloßem Auge kaum sichtbare Wunden plötzlich anfangen zu bluten. Das können winzige Risse in der Haut sein, die man sich beim Rasieren zugezogen hat, oder mikroskopisch kleine Wunden in der Mundschleimhaut. Es kann aber auch, wie hier, zu starkem Nasenbluten kommen oder zu schweren inneren Blutungen. Ich würde sagen, Herr Rosenzweig ist sowohl innerlich als auch äußerlich verblutet.«
Julia Durant fuhr sich mit der linken Hand über den Mund, ließ einen Moment verstreichen, bevor sie ihre nächste Frage stellte. »Also, halten wir fest – Rosenzweig hat sich letzte Woche dem normalen Routinecheck bei Ihnen unterzogen, bei dem nichts Auffälliges festgestellt wurde, wie Sie sagen. Das einzige, woran er litt, war Diabetes, richtig?«
»Ja.«
»Okay, dann werden wir uns den Toten mal aus der Nähe anschauen.« Die Kommissarin ging um den Schreibtisch herum, ging in die Hocke und betrachtete den Toten. »Sein Hemd ist offen«, sagte sie, worauf Laura Fink antwortete: »Er ist, wie seine Frau sagt, gegen halb neun in sein Zimmer gegangen und hat sich das Insulin gespritzt. Danach hat er das Glas mit dem Insulin und die Spritze wieder in die Schreibtischschublade gelegt.«
»Und wieso ist beides jetzt auf dem Tisch?« fragte Julia Durant, den Blick auf die Ärztin gerichtet.
Sie machte ein etwas verlegenes Gesicht. »Ich habe beides herausgeholt und daran gerochen, konnte aber nichts Ungewöhnliches feststellen. Tut mir leid, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Ich hatte allerdings Handschuhe an, falls Sie nach Fingerabdrücken suchen. Meine befinden sich nicht darauf.«
»Schon gut. Wir werden sowohl den Glasinhalt als auch die Spritze untersuchen lassen. Und selbstverständlich eine Obduktion vornehmen lassen.« Sie sah Hellmer an, sagte: »Hilf mir mal, ihn richtig hinzusetzen.« Hellmer und Durant faßten den Toten an der Schulter und setzten ihn aufrecht hin.
»Was ist das?« fragte sie und deutete auf eine fast schwarze, runde Stelle von etwa zehn Zentimetern Durchmesser an der Bauchdecke. Dr. Fink kam zu ihr, befühlte die Stelle, schüttelte den Kopf, meinte lakonisch: »Um die Einstichstelle hat sich eine Gewebsnekrose gebildet.«
»Und was heißt das im Klartext?«
»Das heißt, daß das Gewebe hier abgestorben ist. Was im Prinzip meine Theorie nur erhärtet, daß wir es hier mit Gift zu tun haben. Und zwar mit einem äußerst wirksamen Gift. Herr Rosenzweig hat sich meiner Meinung nach alles, nur kein Insulin gespritzt.«
»Scheiße!« quetschte Julia Durant durch die Zähne. »Könnte es Selbstmord gewesen sein?«
»Unwahrscheinlich«, sagte Laura Fink kopfschüttelnd. »Rosenzweig war nicht suizidgefährdet. Er gehörte nicht zu denen, die sich das Leben nehmen. Schon gar nicht auf eine solche Weise …«
»Sind Sie auch noch Psychologin oder Psychiaterin?« wurde sie von der Kommissarin etwas unwirsch unterbrochen.
»Nein«, erwiderte Laura Fink ruhig, als hätte sie den Ton nicht bemerkt, »aber ich kenne, oder besser kannte Herrn Rosenzweig seit vielen Jahren. Er war erfolgreich, angesehen, führte ein harmonisches Eheleben, soweit ich das beurteilen kann, und er war ein sehr engagiertes Kirchenmitglied. Außerdem, wie soll er denn an das Gift gekommen sein, wenn es denn Gift war?«
»Gut, schließen wir also Suizid aus. Dann war es Mord.« Sie sah die Ärztin an, sagte: »Danke für Ihre Hilfe. Ich denke, alles weitere werden wir der Gerichtsmedizin und dem Labor überlassen. Und dann sind wir gefragt. Sie können gehen. Es könnte aber sein, daß wir in den nächsten Tagen noch ein paar Fragen haben.«
Laura Fink verabschiedete sich und wollte gerade den Raum verlassen, als die Kommissarin sie zurückhielt. »Einen Moment noch«, sagte sie und machte ein nachdenkliches Gesicht. »Ich kenne Leute, die unter Diabetes leiden, und kaum einer von denen benutzt heutzutage noch eine Spritze. Es gibt doch so einen Apparat, der …«
»Sie meinen einen Pen. Tja, ich habe mich auch gewundert, daß er ihn nicht benutzt hat, aber Frau Rosenzweig sagte mir, seiner sei vor ein paar Tagen kaputtgegangen, und er sei noch nicht dazu gekommen, sich einen neuen zu besorgen. Er wollte das aber in den nächsten Tagen tun. Nun, er hatte das Insulin sicherlich noch bereitliegen, schließlich kann es immer mal vorkommen, daß ein empfindliches Gerät wie der Pen kaputtgeht, und man will ja kein Risiko eingehen. Aber hätte er ihn jetzt schon gehabt, ich bezweifle, daß ein Verbrechen dieser Art, wenn es denn eines war, möglich gewesen wäre. Aber was nützen jetzt noch Spekulationen. Er ist tot, und Sie müssen herausfinden, ob es Suizid oder Mord war. Gute Nacht.«
»Nur noch eine Frage«, sagte Durant, »wieviel Insulin spritzt sich ein Diabetiker in der Regel?«
Laura Fink zuckte die Schultern, sagte: »Das hängt vom Schweregrad der Krankheit ab. Aber in der Regel etwa einen bis anderthalb Milliliter. Warum?«
»Nur so. Sie können gehen.«
Julia Durant sah Hellmer an. »Dann werden wir uns mal um seine Frau kümmern.« Und an die beiden Männer in den grauen Anzügen gewandt: »Sie können ihn abtransportieren. Er kommt in die Rechtsmedizin.« Sie schürzte die Lippen, sah sich noch einmal im Raum um, sagte: »Komm, es gibt ein paar Fragen, die wir Frau Rosenzweig stellen müssen. Ach ja«, fuhr sie fort und deutete auf einen der Männer von der Spurensicherung, »die Flasche mit dem Insulin oder was immer da drin ist, kommt noch heute nacht ins Labor. Ich will morgen früh wissen, was das für’n Zeug ist. Fingerabdrücke von der Flasche und der Spritze sind doch schon genommen, oder?«
»Ja, natürlich.«
»Und wie viele Abdrücke habt Ihr gefunden?«
»Auf der Flasche zwei nicht identische.«
»Zwei? Ich hätte wetten können, daß nur die von Rosenzweig drauf sind. Dann werden wir doch gleich mal die Abdrücke seiner Frau und die der Söhne nehmen. Macht das doch mal bitte schnell, bevor wir da unten ein paar Fragen stellen. Obwohl, es könnte natürlich auch der Apotheker oder eine Angestellte …« Sie machte eine Pause, überlegte, sagte: »Stop mal alle, bevor ihr geht, ich will erst sehen, wer von der Rechtsmedizin heute nacht Bereitschaft hat.« Sie nahm ihr Handy aus der Tasche und wählte eine Nummer. Nach einer Weile wurde sie verbunden.
»Morbs«, meldete sich eine barsche Stimme. Durants Gesicht hellte sich auf, als sie seine Stimme vernahm.
»Guten Abend, Professor Morbs, hier ist Durant vom K11. Das ist fast schon mehr als ein Zufall, daß ausgerechnet Sie heute nacht Dienst haben. Wir haben hier nämlich eine männliche Leiche, und die Todesursache ist im Augenblick noch völlig unklar. Der Mann ist an extremen Blutungen gestorben, nachdem er sich angeblich Insulin gespritzt hat. Die Hausärztin der Familie sagt, es könnte Gift, unter Umständen Schlangengift, im Spiel gewesen sein. Sie sind doch Spezialist für Gifte, vor allem Schlangengifte, und Sie haben doch auch schon mehrere Bücher darüber geschrieben. Hätten Sie nicht Lust, sich den Toten mal vor Ort anzuschauen?«
»Was für Blutungen?«
»Nase, Mund, Haut … Ach ja, um die Einstichstelle hat sich eine Gewebsnekrose gebildet, was laut Aussage der Ärztin ebenfalls ein Indiz für …«
»Sie hat wahrscheinlich recht«, wurde sie von Morbs unterbrochen. »Lassen Sie den Toten in die Gerichtsmedizin bringen, damit ich ihn mir gleich mal ansehen kann. Ich mach mich sofort auf den Weg. Und wenn noch etwas von dem angeblichen Insulin da ist, lassen Sie’s auch mitbringen.«
»Das heißt, Sie werden noch heute nacht …«
»Was glauben Sie denn?! Ich hab doch sonst nichts zu tun!«
»Und wann, glauben Sie, werden Sie sagen können …«
»Woher soll ich das wissen? Vielleicht morgen früh, vielleicht übermorgen, vielleicht in einer Woche. Sie werden schon warten müssen, bis ich mit meiner Arbeit fertig bin. Also, ich mach mich auf den Weg.« Morbs legte auf, ohne eine Erwiderung abzuwarten.
Julia Durant grinste Hellmer an. »Unser Giftspezi hat Dienst. So stell ich mir eine gute Zusammenarbeit vor. Und jetzt gehen wir runter, der Familie ein paar Fragen stellen.« Sie begab sich mit Hellmer hinunter ins Erdgeschoß, wo Marianne Rosenzweig und ihre beiden Söhne im Wohnzimmer saßen. Es war ein großer, in sanftes, indirektes Licht getauchter, abgestufter Raum, eingerichtet mit einer erlesenen, blauen Ledergarnitur und einer maßgefertigten, etwa sechs Meter langen und knapp drei Meter hohen Schrankwand, die sich rechtwinklig an der Wand entlangzog. Dicke Teppiche schluckten beinahe jeden Schritt. Etwa in der Mitte des Raumes gelangte man über zwei Stufen in den hinteren Teil, wo sich ein Kamin befand und, wie Julia Durant vermutete, echte Bilder großer Meister an den Wänden hingen.
»Frau Rosenzweig«, sagte die Kommissarin und trat einen Schritt näher, »wir haben uns noch nicht vorgestellt, ich bin Hauptkommissarin Durant und das ist mein Kollege Hellmer. Wir würden Ihnen gern noch ein paar Fragen stellen, wenn es Ihnen nichts ausmacht.«
Marianne Rosenzweig erhob sich und kam auf die beiden Beamten zu. Sie war eine kleine, zierliche Frau, die ein schlichtes, aber elegantes Sommerkleid trug; keine Schönheit, doch eine auffallende Erscheinung mit markanten Gesichtszügen, brünettem, bis auf die Schulter fallendem, leicht gewelltem Haar, grünen Augen und vollen, sinnlichen Lippen. Das einzige, was die Ebenmäßigkeit ihres Gesichts störte, waren die Falten um die Nase und die leicht heruntergezogenen Mundwinkel, die ihr ein etwas bitteres Aussehen verliehen und ihr Alter nur schwer schätzen ließen.
»Bitte, nehmen Sie doch Platz«, sagte sie mit leiser Stimme und deutete auf zwei Sessel. »Möchten Sie mit mir allein sprechen oder sollen meine Söhne dabei sein?«
»Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir uns zunächst allein unterhalten würden.«
»Aaron, Joseph, geht bitte solange auf eure Zimmer …«
»Wir haben später vielleicht auch noch ein paar Fragen an euch«, sagte die Kommissarin. Aaron und Joseph verließen wortlos den Raum und schlossen die Tür hinter sich. Julia Durant und Frank Hellmer setzten sich Frau Rosenzweig gegenüber. Bevor sie eine Frage stellen konnte, sagte Frau Rosenzweig: »Warum haben Sie von mir und meinen Söhnen Fingerabdrücke genommen?«
»Nun, die Spurensicherung hat Fingerabdrücke von mindestens zwei Personen auf der Flasche gefunden. Reine Routine.«
»Das heißt dann doch aber auch, daß Sie unter Umständen meine Söhne oder mich verdächtigen, mit dem Tod meines Mannes etwas zu tun zu haben. Oder irre ich mich da?«
»Frau Rosenzweig, der Tod Ihres Mannes ist sehr mysteriös. Und unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, wer alles die Flasche angefaßt hat, außer Ihrem Mann natürlich. Haben Sie die Flasche heute berührt?«
»Nein, nicht daß ich wüßte. Ich habe mit seinem Insulin nichts zu tun. Warum also sollte ich es anfassen?«
»Gut, mehr wollten wir im Augenblick dazu auch nicht wissen. Die Auswertung der Fingerabdrücke wird bis morgen erledigt sein. Doch jetzt zu etwas anderem. Frau Rosenzweig«, sagte die Kommissarin, »erzählen Sie mir doch bitte, wie sich der heutige Abend bei Ihnen abgespielt hat.«
Marianne Rosenzweig, die einen sehr gefaßten Eindruck machte, legte den Kopf ein wenig zur Seite, sah die Beamten an. Sie zuckte die Schultern, überlegte einen Moment, bevor sie antwortete: »Nun, mein Mann kam wie jeden Montag gegen neunzehn Uhr von der Arbeit, dann haben wir zu Abend gegessen und anschließend im Familienkreis eine Bibelstunde abgehalten. Ich weiß nicht genau, aber es war etwa halb neun, als das Telefon klingelte. Mein Mann ging ran und hat den Anruf in sein Arbeitszimmer umgestellt. Dann ging er nach oben und hat sich nach dem Telefonat wohl das Insulin gespritzt.«
»Wer hat angerufen?« fragte Hellmer neugierig.
»Keine Ahnung, mein Mann hat nichts gesagt. Aber hier rufen sehr oft Leute an, die meinen Mann sprechen wollen, und wenn ich jedesmal fragen würde, wer dran ist … Na ja, mein Mann war sehr beschäftigt, nicht nur beruflich, sondern auch in der Kirche. Sein Leben bestand im Prinzip nur aus Arbeit.«
»Was hat Ihr Mann beruflich gemacht?«
»Er ist – er war Unternehmensberater. Aber fragen Sie mich um Himmels willen nicht, was er da genau getan hat, ich habe mich ehrlich gesagt aus seinen beruflichen Angelegenheiten rausgehalten, ich hätte es sowieso nicht verstanden.«
»Hatte er sein eigenes Unternehmen?«
»Er hatte einen Kompagnon, mit dem zusammen er das Geschäft leitete. Und dann natürlich noch dreißig oder vierzig Angestellte. Aber wie gesagt, was seine Geschäfte anging, da kannte ich mich nicht aus.«
»Gut, Sie haben aber auch etwas von kirchlicher Arbeit erwähnt. Können Sie mir mehr darüber sagen?«
Marianne Rosenzweig lächelte auf einmal. »Wir gehören der Kirche des Elohim an, wenn Ihnen das etwas sagt. Es ist eine Kirche, in der jeder gefordert ist, einen Teil seines Lebens ehrenamtlich Gott zu weihen. Was nichts anderes heißt, als daß jeder eine bestimmte Berufung ausübt.«
»Ich habe von dieser Kirche gehört«, sagte Julia Durant. »Welche Funktion hatte Ihr Mann dort inne?«
»Er war einer der Berater des Regionshirten.«
»Regionshirte? Können Sie mir das etwas näher erläutern?«
»Der Regionshirte ist die oberste Autorität in der Region Kassel-Frankfurt-Mannheim. Das heißt, alle Gemeinden von Kassel über Frankfurt bis hinunter nach Mannheim gehören zu seinem Bereich. In Zahlen ausgedrückt, etwa zehntausend Mitglieder.«
»In Ordnung, belassen wir’s dabei. Was mich viel mehr interessieren würde – hatte Ihr Mann Feinde?«
»Feinde? Keine Ahnung. Im Beruf vielleicht, es gibt immer Neider, die einem den Erfolg nicht gönnen, auch wenn man sich den hart erarbeitet hat. Aber wenn Sie Namen von mir hören wollen, damit kann ich nicht dienen. Und in der Kirche, nein. In der Kirche hat man keine Feinde. Es sind gute Leute, auch wenn es wie überall ein paar schwarze Schafe gibt. Aber die meisten sind gut und gottesfürchtig.«
Julia Durant lehnte sich zurück, öffnete die Handtasche, holte die Schachtel Gauloises heraus und wollte sich gerade eine anzünden, als Frau Rosenzweig sie freundlich zurückhielt. »Bitte, aber wir rauchen nicht, und …«
Die Kommissarin errötete leicht und steckte die Zigarette mit einem Murmeln wieder zurück.
»Entschuldigung, ich …«
»Schon gut. Es gibt ein paar Grundsätze, auf die wir Wert legen, und dazu gehört, daß wir nicht rauchen, keinen Alkohol trinken und überhaupt auf Genußmittel jeder Art verzichten. Ich verlange nicht, daß Sie das verstehen, doch bis jetzt hat es noch keinem von uns geschadet.«
Hellmer grinste nur, während Julia Durant sich eine Bemerkung verkniff. Statt dessen sagte sie: »Auch wenn es vielleicht zu persönlich erscheinen mag – aber wie war Ihre Ehe?«
Für den Bruchteil einer Sekunde zuckte Marianne Rosenzweig zusammen, ihr Blick wurde mit einem Mal kühl und abweisend. Mit Nachdruck sagte sie: »Wir haben eine ausgesprochen harmonische Ehe geführt. Ja, eine sehr harmonische Ehe. Wir hätten in Kürze unseren zwanzigsten Hochzeitstag gefeiert, doch leider ist etwas dazwischen gekommen. Nun, das Leben ist nicht berechenbar, ebensowenig der Zeitpunkt des Todes. Aber mit dem Tod haben Sie sicherlich mehr Erfahrung als ich. Ich habe noch nicht viele Menschen sterben sehen.«
»Hat Ihre Ärztin mit Ihnen über die mögliche Todesursache Ihres Mannes gesprochen?«
»Ja, das hat sie allerdings. Ich bin sehr überrascht und kann es kaum glauben. Warum sollte mein Mann sich Gift spritzen? Wenn er sich hätte umbringen wollen, dann hätte er doch sicherlich eine weniger qualvolle Methode gewählt, oder?« fragte sie und betrachtete dabei ihre schlanken, wohlgeformten Hände.
»Glauben Sie denn, daß Ihr Mann sich umgebracht hat?« fragte Hellmer und blickte die ihm gegenübersitzende Frau direkt an, die seinen Blick jedoch nicht erwiderte.
»Nein, ich wüßte nicht, warum er das getan haben sollte. Es gab keinen Grund, es gab absolut keinen Grund. Ich kann einfach nicht glauben, daß er tot ist.«
»Nun, Frau Rosenzweig, wir werden abwarten müssen, was die Obduktion und die Analyse des Insulins ergibt. Sollte sich allerdings herausstellen, daß sich in dem Fläschchen kein Insulin befunden hat, sondern ein hochwirksames Gift, dann wirft das natürlich die Frage auf, wie das Gift, wenn es Selbstmord war, in seinen Besitz gekommen ist, oder, sollte es Mord gewesen sein, wer das Gift in seinem Schreibtisch deponiert hat. Wobei auch hier die Frage ist, woher der Täter das Gift hatte. Und noch eine Frage beschäftigt mich; warum ist das Unglück ausgerechnet zu einem Zeitpunkt passiert, wo sein Injektionsapparat defekt war und er wieder eine normale Spritze benutzen mußte? Wer hatte alles Zugang zum Schreibtisch Ihres Mannes?«
Marianne Rosenzweig blickte auf, kniff die Augen zusammen und schien durch Hellmer hindurchzusehen. Sie schüttelte kaum merklich den Kopf. »Er selbst, ich, die Kinder und unsere Haushälterin. Aber ich habe sein Arbeitszimmer in den letzten Monaten nicht mehr betreten. Es war so eine Art Refugium für ihn, von dort führte er seine Telefonate, dort hat er den größten Teil seiner kirchlichen Arbeit erledigt, zumindest was das Administrative anging, und dorthin hat er sich zurückgezogen, wenn er einfach seine Ruhe haben wollte. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus?«
»Wir gehen davon aus, daß Ihr Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Und wenn diese Vermutung zutrifft, dann werden wir noch einige sicherlich unangenehme Fragen stellen müssen. Und um noch einmal auf Ihre Ehe zurückzukommen, auch wenn es jetzt vielleicht etwas hart klingt – hatte Ihr Mann ein Verhältnis? Jetzt, oder vielleicht früher einmal?«
Marianne Rosenzweig sah Julia Durant erst verwundert über die ungewöhnliche Frage an, dann wurde ihr Blick mit einem Mal eisig. »Hören Sie, ich sagte Ihnen bereits, unsere Ehe war sehr harmonisch! Mein Mann hatte kein Verhältnis, er hatte so etwas nicht nötig, wenn Sie verstehen, was ich meine. Außerdem ist Keuschheit und die damit verbundene eheliche Treue eines der obersten Gebote in unserer Kirche. Ehebruch kommt gleich hinter Mord und wird unweigerlich mit Ausschluß bestraft, es sei denn, der Ehebrecher bereut seine Tat. Genügt Ihnen das?«
»Vor wem muß er die Tat bereuen? Vor Gott?«
»Natürlich vor Gott, aber auch vor den Menschen. Es gibt so etwas wie ein Kirchengericht, das entscheidet, ob jemand wegen Ehebruchs oder anderer sexueller Verfehlungen ausgeschlossen wird oder ob er nur für eine Weile nicht am gemeinschaftlichen Kirchenleben teilhaben darf. Für Sie mag das altmodisch und überholt klingen, aber Gottes Gesetze und Gebote haben sich zu keiner Zeit geändert. Und wir leben in einer sehr verderbten Welt, und gerade heute ist es mehr denn je notwendig, sich von dem fernzuhalten, was so oft als gut und für den Menschen nützlich angepriesen wird. Sehen Sie sich doch einmal die Filme an, die im Fernsehen gezeigt werden! Es gibt doch nur noch Sex und Mord.« Sie hielt einen Moment inne, bevor sie fortfuhr: »Nun, wir haben unseren Fernsehapparat abgeschafft. Man muß sich die Welt mit all ihren Perversionen nicht Tag für Tag ins Haus holen«, sagte sie mit einer Bitterkeit, die Julia Durant aufhorchen ließ. »Nein, das muß man wirklich nicht. Unsere Kinder sollen mit Werten aufwachsen, die heutzutage kaum noch etwas gelten oder gar gelehrt werden. Und damit meine ich vor allem moralische Werte.«
»Sagen Sie mir doch bitte noch etwas genauer, wie dieses Bereuen vor den Menschen aussieht. Gesteht man öffentlich seine – Sünden – ein, oder wie darf ich das verstehen?«
»Es kommt drauf an. Manchmal ja, manchmal nur vor den Ältesten der Gemeinde.«
»Kommt so etwas nicht einer Steinigung gleich? Nur weil jemand gefehlt hat, muß er vor andern quasi einen Seelenstriptease hinlegen und sich rechtfertigen?«
»Gott hat es so gesagt, und Gottes Wort allein zählt. Sie kennen offensichtlich unsere Kirche nur vom Namen her, die Grundsätze aber sind Ihnen fremd. Würden Sie die kennen, würden Sie sie auch verstehen. Aber ich weiß nicht, was das mit dem Tod meines Mannes zu tun haben soll.«
»Entschuldigen Sie, es war reines Interesse. Frau Rosenzweig«, fuhr die Kommissarin fort, »wir werden vermutlich schon morgen vormittag das Ergebnis der Obduktion haben. Wir werden dann noch einmal auf Sie zurückkommen. Ihre Söhne werden wir dann unter Umständen auch noch befragen. Das wär’s fürs erste. Wenn Sie mir jetzt noch die Adresse der Firma Ihres Mannes geben könnten.«
»Die Firma heißt Rosenzweig & Partner. Sie befindet sich im Messeturm.«
»Ach ja, bevor ich’s vergesse, wie alt war Ihr Mann?«
»Fünfundfünfzig. Und ich bin neununddreißig, falls das Ihre nächste Frage sein sollte. Ich war gerade neunzehn, als wir geheiratet haben«, sagte sie kühl. »Neunzehn und unschuldig und naiv.« Nach dem letzten Wort stockte sie sofort, sah die Beamten kurz und verlegen an.
»Was meinen Sie mit unschuldig und naiv?« fragte Julia Durant.
»Nun, ich denke, ich muß diese Frage nicht im Detail beantworten, oder? Es reicht, wenn ich die Antwort kenne. Haben Sie sonst noch Fragen?«
»Nein, für heute nicht. Danke für Ihre Zeit und auf Wiedersehen.«
Julia Durant und Frank Hellmer standen auf und verabschiedeten sich. Frau Rosenzweig begleitete sie zur Tür. An ihren Wagen angekommen, sagte die Kommissarin, nachdem sie sich eine Gauloise angezündet hatte: »Der hat sich nicht selbst umgebracht. Das war kaltblütiger Mord. Da verwette ich meinen Arsch drauf.«
»Ich auch«, erwiderte Hellmer. »Nur wird es verdammt schwierig werden, das auch zu beweisen.« Und nach einer kurzen Pause: »Ist dir was an der Frau aufgefallen?« fragte er.
»Was meinst du?«
»Als sie von dieser Kirche sprach und diesen ach so hohen moralischen Werten, da kam sie mir irgendwie weltfremd, abwesend vor. Und ich weiß nicht, als sie auf die eheliche Treue ihres Mannes angesprochen wurde, hat sie sich für einen Moment recht merkwürdig verhalten.«
»Inwiefern?« fragte Julia Durant, den Blick zu Boden gerichtet, und nahm einen langen Zug an der Zigarette.
»Auch wenn du mich vielleicht für spinnert hältst, aber ich glaube nicht an dieses Märchen, das sie uns aufgetischt hat, von wegen der ach so harmonischen Ehe. Irgendwas bei den beiden stimmte nicht.«
»Nein«, erwiderte die Kommissarin mit einem Lächeln, »ich halte das nicht für spinnert. So ähnliche Gedanken sind mir in dem Moment auch durch den Kopf geschossen. Ich denke mal, wenn wir ein bißchen rumschnüffeln, werden wir schon rausfinden, ob sie die Wahrheit gesagt hat. Aber«, fuhr sie fort, nachdem sie ihre Zigarette mit dem Schuh ausgetreten hatte, »heute nacht werden wir das nicht mehr klären. Und außerdem bin ich zu müde, um mir noch lange Gedanken darüber zu machen. Wir sehen uns morgen früh. Bis dann.« Sie wollte gerade in ihren Corsa einsteigen, als Hellmers Stimme sie zurückhielt. Er kam auf sie zu, blieb dicht vor ihr stehen und sagte: »Was sagt denn deine Intuition – würdest du ihr einen Mord zutrauen?«
»Keine Ahnung. Sie ist ziemlich undurchschaubar, zumindest im Moment noch. Wer weiß, vielleicht war es doch Selbstmord. Mach’s gut.« Sie setzte sich in ihren Wagen, startete den Motor und fuhr los.
Auch Hellmer machte sich auf den Weg nach Hause, er hielt den linken Arm aus dem geöffneten Seitenfenster. Die Nacht war schwülwarm und sternenklar, kaum noch ein Auto begegnete ihm auf der Sindlinger Straße, die sich zwischen Feldern entlang bis nach Okriftel zog. Links, etwa hundertfünfzig Meter entfernt, zog sich der Main dahin, rechts konnte man bei Tag die sanft geschwungenen Kuppen des Taunus sehen. Es war kurz nach halb eins, als er zu Hause anlangte, er parkte den Wagen vor der Garage, schloß ihn ab und ging ins Haus. Seine Frau Nadine war noch wach, sie lag im Bett, die Beine angezogen und las. Sie blickte auf, als er ins Schlafzimmer kam, sah ihn schweigend an. Er zog sein Hemd und die Hose aus, sie fragte: »Und, was war?«
»Weiß nicht, auf jeden Fall etwas ganz Seltsames. Ich denke, die Sache wird uns mehr Kopfzerbrechen bereiten, als wir uns im Moment vorstellen können. Ich geh nur schnell duschen. Bis gleich.«
Nadine Hellmer sah ihm nach, bis er im Bad verschwunden war, dann las sie weiter. Als er nach zehn Minuten zurückkehrte, legte sie das Buch auf den Nachtschrank, wandte ihm das Gesicht zu.
»Was gibt es denn so Seltsames?« fragte sie.
Frank Hellmer legte sich, nur mit einem Slip bekleidet, aufs Bett. »In Sindlingen ist so ein reicher Typ ziemlich übel verreckt. Und wenn die Hausärztin mit ihrer Vermutung recht behalten sollte, dann hat er sich statt Insulin Schlangengift gespritzt. Der Kerl ist einfach verblutet.«
»Und was glaubst du? War es Selbstmord?«
Hellmer schüttelte den Kopf. »Kaum. Ich hab jedenfalls noch nie davon gehört, daß sich jemand auf derartige Weise umgebracht hat. Außerdem gibt es bis jetzt keinen einzigen Hinweis darauf, daß er irgendeinen Grund gehabt hätte, sich das Leben zu nehmen.«
»Na ja, was soll’s, ich will jetzt schlafen. Kann ich ein bißchen in deinen Arm kommen?«
»Hab ich jemals nein gesagt?« fragte Hellmer grinsend.
Nadine rutschte auf seine Seite, kuschelte sich an ihn und schon wenige Augenblicke später atmete sie tief und gleichmäßig. Bei Frank Hellmer dauerte es etwas länger, bis auch seine Augen zufielen, er hatte einfach das unbestimmte Gefühl, daß hinter dem Tod von Hans Rosenzweig eine Menge Dreck steckte. Und es alles andere als einfach werden würde, seinen Tod aufzuklären. Aber heute nacht wollte er nicht mehr darüber nachdenken, er wollte nur noch schlafen. Es blieben ihm nur wenige Stunden, bis er wieder im Büro sein mußte.
Dienstag, 0.55 Uhr
J