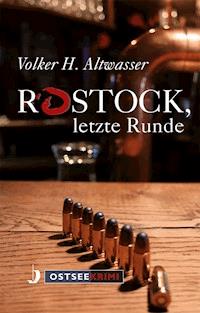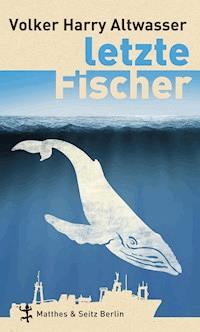
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Luise wird mit ihrem Spezialteam beauftragt, den Walfänger Rimbaud mitsamt seiner Ladung sicher in den Hafen von Spitzbergen zu bringen. Das raue Leben auf dem Walfänger birgt einige Überraschungen - unter anderem beginnt Luise eine gefährliche Affäre mit dem Schiffsjungen Tommy. Zur gleichen Zeit ist ihr Stiefvater Robert mit dem Hochseeschiff Saudade vor Somalia unterwegs, um Rotbarsch zu fangen und die seltene und überaus kostbare Kurznasenseefledermaus zu häuten. Es soll seine letzte Fahrt sein, bevor er sich dem Wunsch seiner Frau Mathilde fügt, ein Leben an Land zu führen. Volker Altwassers Letzte Fischer ist eine Hommage an das Leben auf den Meeren, ein Abgesang auf eine Männerwelt, die mit ihren Ritualen und Traditionen wie aus der Zeit gefallen wirkt. Neben furiosen Beschreibungen der Waljagd und der Walverarbeitung und mitreißenden Schiffsmanövern auf der ungebändigten See entspinnt sich eine zärtliche Geschichte, die von tiefer Melancholie und Wehmut durchzogen ist. Ein großes Hochseeepos, das vom Meer und immer auch von der Literatur über das Meer erzählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 675
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volker Harry Altwasser
Letzte FischerRoman
Erste Auflage Berlin 2011
© 2011 MSB Matthes & Seitz Berlin
Verlagsgesellschaft mbH
Göhrener Str. 7, 10437 Berlin
Umschlaggestaltung: Falk Nordmann, Berlin
eISBN: 978-3-88221-576-2
www.matthes-seitz-berlin.de
»Am nächsten Tag stachen wir in See.«
Joseph Conrad, Jugend
Inhalt
Teil eins
Der Seemann.»Back- und Steuerbordwache zur Beerdigungszeremonie aufgestanden! Klar zur Trauer!«
Die Seemannsbraut.»Guck dir das schöne Haus an, Manfred.« – »Macht nur Arbeit.«
Die Seefrau.»Wie war Kanada?« – »Kalt.«
Der Seejunge.»Verkatert?« – »Geht dich einen Scheiß an; ja.«
Teil zwei
Der Seemann.Er geriet schnell in den Rausch des Dirigierens, während er die vier Meter langen Dickdärme erhaben durch die Halle warf.
Die Seemannsbraut.»Fick mich, bitte fick mich noch ein Weilchen.«
Die Seefrau.»Du bist vielleicht nur durch ein Wunder der Abtreibung entkommen.«
Der Seejunge.»Ein verdammter Doppelbläser, ich fasse es nicht!«
Teil drei
Der Seemann.Ein Wald von geschärftem Stahl, der das Licht bündelte und zurückwarf, weit in die Unendlichkeit der See.
Die Seemannsbraut.Er kannte die Frauen eben immer noch nicht. Sonst würde er ja wissen, dass für eine Frau nichts unwiderruflich war.
Die Seefrau.Wenn einem von niemandem verziehen werden muss, dann braucht man auch seinen Sündigern nicht zu verzeihen und kann sie mit der eigenen, guten Lebensart herrlich in die Hölle schicken.
Der Seejunge.Dann ist nicht Ahab der Teufel, dann ist es der Wal!
Teil vier
Der Seemann.»Arbeite oder krepiere.«
Die Seemannsbraut.»Eine Art Masthuhn des Meeres.«
Die Seefrau.»Fernweh ist Heimkehr.«
Der Seejunge.»Wellen sind die Worte, die Gischt ist der Ton.«
Teil fünf
Der Seemann.Immer nur Anfänge. Bis zum Ende immer nur Anfänge.
Die Seemannsbraut.Sie warf ein lebendiges Licht.
Die Seefrau.»Ich bin nur hier, um euren Arsch zu retten. Das mach ich nicht zum Vergnügen.«
Epilog
Anhang
Teil 1
Als würde die Haut der Kurznasenseefledermaus atmen, als hätte er sich einen lebenden Handschuh übergestreift, so umhüllte dieses kostbare Gut seine Hand. Robert Rösch trug sie vor der Brust, vorsichtig, durch die Verarbeitungshallen, durch die Längs- und Niedergänge und vorbei an den Kammern, Lasten und Tanks des portugiesischen Fang- und Verarbeitungsschiffes Saudade.
Er ging, bis er vor dem Schott stand, durch das er aufs Außendeck gelangte. Mit einem kräftigen Ruck der rechten Hand zog er den schweren Hebel nach oben, die zwölf Riegel sprangen zurück, Robert Rösch trat ins eisige Blau von Labrador und verschloss das Außenschott sofort wieder, damit der Innendruck der Luftversorgung nicht abfiel.
Wie lange hatte er die Sonne nicht gesehen? Drei Tage? Vier? Seine letzte Kurznasenseefledermaus hatte er an einem Sonntag gehäutet, das wusste er noch, aber in welchem Monat? Es hatte eine Flaute geherrscht. Es waren die Wochen einer dieser gefährlichen Flauten gewesen, in denen es nichts zu arbeiten gab, nichts zu lachen, nichts zu denken.
Und nun war es auch noch Mai! Dieser für ihn so gefährliche Monat. Robert Rösch ging, die Haut vor sich hertragend, vorsichtig zur Reling und sah einen Moment lang übers Meer. Er durfte gar nicht daran denken.
Der siebenunddreißigjährige Rösch spuckte in die See, ging mit seiner Ausbeute zur Außentreppe, die zur Nock führte, und setzte sich auf die unterste Stufe. Vorsichtig zog er sich die Haut von der Hand, stülpte sie um, so dass das nach Amber duftende Purpur innen war, und legte sich die nun unscheinbar wirkende Fischhaut auf die flache rechte Hand. Robert Rösch hielt diesen gräulichen Lappen hoch, legte den Unterarm auf den Schenkel und nahm sich mit der Linken den ersten der Auswüchse vor, in denen sich Stacheln mit Giftdrüsen befunden hatten, die er unter Deck provisorisch abgekniffen hatte.
Er massierte den harten Knubbel, bis er sich verflachte und von selbst den Rest des Stachels freigab, den er schnell auf die Metallplanken pustete, ehe er sich den nächsten vornahm. Liebte er Mathilde nun oder hatte er sie aus Mitleid geheiratet? Aus Selbstmitleid?
Verbrachte er darum die Hälfte des Jahres auf der Saudade? Immer die Hälfte, in der sich auch der Mai befand? Erholte er sich nur auf dieser ›letzten Insel der alten Männerwelt‹ vom Eheleben und von dem ewigen Gerede? Aber nein, er liebte sie doch während der Abwesenheit viel inniger! Hier, mitten auf See, war er ihr doch so unsagbar nahe, hier hatte er doch so viel Angst um sie.
Konnte ein Mann nicht sowieso viel besser aus der Ferne lieben?
Robert Rösch sah auf seine Hände.
Achtundzwanzig Zentimeter wurden diese Kurznasenseefledermäuse lang. Sie lebten auf flachem, sandigem Grund, auf Korallensand, aber auch auf Schlamm und Tang.
Langsam schoben sie sich mit Hilfe von Brustflossen und Schwanz über den Boden, ernährten sich von Weichtieren, kleinen Fischen, Krustentieren und Würmern, und nur wenn er ihnen mit eben dieser Langsamkeit auf den Leib rücke, hatte Robert Rösch begriffen, könne er ihnen die harte, stachlige Haut abziehen, die in der Umgebung von Bordeaux mit Gold aufgewogen wurde.
Hier habe er eine Aufgabe, eine echte und einzigartige Arbeit, sei er an Bord doch der Mann mit den schmalsten Händen. Musikerhände. Robert Rösch habe die Kurznasenseefledermaus verstanden und häute sie wie kein anderer. Er sei ein echter Facharbeiter geworden. In der ganzen Fischereiflotte finde sich kein zweiter Mann, der die Fledermaus so sauber häuten könne, hatte der Kommandant einmal während eines Bordappells gesagt. Ihm, diesem schmalen Rösch da, sei es zu verdanken, dass die Heuer der einhundertsechsundsiebzig Besatzungsmitglieder mit einem Bonus von tausendsechshundert US-Dollar aufgestockt werde könne. Der Kommandant sei stolz auf ihn, auf seinen Filigranen!
Robert Rösch lächelte, während er einen weiteren Stachelrest wegpustete. Seit jenem Appell wurde er von den Männern beinahe auf Händen getragen. Keiner der Seebären, die mit den unterschiedlichsten Religionen aus den verschiedensten Regionen der Welt aufs Schiff gekommen waren, machte sich seitdem mehr über ihn lustig. Er war nicht länger der Halbstudent. Robert Rösch war der Filigrane.
Und der mächtigste Mann an Bord war also stolz auf ihn. Ausgerechnet auf ihn. Er sah kurz hoch, musterte den Horizont und sagte leise: »Aus dem Schwachen erwächst der Starke, denn Stärke ist die Fähigkeit zum Verzicht.«
Er sah auf das Gold in seinen Händen, mit dem er nun seine Familie ernährte, begutachtete die geschmeidige Seefledermaushaut ausgiebig, ehe er sie zum Kommandanten brachte, damit der sie in seiner Kajüte trocknen lassen konnte, um sie später in den Tresor einzuschließen.
»Und sonst?«, fragte der Kommandant und war erstaunt, als sein Spezialist sich mit einem Stöhnen in einen der rotbraunen Ledersessel fallen ließ und den Kopf schüttelte.
»Was gibt’s?«, fragte der Kommandant. Er sah unwirsch auf die Wanduhr, dann wieder zu seinem Arbeiter, der immer noch schwieg. Hatte er es doch gewusst! Lobe man den falschen Mann, fasse dieser ein blindes Vertrauen und rücke einem nicht mehr von der Pelle.
»Es ist Mai!«, sagte Filigraner.
»Erst in zwei Tagen, aber wir machen hier keinen ›Tag der Arbeit‹, falls es das ist, was du willst.«
Filigraner schüttelte den Kopf und sah zum Bullauge.
Rösch solle einfach mit dem Reden anfangen, viele Möglichkeiten habe er nicht, ermunterte ihn der Kommandant. Er wisse doch, dass er an Land erst recht nicht reden könne, er sei ein Seemann, ob er das nun gewollt habe oder nicht. Er sei ein Mann der See, das stehe fest, ein Seesüchtiger, der nur hier frei sei. Er sei ein Süchtiger unter Süchtigen, meinte der Kommandant und befahl: »Rede!«
Filigraner nickte, sah seinem Vorgesetzten fest in die Augen, der seinem Blick standhielt, und sagte nach einem Räuspern: »Meine Frau. Mathilde versucht, sich umzubringen.«
»Versuche zählen nicht«, sagte der Kommandant sofort und sah zum Bullauge.
»Schon drei Mal.«
»Drei Mal? Das ist viel.«
»Immer im Mai.«
Wieder sah der Kommandant zur Wanduhr, ging zum Schreibtisch, drückte einen Knopf und gab den Befehl, ihn in den nächsten zwanzig Minuten nicht zu stören. Er setzte sich zu seinem Arbeiter, goss zwei Single Malt, fünfzehn Jahre, ein und sagte: »Pack aus, Junge, erzähl schon!«
Robert Rösch nippte am Whisky und nickte: »Das erste Mal in den Bergen. Vor acht Jahren waren wir dort.«
»Ein Seemann gehört nicht in die Berge. Ganz gewiss nicht. Ein Seemann hat sich von den Bergen fernzuhalten. Erst recht, wenn er ein Fischer ist. Ein Hochseefischer.«
»Das weiß ich jetzt auch, aber Mathilde lag mir seit Monaten in den Ohren, sie wolle in die Berge!«
»Und dann hast du nachgegeben, weil du deine Ruhe haben wolltest. Keine gute Ausgangslage. Ein Mann, der nur nickt, um seine Ruhe zu haben, wird die nächsten Stürme nicht überleben.«
»Ja, Kapitän, Sie verstehen mich gut.«
Der Kommandant nickte und goss nach: »Und nach der Ruhe kam der Orkan?«
»Wegen dieser verdammten Fernsehberichte. Ich meine, da wird man doch verrückt im Kopf, wenn man immer diese Berichte aus der ganzen Welt sehen muss! Weiß doch jeder, dass es nie so ist, wie es gezeigt wird. Weiß doch jeder! – All die schönen Berge. Sonnenaufgang mit Frühnebel im Tal. Grelles Strahlen auf den Bergspitzen. Sah ja gut aus! Aber war doch nur Fernsehen! Heutzutage glauben die Leute dem Fernseher mehr als dem Nachbarn.«
»Erzähl endlich, halte mich nicht hin! Zehn Minuten habe ich noch für dich, dann muss ich wieder zum Kartentisch.«
»Bergkämme mit Schnee, der nie taut! Der noch nie getaut ist. Niemals, ich meine, was weiß so ein Schnee schon vom Schmelzen? Was weiß so ein Berg schon vom Tal? Kindischer Angeber! Der kennt doch gar nichts, keine Gefahr, keine Tücken, nichts, und wir aber hin da! Mit dem Auto.«
»Ausgerechnet mit dem Auto von der Ostsee in die Berge, sag mal, seid ihr bekloppt? Da gibt’s schöne Nachtzüge und alles.«
»Aber mit dem Auto hast du den Vorteil, jederzeit umkehren zu können. Jederzeit, das war ja mein Plan. Drei Mal verfahren und mit großem Tamtam: Jetzt reicht es mir aber! Jetzt kehren wir um! – Blöder Süden, macht einen ganz verrückt! – Und ich hatte vergessen, meine Frau stammt ja aus Bayern! Und Mathilde kannte sich da noch gut aus, sehr gut sogar, obwohl sie mit achtzehn Jahren in den Norden gekommen war. Meine Frau hatte wohl einfach Sehnsucht, als wäre die Erinnerung an die Kindheit die Kindheit selbst. – In München habe ich sieben verdammte Sackgassen ausprobiert, aber Mathilde hat uns durch die Stadt gelotst, als wäre sie da tatsächlich zu Hause. – Als wir aus München raus waren, immer noch Richtung Süden, da saß ich dann plötzlich auf dem Beifahrersitz! Damit hatte ich nicht gerechnet. Ab diesem Moment war die Sache gelaufen. Mathilde fuhr unsere alte Kutsche, diesen uralten Mercedes, und der war ja viel zu breit für die schmalen Bergwege da. Ich saß auf dem rechten Sitz und musste bald mit einer verdammten Seekrankheit kämpfen. Die schmalsten Wege hoch und runter, wieder hoch und wieder runter, Sechzig-Grad-Kurven, Neunzig-Grad-Kurven, steuerbord der Abgrund, backbord die Felshänge und alle zweihundert Meter entgegenkommende Fahrzeuge, ich meine, es ist doch Todessehnsucht, die einen in die Berge lockt. Ich meine, auf den Bergkämmen sitzen all die Tode zusammen und spielen Skat, und wenn es einem von ihnen mal langweilig wird, dann lockt er seinen Menschen hoch, um ihn dann im Gelächter hinunter zu stoßen. Ich hab es selbst gehört, Kapitän, dieses Grollen, kurz bevor die Lawinen sich losmachen. Steinlawinen! Laut wie tauende Eisberge! – Himmelangst wird einem da bei den Wegen, die man Straßen gar nicht nennen kann, gar nicht. Viele hatten nicht einmal Teer auf dem Buckel, einfach Schotter, der die Tausende von Metern hinunterrieselte, sobald wir auf ihm fuhren. Kapitän, ich hab’s doch gesehen! – Zum Glück kamen uns nur Einheimische entgegen, die die Wege zu nehmen wussten. Was die da oben herumkurvten! Und vom Bremspedal hatten sie auch noch nie etwas gehört. Zuerst ging ja alles gut, kam uns einer entgegen, Mathilde rechts ran, Warnblinker raus und abgewartet, bis die Einheimischen das Umschiffen schon irgendwie gemeistert hatten. Ich meine, nicht wenige, die anhielten und fragten, ob unsere alte Kutsche defekt wäre. – Und als die Frager dann immer durch das Fahrerfenster sahen – Mathilde beruhigte sie mit einem Lächeln –, da wurden sie immer ganz mitleidig. Sie brauchten bloß meine blasse Fresse sehen, schon war ihnen alles klar. Richtiggehend fürsorglich wurden sie dann, aber ich hatte immer nur abgewunken, war still geblieben, schweigsam, wie es sich in der Fremde für einen Hochseefischer gehört. – Nicht vorzustellen, wenn uns ein Kennzeichen HH oder HWI entgegengekommen wäre, nicht vorzustellen. – Wir fuhren in die Nacht rein, ich sagte, wir sollten lieber in einer Pension einkehren und uns am nächsten Tag den Gipfel vornehmen, aber Mathilde wollte unbedingt zur Großen Klammspitz, unbedingt! Sie meinte, da befände sich eine Berghütte, da könnte man übernachten. Sie wollte am Morgen die Sonne am Gipfelkreuz begrüßen, das selbst wie eine Sonne gebaut wäre. – Ich meine, was soll man dagegen schon sagen? – Schließlich sind wir in Oberammergau. Fahren durch den Ort, und jetzt war da wirklich eine Sackgasse vor uns, aus der auch Mathilde nicht mehr herauskommt. Diese Sackgasse ist aber unser Ziel. Sie mündet in einen Parkplatz, wir ziehen den Parkschein, und dann gehen wir den Weg an, er führt steil hoch. Zuerst noch stabile Steinstufen, dann Holzstufen, dann nur noch Lehm, Steinchen und Sand. Mathilde mit der Taschenlampe in der Hand voran, immer dem Weg hinterher, der sich hochschlängelt, der einfach nicht aufgeben will. Genau wie Mathilde, auf einmal ist sie ganz und gar Einheimische. Ich keuche hinter ihr her. Sie wartet an manchen Kurven und grinst mich in der Dunkelheit an, aus der eine Kälte steigt, die einen fast lähmt. Mathildes Atem vor ihrem Lächeln, und das Einzige, was sie sagt: ›Zurück geht nicht, wir müssen zur Berghütte, die haben die ganze Nacht auf.‹ – ›Na, wenn du meinst‹, sage ich, und dann sage ich nichts mehr. Jedes Wort zieht ja doch nur ein anderes nach sich, und was am Ende bei rumkommt, das ist ein handfester Streit, mitten in den Bergen, über den die Tode sich dann köstlich amüsieren. Ruckzuck ist da dann eine Steinlawine im Anmarsch; nein, nein, da heißt es, besonnen bleiben und die Schnauze halten, wenn man überleben will. Überleben in fast zweitausend Metern Höhe, Kapitän, das ist nicht leicht. Oberammergau liegt auf achthundert Metern, nach drei Stunden bist du über die Sonnenspitze drüber und bei den Pürschlinghäusern, die sich auf tausendsechshundert Metern am Pürschlingkopf befinden. Wir haben achthundert Meter Höhenunterschied überwunden, aber Mathilde will unbedingt noch über den Hennenkopf zur Brunnenkopfhütte, die sich auf tausendsiebenhundert Metern beim Brunnenkopf befindet. Nicht mehr so steil, aber du weißt ja, Kapitän, die Länge trägt die Last. Noch mal sechs Kilometer, die wir kurz vor Mitternacht auch geschafft haben. Zum Glück leuchten uns der Vollmond und die Sterne, es ist zum Glück nicht so dunkel. Ich falle sofort ins Bett, Mathilde trinkt noch ein Selbstgebrautes mit den Wirtsleuten, ich schnarche schon im Rhythmus der anderen Wanderer. Am Morgen holt mich Mathilde aus dem Bett, wir waschen uns draußen unter der Brunnenpumpe. Das kalte Wasser tut uns gut. Obwohl es immer noch dunkel ist, sind wir mit einem halben Dutzend Lunchpaketen schon auf dem Weg zur Großen Klammspitz, die Mathilde unbedingt bezwingen will. Weiß der Teufel, wieso, der weiß es! Obwohl, es gibt ja gar keinen Teufel, es gibt ja nur Gott, wenn er betrunken ist. – Und an diesem Morgen war Gott betrunken! – Kaum haben wir die Hütte hinter uns, sind gerade in einem Tal angekommen, da stehen wir auch schon vor einer Felswand! Ich frage: ›Spinnst du?‹ Mathilde schüttelt den Kopf und fängt an zu klettern! Wir sollen klettern! Eine Wand, so steil wie die Außenhaut unseres Schiffes! Von Einkerbung zu Einkerbung und mit jedem Schritt an diesem Kalkfelsen werden die Grasbüschel und das Gestrüpp weniger. Schließlich nur noch Stein und Fels. Noch etwa zehn Meter, da bleiben wir plötzlich auf den Steinchen stehen, die schnell ins Rutschen kommen. Ich schiebe mich an Mathilde vorbei, weil mir die Sache zu gefährlich wird. Ich will mich auf diesen verdammten Kamm setzen und meinem Tod sagen, er solle sich ein anderes Hobby suchen, wenn ihm die Skatspiele zu langweilig werden. – Doch Mathilde ist immer noch an der gleichen Stelle und reagiert nicht mehr auf meine Rufe. Ich bin oben, lege mich auf den Bauch, strecke den Arm aus, sie braucht nur zuzufassen, so dicht ist sie, aber sie tut es nicht. Sie dreht sich um, in diesem Augenblick steigt die Sonne über einen anderen Kamm, noch ganz rot vom gestrigen Saufen mit Gott, und Mathilde nimmt die Hände vom Berg! Mit den Sohlen rutscht sie, erst ein paar Zentimeter, dann Meter! Sie hält sich nicht fest, ihr Körper kommt ins Rollen, sie überschlägt sich, ihre ganzen schönen Lunchpakete gehen über Bord! Mathilde rollt runter, das begreife ich jetzt erst. Ich sehe ihrem Rollen zu, keine Anstalten, sich festzuhalten, ich schwöre es, keine Anstalten! – Schließlich knallt sie nach fünfzig Metern auf einen Felsvorsprung, zum Glück, macht noch ein paar Umdrehungen, bleibt aber auf dem Vorsprung liegen, zum Glück! Auf dem Rücken, Arme ausgebreitet, Gesicht in den Himmel, aufgeplatzte Tomaten um sie herum, und ich höre ihren Tod feixen! Lawinenlachen, Kapitän, du weißt, was ich meine. – Mir wird sowas von schwindlig! Ich kann mich nicht mehr bewegen, da auf diesem Grat. Ich starre nach unten, und alles dreht sich mir vor Augen. Keine Bewegung, keine von mir, keine von Mathilde. Ich rufe, Mathilde macht gar nichts. Ich brülle sie an, ich mache sie richtig fertig mit Worten, ohne dass sie sich bewegt, als von der anderen Bergseite einheimische Kletterer kommen und fragen, was los sei. Ich deute nach unten. Der eine kümmert sich um mich, meint, ich habe Bergkoller, Höhenangst. Er hilft mir, Schritt für Schritt runter von dieser verdammten Klammspitz, auf der ein Seemann nichts zu suchen hat, und die anderen beiden Männer kümmern sich um Mathilde. Sie bringen sie dazu, sich hinzusetzen. Sie legen die aufgeplatzten Tomaten ordentlich auf einen Haufen und setzen sich neben meine Frau. Sie sehen mir und meinem Helfer zu, und als wir endlich auch auf dem Felsvorsprung stehen, da hänge ich in den Armen dieses Fremden und frage Mathilde wieder: ›Spinnst du?‹ Ich frage sie, ob das geplant gewesen sei, ob das von Anfang an so geplant gewesen sei, aber zum Glück antwortet Mathilde mir nicht. Sie sieht mich mit großen Augen an und sagt: ›Es ist doch Mai.‹ – Es sei doch Mai, und diesen Monat habe sie immer geliebt, immer, bis zu jenem Mai, in dem sie von hier weg auf die Insel Rügen gekommen sei, und da weiß ich, was los ist mit ihr. Und ich nicke, höre mit dem blöden Gemecker auf, ich setze mich neben sie, nehme sie in den Arm, und leise wippen wir hin und her. – Ich verstand sie, und ich begriff, dass ich vor diesem verfluchten Mai nie wieder Ruhe haben werde. Nie wieder, egal, wo ich gerade sein werde. – Eintausendneunhundertvierundzwanzig Meter über dem Meeresspiegel, da ist die Große Klammspitz, Kapitän«, endete Robert Rösch und sah den Kommandanten an, der nicht zu fragen wagte, was Roberts Frau auf Rügen passiert sei. Er goss erneut nach und sah auf die Wanduhr. Eine ganze Stunde war vergangen! Eine ganze Stunde! Der Kommandant schüttelte den Kopf, stand auf und fragte: »Und die anderen beiden Male?«
»Die waren nicht mehr so schlimm, weil ich vorbereitet war«, antwortete Robert Rösch und erhob sich ebenfalls: »Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie mit meinem Kram so belästigt habe. Entschuldigen Sie bitte, Herr Kapitän. – Ich weiß, man bringt die persönliche Scheiße nicht mit an Bord.«
»Kein Thema«, sagte der Kommandant, und als Robert Rösch schon am Schott war, da fragte er doch: »Und warum? Was war auf Rügen?«
Robert drehte sich halb um, hielt die Metalltür auf und winkte ab.
Und der Kommandant der Saudade nickte, war es ihm doch auch lieber so.
Er zog sich die Jacke über, während Filigraner den Niedergang hochstieg, um vor der Schicht noch eine Mütze Frischluft zu nehmen.
Als schnitten der unerbittliche Sturm und das mit Eissplittern gespickte Salzwasser, das in Böen übers Oberdeck fegte, die Gesichtshaut in Fetzen. Die Kordel des Fischerhuts würgte Robert Rösch, so dass er sie vom Kehlkopf weg auf die beiden Knochen ziehen musste, die aufeinander zuliefen. Der Orkan raubte ihm den Speichel, er musste aber den Mund offen halten, um überhaupt noch atmen zu können. Doch trotz allem mochte er die Georgebank, auf der sie sich befanden, schmolzen hier die mächtigen Eisberge des Nordens doch geradezu majestätisch vor sich hin. Robert Rösch meinte, hier, wo der Golfstrom den Labradorstrom schneide, sei der größte Eisbergfriedhof der Welt, und sich auf einem solchen zu befinden, das Wrack der Titanic unter sich zu wissen, das sei schlicht das Erhabenste. Geduckt stand er. Breitbeinig. Mit beiden Händen hielt er sich am stählernen Vierkant des Schanzkleides der Nock fest. Ließ die See sich über ihn ergießen, ließ das Salz die Haut ausbrennen, ließ die Sturmwellen sich an ihn brechen. Er trotzte dem Orkan und dachte: ›Lern schwimmen und verarsch die Haie.‹
Ein paar Seemeilen weiter westlich waren Boston und New York, ganz in der Nähe befand sich Nuntucket Island, die Heimat des legendären Walfängers Ahab, doch was kümmerte ihn das alles? Nicht viel. Robert Rösch grinste und genoss den Schauder, der ihn durchfuhr, als die Stimme des Kommandanten durch die Bordlautsprecher den neuen Kurs befahl und mit den Worten endete: »Hiev ab in vier Minuten. Deck besetzen. Deckbesatzung: Netze aufklaren!«
Sturmstärke neun, Tendenz steigend, doch Robert Rösch wollte auf dem Außenbalkon der Trawlbrücke bleiben und dem Hieven zusehen, ehe er wieder nach unten zu den Fließbändern musste. Er schlug einen Gordingstek an einen Schekel. Auch wenn dieser Never-open-again-Knoten sich bei Last stark bekniff und dann nur noch mit einem Marlspieker wieder gelöst werden konnte, Robert Rösch schlug ihn, war doch ein sicherer Knoten der dritte Arm des Seemanns. Er wusste, der Gordingstek sei treuer als jede Katze und diese Treue würde ihn an Bord halten, auch wenn der Kaventsmann noch so riesenhaft daherkäme.
Nirgends fand sich auch nur der Schimmer eines Sterns. Gischt und Schaumkronen waren das einzige Hell in der Weite, und nur die vierzehn Starkstromlampen auf dem Fangdeck unter ihm waren eine wirkliche Lichtquelle, wenn die roten und grünen Lämpchen der Trawlbrücke nicht galten, die sich neben Robert Rösch befanden und die er nicht gelten ließ. Und auch nicht den grünlich bläulichen Schimmer der Hauptbrücke über sich. Gischt, von überall her Gischtkronen, zwar nur für Sekunden auftauchend, kamen sie ihm aber doch schaurig schön wie weiße Schatten des Todes vor.
Der Trawler machte langsame Fahrt, den Orkan so gut wie möglich abwetternd, aber gut ging es nicht. Auch Rösch spürte das Ankämpfen des Schiffes gegen die See. Wellenberg um Wellenberg erklomm es, um sich sofort in die Tiefe zu stürzen, und obwohl der Orkan sich verstärkte, plättete er die See. Der Seegang ließ nach, doch immer mehr Wasser wurde wie Staub durch die Luft geschleudert. Schließlich lagen die weißen Schatten des Todes selbst bei Robert Rösch auf der Nock. Er hörte den Sturm kreischen und grinste abfällig. Er dachte an die These des uralten Richards, der sich schon seit weit über fünfzig Jahren an Bord des Trawlers befand. Die Möwe kreische nur deshalb, weil sie die Fische in Panik versetzen wolle, denn ihr Kreischen erinnere den Fisch an die Geräusche der Stürme. So komme der verstörte Fisch der Oberfläche zu nahe und sei eine leichte Beute für die Möwe, die noch ganz andere Sachen könne, ganz andere!
Vom Kreischen der See umgeben und vom nassen Schwarz überrannt, fiel die alte Saudade ins Tal und hob Robert Rösch aus dem Stand, der sich an den Handlauf des Schanzkleides klammern musste und in die Knie ging, als das Schiff aufs Wasser aufschlug, ehe es sich in der Längsachse nach steuerbord drehte und den nächsten Berg hochgescheucht wurde. Was waren das doch für Gebirge! Wie lebendig! Wie tot waren dagegen die Berge der Alpen; Robert Rösch trat gegen einen zappelnden Rotbarsch, der sich auf der Nock verklemmt hatte.
Zwölf Meter über dem Fangdeck stand Rösch, aber der Barsch hatte trotzdem zu ihm gefunden.
Ein Knall schoss ihm durch den Kopf, Rösch hing an der verknoteten Leine, blickte neben sich, sah das zertrümmerte Fenster, schaute dem sich aufrappelnden Windenfahrer und dem Bootsmann zu, bemerkte die tief in der Holzvertäfelung steckenden Glassplitter.
Rösch warf einen Blick auf den Krängungsmesser, der bei siebenundfünfzig Grad stehen geblieben war, als sich das Schiff langsam wieder aufrichtete. Wie knapp sich der Zeiger doch vor dem dicken, dem roten, dem Unheil verkündenden Strich befand, auch Robert Rösch wusste, dass bei sechzig Grad alles aus war. Alles vorbei. ›Das ist keine Übung: Klarmachen der Rettungsinseln‹, wäre dann der nächste Befehl gewesen, so aber hörte er nur die Stimme des Kommandanten über die Lautsprecher sagen: »Achtung, sofortige Schadensmeldung über Funk aus allen Bereichen!«
»Brücke! Hier Fangdeck, das Netz schleppen wir noch, aber es wird langsam brenzlig.«
»Brücke! Hier Trawlbrücke, Sicherheitsglas Totalschaden, Wassereinbruch, aber wir kriegen es abgedichtet.«
»Brücke! Maschinenraum, keine besonderen Vorkommnisse.«
»Brücke! Verarbeitungsabteilungen, keine besonderen Vorkommnisse.«
»Brücke! Hier ist die Kombüse, es gibt heute keine Suppe als Vorspeise.«
»Brücke! Funkraum dicht und trocken.«
»Trawlbrücke! Hier Fangdeck, wir sollten den Hol jetzt retten, lange macht die Monroe das nicht mehr.«
Monroe hatten die Deckarbeiter also ihr Netz diesmal getauft, Robert Rösch grinste und sah unter sich alle zwanzig Deckmänner der Steuerbordwache am Heck stehen. Sie waren bereits mit den Laufseilen vertäut, an die sie sich immer wieder heranzogen, wenn die See sie nach steuerbord geschleudert hatte.
»Hier Trawlbrücke, Aufkommen in zwei Minuten!«
Da standen sie wieder, die zwanzig Männer wie einer, dieses Gemisch aus allen Religionen und Regionen der Welt, Robert Rösch wusste, dass nur ein einziger Gedanke sie jetzt durchströmte: Man überstand das Abschlagen des Eises von den Decksaufbauten bei vierzig Grad unter Null, man überstand das Abdichten von Lecks unter Wasser, das wochenlange Lenzen, und man überstand das tagelange Ausnehmen des Rotbarsches, weil die Gewissheit blieb, dass es zu Hause eine Frau gebe, eine treue Ehefrau, für die zu arbeiten und zu sterben sich lohne. Die Frau bleibe dem Seemann treu, und diese Treue sei ihm der feste Boden unter den Füßen, da könne die See noch so sehr wanken und wackeln. Die Frau bleibe treu, sie stehe zu ihrem Mann, der all das Leiden aushalte. Darauf könne die Frau zu Hause bauen, dass der Seemann auch die nächsten Stunden überstehe, mit einem abfälligen Lächeln. Dass er auch die kommende Zeit überlebe, mit einem frechen Grinsen. Dass er verlässlich bleibe, schweigsam und gelassen.
Erst recht, wenn er ein Deckarbeiter war! Robert Rösch nickte ihnen zu, die sich da unten Zentimeter um Zentimeter am Tau zurück auf ihre Positionen zogen, die im Eiswasser lagen und verächtlich lachten, diese Männer vom alten Schrot und Korn, deren Art allmählich ausstarb und die nur mit den Händen redeten, Robert Rösch wusste zwar, auch diese ›letzte Insel der alten Männerwelt‹ würde bald verschrottet sein, aber noch sah er sie auf ihrer Stahlinsel kämpfen: gegen die See und um jeden Fisch!
Alle vierzehn Starkstromscheinwerfer des Fangdecks flackerten, und Robert Rösch brüllte mitten in den Sturm hinein: »Wozu Licht, wenn unsere Frauen uns leuchten!«
»Ein Sturm verebbt, Treue niemals«, brüllte der neuseeländische Windenfahrer zurück, und Rösch nickte ihm grinsend zu, auch wenn seine eigene Frau sich da anders verhielt, solange es diesen verfluchten Monat Mai gab. Doch was soll’s? Der Kommandant hatte gesagt, erst in zwei Tagen sei es Mai! Heute war sie ihm treu! Ganz bestimmt. Heute Nacht war kein Selbstmordversuch zu befürchten, keine plötzliche Durchsage, Fischverarbeiter Robert Rösch solle sofort in den Funkraum kommen. Heute nicht. Heute werde Fisch gefangen und verarbeitet, meinte er. Heute werde mit den Händen geantwortet. Und gleich könne auch er loslegen.
Der Bootsmann nahm das Funkgerät in die Hand und sagte: »Bestmann, hörst du mich?«
»Klar und deutlich«, kam es vom Vorarbeiter der Deckmannschaft zurück, der auf dem Fangdeck die Bewegungen der zwanzig Männer koordinierte.
»Gebete beendet, fluchet und ziehet!«, sprach der Bootsmann die uralte Formel der Hochseefischer, die nun schon seit Jahrhunderten das Hieven einläutete.
Robert Rösch sah den blonden Iraner, der sich zum Heckende kämpfte, um die Heckklappen auszuhaken. Er sah ihn für Sekunden im einströmenden Eiswasser verschwinden, als er das Eis von den Heckklappenquerstangen abschlug. Er sah ihn ausrutschen und mit dem Hinterkopf auf die Eisenplanken schlagen, aber schon sah Robert Rösch ihn wieder stehen als der Teil des einen Mannes, zu dem sie da unten geworden waren. Wie prachtvoll sich der blonde Iraner am Tau wieder auf die Beine zog, ein Lächeln im Gesicht, war er doch gerade Vater von Drillingen geworden. Da stand der blonde Iraner wieder, und Robert Rösch sah ihm nickend zu, wie er die Handschuhe auszog und mit bloßen Händen ins Meerwasser griff, um die Bolzen der Fangleinenverankerung herauszuziehen. Nichts sei groß genug, um einen Mann, dem die treue Ehefrau gerade Kinder geboren habe, in die Knie zu zwingen, Robert Rösch brüllte einen Gruß, der aber vom Sturm weggerissen wurde, so dass er ihn selbst nicht verstand.
Wenn nur dieser vermaledeite Monat Mai nicht wäre!
»Aufkommen in einer Minute!«, sagte der Windenfahrer zum Bootsmann, der neben ihm stand. Robert Rösch sah zu ihnen, keine fünf Meter von ihm entfernt, und da der Sturm von backbord kam, brachte er ihm jedes Wort mit. Er sah den Bootsmann nicken und ins Funkgerät sprechen: »Bestmann, hiev up in einer Minute!«
»Verstanden, eins null. – Arschlöcher, legt an!«
Die Deckmänner nahmen die beiden Netzseile auf, Robert Rösch sah ihnen weiter vom Balkon der Trawlbrücke zu, und obwohl der Orkan ihn von einer Ecke in die andere warf – um nichts in der Welt wäre er jetzt gewichen.
Für einen Moment herrschte im ganzen Schiff Regungslosigkeit. In den Maschinenräumen, in den Verarbeitungshallen, in der Navigation, auf der Hauptbrücke, auch in der Kantine und im Büro des Wachtmeisters, und selbst der Funker schaltete für diesen Moment die Verbindung zu den anderen Trawlern ab, um sich auf die Bordlautsprecher zu konzentrieren. Alle einhundertsechsundsiebzig Männer hielten den Atem an, der Kommandant stand still im Orkan, die Füße fest auf den Planken. Allein Daumen und Zeigefinger des Windenführers bewegten sich jetzt auf dem einhunderteinundvierzig Meter langen Schiff. Jetzt galt alle Elektronik nichts. Jetzt galt einzig das Tasten des Windenführers.
Rösch harrte mit seinen Kollegen in stummem Bangen aus.
Noch dreißig Sekunden. Er hielt den Atem an, als könne in diesem Sturm ein einziger, unbeherrschter Atemzug das Netz von den Leinen reißen. Die Hände des Windenführers hielten still. Endlich, langsam atmete Robert Rösch aus.
»Kapitän, das Heck drückt!«, erklang die Stimme des Bootsmanns durch die Lautsprecher. Mürrisch klang sie, der Mann jedoch grinste, und auch Rösch lächelte.
»Hier Brücke, Maschinenraum! Alle Maschinen stopp! Vorschiffluken eins bis fünf fluten. Sechs bis acht halb fluten! Ende«, sagte der Kommandant.
Und aus brach der Jubel auf dem gesamten Hochseeschiff!
Wild schrien sich die Männer an, endlich, endlich sei die fanglose Zeit zu Ende. Endlich gebe es wieder Arbeit für die Hände, Robert Rösch wusste sie alle im Taumel vereint und jaulte vor Freude mit.
Unterhalb der Trawlbrücke versammelte sich nun die halbe Mannschaft, um den Hol mit eigenen Augen zu sehen. Alle Freigänger der Backbordwache drängelten sich unter Robert Rösch, um dem Hieven beizuwohnen, doch er, Robert Rösch, hatte als erster den Riecher gehabt und sich den besten Platz gesichert.
Er grinste und sah zum Windenfahrer und zum Bootsmann, die sich weiter auf der Trawlbrücke befanden, ehe er sich auf die Deckbesatzung konzentrierte, die nun gelbe Gummijacken trug. Sie stand in Formation auf dem Fangdeck, die Leinen in der Hand. Vermummt und mit großen, schwarzen Zahlen auf den Rücken, deren Ränder reflektierten, so hielten sie im eisigen Spritzwasser der Wellenberge aus. Ganz hinten, an der Slip, stand der Bestmann zwischen den beiden sich aufwickelnden Kurrleinen.
Neben Rösch wartete der Windenfahrer auf den entscheidenden Befehl, die Netzwinde wieder in Gang zu setzen, nachdem die Luken geflutet waren, und prompt kam die Meldung auch aus den Lautsprechern: »Maschinenraum an Brücke, Fluten gelukt; sorry, Luken geflutet!«
»Brücke an Trawlbrücke: Hiev up!«
»Aye, aye, Käpt’n«, sagte der Bootsmann und nickte dem Windenfahrer zu, der die Winsch sofort los brachte.
Die Schwimmkörper des Netzes tauchten auf, die Deckleute hielten die Kurrleinen straff.
Schwärme von Möwen kamen aus dem Nichts über das Schiff, aus allen Richtungen fielen sie ein. Schreiend und lachend stürzten sie sich auf die dicht unter der Oberfläche zappelnden Rotbarsche.
Ein gigantischer roter Teppich, der mit jeder Faser das Meer aufzupeitschen schien. Der Fisch kämpfe, aber er hatte bereits verloren, Robert Rösch schätzte den Teppich auf anderthalb Kilometer. Er jubelte in eine Böe hinein und schlug mit der Faust aufs Schanzkleid.
Die Netzbeschwerer krachten bereits die Slip hinauf, der Teppich wurde zusammengezogen, und Rösch sah den Bestmann wild gestikulieren. Die Deckmänner verstanden und begannen, das schwere Vornetz an Bord zu hieven.
Sie waren der eine Mann mit den zwei Armen, die die beiden Kurrleinen Stück um Stück an Bord zogen. Auf vereisten Planken. Zwischen aufkommenden Böen der Windstärken neun und zehn. Vom Seegang von einer Seite auf die andere geschleudert. Von Orkanwellen umgeworfen. Kniend, liegend, kriechend, doch niemals die Leinen loslassend, niemals! Und niemals den Takt verändernd, in dem sie zogen, niemals! Vor sich die Bilder der Heimat, zogen und schrien sie im Rhythmus gegen den Rhythmus der See.
Und auch Robert Rösch schrie den Takt lauthals mit, die Hände fest um den Vierkant der Reling. Er ließ sich die Worte von den Lippen reißen, ließ den Sturm sie zerfetzen, schrie ununterbrochen Sätze heraus, von denen er plötzlich im Überfluss hatte, Sätze, die zum Dialog wurden, in dem alles ausgesprochen wurde, was einem Hochseefischer wichtig war; Sätze, die in zwei Worte passten: »Hiev? – Up!«
»Hiev!«
»Up?«
»HIEV?«
»UP!!!«
Die Stahlplatten, die das Schleppnetz am Meeresgrund offen hielten, schleiften übers Fangdeck, der Dialog der Männer setzte sich ohne Unterbrechung fort: »Hiev? – Up!«
Das Vornetz lag auf dem Heck, das Hauptnetz dehnte sich mehr und mehr. Das Nylon zog sich in die Länge, aber reißen werde es nicht, oder?: »Hiev? – Up!«
Der eine Teil des Netzes war schon an Deck, der andere befand sich noch immer im Wasser und wurde schwerer, schwerer und schwer. Erneut schlug ein Kaventsmann die Deckleute nach steuerbord gegen die Reling, aber den Rhythmus der Fänger konnte auch er nicht verändern: »Hiev? – Up!«
Die gequälte See schien zu ächzen, glaubte Robert Rösch, als wolle sie ihren Reichtum nicht opfern, aber ein Fischer heiße nun mal Fischer, weil er fischt: »Hiev? – Up!«
Und nicht, weil er sich den Raub wieder rauben lasse: »Hiev? – Up!«
Noch war die Größe des Fangs das Geheimnis der gepeinigten See, doch hatten die vorderen Kammern geflutet werden müssen, damit das ganze Schiff beim Hieven nicht nach hinten überschlug. So mächtig also war der Hol! So gewaltig der Schwarm, den sie sich da geholt hatten: »Hiev? – Up!«
Sie hievten eisern, der Windenfahrer ließ die Kurrleinen weiter über die Slip aufrollen, immer weiter gehe das Schiff trotz allem mit dem Heck nach unten, bemerkte Robert Rösch und sah lahmen Michel ausrutschen. Sich am Seil festhalten. Noch im Rutschen den Takt halten. Jeden Moment musste der Fang auftauchen. Lahmer Michel lag auf dem Rücken, das abfließende Wasser über sich, doch er zog weiter im Takt der Hochseefischer.
Robert sah lahmen Michel wieder auf die Knie kommen, schwerfällig, langsam, aber dann war er doch wieder Teil einer Größe, Faser eines Muskels. Robert Rösch atmete durch.
»Winde stopp!«, sagte der Bestmann durch die Funke, und sofort nahm der Windenfahrer die Hände von den kurzen, schwarzen Hebeln mit den Kugelenden.
Das Vornetz wurde zusammengezogen und an den Rand gebracht, der Bestmann hielt die Steertleine straff in der Hand, mit der durch einen Knoten die Netzöffnung zusammengehalten wurde, und Robert Rösch beugte sich über das Schanzkleid und wusste, der Moment war da.
Alle zweihundert Finger des einen Mannes schlugen in die Maschen der Monroe und hievten das Hauptnetz mit vibrierenden Armen aufs Heck.
»Winsch auf!«, schrie der Bestmann durch die Funke, und wieder gehorchte der Windenfahrer sofort.
Dem Wasser entstieg der bereits zur Hälfte aufs Eisen gezogene Fisch nun zur Gänze.
Taumelnd hing er in der Luft, umkreist von den leuchtenden Vögeln der See.
Lotrecht hing der Fisch über dem Schiff, das schwankte und pendelte und dem Fang fast unterlegen war.
Und auf jubelten die Männer des Fang- und Verarbeitungsschiffes Saudade!
Da hingen zweitausend Zentner Rotbarsch.
Vierzigtausend zappelnde Fische zusammengepfercht zu einem einzigen Ungetüm.
Da hing er! Der rote Wal! Gefangen im Nylonnetz.
Der rote Bruder des sagenumwobenen Moby-Dick, er war aus dem Wasser gezogen, er war gestellt.
Und als plötzlich ein grässlicher Urschrei zu hören war, der aus den Untiefen der schwarzen See kam, ein Quietschen, da schien es Robert Rösch einen Moment lang, als habe der Teufel Ahab aufgelacht, ehe er sich eingestand, auch er könne in so einem Augenblick selbst den eigenen Ohren nicht trauen.
›Du fetter roter Wal‹, dachte er, doch mehr fiel Robert Rösch nicht ein, war ihm dieser Anblick doch zu erhaben, zu groß, übermächtig.
Sie hatten mitten auf einer Rotbarschwiese zugeschlagen, auch Rösch konnte sein Glück kaum fassen, denn war es nicht so, dass sich auf so einer Wiese noch mehr Fisch fand? Noch viel mehr? Jawohl! Um darauf ein klares Ja geben zu können, war Rösch schon lange genug an Bord des Trawlers.
Zufrieden verfolgte er, wie auf dem Fangdeck die Luke des Frischwasserbunkers siebzehn geöffnet und wie der rote Wal dorthin dirigiert wurde.
Er spürte, dass das Schiff sich in der Längsachse stabilisierte, und fand auf den Gesichtern der schwer arbeitenden Männer das Glück eingefroren. Das Glück als tiefe Abwesenheit.
Und verdammt ja! Auch Robert hätte jetzt gerne Mathilde an der Seite gehabt! Wie der Rotbarsch so zusammengepfercht über der Luke baumelte, wie die Scheerbretter auf den Planken klapperten, wie die Kurrleinen von den erschöpften Männern fallengelassen wurden, wie der Bestmann unter das Netz trat und den Steertknoten mit einem einzigen Ruck löste; diesen Augenblick, in dem der gigantische Fang in den Tank prasselte, diesen Moment des Fischregens hätte er gern mit seiner Frau geteilt. Nur ein einziges Mal!
Moby-Dicks roter Bruder sei gefangen, er könne verarbeitet werden, Robert Rösch drückte die Mundwinkel nach oben und strich sich mit der Zunge das Salz von den aufgesprungenen Lippen. Er blickte weiter starr geradeaus.
»Vorschiff leerpumpen!«, kam es aus den Lautsprechern.
»Vorschiff leerpumpen, verstanden!«
»Winsch fest!«
»Winsch ist fest!«
»Halbe Fahrt voraus!«
»Halbe Fahrt voraus!«
Die Seemannsrollen wurden abgespult, und Robert Rösch ging mit den anderen Freiwachen ins Innere des Schiffes zurück, nachdem er den Gordingstek nur mit Mühen und mittels Marlspieker hatte aufbrechen können, während er an langer Finger dachte, der ihm vom Lachs erzählt hatte.
Der Lachs könne sich wie alle Fische erinnern. Der Lachs könne sich exakt an den Geruch des Wassers erinnern, in dem er geboren wurde. Er finde genau die Stelle wieder, um selbst dort zu laichen. Das sei ein göttliches Vermögen, hatte langer Finger gemeint: »Wir suchten Gott immer im Himmel, aber was soll sein in der Kälte zwischen den Sternen, die nur eine Spiegelung des Weltmeeres ist? Im Fisch zeigen sich uns die Gottheiten, und ohne Fisch sterben wir aus.«
Uralter Richard hatte genickt und geantwortet: »Und der Rotbarsch wird bis zu siebzig Jahre alt! Da kommt schon was an Erinnerung zusammen, meine ich. Wenn wir sie lassen würden, hätten die Rotbarsche bald so viel Erinnerung zusammen, dass sie uns damit jagen könnten! Aber wir lassen sie ja nicht. An Land ist der Wolf der Hai, und wir machten ihn zum Hund, aber auf See brauchen wir keine Hunde!«
Robert Rösch grinste beim Schließen des Außenschotts. Und langer Finger, was für ein guter Kerl der doch gewesen war! So gut, dass seine eigenen Götter ihn verspeist hatten!
In der Messe nahm sich Robert Rösch einen der tiefen Teller, ließ ihn sich vom Smutje mit Eintopf füllen, in dem Fettaugen und Putenfleisch fast die einzigen Zutaten waren, ging an seine Back, setzte sich auf seinen Stammplatz zwischen uralter Richard und Christian, Opernsänger genannt, und bevor Robert Rösch einen Bissen zu sich nahm, erhob er sein Glas und sagte: »Auf langer Finger!«
Opernsänger goss Richard und sich Wasser aus der Karaffe ein, die auf der Back stand, und zu dritt stießen sie auf den toten Deckmann an, ehe sie beim Schlürfen und Kauen an den gestrigen Tag dachten. Auch gestern hatte Robert Rösch während der Freiwache wieder auf der Trawlbrücke gestanden. Quälende Stunden. Ein Leerfang jagte den anderen, bis sich das Nylonnetz dann doch noch in die Länge zog.
Rösch sah wenig später den Bestmann auf dem Fangdeck unters Netz treten. Sein großer Augenblick! Der Moment seines geheiligten Handgriffes! Jenes Handgriffes, der ihn über alle anderen Menschen erhob.
Nur der Bestmann war in der Lage, den Steertknoten zu lösen, der ein hochkompliziertes Gebilde darstellte und das gesamte Netz zusammenhielt. Er hatte diesen Knoten erfunden, wie jeder Bestmann auf jedem Trawler seinen eigenen Knoten erfand, war dies doch seit jeher Tradition auf den Trawlern. Nur der Bestmann durfte den Steertknoten schlagen, der das gewaltige Netz zusammenhielt, und der doch mit einem einzigen Handgriff zu lösen sein musste. Einen Handgriff, den nur der Bestmann kannte.
Die beiden Trupps der Deckmänner standen sich gegenüber und hielten die Leinen straff, an die der Bestmann gebunden war, so dass er nach seinem geheiligten Handgriff zur einen Seite gezogen und von der anderen Seite gleichzeitig gebremst werden konnte. Der Mann stellte sich breitbeinig hin, sah nach oben, wo ein schmaler roter Wal im Netz baumelte, ging leicht in die Knie. Er hob beide Arme in die Höhe, tastete einen Moment den Knoten mit geschlossenen Augen ab und hielt inne.
Auch der Bestmann stellte sich in seinem schwierigsten Moment seine Ehefrau vor. Robert Rösch wusste es von ihm selbst. Er stelle sich vor, er übergebe ihr endlich die Schlüssel zu ihrem Altenteil in der Toskana. Der Schlüssel selbst sei wie ein Knoten geschmiedet, der beste Steertknoten, den die Welt je gesehen habe.
Robert Rösch sah ihn die Augen öffnen und seinen Leuten ein Zeichen geben. Sie ließen die Seile locker, er sprang hoch, klammerte sich an einen bestimmten Teil des Knotens, nahm die Beine in die Hocke und zog den Knoten beim Herunterfallen mit dem eigenen Körpergewicht auf.
Und noch ehe er auf dem Hosenboden landete, wurde er abbremsend zur Seite gezogen, während Tausende von Rotbarschen dicht an ihm vorbei in den Frischwassertank prasselten. Hinter sich den Fischregen, erhob sich der Bestmann und nickte sich selbst zu.
Der Bootsmann atmete neben Robert Rösch zufrieden auf und gab mittels Funk den Befehl, die vorbeigefallenen Fische mit den Wasserspritzen in die Luke zu fegen und diese dann gut zu verschließen.
Auch die Stimme des Kommandanten klang zufrieden, als sie wenig später durch die Lautsprecher drang: »Geschirr aufklaren und erneut aussetzen!«
Über das schon wieder vereiste Fangdeck wurde das Fangnetz ausgelegt, die Leinen wurde aufgerollt und an die Seite gelegt, die Kurrleinen wurden locker zu Schlaufen verholt und die Scheerbretter ausgerichtet, während der Bestmann allein am Deckende stand, die Hacke eines Fußes über der Heckkante, und, abgeschirmt vom Kettenkasten des Steuerbordankers, erneut einen Steertknoten schlug.
»Jetzt dreht er«, sagte der Bootsmann: »Wird wohl was Riesiges auf dem Fischradar haben.«
Und nun bemerkte auch Rösch, dass das Schiff einen Bogen gefahren war und genau an die Stelle zurückkam, an der sie kurz zuvor den Fisch gestellt hatten.
»Das geht noch ein paar Stunden so«, sagte der Windenfahrer: »Endlich!«
Der Bootsmann nickte und sprach ins Funkgerät: »Kombüse! Zwei Pott Kaffee auf die Trawlbrücke! – Herr Kapitän, wir glauben, Sie haben mal wieder einen Riecher!«
»Na ja«, schnarrte es aus den Lautsprechern: »Ein Kaffee wird wohl erst einmal reichen!«
»Das ist doch ein Wort«, gab der Bootsmann zurück, ehe er den Zuschauer Rösch bemerkte und sagte: »An die Kombüse! Drei verdammte Pötte, wir haben eine Blindschleiche hier!«
»Drei Pötte ohne Kötte!«, kam es aus dem Funkgerät, und obwohl die einhundertsechsundsiebzig Männer nun schon über fünf Monate zusammen zur See fuhren, vierundzwanzig Stunden am Tag beieinander, hatte doch noch niemand von ihnen herausbekommen, was der Smutje immer mit Kötte meinte. Wieder schüttelte Robert Rösch den Kopf, während der Bootsmann abwinkte und der Windenfahrer die Schultern hob.
»Netz klar«, sagte der Bestmann durch die Funke.
»Auswurfposition in zwei Minuten erreicht«, kam es vom Steuerhaus: »Bereithalten zum Auswurf.«
»Deckbesatzung bereit!«
»Trawlbrücke bereit!«
»Achtung, Trawlbrücke! Tiefe dreihundertacht Meter, vierundsiebzig Zentimeter!«
»Trawlbrücke verstanden! Tiefe drei null acht Strich sieben vier.«
»Achtung an alle! Auswurfposition in einer Minute erreicht!«
Während Rösch zum Niedergang ging, um dem Hilfssmutje das Tablett mit den Tassen abzunehmen und sie zu verteilen, zählte der Kommandant mit ruhiger Stimme: »Dreißig Sekunden. Zwanzig Sekunden. Zehn Sekunden. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. WURF!«
Der Windenfahrer riss die Sperre mit dem linken Zeigefinger los, die Deckarbeiter zogen über Winden das Netz ins Wasser, die Kurrleinen strafften sich, die Schlaufen wurden rasend abgerollt, die Winden quietschten, und der Windenfahrer behielt auf der Trawlbrücke die Anzeige der Abwärtsbewegung im Blick, zweihundert Meter, zweihundertfünfzig Meter, doch Robert Rösch ließ leichenblass die Kaffeepötte fallen.
»HALT!«, schrie der Bootsmann und schlug mit der Faust auf den großen roten Notknopf.
»Was?«, schrie der Windenfahrer und sah auf.
»AUF! Du Arschloch!«, schrie der Bootsmann, während es Robert Rösch schlecht wurde. Er ging auf die Knie und würgte.
Die Kurrleinen des leeren Netzes wurden erneut auf die Winden gerollt, schnell kamen die Scheerbretter des Vornetzes auf, das Vornetz selbst.
»Oh Gott!«, stöhnte der Windenfahrer: »Das habe ich nicht gesehen!«
Robert Rösch übergab sich laut röchelnd.
»Bring ihn aufs Deck«, flüsterte der Bootsmann, und der Windenfahrer ließ das Vornetz hinunter, in dem sich langer Finger mit einem Fuß verfangen hatte.
»Abbrechen des Fanges! Schiffsarzt sofort aufs Fangdeck«, befahl der Kommandant durch die Lautsprecher: »Schiffsarzt aufs Fangdeck!«
»Ich hab ihn nicht gesehen? Wo stand er denn?«
»Wie auch, bei der miesen Deckbeleuchtung immer!«, sagte der Bootsmann, ehe er sich umdrehte, zu Robert sah, der immer noch bleich war, und ihm befahl, die Sauerei wegzumachen.
Eine Sauerei, an die Rösch auch jetzt beim Schlürfen des Eintopfs wieder denken musste. Er schloss kurz die Augen und trank einen großen Schluck Wasser, als die Stimme des Kommandanten durch die Lautsprecher drang: »Achtung, hier spricht der Kapitän! Back- und Steuerbordwache zur Beerdigungszeremonie aufgestanden! Klar zur Trauer!«
In allen Kammern und Decks erhoben sich die Männer der Besatzung des Fang -und Verarbeitungsschiffes Saudade, nahmen die Kopfbedeckungen ab und legten sich die Hände auf die eigenen Schultern.
Vor Robert Rösch stand das Bild des aufgerissenen Mundes und der herausgetretenen Augen. Er sah langer Fingers leblosen Leib im Netz baumeln, die Beine verdreht, ein Arm abgerissen. Langer Finger, der nun unten war, unten bei seinen Göttern!
»Besatzung des Hochseefischereitrawlers Saudade, habt Acht! Gestern Nacht, zwei Uhr siebzehn Bordzeit, haben wir unseren Kollegen Matthi Haukermäki, Bordname langer Finger, auf tragische Art und Weise verloren. Matthi Haukermäki war bei allen an Bord beliebt, und er wird uns allen unsterblich bleiben! Er war ein so guter Mann, dass die See nicht anders konnte, als ihn zu sich in die Tiefe zu holen. Er soll uns aber auch Mahnung sein, dass wir, dass die Hochseefischer den gefährlichsten Job der Welt machen! Seid also immer auf der Hut! Männer der Saudade, steht aufrecht, steht still, ehrt Matthi Haukermäki mit einem tiefen Schweigen. Männer der Saudade! Betet und bittet um Frieden für die Seele eures geliebten Kameraden! Denn die See ist die Seele und die Seele ist die See!«
»Denn die See ist die Seele und die Seele ist die See«, sprachen die Fischer und Verarbeiter nach, ehe sie für eine Minute schwiegen, um danach zu beten.
»Männer!«, sagte der Kommandant: »Abschließend mahne ich euch noch einmal! Unser Job ist so gefährlich, dass jährlich von zehn Hochseefischern vier sterben, weltweit. Haltet stets die Augen offen! Nachlässigkeit ist euer Todfeind! Physische Schwäche, Übermüdung, Unterschätzung, Überheblichkeit und Alkohol, das sind die Waffen, mit denen euer Todfeind umzugehen weiß! Wehrt euch in jeder Sekunden eures Lebens, wenn euch euer Leben lieb ist! Ende der Trauer! Wachtmeister, Einlagerung der Leiche in die Delikatessenlast. Funker, verständigen Sie die Reederei. Fordern Sie einen Deckarbeiter an. Deckbesatzung, klar zum Auswurf in zehn Minuten.«
Ein Knacken beendete die Ansprache des Kommandanten, doch Robert Rösch blieb noch, wie alle anderen Männer in der Messe auch, einen Augenblick lang stehen, ehe er schweigend die drei Terrinen nahm und sie von der Back zum Geschirrspüler brachte. Wenig später stand er mit uralter Richard und Opernsänger in der Rauchernische des Längsganges.
Uralter Richard sagte: »Der Tod klopft niemals an!«
Opernsänger nickte: »Warum auch?«
Robert Rösch sagte: »Vielleicht auch besser so.«
Sie warteten auf den Anfang ihrer Schicht und schlenderten zu den Verarbeitungshallen.
»Wenigstens wieder Arbeit!«, sagte Opernsänger.
»Besser mehr als leer!«, sagte uralter Richard, ehe Robert Rösch für alle sprach und dabei ein wenig zu laut wurde: »Langer Finger war ein verdammt feiner Kerl!«
Wenn Mathilde etwas nicht mochte, dann waren es Pflanzen in Töpfen. Das war doch gerade das Große und Erhabene an Blumen und Bäumen, dass sie in der Heimaterde blieben! Bäume wie Porzellan mit sich herumzutragen, das sei schlecht, war Mathilde sich sicher.
Und wieder sah sie diesen dicklichen Jungen, der sich an den Zaun klammerte und zu ihr herübersah. Pause für Pause stand er dort, während die anderen Kinder hinter ihm spielten, schrien und lachten. Niemals beteiligte sich der Junge. Er sah immer nur zu ihrem Haus herüber; unheimlich! Mathilde hatte sogar schon von ihm geträumt, von seinen großen, schwarzen Augen, mit denen er sie ernst angestarrt hatte.
Noch zehn Minuten, dann war Mittagszeit für die Mädchen und Jungen des benachbarten Kindergartens, Mathilde drehte sich von der geschlossenen Terrassentür weg, und bevor sie selbst zur Arbeit ging, setzte sie sich noch einmal auf das weiße Ledersofa, das mitten im Raum stand und auf sie verloren wirkte. Zwischen den gerahmten Postern aller Viermaster der Welt befanden sich auch Fotos von Stagg, dem ältesten Baum der Erde.
Dieser Mammutbaum war so gewaltig, dass sein Abbild aus sechs aneinander gehefteten Fotos bestand. Sequoia-dendron giganteum, Mathilde hatte Staggs lateinischen Namen auswendig gelernt, so viel bedeutete er ihr. Sein Entdecker allerdings hatte ihn Stagg genannt – nach einem Footballtrainer! Auf solche Ideen konnten doch auch nur Männer kommen! Mathilde sah zum Wipfel des Baumes, in dem sich als winziger roter Punkt ein Mensch befand.
Zweiundsiebzig Meter war Stagg groß. Seine Heimat war das Cap Nelson in Kalifornien, wo es noch mehr Riesenmammutbäume gab, doch war keiner älter als Stagg: dreitausend Jahre.
Und somit hatte es ihn schon gegeben, als ein gewisser Noah in Afrika Holz für seine Arche zusammengesucht hatte.
Stagg kannte die ganze und die wahre Geschichte. Er wusste, wie das damals mit dem fliegenden Menschen gewesen war, den sie Jesus nannten.
Für Mathilde war Stagg der Anfang, der Anfang von allem. Er war der letzte der ersten Bäume.
Sie stand auf und ging zu dem einen Meter siebzig großen Bild. Sie bemerkte Fingerabdrücke auf der Glasscheibe und wischte sie mit einem Papiertaschentuch weg, wobei sie sorgsam und langsam Kreise zog, bis die Abdrücke verschwunden waren. Mathilde hauchte aufs Glas und konzentrierte sich wieder aufs fotografierte Grün. Im Laufe der vielen Jahrhunderte hatten Stürme dicke Äste an den Enden Staggs abgeknickt, und später waren aus diesen Enden ganz neue Bäume entstanden. Aus dem uralten lebenden Stagg waren neue Bäume gewachsen, und jeder jüngere Baum hatte seinen eigenen Charakter entwickelt, aber keiner war wie der des alten Staggs.
Stagg, einsamer Gigant. Letzter seiner Art. Und unwillkürlich dachte sie an ihre Tochter Luise, die als ausgebildete Kampfschwimmerin eine der Ersten ihrer Art war. Mathilde lächelte, als sie wieder zum alten Stagg sah. Jedes Jahr ließ er elftausend Zapfen, gefüllt mit Millionen von Samen, auf den Waldboden fallen – und wann würde Luise wohl schwanger werden?
Staggs Stamm hatte einen Umfang von dreiunddreißig Metern – und wann würde Luise wohl heimisch werden und sich einrichten?
Ein Nadelbaum. Ein immergrüner Mammutbaum. Sechzig Zentimeter Wachstum im Jahr, dank eines raffinierten Hydrauliksystems, mit dem das Wasser aus den Wurzeln bis in die Zweige gepumpt werde, wozu der Baum allerdings vier Wochen brauche. Vier Wochen, ehe das Wasser oben ankomme, aber Zeit habe für Stagg ja keine Bedeutung, der es dank seines unbändigen Lebenswillens geschafft habe, dass sich kein einziger Pilz je an sein rötliches Holz herangemacht habe. Die ganzen dreitausend Jahre nicht. Ein Lebenswille, der alles ausgehalten habe und alles aushalten werde, an dem man sich halten könne, von dem man sich stärken lassen könne.
Unbesiegbar, wusste Mathilde, heute habe die Rinde dreißig Zentimeter Durchmesser, eine Dicke, die ihn selbst vor Waldbränden schütze, wusste Mathilde: Ganze Wälder brannten um ihn herum nieder, Stagg aber blieb, wo er immer gewesen war, und ließ neue Samen fallen.
Immer wieder wurde ihm die Krone von Orkanen zerfetzt, immer wieder verlor er sie, doch nur, um an diesen Stellen neue Bäume wachsen zu lassen.
Schließlich war aus seinem Überlebenswillen ein solch komplexes Gebilde von riesigen Bäumen entstanden, dass die Spezialisten sagten, so ein Mammutbaum sei ein ganzer Wald für sich. Unmengen von Wipfeln, die aus einem einzigen Wipfel kamen und in denen sich Moos, Orchideen, Heidelbeerbüsche, bonsaiartige Fichten, Schierling und andere Aufsitzpflanzen fanden, die auf Staggs starken Ästen alle zusammen zu Waldböden wurden. Farn wuchs dort oben so dicht, dass sich Erde ansammelte, in der Würmer lebten, Käfer, Salamander und eines Tages sicher auch Rehe. Mathilde lächelte versonnen, wusste sie doch um die wahre Entstehungsgeschichte der Erde. Sie wusste, es waren Stagg und seine Brüder gewesen, die alles anhäuften, bis es zu leben begann. Von ihm hatten die Menschen die Idee vom Turmbau. Doch hätten sie ihm nur zugehört! Sie hätten bemerkt, dass er schwieg, dass er beim Wachsen und Bauen keine Sprache benutzte, dachte Mathilde, erhob sich mit Schwung und ging zielstrebig zur Haustür, die wenig später hinter ihr ins Schloss fiel.
Sie blieb unterm Südbalkon des Hauses stehen, das nach skandinavischer Bauart ganz aus Holz hergestellt worden war. Nicht weit von Rostock gab es ein riesiges Lager, in dem diese Fertighäuser in kilometerlangen Regalen standen. Drei Häuser übereinander, Mathilde war fassungslos gewesen, als sie diese Ordnung damals gesehen hatte.
Diese Häuser, die man wie Bierkästen kaufen konnte, ließen sich überall aufstellen. Sie besaßen keinen Keller, dafür große Balkone an zwei Seiten. Unter dem Südbalkon ihres Hauses befand sich die Eingangstür, links daneben der Wirtschaftseingang, und unter dem Nordbalkon war der Wintergarten, an den sich die große Terrasse anschloss, die mit einer Markise schattig gehalten werden konnte, reichte der Hausschatten doch nicht bis zur Terrassenbrüstung, hinter der sich ein Stück Rasen befand, das sich bis zur Hecke erstreckte, hinter der sich der Küstenpfad vorbeischlängelte, über den sommers wie winters Unmengen Touristen von Warnemünde nach Heiligendamm wanderten oder Fahrrad fuhren. Abends kamen sie dann von Heiligendamm nach Warnemünde zurück, laut und von der Ostseeluft euphorisiert.
Die einundvierzigjährige Mathilde hatte sich daran gewöhnt, von den Urlaubern gemustert und beneidet zu werden. Sie saß meist auf dem Balkon über dem Wintergarten, von dem aus sie einen uneingeschränkten Blick über die Ostsee hatte, fiel doch die Steilküste keine fünfzig Meter hinter der Hecke ab. Vom Sandstrand mit seinen Urlaubern hörte sie auch im Sommer nie etwas, und meistens ging sie früh morgens hinunter, um sich zwischen den Wellenbrechern für ein paar Runden in die Fluten zu stürzen. Bis weit in den Oktober konnte sie das tun, weil die Ostsee sich nur langsam abkühlte. Die Ostsee, die gemeinhin auch die Milde genannt wurde. Hier gab es keine Gezeiten, und nur vor dem Ostwind musste man sich im Winter in Acht nehmen, der direkt aus Sibirien kam.
Oft wurde ihr Haus bewundert, dabei war es doch lediglich ein Fertigteilhaus mit siebzig Jahren Garantie. Siebzig Jahre, das war für Robert und für sie vor fünf Jahren lange genug gewesen. Wozu sollte man heute noch Häuser Stein auf Stein bauen? Es gab doch kaum noch Familien, die sich erlauben konnten, über Generationen hinweg an einem Fleck zu bleiben. Heimat war doch schon längst zu einem Luxusartikel geworden. Und somit auch die Freiheit. Befanden sich in Westeuropa nicht schon alle Menschen in der Sklaverei des Hin und Her und der Heimatlosigkeit? Mathilde meinte, heute wisse doch niemand mehr, wo er in fünf oder sechs Jahren arbeiten werde, geschweige denn, in welchem Beruf. Mobile Telefone, das Spektakel des Internets und transportierbare Häuser, daraus bestehe die Heimat von morgen. Eroberungskriege fänden heute ganz im Privaten statt.
Sie schloss die Haustür zu, ging zur Garage, hinter der sich der Kindergarten befand, in dem früher einmal einer der Kapitäne der Fischereiflotte der DDR gelebt hatte.
Dieses Haus war noch Stein auf Stein gebaut worden. Seit hundert Jahren hielt es hier auf der Steilküste den Stürmen stand. Lange Zeit war es das nördlichste Haus des Ortes gewesen, ehe weiter westlich das Hotel gebaut worden war. Das Haus war noch da, aber wo waren seine Bewohner geblieben? Mathilde warf einen Blick zum Dach, auf den krummen First, ehe sie zum Spielplatz des Kindergartens sah, der jetzt leer und verlassen war. Was mochte nur mit diesem dicklichen Jungen los sein, der sie ständig vom Zaun aus anstarrte? Was sah er in ihr? Eine Verbündete? Gegen wen?
Mathilde ging in die Garage, fuhr mit dem Peugeot rückwärts heraus und setzte auf die Straße, ohne das Tor zum Grundstück zu schließen. Sie hielt dicht neben dem Briefkasten, zog die Klappe auf, fand aber nur Gratiszeitungen, die sie im Kasten ließ.
Wenig später fuhr sie durch das neue Viertel des alten Fischerdorfes, das das Weiße genannt wurde, weil sich hier überall Holzhäuser in Fertigteilbauweise fanden, allesamt geweißt mit derselben weißen Farbe.
Viele Ferienhäuser standen hier, deren Besitzer aus Berlin und Hamburg kamen, zum Teil recht prominente Schauspieler und Professoren, die hier niemand vermutete. Mathilde lächelte, als sie sich erinnerte, wie eines Tages ein sehr berühmter Schauspieler bei ihr geklingelt und sie gefragt hatte, ob ihr Haus zu verkaufen sei.
Sie hatte nicht sofort verneint. Sie hatte mit diesem schönen und erfolgreichen Frauenschwarm erst einmal gemütlich eine Tasse Tee getrunken. Als Sky du Mont dann merkte, dass sie ihn nur hinhielt, war er verärgert abgezogen.
Gleich war sie wieder gefordert. Viermal in der Woche gab sie für Schüler der Altersklassen neun bis siebzehn Nachhilfeunterricht in Deutsch, Englisch und Mathematik – die Direktorin schien froh, mit Mathilde eine Frau gewonnen zu haben, die diese Fächer einmal studiert habe und der es heute finanziell so gut gehe, kein Honorar verlangen zu müssen. Das sei selten in dieser Gegend, in der zwar überall teure Häuser gebaut aber wohl noch nicht abbezahlt worden seien, die Schulleitung baue auf sie, denn sie habe Erfolge vorzuweisen.
Seit sie abends und nachmittags Nachhilfestunden gab, kamen viel mehr Schüler besser durch den Unterricht. Bestimmt lag das auch daran, dass sie keine Unterschiede machte. Da saßen die Jungs der arbeitslosen Eltern aus dem Neubauviertel neben den Mädchen der Beamten und Angestellten. Sie hatte gleich in der ersten Stunde zu den Kindern gesagt, kein Kind der Welt könne etwas für seine Eltern. Ein Kind habe selten Schuld, es sei ja ein Kind.
Pädagogisch nicht besonders wertvoll, Mathilde wusste es selbst, aber seitdem mochten die Kinder sie und hielten sie für eine Freundin. Sie glaubten ihr, und das war für den Unterricht selbst eine gute Voraussetzung.
Sie ging in den Klassenraum und holte die Stühle wieder von den Tischen, die das Reinigungspersonal kurz zuvor hochgestellt hatte. Der Boden war noch feucht, Mathilde öffnete das Fenster und wischte die Tafel noch einmal ab, obwohl sie sauber war. Sie reinigte sie langsam, zog sorgsam einen dicken, nassen Strich neben den anderen und freute sich wenig später, als nach dem Trocknen nicht ein einziger Striemen zu sehen war.
Die ersten Kinder kamen herein, grüßten sie stumm, behielten die Ohrstöpsel an, lauschten der Musik, während sie die Schulsachen auspackten und sich Saft eingossen. Die Kinder wirkten müde, fand Mathilde, besonders die Jungs erschienen ihr wieder einmal völlig erschöpft.
Auch sie hatte langsam ihre Zweifel. War dieses Schulsystem nicht falsch für Jungs? Lernten die nicht viel besser, während sie in Bewegung waren? Ging dieses ganze Gerede von der Förderung der Mädchen nicht auf Kosten gerade der Söhne?
Mädchen lernten besser durch Erkenntnis, Jungen aber durch Erfahrung. Warum das niemand begriff?