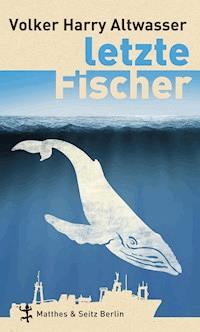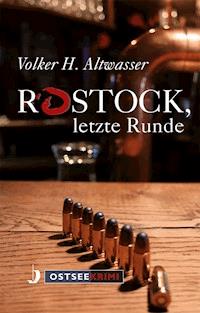Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sommer 1945, Kalifornien: Der jüdische Schriftsteller Bruno Frank liegt im Sterben und beginnt seinen letzten Roman, in dem er den Tod des großen französischen Moralisten und Frauenhelden Chamfort erzählen will. Das Manuskript bricht nach dem ersten Kapitel ab, Frank stirbt, doch der Beginn des Romans wird mit Unterstützung seiner Freunde Thomas Mann und Lion Feuchtwanger in einer Zeitschrift veröffentlicht. Jahrzehnte später liest Volker Harry Altwasser dieses Fragment und beschließt, das Buch für Frank zu Ende zu schreiben. Entstanden ist ein übermütiger, dicht erzählter Roman, der die Biografien zweier großer Männer leichtfüßig verknüpft, ein wahres Buch voll Erotik und Tod.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Glückliches Sterben
GLÜCKLICHES STERBEN
Volker Harry Altwassers Romanüber Bruno Franks Bericht,in dem Chamfortseinen Tod erzählt
VORWORT
Denn das war die Macht der Diener,dass sie herrschen ließen.Altwasser.
Als Jugendlicher verschlang ich Bruno Franks historischen Roman Cervantes, der mich demütig vor dem Leid anderer machte. Dieses Gefühl ist mir nun wieder präsent, weil ich in der glücklichen Lage bin, den 1912 erschienenen Gedichtband Der Schatten der Dinge in Händen zu halten, der auf scheinbar beschwingte Weise Trauer um einen geliebten Menschen verarbeitet, wie es wohl nur die ganz großen Humanisten schaffen. Bruno Frank gehörte zu ihnen.
Mein Leseerlebnis in der Jugend kam mir wieder zu Bewusstsein, als ich im Jahre 2008 an einer Veranstaltung zur Bücherverbrennung teilnahm. Aus einer Liste von Autoren, deren Bücher man verbrannt hatte, konnte ich einen Namen auswählen. Mein Blick blieb bei Bruno Frank hängen, der Text, den man vortragen konnte, lautete Chamfort erzählt seinen Tod. Ich las diesen wenige Seiten umfassenden Bericht über die Wirkungslosigkeit des Schriftstellers Chamfort zur Zeit der Französischen Revolution, und als ich feststellte, dass Bruno Frank mitten beim Schreiben seines Romans verstorben war, da sagte ich nicht gerade bescheiden zu mir, es solle keiner Diktatur gestattet sein, einen Roman zu verhindern, auch wenn sie Bücher oder sogar Schriftsteller verbrenne. Es war einer jener großen Momente der Realitätsverachtung, denen gewisse Autoren zuweilen erliegen.
Fünf Jahre arbeitete ich mich in den Stil und in die Romanidee ein, um dem großen Vergessenen ›Stift und Papier‹ für sein letztes Werk sein zu können. Es begann eine Zeit, in der ich auch Bruno Franks Leben kennenlernte, der wiederum von Chamfort hatte erzählen wollen. Daher kümmerte ich mich auch um diesen großen Franzosen – und um die fiktive Denise, die Bruno Frank bereits als Figur eingearbeitet hatte. Sein kurzer Originaltext setzt sich aus den Passagen meines ersten Kapitels zusammen, die mit einem fett gedruckten Anfangswort markiert sind. Ich hoffe, die Weiterführung in seinem Sinne gestaltet zu haben.
Bruno Frank, der Vergessene, war zum einen der treueste Schriftstellerfreund Thomas Manns, zum anderen wurde er von Hermann Hesse als wahrer Meister der Novelle bezeichnet. Heute wissen wir nichts mehr von dem Mann, der den ›Zauberer‹, wie Bruno Frank Thomas Mann zuerst nannte, fast vierzig Jahre lang begleitete, der selbst drei Weltbestseller verfasste und der von sich selbst sagte, Ruhmessucht gehöre zum Glück nicht zu seinen Lastern.
Während er am fiktiven Todesbericht mit dem Titel Chamfort erzählt seinen Tod arbeitete, starb Bruno Frank seinen ›glücklichen Tod‹, wie Golo Mann und Ludwig Marcuse es beschrieben. Bruno Frank war die ›humanistische Mitte der Exilschriftsteller‹, über deren Verlust sie im Juni 1945 alle so erschrocken waren. Bedingt durch seinen frühen Tod verlor sich seine Spur alsbald im Nachkriegsdeutschland.
Ich widme diese französisch-deutsche ›Nouvelle Noire‹ dem Schweizer Schriftsteller Thomas Hürlimann aus Berlin, der mir in so vielen Dingen fernes Vorbild und echter Unterstützer geworden ist.
Volker Harry Altwasser, November 2013.
»Wenn sich der Künstler auch vielleicht über die Unsterblichkeit seines Werkes täusche, über die sozusagen materielle Unsterblichkeit, so könne doch niemand wissen, in welch geheimnisvoller Weise das neue und wahre Bild der Dinge, das er hervorgebracht, ins Unendliche weiter wirke, – ohne dass diese Wirkung vielleicht einen bewussten Abglanz in menschlichen Köpfen hervorbringe.« (Bruno Frank, Ein Abenteuer in Venedig, Novelle.)
Dies ist der Anfang einer Autobiografie des französischen Schriftstellers Chamfort, die er nie geschrieben hat. Hundertfünfzig Jahre nach seinem Tod versuche ich mit seiner Stimme zu reden.
Geboren unter dem fünfzehnten Ludwig und seltsam endend in der Revolution, war er ein Mann zweier Sphären, zweier Zeitalter. Mit seinen Nerven und Neigungen, seiner Bildung, seinem Geschmack gehörte er der versinkenden Welt an, mit seinen Einsichten, Absichten, Fernsichten der neuen Epoche, die unter Gewitter anbrach.
Ausgestattet mit dieser Doppelseele, ist Chamfort recht sehr unser Schicksalsgefährte; und dem größten unter seinen ›Zeitgenossen‹, Thomas Mann, widme ich von Herzen diesen Beginn.
Bruno Frank, Juni 1945.
ERSTER TEIL
Ohne mich ginge es mir sehr gut.Chamfort.
Kalifornien, Los Angeles, war ihm nie mehr als eine Filmkulisse gewesen. Auf dem Grundstück, das zur Villa ›Aurora‹ seines alten Weggefährten Feuchtwanger gehörte, lag Bruno Frank auf der Terrasse und dachte, wie erhaben es sei, wenn man die Sonne nur noch sehe, sie aber nicht mehr spüre. Schon immer hatte er die letzte Stunde des Lichts für die großartigste gehalten.
Er sah seine junge Frau im Pool treiben, die Arme ausgebreitet, mit den Füßen schwimmend, und hielt die Erinnerung an die Abdrücke ihrer Brüste in den Handwölbungen mit allem Willen fest. Das Gefühl, wenn die Spitzen hart geworden waren; mühsam öffnete der alte Kranke die beiden Fäuste, lächelte über die Leere in ihnen.
Ein gutes Leben gehe hier sanft zu Ende, während in seinem Heimatland, ach, auf seinem Heimatkontinent Trümmerfrauen letzte, ach, erste Handgriffe verrichteten: Sei das nicht der richtige Sterbensmoment, ach, der beste aller möglichen? Der Todkranke nickte mechanisch und spürte nun doch die Sonnenstrahlen als Schweißperlen in den Augenwinkeln; was ihm nur mäßig erhaben schien.
An diesem dreizehnten Juni fünfundvierzig war ihm der lebenslange Kamerad fern – wie noch nie. Während ihm Lion Feuchtwanger die Finger der rechten Hand massierte, dachte Bruno Frank an den ›Zauberer‹, wie er ihn nannte, an die erste Begegnung mit Thomas Mann, München um neunzehnhundertzehn, was war das für eine quirlige Stadt gewesen! Aber ach, es galt, Dinge zu regeln, es galt, letzte Worte festzuhalten.
»Danke, Lion«, sagte Bruno: »Ich glaube, ich versuche es jetzt. Ich glaube, es müsste gehen.«
Lion half ihm, sich aufzurichten, stopfte ihm Kissen hinter den Rücken, stellte ihm das Tablett mit den leeren Seiten auf die Knie, legte ihm die rechte Hand auf das Papier, steckte ihm den Bleistift mit weichster Mine zwischen Zeigefinger und Daumen, nickte ihm schließlich zu. Sie sahen beide, wie das Schreibgerät aus der Hand rutschte, und wagten nicht, sich anzusehen.
Die alten Gefährten schwiegen und sahen traurig Elisabeth zu, die aus dem Bassin kletterte. Sie hüllte sich in einen weißen Bademantel, strich sich die langen, braunen Haare zurück und sagte: »Das macht doch gar nichts, mein Liebster, dann mime ich die Sekretärin für dich. Ich bin nicht umsonst die Tochter zweier berühmter Schauspieler, ich bin dein Stift, ich bin dein Papier.«
»Danke, Liesl«, sagte Bruno: »So schreiben wir also zuletzt, wie wir so lange gelebt haben: gemeinsam.«
Es ist nun beinahe sieben Wochen her, dass ich versucht habe, mein Leben zu beenden, ein Versuch, der missglückt ist, sonst könnte ich ja nicht von ihm berichten, aber doch nicht völlig missglückt.
Damals, Mitte November, erschien in meiner Dienstwohnung, Rue Neuve des Petits Champs Nummer achtzehn, derselben, in der ich jetzt schreibe, ein Kommissar der republikanischen Polizei mit seinen Leuten und wies den Befehl vor, mich, Sébastien-Roch Nicolas, genannt Chamfort, Schriftsteller und Direktor der Nationalbibliothek, ins Gefängnis zu führen.
»Verzeiht, meine Freunde, wenn ich euch nun alleine lasse«, sagte Lion: »Ich sehe euch ja in bester Gesellschaft mit euren Favoriten.«
Leicht verzog Bruno das Gesicht, die Finger der rechten Hand andeutungsweise hebend, während Elisabeth kaum aufsah.
Marta Feuchtwanger stand unter den Arkaden der Villa und lächelte ihrem Mann zu, der ihre Hand nahm, um sie ins Innere zu führen. Sie waren auf eine der vielen Dinnerpartys eingeladen, die von den Exildeutschen im zweiten Monat der Befreiung gegeben wurden. Überall regte sich nach dem Trauma der unfassbaren Nachrichten aus der Heimat endlich wieder Hoffnung.
Da wich der Schock.
In allen Wohnstätten wurde geplant; die Gemeinde der Exilanten sei in der Tat völlig aus dem Häuschen, meinte Lion zu seiner Frau, ehe er anfügte: »Und unser armer Bruno, der geht gerade jetzt!«
»Es ist gut, dass wir die Überraschungsgeburtstagsparty für ihn doch abgesagt haben. Er scheint sich auch heute kaum besser zu fühlen.«
Die Feuchtwangers sahen zu den Franks hinüber, denen sie Quartier gegeben hatten, weil die Ärzte meinten, Ruhe und Licht könnten helfen. Bruno Frank hatte sich erstaunlich schnell von dem Herzinfarkt erholt, den er am ersten April erlitten hatte, aber, soviel wusste Lion vom Leben, eine Erholung, gerade eine unerwartete, war doch immer auch ein Wagnis. Er nahm seine Frau in den Arm, zog sie in den Schatten der Villa und sagte: »Am Ende geht es wohl gar nicht mehr darum, dass etwas besser wird. Es soll nur nicht schlechter werden, das zeichnet wohl ein Ende aus, das auf einen Schluss zuläuft.«
Sie warfen noch einen Blick auf die Franks, die am Pool dicht beieinander blieben, Bruno auf dem Liegestuhl, Elisabeth vornüber gebeugt auf einer Fußbank, das Schreibtablett auf den Knien; ein Paar im zwanzigsten Jahr seiner Ehe: schreibend erzählen, gegenwärtig, aber stets gegen die Gegenwart, die es nur als Moment in der Zukunft gibt – und in der Vergangenheit, sinnierte Lion bei dem Anblick.
Es war nicht meine erste Verhaftung. Aber dieser neuen gedachte ich nicht zu folgen. Unter dem Vorwand, meine Habseligkeiten zu packen, begab ich mich in ein entferntes Kabinett und legte hier Hand an mich, durchaus entschlossen und sogar hartnäckig. Allein ich war ungeschickt. Ich wurde in hilflosem Zustande entdeckt, man rief Ärzte, die alles taten, um meine Existenz, die ich hatte loswerden wollen, kunstgerecht zu bewahren. Seitdem besuchen mich diese Gelehrten, die Doktoren Bradin und Beaudouin, täglich, auch der hoch angesehene Chirurg Doktor Dessault beehrt mich, aus reinem Interesse an der Erhaltung eines bedeutenden Autors, wie er mich wissen lässt, und jedenfalls ohne einer Bezahlung zu gedenken. Diese Herren sind entzückt von den Fortschritten, die ihre Kunst bereits an mir erzielt hat, und ich hüte mich höflicherweise, ihnen ihre Illusion vorzeitig zu nehmen.
Aber ich weiß es besser als sie. Es ist mein letztes Jahr, das beginnt.
»Wirklich, Bruno! Sollen wir nicht lieber von etwas Schönerem erzählen? Quäl dich doch in deinen letzten Tagen nicht so. – Müssen sich denn selbst die allerletzten Gedanken noch um ein Manuskript drehen, in dem es wieder ums Verschweigen geht?«
»Gerade ums Verschweigen soll es diesmal nicht gehen, meine Liebe. Schreibe einfach weiter mit mir Chamforts Tod zu Ende. Manchmal muss man im Schatten ansetzen, um im Licht anzukommen, meine Liebe. – Du wirst sehen, es wird sich alles ganz prächtig fügen, denn vom Hang aus sieht jedes Tal schön aus. – Nur, lass es für heute genug Arbeit gewesen sein. Mir flimmert es schon wieder grell vor den Augen.«
Die Villa stand an einem Hang, der sich allmählich im Meer verlor, das von hier oben fast wie der Comer See aussah, still, gelassen, von der Sonne beschienen – die Idylle ihres ersten Fluchtpunktes; was war ihr Mann neunzehnhundertdreiunddreißig doch vorausschauend gewesen, die Heimat mit ihr am Tag nach dem Reichstagsbrand zu verlassen! Als sie ihn, der Schlafmittel genommen hatte, weckte, um ihm von den Ereignissen zu erzählen, da hatte er – noch schlaftrunken – gemeint, das seien nicht die Kommunisten gewesen, das hätten die Nazis selbst gemacht. Und Recht hatte er behalten; Elisabeth stand gern am niedrigen Zaun des Anwesens ihrer so treuen Freunde. Die Feuchtwangers, wie seltsam war es doch, sich den Tod ins Haus zu holen und über ihn kein wenig erschrocken zu sein. Sie drehte sich halb um und sah zu ihrem Mann, der auf der Terrasse im Schatten mehr lag als saß, eine Hand offen auf der Brust, die andere hinter dem Kopf. Es war seine Lieblingshaltung beim Ruhen, wusste Elisabeth, und all seine Protagonisten, hatten die Kritiker geschrieben, nahmen sie in entscheidenden Momenten vor wichtigen Taten ein. Dieses Zaudern der Helden fand sich als gespiegelter Blick oder eben als jene Ruhestellung in all seinen Büchern: Die Nachtwache, Die Fürstin, Tage des Königs, Trenck – Roman eines Günstlings, Cervantes, Der Reisepass, Politische Novelle, Die Tochter; welcher dieser Romane würde wohl bleiben?
Am ehesten wohl Cervantes, der Weltbestseller ihres zu bescheidenen Ehemannes. Wahrlich, Ruhmsucht hatte nie zu seinen Lastern gehört, die hatte er seinem ›Zauberer‹ überlassen.
War ihr Bruno nicht wirklich der einzige Kollege, den der große Thomas Mann hatte Zeit seines Lebens um sich dulden können? Ihr Bruno, sie wusste es, hatte an den großen Werken Thomas Manns mitgeschrieben: während der vielen privaten Vorleseabende, in Form unendlicher Berufsgespräche einer fast vierzigjährigen Freundschaft oder während des einen oder anderen stillen Lektorats. Und einiges, was Bruno passiert war, war in die Mann’schen Romane eingeflossen, doch niemals hatten die beiden Männer darüber ein Wort verloren. Bruno hatte die stille Teilhaberschaft genügt, und Thomas war missmutig über sie hinweggegangen – doch was blieb vom eigenständigen Werk ihres Mannes?
Der Cervantes, wirklich nur der Cervantes? Oder die Politische Novelle? Oder Trenck – Roman eines Günstlings. Oder am Ende doch nur das Drehbuch zum Film Der Glöckner von Notre Dame mit Anthony Quinn in der Hauptrolle?
Immerhin lagen die Tage hinter ihnen, in denen ein deutschsprachiger Schriftsteller nur existierte, wenn er übersetzt war. So weit also hatte es das Naziregime gebracht, dass die deutsche Literatur wirklich fast ausgestorben wäre. Die Fackel der deutschsprachigen Literatur, frei von Schutzstaffelrunen, war in der Fremde von einigen wenigen weitergetragen worden, eisern und unter Qualen: Brecht mit der Seghers in Mexiko und Russland, die Manns hier in den USA, zusammen mit Feuchtwanger, Hesse, dem unermüdlichen Marcuse – und sicherlich ein wenig auch von ihrem eigenen Mann. Bruno Sebald Frank. Sie alle hatten es sich auferlegt, einen reinen Stil zu bewahren. Die Form mit der Flucht zu retten, das war das Fundament der Exilschriftsteller gewesen, denen die Leser ausgegangen waren: nichts weiter als die literarische und freie Sprache der Deutschen zu beschützen und zu nähren: zu erhalten auch mit dem eigenen Leben: gegen die in Ausrufesätzen der Kriegspropaganda gefangene Heimatlandsprache.
Elisabeth lächelte versonnen, jetzt könnte sie weitergegeben werden, diese Fackel, doch wem anvertrauen?
Konnte es eine neue Autorengeneration überhaupt dort geben, wo es gar nichts mehr gab an Freiheit, Brüderlichkeit, Menschlichkeit? Die große Französische Revolution – Chamforts Erbe – war nicht umsonst gewesen und auch das Elend der Exilschriftsteller – Bruno Franks Kampf – war nicht vergeblich.
Man kann Bücher verbrennen, sogar Schriftsteller, aber niemals die Literatur.
Es muss Gedichte nach Auschwitz geben; es muss einfach so sein, auch wenn Tantalusqualen zu erleiden sind. Und begriffen hatten das sogar Junkies wie Johannes R. Becher und Hans Fallada. Elisabeth nahm den Blick von ihrem sterbenden Mann und sah wieder aufs seeähnliche Meer vor Kalifornien: kein Prometheus am Himmel? Er wird sich doch nicht verspäten?
Denn ich schreibe in der Sylvesternacht, auf der Schwelle zum Jahre siebzehnhundertvierundneunzig. Aus meinem Arbeitszimmer im ersten Stockwerk blicke ich in die Rue Neuve des Petits Champs hinaus. Der Tisch, an dem ich schreibe – in gezwungener und komplizierter Haltung, denn meine beschädigten Gliedmaßen schmerzen beinahe in jeder –, steht zwischen den beiden Fenstern, von denen die blauen Ripsvorhänge zurückgezogen sind. Draußen hängt in der Höhe meines Gesichts an einem Strick, der quer über die Straße gespannt ist, eine Öllaterne, die in der windigen Nacht, von leichten Schneeflocken umstöbert, fortwährend leise schwankt. Auf diese Weise erkenne ich ihr Licht nur als einen mondig milchigen Schimmer, was überhaupt kein Wunder ist, da ich nur noch ein Auge besitze.
Auf meinem Schreibtisch, einem hübschen, geschweiften Stück, was wie beinahe mein gesamtes Mobiliar zum Eigentum der Nationalbibliothek gehört und aus der frühen Zeit des vorletzten Königs stammen muss, brennen drei Kerzen. Aber sie genügen unter den Umständen kaum, das Blatt vonr mir befriedigend zu erhellen. Ich bemerkte soeben, dass ich diese letzte Zeile hier über die vorletzte geschrieben habe, sodass ein schwer leserliches Gesudel entstanden ist, und ich besser beide kopiere. Ich habe schon einen ganz hübschen Vorgeschmack von der Dunkelheit, die mich, meinen Ärzten zum Trotz, in der Nähe erwartet.
Bei den blauen Ripsvorhängen war seine Frau stutzig geworden, sie hatte kurz mit dem Schreiben aufgehört, so wie Bruno es sich von Herzen gewünscht hatte. Er hatte sie genau beobachtet, dann aber doch weggesehen, als sie aufschaute. Sie hatte es also nicht vergessen, nichts hatte sie vergessen, genau wie er selbst. Wie könnte er auch!
Bruno schloss für einen Moment die Augen, sich fragend, ob es überhaupt einen Menschen gab, der den ersten Kuss mit seiner großen Liebe vergessen hatte.
Verdrängt vielleicht, aber vergessen?
»Also wieder ein Augenkranker«, sagte Elisabeth stattdessen: »Wie in deiner allerersten Erzählung. Und wieder ein dunkles Zimmer. Dann wird ja bald ein Mädchen auftauchen, das grob verletzt wird vom einsamen Künstler.«
Bruno lächelte still, erbat sich die zwei Seiten beschriebenes Papier, las sie und deutete auf den einzigen Schreibfehler. Da also war sie ein wenig unkonzentriert gewesen, da also waren ihr die blauen Ripsvorhänge in die Erinnerung geweht. Er sah ihr zu, wie sie aus dem kleinen n schnell ein kleines r machte, ehe er sagte: »Nein, diesmal wird die Menschlichkeit siegen, nicht die Kunst wie Im dunklen Zimmer. Wo die Kunst über das Leben triumphiert, da triumphiert eben immer auch der Tod. – Um die Mona Lisa erschaffen zu können, musste die Mona Lisa gestorben sein. Das Geheimnis der Mona Lisa ist, dass uns auf dem Bild eine Tote anschaut, als wäre sie lebendig. So sehen die Toten uns an, darum fasziniert uns das Gemälde.«
Auch von der Stille, die nach so viel Gerede, Gelächter und Deklamation mich umgeben wird, gibt diese Neujahrsnacht einen Vorschuss. Wiewohl das Gehör zu jenen Funktionen meines Leibes zählt, die intakt geblieben sind, vernehme ich nichts. Unten auf der Straße im Flockenfall scheint sich kein Mensch zu bewegen. Und hinter meinem Rücken weiß ich die weiten, tiefen Räume der Bibliothek, wo im Dunkel Hunderttausende von Bänden auf ihren Regalen gereiht stehen, Meile um Meile davon, das zu Milliarden Lettern schwarz geronnene Herzblut derer, die ihre gierig wimmelnden, stolpernden Menschengenossen haben auf horchen machen, zur Besinnung bringen und anleiten wollen.
Der Wurm wandelt dort bohrend von einem ledernen Einbanddeckel zum anderen, der Buchskorpion, Chiridium Museorum, langsam wie der menschliche Fortschritt, und erliegt mitten auf seiner unwissenden Wanderung, im dritten Jahr des ›Peloponnesischen Kriegs‹ oder vorm Eintritt in das Paradiso des Dante. Lärmte das Nagen und Raspeln dieser Würmer zusammen in eins, es müsste kreischen wie das Geräusch der Säge. Aber sie sind weit voneinander entfernt, jeder bohrt ganz allein. So höre ich nichts.
Etwas anderes vermag ich zu hören, wenn ich meinen Atem anhalte: ein zartes Schnaufen, ein diskretes Schnarchen genau gesagt, aus jenem abgelegenen Kabinett, darin ich vor sieben Wochen meine hartnäckigen Versuche angestellt habe. Ich ahne es eigentlich mehr als dass ich es höre. Aber ich ahne es gern.
Sechzehn Jahre war sie alt gewesen, als Bruno sie zum ersten Mal sah. Er selbst war da bereits zweiunddreißig, getränkt mit den Erfahrungen eines waschechten Casanovas. Bruno Frank versank für einen Moment schweigend in seiner glücklichen Jugend.
Was waren ihm Frauen und Mädchen vor Elisabeth doch kaum mehr als Ausflugshäfen gewesen. Immer waren sie ja für ihn offen und frei gewesen, dem schönen Verträumten, dem reichen Bankierssohn, dem jugendlichen Mann, dem charmant Wartenden, der jene so nervös machte, bis sie ihrerseits nicht länger warten konnten.
Und vor Elisabeth war es im thüringischen Haubinda nur die Frau des Lehrers Lessing gewesen, die ihm mehr als ein Ausflugshafen gewesen war: eine ganze Hafenstadt.
Mit dieser Älteren war er sogar getürmt – selbst erst sechzehnjährig, sie eine Adlige aus dem alten Kaisergeschlecht –; mochte es sein, Bruno Frank lächelte in sich hinein, vielleicht war er zu früh in die frühlingshaften Ausflugshäfen gekommen, denn das war seine Erfahrung geworden, die sich stets in seinen Büchern spiegelte: War ein schöner und junger Mensch schon anziehend, so wurde er unwiderstehlich, wenn er sich abwartend gab. Bruno war überzeugt, auch Casanova hatte diese Haltung vor den vielen Schlafzimmern gezeigt, ehe das Schafsfell dann in den Zimmern wie von selbst vom Wolf abfiel. Einem Dienenden flogen Herzen zu, einem Sanftmütigen, einem Demütigen, solch einem konnte selbst die stolzeste Fürstin nicht widerstehen. Er hatte es ja erleben dürfen.
Bruno räusperte sich, sagte sich, dass ein Casanova nicht zur Hauptfigur tauge, genauso wenig wie er selbst, dass er aber mit Chamfort einen Menschen gefunden hatte, der zwiespältig genug war, der Extreme in sich vereinigte, der somit literarisch war: ein Moralist und Menschenfeind. Ein Zyniker im besten Sinne und ein armer Trottel. Voller intuitiver Intelligenz, an der er nur scheitern konnte. Und ausgerechnet er selbst, der Frauenfreund, er würde nun einen Roman über einen Frauenfeind zum Abschluss bringen. War das die viel gerühmte Altersweisheit, von der die Diva Dietrich neulich noch gesungen hatte? ›Und ist der Ruf erst ruiniert, so lebt es sich ganz ungeniert.‹
Und ist erst einmal alles ruiniert, so krepiert es sich ganz ungeniert, dachte der Sterbende, Wahrheit ist der Teil des Ganzen, den niemand gern hört. Der Glaube an sie bringt Menschenhasser hervor, darum ist Chamfort zuerst auch als Schriftsteller gescheitert. Ihm fehlte die Formel für großartige Literatur: täuschend echt. – Täuschend wahr ist immer nur die wirkliche Lüge, inbrünstig aufgeschrieben aus Überzeugung. Wer seinen eigenen Lügen wahrhaft glaubt, der bringt grandiose Literatur hervor. Wer nicht mehr weiß, dass er lügt, der erzählt Wahres.
»So lass uns noch eine Seite für heute versuchen«, sagte er zu Elisabeth.
Sie nickte, sie schraubte den Füllfederhalter auf. Er war ein Geschenk des englischen Königs, Edward der Achte.
Der da so verhalten schnarcht, ist der Gendarm Louis Le Courcheux, ein mir von Gerichts wegen in die Wohnung gelegter Aufseher, den ich bis zum Betrag von drei Franken täglich selbst zu erhalten habe. Es könnte überflüssig erscheinen, dass man einem Mann, der kaum mehr sieht und dessen Glieder ihm vielfach den Dienst versagen, einen ständigen Aufpasser beigibt. Aber ich bin weit entfernt, mich in meinem Fall zu beklagen. Denn der Gendarm Le Coucheux ist mir, statt eines Büttels, vielmehr ein dienender Gefährte und Helfer geworden.
Er ist ein Mann um die vierzig, appetitlich in seiner Person und stets delikat rasiert, der in seiner Kleidung so wenig Amtliches zeigt, als ihm nur irgend erlaubt scheint. Sein Betragen ist still und sanft, von nie durchbrochener, sogar etwas umständlicher Höflichkeit, und er erinnert an nichts so sehr als an einen vertrauten Kammerdiener in einem verschwundenen Adelshause. Er steht jetzt im Dienst der Republik und profitiert zu seinem bescheidenen Teil von den veränderten Umständen. Aber ich muss es ihm öfters verweisen, dass er mich durchaus nicht ›Bürger‹, nach der herrschenden Vorschrift, sondern unter Anwendung der dritten Person ›Monsieur‹ und mit Vorliebe Monsieur de Chamfort nennt. Ich verweise ihm das, nicht weil ich durchaus ›Bürger‹ geheißen sein möchte, sondern weil mir das Adelsprädikat nicht zukommt, mir auch nie zugekommen ist, und weil meine Empfindlichkeit, sogar in solch untergeordneten Dingen, gegen jede Art von blauem Dunst und Mogelei mechanisch reagiert. Reine Sache der Nerven. Als ob es nicht vor der Türe zum Nichts dreifach gleichgültig wäre, ob jemand mit Vicomte, Marquis, Bürger oder Schweinehund angeredet wird.
So finden wir wieder Brunos typischen dramatischen Aufbau, dachte seine Frau beim Schreiben, der Diener, der herrschen soll und dies nicht kann, der Herr, der in sich selbst gefangen der Umwelt gegenüber nachlässig ist, entweder aus Liebe zu einer Frau oder aus Liebe zur Kunst. Es sind immer wieder die gleichen Aufbauten, sofern es mal nicht um den alten Fritz geht. Wessen Herr ist der Herr ein Herr und wessen Hund ist der Hund ein Hund? Ein Spiegelatelier voller Don Quijotes und Sancho Panzas, darin bist du also sogar noch als Sterbender gefangen, Bruno, ältester Sohn eines berühmten Stuttgarter Bankiers, Spielsüchtiger, der das Hungern auszuhalten lernte, ein Herr, der nie befahl, ein Knecht, der nie gehorchte; ein Schriftsteller eben.
Jedenfalls, ich könnte mir keinen angenehmeren Lebens- oder Ablebensgefährten wünschen als Luis Le Courcheux. Ob er Befugnis dazu besitzt, weiß ich nicht; aber er hat sich erboten, mich auf Ausgängen durch Paris zu begleiten. Miete ich unten an der Ecke der Rue de Richelieu eine der altersmorschen Sänften, die da noch bereitstehen, so wandert er neben den tragenden Savoyarden her und macht sie auf Unebenheiten des Pflasters aufmerksam. Und so erscheine ich, tappend und brüchig, mitunter im Zirkel der Freunde, die mir geblieben sind, und verbringe eine belebte Abendstunde mit verständigen Männern, ein Vergnügen, das ich seit jeher geliebt habe, und eines der wenigen, die ich mit meinem bevorstehenden Eintritt in das endgültige Schweigen ungern aufgebe.
Mein Gendarm ist verheiratet. Auf einem unserer Gänge durch Paris gelangten wir, ob durch Zufall oder auch nicht, in die unmittelbare Nähe seiner Wohnung, Rue Jean de l’Église, und er bat mich um die Ehre, bei ihm einzutreten. Ich hatte den Eindruck, dass wir erwartet wurden. Seine Frau, eine hübsche, füllige Picardin, von dem halbspanischen Typus, der in jener Nordprovinz auffallenderweise angetroffen wird, hielt einen Imbiss bereit. Er wurde uns von seiner Nichte aufgetragen, einem reizenden, sechzehnjährigen Geschöpf von zugleich engelhaftem und aufgewecktem Wesen.
»Bruno! Muss das denn schon wieder sein?«
»Ja, meine Liebe. Es muss sein. Auch diesmal.«
»Nur weil du selbst von dieser Lehrergattin verführt worden bist, als du sechzehn warst, nur weil du mich verführt hast, als ich sechzehn war, nur weil in deinen ersten Texten, Im dunklen Zimmer, Die Nachtwache, Die Fürstin, ich rede gar nicht erst von deinen Novellen und Gedichten, nur weil immer alle sechzehn sind, wenn sie verführt werden, musst du doch nicht auch in deinem letzten Werk ...«
»Bitte, Elisabeth, echauffiere dich nicht. Die kleine Nichte wird ja schon in den nächsten Tagen siebzehn!«
»Witzig. – Ich meine es durchaus ernst, ich weiß doch, worauf das hinausläuft, Bruno.«
»Worauf denn?«
»Das weißt du ganz gut selbst.«
»Nun lass mir doch ein letztes Mal dieses unschuldige Vergnügen. – Sechzehn Jahre, das ist Verheißung, pures Versprechen, das ist Glut ohne Brennen. Das ist die Freiheit der Liebe, nicht ihr Alltag.«
»Immer betonst du das nichtautobiografische Schreiben, und was ist in Wirklichkeit? In jedem Text von dir finde ich mich wieder – als Abbild derer, die ich einmal war – Bruno, das ist für eine erwachsene Frau nicht sehr charmant, wenn ihr Mann in ihr nur immer die Vergangenheit sieht.«
»Da gebe ich dir recht! – Unumwunden! – Und zum Glück trifft das auf mich ja nicht zu. – Als Mann sehe ich dich jetzt, nur eben als Künstler bin ich ein anderer.«
»Wenn ich dir nur glauben könnte.«
»Du kannst einem Literat alles glauben, es passiert dir nichts, wenn du ihm alles glaubst.«
Diese Nichte, Denise geheißen, Brudertochter ...
»Nicht auch noch Denise! Das ist gemein.«
Diese Nichte, Denise geheißen, Brudertochter meines Gendarmen und Waise, hatte ihre ...
»Eine Waise! Natürlich, wie praktisch!«
»Elisabeth, bitte!«
Diese Nichte, Denise geheißen, Brudertochter meines Gendarmen und Waise, hatte ihre Erziehung bei den ›Dames La Congrégation‹ im Faubourg Saint-Marcel genossen und war erst kürzlich, nach Aufhebung der Klöster, zu ihren Verwandten zurückgekehrt. Ihr Onkel veranlasste sie, mir ihre Schulhefte vorzuweisen, was sie auch sogleich mit anmutig bemänteltem Stolz tat. Ich sah die klarste und rundeste Handschrift der Welt, Kennzeichen eines natürlichen Geschmacks und einer ebenmäßig entwickelten Intelligenz.
Unter liebevollem Kopfnicken gegen das Mädchen hin bemerkte mein Gendarm, dass die Äbtissin oder Vorsteherin jener Erziehungsanstalt alle ihre Berichte und Memoranden an die geistlichen Oberen der jungen Denise in die Feder diktiert habe, gewiss nicht nur in Würdigung ihrer Kalligraphie, sondern auch im Vertrauen auf ihre Verschwiegenheit.
Dem allen lag eine Absicht zugrunde. Le Courcheux musste bemerkt haben, wie sehr schon beim Abfassen kurzer Briefe mich mein Körperzustand behinderte, und er bot mir seine schön schreibende Nichte als Amanuensis an, ausdrücklich ohne Entgelt. Aus der Manier, in der er dies tat, sprach ein so hoher Respekt vor der Literatur als Beruf, dass ich schmerzhaft, ja wie von Reue berührt wurde. Denn mir selbst war dieser Respekt in meiner Laufbahn völlig abhanden gekommen. Oder wenigstens glaubte ich das.