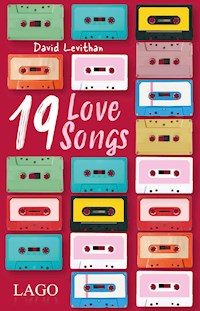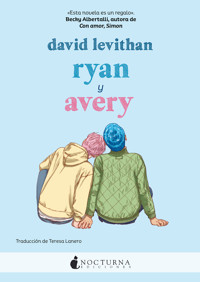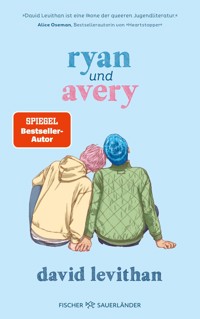Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: argon Kinder- und Jugendhörbuch
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Alle Bücher zu "Letztendlich sind wir dem Universum egal"
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer ungewöhnlichen ersten großen Liebe – und ein phantastischer Roman, wie er realistischer nicht sein könnte. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2015 in der Kategorie Jugendjury – jetzt in neuer Ausstattung, anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des »SPIEGEL«- und »New York Times«-Bestsellers »Jeden Tag bin ich jemand anders. Ich bin ich – so viel weiß ich – und zugleich jemand anders. Das war schon immer so.« Jeden Morgen wacht A in einem anderen Körper auf, in einem anderen Leben. Nie weiß er vorher, wer er heute ist. A hat sich an dieses Leben gewöhnt, und er hat Regeln aufgestellt: Lass dich niemals zu sehr darauf ein. Falle nicht auf. Hinterlasse keine Spuren. Doch dann verliebt A sich unsterblich in Rhiannon. Mit ihr will er sein Leben verbringen, für sie ist er bereit, alles zu riskieren – aber kann sie jemanden lieben, dessen Schicksal es ist, jeden Tag ein anderer zu sein? Wie wäre das, nur man selbst zu sein, ohne einem bestimmten Geschlecht oder einer bestimmten Familie anzugehören, ohne sich an irgendetwas orientieren zu können? Und wäre es möglich, sich in einen Menschen zu verlieben, der jeden Tag ein anderer ist? Könnte man tatsächlich jemanden lieben, der körperlich so gestaltlos, in seinem Innersten aber zugleich so beständig ist? Bei Antolin gelistet
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Levithan
Letztendlich sind wir dem Universum egal
Roman
Über dieses Buch
Die Geschichte einer ungewöhnlichen ersten großen Liebe – und ein phantastischer Roman, wie er realistischer nicht sein könnte
Jeden Morgen wacht A in einem anderen Körper auf, in einem anderen Leben. Nie weiß er vorher, wer er heute ist. A hat sich an dieses Leben gewöhnt und er hat Regeln aufgestellt: Lass dich niemals zu sehr darauf ein. Falle nicht auf. Hinterlasse keine Spuren. Doch dann verliebt A sich unsterblich in Rhiannon. Mit ihr will er sein Leben verbringen, für sie ist er bereit, alles zu riskieren – aber kann sie jemanden lieben, dessen Schicksal es ist, jeden Tag ein anderer zu sein?
Pressestimmen zur Deutschen Erstausgabe:
»Eine emotionale Achterbahnfahrt beginnt, die den Leser in jede Kurve mitnimmt und atemlos bis ans Ende der Geschichte trägt.« hr-online
»Hier beginnt eine der ungewöhnlichsten Liebesgeschichten der Jugendliteratur.« Cicero
»Phantastisch!« emotion
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischer-sauerlaender.de
Biografie
David Levithan, geboren 1972,lebt in Hoboken, New Jersey, und ist Verleger eines der größten Kinder- und Jugendbuchverlage in den USA sowie Autor vieler erfolgreicher Jugendbücher, unter anderem Will & Will (gemeinsam mit John Green) und Two Boys Kissing. Sein Roman Letztendlich sind wir dem Universum egal wurde 2015 von der Jugendjury mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Bei FISCHER KJB ist außerdem eine Graphic-Novel-Adaption unter dem Titel Every Day erschienen.
Impressum
Zu diesem Roman ist im Argon Verlag ein Hörbuch,
gelesen von Adam Nümm, erschienen,
das im Buchhandel erhältich ist.
Für die Verwendung in der Schule ist unter
https://www.fischerverlage.de/verlag/kita-und-schule
ein Unterrichtsmodell zu diesem Buch abrufbar.
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2015 (Jugendjury)
Neuausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2012
unter dem Titel Every Day bei Alfred A. Knopf,
einem Imprint von Random House Children's Book, Inc., New York
© David Levithan, 2012
Translation rights arranged by The Clegg Agency, Inc., USA
Unveränderte Neuausgabe
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2024 Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag GmbH,
Hedderichstraße 114, D-60596 Frankfurt am Main
Zuerst erschienen 2014 bei FISCHER FJB
Quellennachweis der zitierten Originaltexte im Anhang
Covergestaltung: Buchgut, Berlin, unter Verwendung einer Illustration von Kathrin Wedler
Coverabbildung: Kathrin Wedler
ISBN 978-3-7336-0625-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
5994. Tag
5995. Tag
5996. Tag
5997. Tag
5998. Tag
5999. Tag
6000. Tag
6001. Tag
6002. Tag
6003. Tag
6004. Tag
6005. Tag
6006. Tag
6007. Tag
6008. Tag
6009. Tag
6010. Tag
6011. Tag
6012. Tag
6013. Tag
6014. Tag
6015. Tag
6016. Tag
6017. Tag
6018. Tag
6019. Tag
6020. Tag
6021. Tag
6022. Tag
6023. Tag
6024. Tag
6025. Tag
6026. Tag
6027. Tag
6028. Tag
6029. Tag
6030. Tag
6031. Tag
6032. Tag
6033. Tag
6034. Tag
Danksagung
Quellennachweis
Für Paige (Möge dir jeder Tag Glück bringen)
5994. Tag
Ich werde wach.
Und muss auf der Stelle herausfinden, wer ich bin. Nicht nur äußerlich – die Augen aufschlagen und nachsehen, ob ich am Arm helle oder dunkle Haut habe, ob meine Haare lang oder kurz sind, ob ich dick oder dünn bin, Junge oder Mädchen, voller Schrammen und Narben oder glatt und unversehrt. Darauf stellt man sich am leichtesten ein, wenn man es gewöhnt ist, jeden Morgen in einem neuen Körper aufzuwachen. Aber das Leben darum herum, das Umfeld – das ist manchmal schwer in den Griff zu bekommen.
Jeden Tag bin ich jemand anders. Ich bin ich – so viel weiß ich – und zugleich jemand anders.
Das war schon immer so.
Die Information ist da. Ich werde wach, schlage die Augen auf und begreife: wieder ein neuer Morgen, wieder ein neuer Ort. Die Lebensgeschichte schaltet sich zu, ein willkommenes Geschenk von dem Nicht-Ich-Teil in meinem Kopf. Heute bin ich Justin. Nein, falsch, bin ich nicht, aber heute heiße ich so und leihe mir für einen Tag Justins Leben aus. Ich sehe mich um. Das ist also sein Zimmer. Das ist sein Zuhause. In sieben Minuten klingelt der Wecker.
Ich bin nie zweimal dieselbe Person, aber in solchen Typen wie dem hier habe ich definitiv schon dringesteckt. Überall Klamotten. Deutlich mehr Videospiele als Bücher. Schläft in seinen Boxershorts. Nach dem Geschmack im Mund zu urteilen, ist er Raucher. Aber nicht so süchtig, dass er sich gleich nach dem Aufwachen eine anstecken muss.
»Guten Morgen, Justin«, sage ich, um seine Stimme zu testen. Leise. Die Stimme in meinem Kopf klingt immer anders.
Justin geht nicht gut mit sich um. Seine Kopfhaut juckt. Seine Augen wollen zubleiben. Er hat nicht viel Schlaf gekriegt.
Schon jetzt weiß ich, dass mir der Tag heute nicht gefallen wird.
Es ist schwer, im Körper von jemandem zu sein, den man nicht mag, weil man ihn trotzdem achten muss. In der Vergangenheit habe ich manchmal Schaden im Leben von anderen angerichtet und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es mich nicht loslässt, wenn ich Mist baue. Also versuche ich, vorsichtig zu sein.
Soweit ich das feststellen kann, sind alle, in die ich schlüpfe, so alt wie ich. Ich springe nicht von sechzehn zu sechzig. Im Augenblick bin ich immer nur sechzehn. Keine Ahnung, wie das funktioniert, oder warum. Den Versuch dahinterzukommen, habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Das werde ich nie ergründen, ebenso wenig wie ein normaler Mensch je seine Existenz ergründen wird. Früher oder später muss man mit der Tatsache Frieden schließen, dass man einfach existiert. Warum es so ist, das lässt sich nicht herausfinden. Man kann Theorien aufstellen, aber es wird nie schlüssige Beweise geben.
Ich kann nur Fakten abfragen, keine Gefühle. Ich weiß, dass das hier Justins Zimmer ist, aber ich habe keine Ahnung, ob er es mag oder nicht. Würde er seine Eltern im Schlafzimmer nebenan am liebsten umbringen? Oder wäre er verloren, wenn seine Mutter nicht reinkommt und nachsieht, ob er auch wirklich wach ist? Das lässt sich unmöglich sagen. Offenbar verdrängt dieser Teil von mir den entsprechenden Teil der Person, in der ich bin. Einerseits bin ich froh, meine eigenen Gedanken und Gefühle zu haben, andererseits wäre hier und da ein kleiner Hinweis, wie und was der andere denkt, schon ganz hilfreich. Wir haben alle unsere Geheimnisse – insbesondere von innen heraus betrachtet.
Der Wecker klingelt. Ich greife nach einem Hemd und einer Jeans, aber wie es aussieht, hat er das Hemd gestern schon angehabt. Ich suche mir ein neues. Nehme die Klamotten mit ins Bad, dusche und ziehe mich an. Seine Eltern sind jetzt in der Küche. Sie haben keine Ahnung, dass irgendwas anders ist.
Sechzehn Jahre sind eine lange Übungszeit. Normalerweise mache ich keine Fehler. Nicht mehr.
Seine Eltern sind leicht zu durchschauen: Justin redet morgens nicht groß mit ihnen, also muss ich auch nicht mit ihnen reden. Ich habe mir ein Gespür dafür antrainiert, ob Erwartungen da sind oder nicht. Ich schaufle mir eine Portion Cornflakes rein, stelle die Schüssel so, wie sie ist, ins Spülbecken, schnappe mir Justins Schlüssel und gehe.
Gestern war ich ein Mädchen aus einem Ort, der schätzungsweise zwei Stunden von dem hier entfernt liegt. Vorgestern war ich ein Junge und lebte noch mal drei Stunden weiter weg. Schon jetzt vergesse ich, was die beiden im Einzelnen ausgemacht hat. Das muss ich, sonst weiß ich endgültig nicht mehr, wer ich wirklich bin.
Justin hört laute, grausige Musik auf einem lauten, grausigen Sender mit lauten, grausigen DJs, die sich mit lauten, grausigen Witzen durch den Vormittag kämpfen. Mehr muss ich über Justin eigentlich nicht wissen. Ich mache eine Abfrage und lasse mir von seinem Gedächtnis den Weg zur Schule zeigen, den richtigen Parkplatz und den richtigen Spind. Die Zahlenkombination seines Schlosses. Die Namen der Leute im Flur, die er kennt.
Manchmal sind diese Abläufe zu viel für mich. Manchmal kann ich mich nicht aufraffen, zur Schule zu gehen und mich durch den Tag zu manövrieren. Dann schütze ich irgendeine Krankheit vor, bleibe im Bett und lese ein paar Bücher. Aber nach einer Weile bin ich auch das leid und wieder bereit für die Herausforderung einer neuen Schule und neuer Freunde. Für einen Tag.
Als ich Justins Bücher aus seinem Spind nehme, spüre ich jemanden im Hintergrund. Ich drehe mich um, und das Mädchen, das da steht, ist durchsichtig wie Glas, was ihre Gefühle angeht – zaghaft und erwartungsvoll, nervös und voller Bewunderung. Ich muss keine neue Abfrage starten, um zu wissen, dass das Justins Freundin ist. Niemand sonst würde so auf ihn reagieren, in seiner Gegenwart so unsicher wirken. Sie ist hübsch, aber das sieht sie nicht. Sie versteckt sich hinter ihren Haaren, ist glücklich und unglücklich zugleich bei meinem Anblick.
Sie heißt Rhiannon. Und einen Moment lang – den Bruchteil eines Herzschlags – denke ich, ja, der Name passt zu ihr. Keine Ahnung, wieso. Ich kenne sie ja gar nicht. Aber er kommt mir passend vor.
Das ist nicht Justins Gedanke. Es ist meiner. Ich versuche, ihn zu ignorieren. Ich bin nicht der, mit dem sie reden will.
»Hey«, sage ich, übertrieben lässig.
»Hey«, murmelt sie.
Sie schaut zu Boden, auf ihre angemalten Chucks. Sie hat rund um die Sohlen mit dem Filzstift Wolkenkratzerstädte emporwachsen lassen. Irgendwas ist zwischen ihr und Justin vorgefallen, und ich weiß nicht, was. Vermutlich hat Justin es zu dem Zeitpunkt gar nicht mitgekriegt.
»Alles okay mit dir?«, frage ich.
Es gelingt ihr nicht, ihre Überraschung zu verbergen. So was fragt Justin sie normalerweise nicht.
Und das Komische ist: Ich will die Antwort wissen. Umso mehr, als es ihm offensichtlich egal ist.
»Klar«, sagt sie, hört sich aber absolut nicht so an.
Es fällt mir schwer, sie anzusehen. Ich weiß aus Erfahrung, dass Mädchen, die so im Hintergrund bleiben, tiefgründig sind. Das hält diese Rhiannon versteckt, will aber zugleich, dass ich es sehe. Nein, dass Justin es sieht. Und diese Tiefgründigkeit ist da, gerade eben außerhalb meiner Reichweite. Ein Ton, der darauf wartet, zum Wort zu werden.
Sie ist so versunken in ihre Traurigkeit, dass sie gar nicht merkt, wie offensichtlich sie ist. Ich glaube zu verstehen, was in ihr vorgeht – bilde es mir einen Moment lang ein –, doch dann überrascht sie mich, zeigt sich mitten in ihrer Bedrückung plötzlich entschlossen, ja tapfer.
Sie hebt den Blick, sieht mir in die Augen und fragt: »Bist du sauer auf mich?«
Ich wüsste nicht, warum ich sauer auf sie sein sollte. Wenn überhaupt, bin ich sauer auf Justin, denn er ist schuld, dass sie sich so nichtswürdig vorkommt. Das kann man aus ihrer Körpersprache ablesen. Wenn sie in seiner Nähe ist, macht sie sich klein.
»Nein«, sage ich. »Ich bin absolut nicht sauer auf dich.«
Exakt das will sie hören, aber sie traut dem Frieden nicht. Ich serviere ihr die richtigen Worte, und sie sucht argwöhnisch nach den Haken, die darin stecken.
Das ist nicht mein Problem, ich weiß. Ich bin genau einen Tag lang hier. Ich kann nicht die Beziehungsprobleme anderer lösen. Ich sollte nicht in das Leben anderer eingreifen.
Ich kehre ihr den Rücken zu, hole meine Bücher heraus und schließe den Spind ab. Sie bleibt, wo sie ist, erstarrt in der abgrundtiefen, verzweifelten Einsamkeit einer miesen Beziehung.
»Willst du dich immer noch heute mit mir zum Mittagessen treffen?«, fragt sie.
Die bequeme Variante wäre, nein zu sagen. Das tue ich oft: Wenn das Leben der anderen Person mich aufzusaugen droht, entziehe ich mich und laufe davon.
Aber irgendwas an ihr – die Großstadtsilhouetten auf ihren Schuhen, der mutige Vorstoß, die unnötige Traurigkeit – macht mich neugierig, was für ein Wort schließlich aus dem Ton herauskommen wird. Jahr um Jahr habe ich mit Menschen zu tun, ohne sie wirklich kennenzulernen, und an diesem Vormittag, hier, bei diesem Mädchen, will ich es erstmals wenigstens andeutungsweise wissen. Und in einer Anwandlung von Schwäche – oder Tapferkeit – meinerseits beschließe ich, dem nachzugehen. Mehr darüber in Erfahrung zu bringen.
»Auf jeden Fall«, sage ich. »Das fände ich super.«
Wieder ist sie glasklar zu durchschauen: Ich habe zu viel Begeisterung gezeigt. Justin ist nie von irgendwas begeistert.
»Können wir schon machen«, schiebe ich nach.
Sie ist erleichtert. Oder zumindest so erleichtert, wie sie es sich zugesteht, was eine sehr verhaltene Form von Erleichterung ist. Ich rufe die Information ab, dass Justin und sie seit mehr als einem Jahr zusammen sind. Konkreter wird es nicht. Justin erinnert sich nicht an das genaue Datum.
Sie greift nach meiner Hand. Ich bin überrascht, wie gut sich das anfühlt.
»Schön, dass du nicht sauer auf mich bist«, sagt sie. »Ich will bloß, dass alles okay ist.«
Ich nicke. Wenn ich eins gelernt habe, dann das: Wir alle wollen, dass immer alles okay ist. Wir streben gar nicht so sehr nach phantastisch oder grandios oder hervorragend. Wir geben uns gern mit okay zufrieden, denn in den meisten Fällen ist okay völlig ausreichend.
Die Schulglocke läutet zum ersten Mal.
»Bis später«, sage ich.
Was für ein Allerweltsversprechen. Aber für Rhiannon ist es das Größte überhaupt.
Anfangs war es schwer, einen Tag nach dem anderen durchzustehen, ohne ernsthafte Beziehungen zu knüpfen oder Veränderungen im Leben anderer zu hinterlassen. Als ich noch jünger war, sehnte ich mich nach Freundschaft und Nähe. Ich ließ mich auf Bindungen ein, ohne mir einzugestehen, wie schnell und endgültig sie wieder gekappt sein würden. Ich nahm das Leben anderer persönlich, hatte das Gefühl, ihre Freunde und ihre Eltern könnten meine Freunde und meine Eltern sein. Aber nach einer Weile musste ich damit aufhören. Es war zu herzzerreißend, mit so vielen Trennungen zu leben.
Ich bin Treibgut, und so einsam das mitunter sein kann, es ist auch enorm befreiend. Ich werde mich niemals über jemand anderen definieren. Ich werde nie den Druck von Gleichaltrigen oder die Last elterlicher Erwartung spüren. Ich kann alle als Teile eines Ganzen betrachten und mich auf das Ganze konzentrieren, nicht auf die Teile. Ich habe gelernt zu beobachten, weit besser als die meisten anderen Menschen. Die Vergangenheit setzt mir keine Scheuklappen auf, die Zukunft motiviert mich nicht. Ich konzentriere mich auf die Gegenwart, denn nur in ihr ist es mir bestimmt, zu leben.
Ich lerne. Manchmal sind es Dinge, die ich schon aus Dutzenden anderer Klassenzimmer kenne. Manchmal bringt man mir völlig Neues bei. Ich muss die Informationen abrufen, die in Körper und Kopf gespeichert sind. Und wenn ich das tue, lerne ich dazu. Wissen ist das Einzige, was ich mitnehme, wenn ich wieder gehe.
Ich weiß so vieles, was Justin nicht weiß und nie wissen wird. Ich sitze hier in seiner Mathestunde, schlage sein Heft auf und schreibe Sätze hinein, die er noch nie gehört hat. Sätze von Shakespeare und Kerouac und Dickinson. Morgen, oder irgendwann später, oder auch nie, wird er diese Worte in seiner Handschrift sehen und keine Ahnung haben, wo sie hergekommen sind oder was das überhaupt sein soll.
Mehr Einmischung gestatte ich mir nicht.
Alles andere muss sauber erledigt werden.
Rhiannon lässt mich nicht los. Ihre Details. Aufflimmernde Bilder aus Justins Erinnerungen. Kleinigkeiten – wie ihr Haar fällt, wie sie auf den Fingernägeln herumkaut, die Entschlossenheit und die Resignation in ihrer Stimme. X-beliebige Sachen. Ich sehe sie mit Justins Großvater tanzen, der sich einen Tanz mit einem hübschen Mädchen gewünscht hat. Ich sehe, wie sie sich in einem gruseligen Film die Augen zuhält und zwischen den Fingern hindurchspäht, den Kitzel der Angst genießt. Das sind die guten Erinnerungen. Andere schaue ich mir nicht an.
Ich sehe sie vormittags nur einmal kurz im Vorübergehen auf dem Flur, nach der ersten Stunde. Ich lächle, als sie näher kommt, und sie lächelt zurück. So einfach ist das. Einfach und kompliziert, wie die meisten wesentlichen Dinge. Zwischen der zweiten und der dritten Stunde ertappe ich mich dabei, dass ich nach ihr Ausschau halte, zwischen der dritten und der vierten ebenfalls. Vom Gefühl her habe ich es nicht mal mehr unter Kontrolle. Ich will sie sehen. Einfach. Kompliziert.
Zu Beginn der Mittagspause bin ich ziemlich k.o. Justins Körper ist ausgepowert vom Schlafmangel, und ich, in ihm drin, bin ausgepowert von Rastlosigkeit und zu viel Nachdenken.
Ich warte bei Justins Spind auf sie. Es läutet zum ersten Mal. Es läutet zum zweiten Mal. Keine Rhiannon. Vielleicht sollte ich sie irgendwo anders treffen. Vielleicht hat Justin vergessen, wo sie sich immer treffen.
Wenn das der Fall ist, ist sie Justins Vergesslichkeit gewöhnt. Sie findet mich, als ich gerade aufgeben will. Die Gänge sind praktisch leer, die Herde ist zur Abfütterung getrabt. Sie kommt näher als vorher.
»Hey«, sage ich.
»Hey«, sagt sie.
Sie sieht zu mir hin. Justin ist derjenige, der den ersten Schritt tut. Der Pläne macht. Der entscheidet, was sie unternehmen.
Es deprimiert mich.
Das habe ich schon zu oft erlebt. Diese völlig unangebrachte Unterwürfigkeit. Diese Unterdrückung der Furcht, mit dem Falschen zusammen zu sein – aus Furcht davor, sonst allein sein zu müssen. Die Hoffnung gefärbt von Zweifel, der Zweifel gefärbt von Hoffnung. Solche Gefühle aus der Miene anderer abzulesen zieht mich jedes Mal runter. Und in Rhiannons Gesicht ist noch mehr zu erkennen als nur die Enttäuschungen. Etwas wie Herzensgüte. Etwas, das Justin nie und nimmer zu schätzen wissen wird. Ich sehe es sofort, aber da bin ich der Einzige.
Ich verstaue alle meine Bücher im Spind, gehe zu ihr hin und fasse sie am Arm.
Ich habe keine Ahnung, was ich da eigentlich tue. Ich weiß nur, dass ich es tue.
»Fahren wir irgendwohin«, sage ich. »Wo willst du hin?«
Jetzt bin ich nahe genug, um zu erkennen, dass ihre Augen blau sind. Nahe genug, um zu erkennen, dass niemand je nahe genug herankommt, um zu erkennen, wie blau ihre Augen sind.
»Ich weiß nicht«, gibt sie zur Antwort.
Ich nehme ihre Hand.
»Komm«, sage ich.
Die Rastlosigkeit wird zur Sorglosigkeit. Erst gehen wir Hand in Hand. Dann laufen wir Hand in Hand. Der Rausch, miteinander Schritt zu halten, durch die Schule zu sausen, alles außer uns zu undeutlichen, unbedeutenden Flecken verwischen zu lassen. Wir lachen, sind ausgelassen und fröhlich. Sie verstaut ihre Bücher im Spind, und wir gehen raus an die Luft, echte Luft mit Sonnenschein und Bäumen, raus in die nicht so beschwerliche Welt. Ich verstoße gegen die Regeln, indem ich die Schule verlasse, mit Rhiannon in Justins Wagen steige, den Zündschlüssel umdrehe.
»Wo willst du hin?«, frage ich noch einmal. »Sag ganz ehrlich, wo du gerne hinfahren würdest.«
Erst ist mir gar nicht klar, wie viel von ihrer Antwort abhängt. Wenn sie sagt: Fahren wir zur Mall, klinke ich mich aus. Wenn sie sagt: Fahren wir zu dir nach Hause, klinke ich mich aus. Wenn sie sagt: Eigentlich will ich den Nachmittagsunterricht nicht verpassen, klinke ich mich aus. Und das sollte ich auch. Ich sollte mich aus so was raushalten.
Aber sie sagt: »Ich will ans Meer. Fahr mit mir zum Meer.«
Und ich klinke mich ein.
Wir brauchen eine Stunde. Es ist Ende September in Maryland. Die Blätter haben sich noch nicht verfärbt, aber man sieht, dass sie so langsam daran denken. Das Grün ist stumpfer, matter. Bunt steht vor der Tür.
Ich überlasse Rhiannon das Radio. Das wundert sie, aber es ist mir egal. Ich habe genug von laut und grausig und ahne, dass es ihr ebenso geht. Sie bringt Wohlklang in den Wagen. Es kommt ein Song, den ich kenne, und ich singe mit.
And if I only could make a deal with God …
Rhiannons Verwunderung wird zu Argwohn. Justin singt nie mit.
»Was ist denn auf einmal in dich gefahren?«, fragt sie.
»Musik«, sage ich.
»Ha.«
»Nein, echt.«
Sie sieht mich lange an. Lächelt dann.
»Wenn das so ist«, sagt sie und dreht am Knopf, bis sie den nächsten Song gefunden hat.
Bald singen wir aus voller Kehle. Einen Popsong, der ungefähr so viel Substanz hat wie ein Luftballon, uns beim Singen aber ebenso schweben lässt.
Es ist, als hielte uns die Zeit nicht mehr im Griff. Rhiannon denkt nicht mehr darüber nach, wie ungewöhnlich das hier ist. Sie überlässt sich dem, was geschieht.
Ich möchte ihr einen schönen Tag schenken. Einfach nur einen schönen Tag. Ich bin so lange ohne Ziel und Zweck umhergestreift, und jetzt ist mir dieses Eintagsziel geschenkt worden – es fühlt sich jedenfalls an wie ein Geschenk. Ich habe nur einen Tag zu verschenken – warum soll es kein schöner sein? Warum kein gemeinsamer? Warum soll ich die Musik dieses Augenblicks nicht annehmen und schauen, wie lange sie anhält? Die Regeln lassen sich löschen. Ich kann das hier annehmen. Ich kann das hier verschenken.
Als der Song aus ist, lässt sie das Beifahrerfenster herunter und hält die Hand in den Luftstrom, bringt neue Musik in den Wagen. Ich lasse auch die übrigen Fenster herunter und fahre schneller, bis schließlich der Wind das Sagen hat, unser Haar in alle Richtungen verweht und es uns vorkommt, als wäre der Wagen gar nicht mehr da, als wären wir selbst der Antrieb, das Tempo. Dann kommt noch ein guter Song, und ich schließe uns wieder ein, nehme ihre Hand. Fahre Meile um Meile so und stelle ihr Fragen. Wie es ihren Eltern geht. Wie es zu Hause so ist, nachdem ihre Schwester jetzt aufs College geht. Ob dieses Schuljahr ihrem Gefühl nach in irgendeiner Weise anders ist.
Sie tut sich schwer. Jede einzelne Antwort beginnt mit: Ich weiß nicht. Aber meistens weiß sie es sehr wohl, wenn ich ihr Zeit und Raum zum Antworten gebe. Ihre Mutter meint es gut, ihr Vater weniger. Ihre Schwester meldet sich nicht zu Hause, was Rhiannon verstehen kann. Schule ist Schule – sie hätte sie gern hinter sich, fürchtet sich aber auch davor, sie hinter sich zu haben, weil sie sich dann überlegen muss, was als Nächstes kommt.
Sie fragt mich, wie ich das sehe, und ich sage: »Ganz ehrlich, ich versuche bloß von einem Tag zum nächsten zu leben.«
Es ist nicht genug, aber immerhin etwas. Wir sehen die Bäume, den Himmel, die Schilder, die Straße. Wir spüren einander. Jetzt und hier besteht die Welt nur aus uns. Wir singen weiter mit, so hemmungslos wie vorher, und kümmern uns nicht groß darum, ob wir die richtigen Töne und Worte treffen. Beim Singen sehen wir uns an: nicht zwei Solisten, sondern ein Duett, das sich kein bisschen ernst nimmt. Das ist auch eine Form von Gespräch – aus den Geschichten, die andere einem erzählen, erfährt man eine Menge über sie selbst, aber ebenso daraus, wie sie mitsingen, ob sie die Fenster gern oben oder unten haben, ob sie sich von Landkarten leiten lassen oder von der Welt, ob sie den Sog des Meeres spüren.
Sie sagt mir, wie ich fahren soll. Vom Highway runter. Über die freien Nebenstraßen. Es ist weder Sommer noch Wochenende. Es ist Montagmittag, und niemand außer uns will zum Strand.
»Ich sollte jetzt in Englisch sein«, sagt Rhiannon.
»Und ich in Bio«, sage ich nach einer Abfrage von Justins Stundenplan.
Wir fahren weiter. Als ich sie heute Morgen zum ersten Mal sah, machte sie den Eindruck, als balancierte sie auf Felsspitzen oder einem schmalen Gipfelgrat. Jetzt ist der Boden unter ihren Füßen ebener, weniger feindlich.
Hier lauert Gefahr, ich weiß. Justin ist nicht gut zu ihr. Das erkenne ich. Wenn ich die schlechten Erinnerungen abrufe, sehe ich Tränen, Streitereien und Überreste von so etwas wie Zusammengehörigkeit. Sie ist immer für ihn da, das findet er sicher gut. Seine Freunde mögen sie, das findet er sicher auch gut. Aber es ist nicht dasselbe wie Liebe. Sie klammert sich schon so lange an die Hoffnung auf ihn und sieht nicht, dass da nichts mehr zu hoffen ist. Bei ihnen gibt es kein gemeinsames Schweigen, nur Lärm. Meistens seinen. Wenn ich wollte, könnte ich tief in ihre Streitereien eintauchen. Könnte nachspüren, vor welchem Scherbenhaufen er steht, so oft, wie er sie schon kurz und klein gehackt hat. Wenn ich tatsächlich Justin wäre, würde ich irgendwas finden, was mir an ihr nicht passt. Jetzt und hier. Es ihr sagen. Sie anschreien. Sie niedermachen. Ihr zeigen, wo es langgeht.
Aber das kann ich nicht. Ich bin nicht Justin. Auch wenn sie es nicht weiß.
»Lassen wir’s uns einfach gutgehen«, sage ich.
»Okay«, sagt sie. »Von mir aus gerne. Ich denke so oft ans Ausbrechen – da ist es echt schön, es tatsächlich mal zu tun. Für einen Tag. Statt ewig aus dem Fenster zu starren, tut es gut, mal auf der anderen Seite vom Fenster zu sein. Das sollte ich öfter machen.«
In ihr steckt so viel, von dem ich wissen will. Und zugleich habe ich bei jedem unserer Worte das Gefühl, dass womöglich etwas in ihr steckt, von dem ich schon weiß. Wenn ich bis dahin komme, werden wir einander erkennen. Das werden wir.
Ich parke. Wir ziehen die Schuhe aus und lassen sie unter den Sitzen, dann gehen wir Richtung Meer. Am Strand bücke ich mich und kremple meine Jeans auf, Rhiannon läuft weiter. Als ich wieder hochschaue, dreht sie sich im Kreis, wirbelt mit den Füßen Sand hoch, ruft nach mir. In diesem Moment ist alles federleicht. Sie strahlt vor Freude, und ich kann nicht anders, muss eine Sekunde stehen bleiben und ihr zusehen. Zeuge sein. Es mir einprägen.
»Na los!«, ruft sie. »Komm her!«
Ich bin nicht der, für den du mich hältst, würde ich am liebsten sagen. Aber das geht nicht. Natürlich geht das nicht.
Wir haben den Strand für uns, das Meer für uns. Ich habe sie für mich. Sie hat mich für sich.
Kind zu sein, hat etwas Kindisches und etwas Heiliges an sich. Plötzlich rühren wir an das Heilige – laufen ans Ufer, spüren den ersten kalten Wasserschwall an den Knöcheln, angeln in der Strömung nach Muscheln, bevor die Ebbe sie uns unter den Fingern wegzieht. Wir kehren zurück in eine Welt voller Glitzerkraft und waten tiefer hinein. Breiten die Arme weit aus, als wollten wir den Wind umarmen. Sie bespritzt mich zum Spaß, und ich gehe zum Gegenangriff über. Unsere Hosen und T-Shirts werden nass, aber das macht uns keine Sorgen. Wir sind sorgenfrei.
Ich soll ihr helfen, eine Sandburg zu bauen, und dabei erzählt sie mir, dass sie und ihre Schwester nie wirklich zusammen an Sandburgen gearbeitet haben – es war immer ein Wettbewerb, bei dem ihre Schwester möglichst hoch hinaus wollte, während es Rhiannon auf die Einzelheiten ankam: Jede Sandburg sollte das Puppenhaus sein, das sie nie haben durfte. Ein Detail, das auch jetzt noch zu erkennen ist, als unter ihren gewölbten Händen Türmchen emporwachsen. Ich für mein Teil habe keine Erinnerungen an Sandburgen, aber es muss bei mir so was wie ein sensorischer Speicher angedockt sein, denn irgendwie weiß ich, wie es geht, wie man die Formen hinbekommt.
Als wir fertig sind, gehen wir wieder ans Wasser und spülen uns die Hände ab. Hinter mir sehe ich unsere Fußspuren zu einem Trampelpfad zusammenlaufen.
»Was ist?«, fragt sie. Offenbar lässt sich aus meiner Miene etwas ablesen.
Wie soll ich das erklären? Das Einzige, was mir einfällt, ist »Danke«.
Sie sieht mich an, als hätte sie das Wort noch nie gehört.
»Wofür?«, fragt sie.
»Für das hier«, sage ich. »Für das alles.«
Für das Ausbrechen. Das Wasser. Die Wellen. Für Rhiannon. Es ist, als wären wir aus der Zeit herausgetreten. Auch wenn sie kein Ort ist.
Halb wartet sie immer noch auf den Moment, an dem es kippt, an dem diese unbändige Freude zu Schmerz umschnappt.
»Es ist okay«, sage ich. »Es ist okay, glücklich zu sein.«
Tränen steigen ihr in die Augen. Ich nehme sie in die Arme. Das ist falsch. Aber es ist das Richtige. Ich muss auf meine Worte hören. Glück kommt in meinem Vokabular kaum vor, weil es für mich so flüchtig ist.
»Ich bin glücklich«, sagt sie. »Bin ich wirklich.«
Justin würde sie auslachen. Justin würde sie umschubsen, in den Sand, und mit ihr machen, was er will. Justin wäre nie hierhergekommen.
Ich bin es leid, nichts zu fühlen. Ich bin es leid, mich nicht einzuklinken. Ich will hier bei ihr sein. Ich will der sein, der ihren Hoffnungen gerecht wird, auch wenn meine Zeit begrenzt ist.
Das Meer macht seine Musik; der Wind führt seinen Tanz auf. Wir halten uns fest. Erst aneinander, und dann an etwas, das noch größer erscheint. Noch großartiger.
»Was ist das hier?«, fragt Rhiannon.
»Schsch«, sage ich. »Keine Fragen stellen.«
Sie küsst mich. Ich habe seit Jahren niemanden mehr geküsst. Mir seit Jahren nicht mehr erlaubt, jemanden zu küssen. Ihre Lippen sind weich wie Blütenblätter, und doch ist Nachdruck dahinter. Ich lasse mir Zeit, lasse Moment um Moment ineinanderströmen. Spüre ihre Haut, ihren Atem. Schmecke die Feuchte unserer Berührung, verweile in ihrer Wärme. Rhiannons Augen sind geschlossen, meine offen. Ich will das hier nicht nur als ein einzelnes Gefühl im Gedächtnis behalten. Sondern als Ganzes.
Wir küssen uns. Nicht mehr und auch nicht weniger. Manchmal macht sie Anstalten, weiter zu gehen, aber das brauche ich nicht. Ich streiche über ihre Schultern, sie streicht über meinen Rücken. Ich küsse sie am Hals. Sie küsst mich unter dem Ohr. Wenn wir innehalten, lächeln wir einander an. Ungläubiges Staunen. Gläubiges Staunen. Sie sollte in Englisch sein. Ich in Bio. Es war nicht die Rede davon, dass wir heute auch nur in die Nähe des Meers kommen. Wir haben unser Tagesprogramm über den Haufen geworfen.
Hand in Hand gehen wir am Strand entlang, während die Sonne am Himmel tiefer sinkt. Ich denke nicht an die Vergangenheit und auch nicht an die Zukunft. Ich bin so unendlich dankbar für die Sonne, für das Wasser, für meine Füße, die sich in den Sand graben, für das Gefühl, Rhiannons Hand in meiner zu halten.
»Das sollten wir jeden Montag machen«, sagt sie. »Und jeden Dienstag. Und jeden Mittwoch. Und jeden Donnerstag. Und jeden Freitag.«
»Dann wäre es nichts Besonderes mehr«, sage ich. »So was macht man am besten nur einmal.«
»Nie wieder?« Das hört sich für sie nicht gut an.
»Tja, man soll niemals nie sagen.«
»Ich würde niemals nie sagen«, erklärt sie mir.
Jetzt sind noch ein paar andere Leute am Strand, überwiegend ältere Männer und Frauen beim Nachmittagsspaziergang. Sie nicken uns im Vorbeigehen zu, manchmal grüßen sie auch. Wir nicken zurück, erwidern ihren Gruß. Niemand will wissen, warum wir hier sind. Niemand will irgendetwas wissen. Wir gehören einfach zu dem Augenblick dazu, so wie alles andere.
Die Sonne sinkt weiter. Die Temperatur sinkt mit ihr. Rhiannon zittert, ich lasse ihre Hand los und lege den Arm um sie. Sie schlägt vor, zurück zum Wagen zu gehen und die »Knutschdecke« aus dem Kofferraum zu holen. Wir finden sie begraben unter leeren Bierflaschen, einem verknäulten Starthilfekabel und anderem Jungsschrott. Ich frage mich, wie oft Rhiannon und Justin die Knutschdecke wohl schon hergenommen haben, aber ich mache keinen Versuch, die Erinnerungen abzurufen. Stattdessen gehe ich mit der Decke zurück zum Strand und breite sie für uns aus. Ich lege mich hin und schaue hoch zum Himmel, Rhiannon legt sich neben mich und tut das Gleiche. Wir starren in die Wolken, mit Luft zum Atmen zwischen uns, und nehmen alles in uns auf.
»Das ist unter Garantie einer der besten Tage überhaupt«, sagt Rhiannon.
Ohne den Kopf hinzudrehen, finde ich ihre Hand und halte sie.
»Erzähl mir was von anderen solchen Tagen«, sage ich.
»Ich weiß nicht …«
»Bloß einer. Der erste, der dir in den Sinn kommt.«
Rhiannon denkt kurz nach. Dann schüttelt sie den Kopf. »Das ist total dämlich.«
»Erzähl.«
Sie dreht sich zu mir hin und legt mir die Hand auf die Brust. Malt träge Kreise darauf. »Keine Ahnung wieso, aber das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist diese Modenschau für Mutter und Tochter. Versprichst du, nicht zu lachen?«
Ich verspreche es.
Sie mustert mich. Vergewissert sich, dass ich es ernst meine. Redet weiter.
»Da war ich in der vierten Klasse oder so. Dieser Klamottenladen, Renwick’s, hat eine Spendenaktion für Opfer von einem Wirbelsturm veranstaltet und Freiwillige aus unserer Klasse gesucht. Ich hab meine Mutter gar nicht erst gefragt – ich hab mich einfach eingetragen. Und als ich mit der Info nach Hause kam – na, du kennst ja meine Mom. Sie hat Zustände gekriegt. Sie schafft’s ja schon kaum bis zum Supermarkt. Und dann eine Modenschau? Vor wildfremden Leuten? Genauso gut hätte ich sie bitten können, für den Playboy Modell zu stehen. O Gott, was für eine Horrorvorstellung.«
Ihre Hand liegt jetzt still auf meiner Brust. Sie schaut zum Himmel.
»Aber das Komische war: Sie hat nicht nein gesagt. Eigentlich wird mir erst jetzt so richtig klar, was ich ihr da zugemutet habe. Sie hat mich nicht gezwungen, zu der Lehrerin zu gehen und es rückgängig zu machen. Als es so weit war, sind wir zu Renwick’s gefahren und haben uns erklären lassen, wo wir genau hin sollten. Ich hatte gedacht, sie würden uns einen Partnerlook verpassen, aber so war es nicht. Sie meinten, wir hätten die freie Auswahl. Also sind wir kreuz und quer durch den Laden und haben alles Mögliche anprobiert. Ich bin natürlich auf die Abendkleider los. Und bin dann bei einem hellblauen Kleid gelandet, mit jeder Menge Rüschen. Ich fand es irrsinnig elegant.«
»War bestimmt todschick«, sage ich.
Sie gibt mir einen Klaps. »Halt den Mund. Lass mich meine Geschichte weitererzählen.«
Ich greife nach ihrer Hand auf meiner Brust. Beuge mich zu ihr und küsse sie kurz.
»Nur zu«, sage ich. Ich genieße das. Sonst lasse ich mir nie von Leuten Geschichten erzählen. Normalerweise muss ich mir die irgendwie selbst zusammenreimen. Denn wenn mir Leute Geschichten erzählen, erwarten sie, dass ich sie im Gedächtnis behalte. Und das kann ich nicht garantieren. Ich kann unmöglich wissen, ob die Geschichten bleiben, nachdem ich weg bin. Und es wäre doch eine Katastrophe, wenn man jemandem etwas anvertraut und feststellen muss, dass es verschwunden ist. Dafür will ich nicht verantwortlich sein.
Aber bei Rhiannon kann ich nicht widerstehen.
Sie redet weiter. »Okay, also ich hatte damit schon mal sozusagen mein Abschlussballkleid in klein. Und dann war Mom an der Reihe. Komischerweise ist sie auch zu den Abendkleidern hin. Bis dahin hatte ich sie noch nie so richtig edel angezogen gesehen. Und das hat mich wohl am meisten umgehauen: Nicht ich war Aschenputtel, sondern sie.
Als wir die Kleider ausgesucht hatten, haben sie uns dann geschminkt und so. Ich dachte, Mom rastet aus, aber sie hatte richtig Spaß dabei. Sie haben gar nicht viel mit ihr gemacht – nur ein bisschen mehr Farbe. Und das reichte auch vollkommen. Sie war echt hübsch. Kaum zu glauben, ich weiß, so wie sie jetzt ist. Aber an dem Tag hat sie ausgesehen wie ein Filmstar. Die anderen Mütter haben ihr alle Komplimente gemacht. Und als dann die Show losging, sind wir rausmarschiert, und die Leute haben geklatscht. Mom und ich haben beide gelächelt, und zwar ganz echt, verstehst du?
Wir durften die Kleider zwar nicht behalten, aber ich weiß noch, dass Mom auf der Rückfahrt immer wieder gesagt hat, wie toll sie mich fände. Zu Hause hat Dad uns angeschaut, als wären wir Aliens, aber das Coole war, er hat keine blöden Bemerkungen gemacht, sondern mitgespielt. Wir wären seine Supermodels, hat er gesagt, und ob wir die Modenschau nicht noch mal machen könnten, nur für ihn in unserem Wohnzimmer, und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben uns halbtot gelacht. Und das war’s. Dann war der Tag vorbei. Ich glaube nicht, dass Mom sich seitdem irgendwann noch mal geschminkt hat. Und aus mir ist auch kein Supermodel geworden. Aber der Tag heute erinnert mich an den damals. Weil er so ganz anders war als sonst wahrscheinlich?«
»Klingt so«, sage ich.
»Ich fasse es nicht, dass ich dir das gerade erzählt habe.«
»Wieso?«
»So eben. Keine Ahnung. Es klingt doch total dämlich.«
»Nein, es klingt nach einem guten Tag.«
»Was ist mit dir?«, fragt sie.
»Ich war noch nie bei einer Modenschau für Mutter und Tochter«, witzle ich. Was übrigens nicht stimmt, ich war schon bei mehr als nur einer.
Sie pufft mich an der Schulter. »Nein. Erzähl mir von einem Tag, der auch so war wie der hier.«
Ich frage Justins Gedächtnis ab. Er ist mit zwölf hierhergezogen. Demnach ist alles davor frei verfügbar, weil Rhiannon nicht dabei gewesen sein kann. Ich könnte versuchen, ihr etwas aus seiner Erinnerung zu erzählen, aber das will ich nicht. Ich will Rhiannon an meinen Erinnerungen teilhaben lassen.
»Da war ich elf.« Ich versuche mich an den Namen des Jungen zu erinnern, in dessen Körper ich an dem Tag steckte, aber ich weiß ihn nicht mehr. »Ich habe mit meinen Freunden Verstecken gespielt. Die brutale Variante, wo man beim Abschlagen richtig fest zuhaut und sich rauft. Wir waren im Wald, und aus irgendeinem Grund kam ich auf die Idee, ich müsste auf einen Baum klettern. Das hatte ich vorher noch nie gemacht, glaube ich. Aber ich hab einen mit ein paar Ästen weit unten gefunden und bin einfach hoch. Höher und höher. Es war kinderleicht. In meiner Erinnerung ist der Baum turmhoch. Wolkenkratzerhoch. Irgendwann bin ich sozusagen über die Baumgrenze drüber. Kletterte immer weiter, aber es waren keine anderen Bäume mehr um mich herum. Ich war ganz allein, klammerte mich an den Baumstamm, ewig weit vom Boden weg.«
Schemenhaft sehe ich es wieder vor mir. Die Höhe. Das Städtchen unter mir.
»Es war wie im Märchen«, sage ich. »Anders lässt es sich nicht beschreiben. Ich hörte meine Freunde brüllen, wenn sie gefangen wurden, das Spiel lief langsam aus. Aber ich war vollkommen woanders. Ich sah die Welt von oben, und das ist schon was Außergewöhnliches, wenn man es zum ersten Mal erlebt. Ich war bis dahin noch nie geflogen. Ich glaube, ich war sogar noch nie in einem hohen Gebäude gewesen. Und da hockte ich nun, schwebte über allem, was ich kannte. Ich hatte es an einen besonderen Ort geschafft, und zwar ganz allein. Niemand hatte mir dazu verholfen. Niemand hatte mich da raufgeschickt. Ich bin einfach geklettert und geklettert und geklettert, und das war die Belohnung. Die Welt im Blick zu haben und mit mir allein zu sein. Ich merkte, dass das genau das war, was ich brauchte.«
Rhiannon schmiegt sich an mich. »Das ist echt irre«, flüstert sie.
»Ja, das war es.«
»Und das war in Minnesota?«
In Wahrheit war es in North Carolina. Aber ich checke Justins Erinnerung und stelle fest, ja, für ihn wäre es Minnesota gewesen. Also nicke ich.
»Willst du wissen, welcher Tag noch so war wie der hier?«, fragt Rhiannon und kuschelt sich enger an mich.
Ich verlagere meinen Arm, damit wir es beide bequem haben. »Klar.«
»Unser zweites Date.«
Aber das hier ist doch erst unser erstes, denke ich. Schwachsinn.
»Echt?«, frage ich.
»Weißt du das noch?«
Ich checke Justin. Er erinnert sich nicht an ihr zweites Date.
»Bei Dacks Party?«, hilft sie nach.
Immer noch nichts.
»Jaaa …«, druckse ich.
»Keine Ahnung – vielleicht zählt es ja auch nicht als Date. Aber es war das zweite Mal, dass wir rumgemacht haben. Und, keine Ahnung, du warst einfach so … so süß dabei. Werd jetzt nicht sauer, okay?«
Ich frage mich, worauf das hinausläuft.
»Ich wüsste nicht, was mich hier und jetzt sauer machen sollte, Ehrenwort«, sage ich und lege sogar noch die Hand aufs Herz, um zu zeigen, dass ich es ernst meine.
Sie lächelt. »Okay. Also, in letzter Zeit – hast du es irgendwie immer eilig. Ich meine, wir schlafen miteinander, aber wir sind uns nicht so richtig … nahe. Und es ist schon okay so. Ich meine, es macht Spaß und alles. Aber hin und wieder ist es auch gut, wenn es so ist wie jetzt. Und bei Dacks Party – da war es so. Als hättest du alle Zeit der Welt, als wolltest du sie mit mir zusammen haben. Das war toll. Damals hast du mich noch so richtig angesehen. Es war – als wärst du auf diesen Baum geklettert und hättest ganz oben mich gefunden. Und das haben wir zusammen so erlebt. Obwohl wir bei irgendwelchen wildfremden Leuten im Garten waren. Irgendwann – weißt du das noch? – hast du gesagt, ich soll ein Stückchen rücken, weiter ins Mondlicht. ›Das bringt deine Haut zum Leuchten‹, hast du gesagt. Und genau so war es für mich. Als ob ich leuchte. Weil du mich so angeschaut hast, im Mondlicht.«
Ob sie spürt, dass sie eben jetzt, da es nicht mehr ganz Tag und noch nicht ganz Nacht ist, von dem warmen Orangerot am Horizont angeleuchtet wird? Ich beuge mich über sie, werde ihr Nachtschatten. Ich küsse sie, dann versinken wir ineinander, schließen die Augen, gleiten in den Schlaf. Dieses Gefühl habe ich noch nie erlebt. Eine Nähe, die nicht nur zwischen zwei Körpern besteht. Eine Verbindung – obwohl wir uns gerade erst kennengelernt haben. Eine Empfindung, die nur vom höchsten aller Glücksgefühle herrühren kann: zusammenzugehören.
Was ist das für ein Moment, in dem man sich verliebt? Wie kann so ein winziges bisschen Zeit etwas so Großes, Ungeheuerliches hervorbringen? Plötzlich wird mir klar, wieso Menschen an Déjà-vus glauben und an frühere Leben, denn es ist vollkommen ausgeschlossen, dass meine paar Jahre auf dieser Erde ein solches Gefühl in sich bergen könnten. Wenn man sich verliebt, kommt es einem vor, als stünden Jahrhunderte hinter diesem Augenblick, ganze Generationen – die sich alle so ordnen, dass es genau zu diesem entscheidenden Schnittpunkt kommt. Du weißt, wie albern es ist, und trotzdem spürst du es, in deinem Herzen, in deinen Knochen, dass alles darauf zugelaufen ist, alle verborgenen Pfeile hierher gezeigt haben, das Universum und die Zeit selbst schon seit langem daran wirken und du es eben jetzt erkennst, eben jetzt dort ankommst, wo du immer schon sein solltest.
Eine Stunde später weckt uns der Klingelton ihres Handys.
Ich lasse die Augen zu. Höre sie stöhnen. Ihrer Mutter sagen, dass sie bald nach Hause kommt.
Das Wasser ist mittlerweile pechschwarz, der Himmel tintenblau. Die Kälte kriecht uns unter die Haut, als wir die Decke aus dem Sand klauben und einen neuen Satz Fußabdrücke produzieren.
Sie dirigiert mich, ich fahre. Sie redet, ich höre zu. Wir singen noch ein paar Songs mit. Dann lehnt sie sich an meine Schulter, und ich lasse sie da sein und ein kleines bisschen weiterschlafen, ein kleines bisschen weiterträumen.
Ich versuche, nicht daran zu denken, was als Nächstes geschehen wird.
Ich versuche, nicht daran zu denken, dass es enden wird.
Ich bekomme nie Menschen im Schlaf zu sehen. Nicht so. Sie ist das Gegenteil von dem, was sie bei unserer ersten Begegnung am Morgen war. Ihre Verletzlichkeit ist mit Händen zu greifen, aber sie fühlt sich sicher darin. Ich sehe, wie ihr Körper sich hebt und senkt, sich rührt und ruht. Ich wecke sie erst, als ich neue Anweisungen von ihr brauche, wie ich fahren soll.
In den letzten zehn Minuten macht sie Vorschläge, was wir morgen unternehmen könnten. Ich kriege keine Antwort zustande.
»Wenn es nicht geht, sehe ich dich trotzdem in der Mittagspause?«, fragt sie.
Ich nicke.
»Und vielleicht können wir ja doch nach der Schule noch irgendwas zusammen machen?«
»Ich denke schon. Wobei, ich weiß nicht so genau, was sonst noch so ansteht. Ich habe gerade was anderes im Kopf.«
Das leuchtet ihr ein. »Ist schon gut. Morgen ist morgen. Lassen wir es heute einfach schön ausklingen.«
Sobald wir im Ort sind, kann ich die Wegbeschreibung zu ihrem Haus abrufen und muss sie nicht danach fragen. Aber ich würde mich viel lieber verfahren. Um das Ende hinauszuzögern.
»Da wären wir«, sagt Rhiannon, als wir bei der Einfahrt zu ihrem Haus sind.
Ich parke. Drücke auf den Knopf, der die Zentralverriegelung aufhebt.
Sie beugt sich zu mir und küsst mich. Mit allen Sinnen, hellwach, schmecke ich sie, rieche sie, spüre sie, höre sie atmen, sehe sie langsam von mir fortrücken.
»Das ist der schöne Ausklang«, sagt sie. Und bevor ich noch etwas erwidern kann, ist sie aus dem Auto heraus und weg.
Keine Chance, mich zu verabschieden.
Ich vermute richtig, dass Justin selten Bescheid sagt, wenn er nicht zum Abendessen kommt, und seine Eltern daran gewöhnt sind. Sie schreien ein bisschen rum, aber man merkt genau, dass alle nur ihr Ding abspulen, und als Justin in sein Zimmer stampft, ist das bloß die neueste Wiederholung einer uralten Show.
Ich sollte noch Justins Hausaufgaben machen – wenn möglich, bin ich da immer ziemlich gewissenhaft –, aber meine Gedanken schweifen ständig ab zu Rhiannon. Ich stelle sie mir vor. Bei sich zu Hause. Mit dem Gefühl, zu schweben, nach dem einen geschenkten Tag. In dem Glauben, dass etwas anders ist als sonst, dass Justin sich irgendwie geändert hat.
Ich hätte es nicht tun dürfen. Das weiß ich. Auch wenn es mir vorkam, als hätte das Universum es mir befohlen.
Ich plage mich Stunden damit herum. Ich kann es nicht rückgängig machen. Ich kann es nicht aus der Welt schaffen.
Ich habe mich schon einmal verliebt, oder zumindest dachte ich das bis heute. Er hieß Brennan, und es fühlte sich sehr echt an, obwohl es im Großen und Ganzen bei Worten blieb. Tief bis ins Herz hinein empfundenen Worten. Ich war so blöd, mir eine mögliche Zukunft mit ihm auszumalen. Aber die gab es nicht. Ich habe versucht, es zu steuern, aber es ging nicht.
Das war Kinderkram im Vergleich zu dem hier. Sich zu verlieben, ist nicht das Gleiche wie zu merken, dass jemand anderer dich liebt, und sich für diese Liebe verantwortlich zu fühlen.
Ich kann nicht in diesem Körper bleiben. Ob ich mich schlafen lege oder nicht, der Wechsel kommt so oder so. Früher dachte ich, wenn ich die ganze Nacht wach bliebe, müsste ich nicht woanders hin. Aber dann wurde ich aus dem Körper, in dem ich steckte, herausgerissen. Und das fühlte sich genauso an, wie man es sich vorstellt, aus einem Körper herausgerissen zu werden. Bis in den letzten Nerv erlebt man den Schmerz, auseinandergenommen und in eine neue Form gegossen zu werden. Ab da legte ich mich jeden Abend schlafen. Es hatte keinen Sinn, dagegen anzukämpfen.