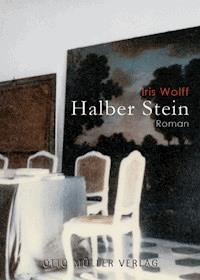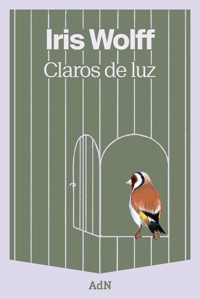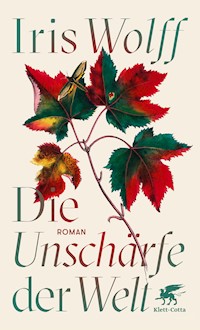16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Müller, Otto
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit einem Unfall am See beginnt die Freundschaft zwischen Ella und Harriet. Die beiden Mädchen, unterschiedlich aufgewachsen und erzogen, sind sich auf unmittelbare, sinnliche Weise vertraut - doch Harriet hat ein Geheimnis, das sie selbst ihrer besten Freundin lange verschweigt. Neben der Wahrheit um Harriets Vergangenheit wird Ella mit einem tiefgreifenden Verlust konfrontiert. Die politischen Ereignisse der Jahre 1943 und 1944 im siebenbürgischen Hermannstadt zwingen die Mädchen zu einem schnellen und unsanften Abschied von der Kindheit. Die Familiengeschichte mit ihren lebendig gezeichneten Figuren ist bestimmt durch Gegensätze: Die Verführungskarft einer zerstörerischen Ideologie, Traditionsbewusstsein und Sehnsucht nach Stabilität. Häuser, Straßen und Natur sind Zufluchtsorte und Identitätsräume und spiegeln doch das Ende einer Epoche. Der beginnenden Auflösung einer jahrhundertealten Kultur wird Lebensmut, humorvoller Pragmatismus und der Wille zum Glück entgegengesetzt. Letztlich bleibt Ella die Zeit mit Harriet in bildhafter Intensität gegenwärtig, denn "Glück wird durch Leid nicht aufgehoben", und die Erfahrung des Verlusts lässt die Erinnerung umso leuchtender werden. Poetisch und mit beeindruckender Leichtigkeit erzählt Iris Wolff in ihrem zweiten Roman von der Unantastbarkeit der Freiheit, von Freundschaft und Liebe in der Zeit zwischen Kindheit und Erwachsensein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Iris WolffLeuchtende Schatten
Iris Wolff
Leuchtende Schatten
Roman
OTTO MÜLLER VERLAG
Dieser Roman wurde gefördert durch ein Literatur-Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg.
www.omvs.at
ISBN 978-3-7013-1228-3eISBN 978-3-7013-6228-8
© 2015 OTTO MÜLLER VERLAG SALZBURG-WIENAlle Rechte vorbehaltenSatz: Media Design: Rizner.atDruck und Bindung: Druckerei Theiss GmbH, A-9431 St. StefanUmschlaggestaltung © Foto: Stine Wiemann;Illustration: Günter Wolff; Grafik: Andreas ThiesAbdruck des Gedichts Die Liebenden durch die freundlicheGenehmigung des Suhrkamp VerlagsZitiert nach: Bertolt Brecht, Werke. Hrsg. v. Werner Hecht u.a. Band 14. Gedichte 4, Gedichte und Gedichtfragmente 1928-1939. Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 1993, Seite 15 f
Für Ralf und Andreas
Inhaltsverzeichnis
I
Das fremde Mädchen
Am See
Büffelklavier
Es ist Zeit
Margeriten
Hohe Rinne
Der Zug
II
Licht und Schatten
Immerhin ein Baum
Kraniche
Gasse ohne Namen
Wolkensammlerin
Kronstadt
Nachbilder
Die Liebenden
Sieh jene Kraniche in großem Bogen!
Die Wolken, welche ihnen beigegeben
Zogen mit ihnen schon, als sie entflogen
Aus einem Leben in ein andres Leben.
In gleicher Höhe und mit gleicher Eile
Scheinen sie alle beide nur daneben.
Daß also keines länger hier verweile
Daß so der Kranich mit der Wolke teile
Den schönen Himmel, den sie kurz befliegen
Und keines andres sehe als das Wiegen
Des andern in dem Wind, den beide spüren
Die jetzt im Fluge beieinander liegen.
So mag der Wind sie in das Nichts entführen;
Wenn sie nur nicht vergehen und sich bleiben
So lange kann sie beide nichts berühren
So lange kann man sie von jedem Ort vertreiben
Wo Regen drohen oder Schüsse schallen.
So unter Sonn und Monds wenig verschiedenen Scheiben
Fliegen sie hin, einander ganz verfallen.
Wohin, ihr?
Nirgendhin.
Von wem entfernt?
Von allen.
Ihr fragt, wie lange sind sie schon beisammen?
Seit kurzem.
Und wann werden sie sich trennen?
Bald.
So scheint die Liebe Liebenden ein Halt.
Bertolt Brecht
I
Das fremde Mädchen
Ich liebte Harriet vom ersten Augenblick an.
Mein Tisch trug die üblichen Spuren, Kerben, Tintenkleckse und ein eingeritztes Herz. Einige Zeichen hatte ich hinterlassen, andere stammten von den Jahrgängen vor mir. Der Stuhl war kühl, es roch nach Holz und feuchter Kreide. Schon jetzt hatte ich diesen Geruch wieder satt. Sehnsüchtig sah ich zum Fenster. Aprilwolken zogen ruhelos über den Himmel. Die Linden trugen ihr erstes Grün, Goldglöckchenbüsche standen in flammendem Gelb. Die Seilergasse war seltsam still.
Nach der Morgenandacht hatten die Klassenzimmer alle Mädchenstimmen und -schritte wieder aufgenommen. Vierzig Schülerinnen fasste das Zimmer der Tertia: Alice, meine Tischnachbarin, Maria aus der Harteneckgasse, Grete, deren Vater Arzt war und seine Praxis am Kleinen Ring hatte, meine Cousine Daggi, die Mädchen aus dem Waisenhaus – vierzig braune, schwarze, rote und blonde Schöpfe, die ich alle kannte. Alle? Ich entdeckte einen schwarzen Haarschopf in der ersten Reihe, der mir bisher nicht aufgefallen war. Ein Mädchen mit kunstvoller Frisur, schlankem Hals und einem Rücken, der so gerade aufgerichtet war, dass er die Stuhllehne nicht berührte. Ihre Schultern waren gestrafft und hoben sich im Takt ihres Atems, der Nacken verriet Anspannung und Konzentration.
Professor Schwarz betrat die Klasse, sofort verstummten die Gespräche. Er hatte dunkle Augen und dichtes, mit Pomade gezähmtes Haar, die ihm den Spitznamen „Lupus“ eingebracht hatten. Er begrüßte uns und bedankte sich für das Ostergeschenk, das wir ihm vor den Ferien im Lehrerzimmer hinterlassen hatten. Lächelnd spielte er auf das Scherzgedicht an, das dem Eierlikör beigegeben worden war. Ich war maßgeblich daran beteiligt gewesen und versuchte, mich möglichst ungerührt zu geben.
Lupus nahm eine Liste vom Katheder.
„Elisabeth Franchy.“
Ich erhob mich und blieb neben dem Tisch stehen, bis er nickte und den nächsten Namen aufrief. So ging es weiter bis zum Buchstaben W.
„Harriet Weissenberg?“
Das fremde Mädchen aus der ersten Reihe wandte sich zur Seite und stand mit einer raschen Bewegung auf. Ihr Kleid schob sich hoch, gab die Kniestrümpfe frei und glitt mit fließendem Schwung wieder hinunter. Sie blieb in gerader Haltung stehen, den Kopf erhoben, die Fingerkuppen der linken Hand auf dem Tisch.
Ich bedauerte, dass ich ihr Gesicht nicht hatte sehen können. Sie war zu schnell aufgestanden und hatte sich mit einer ebenso gewandten und beherrschten Haltung wieder gesetzt. Die ganze Unterrichtsstunde konnte ich den Blick nicht von ihrem Nacken abwenden. Von dem verspielten, drängenden Schwung der Haare, und jener Strähne, die sich aus ihrer Frisur zu lösen begann. Das durch die Lindenblätter gesiebte Licht streute alle Farben in das Cremeweiß ihres Kleides. Ein Anklang von Schwarz an den Ärmeln, dort, wo der Saum war. Ich konnte mich ihrer Gegenwart nicht entziehen, war unkonzentriert und musste mich immer wieder bei Alice vergewissern, welche Seiten des Lehrbuchs wir aufschlagen sollten.
Wer war dieses Mädchen? Hatte sie schon an ihrem Platz gesessen, als ich das Zimmer betreten hatte? Oder war sie später hereingekommen und ich hatte es nicht bemerkt? Warum kam sie mitten im Schuljahr in unsere Klasse? Da es kein anderes Mädchengymnasium in Hermannstadt gab, musste sie neu in der Stadt sein.
Nachdem die erste Schulstunde vorbei war, tippte mir Maria auf die Schulter und verwickelte mich in ein Gespräch. Als ich mich wieder umsah, war das Mädchen fort.
Ich sah sie erst in der großen Pause wieder. Sie hatte ihren Antrittsbesuch bei der Schulleiterin hinter sich gebracht und ihre Schulmütze erhalten. Sie saß auf einer Bank, ihr plissiertes Kleid fächerte sich ab der Taille in unzähligen Falten über das Holz auf. Ich bemerkte, dass die Bänke des Pausenhofs einen neuen Anstrich erhalten hatten. Ein dunkles Grün, das an Efeu erinnerte. Harriet Weissenberg hielt den Rücken gerade, den Kopf gesenkt und aß ihr Pausenbrot. Dabei sah sie konzentriert in ein Notizbuch, das auf ihren Knien lag. Eine akkurate, leicht nach rechts geneigte Schrift füllte die Seiten. Ich umrundete ihre Bank in der Hoffnung, ihr Gesicht zu sehen, doch sie blickte nicht auf. Dieses Mädchen war vollauf damit beschäftigt, so zu wirken, als mache es ihm nichts aus, allein zu sein.
Meine Cousine Daggi winkte mich zu sich. Wir suchten unsere Ecke an der Turnhalle auf. Von diesem Platz aus hatte man das Schulgelände im Blick. Den Pausenhof, auf dem die Schülerinnen sich in Gruppen zusammenfanden, die rückseitige Pforte, die hohen Sprossenfenster des ersten und zweiten Stocks bis hinauf zu den mandelförmigen Dachgauben.
Daggi war anderthalb Jahre älter als ich, ging jedoch in dieselbe Klasse, da sie im letzten Schuljahr sitzen geblieben war. Dagmar Luise Seiler, so ihr Taufname, hatte bereits einen Freund, zog sich jeden Morgen im Park die Lippen nach, steckte den Rock mit Sicherheitsnadeln hoch und rollte die Kniestrümpfe ein kleines, doch nicht unwesentliches Stück hinunter. Sie hatte ein jungenhaftes Gesicht und hellrote Haare, ebenso wie ihr Bruder Ferdinand. Eine Nuance zwischen Karottenrot und Gold. Großmutter hasste diese Farbe.
„Alles, nur keine roten Haare!“, hatte sie vor der Geburt ihrer drei Enkel gesagt. Bei Ferdi, der zuerst zur Welt kam, hielt sie es für reines Pech. Für vorsätzlich und allein dazu bestimmt, sie zu ärgern, als auch Daggi mit roten Haaren geboren wurde, und sie versöhnte sich erst wieder mit ihrem Los, als sich herausstellte, dass ich ihr unentschiedenes Blond geerbt hatte. Bis heute unterließ sie es nicht zu sticheln – der rötliche Einschlag komme nicht aus der Familie Connert oder der ihres Vaters, deren Stammbaum sogar ungarisches Adelsblut nachweise, sondern von der angeheirateten Linie Seiler.
„Was hältst du von ihr?“ Ich wies mit dem Kopf zur Bank, auf der Harriet saß.
Daggi kramte in ihrer Rocktasche und zündete sich eine Zigarette an. „Ein scheues Ding.“
„Wie würde es dir am ersten Tag in einer neuen Klasse gehen?“
Daggi entging die überraschende Schärfe meiner Äußerung nicht. Sie hob fragend eine Augenbraue und atmete den Rauch aus. Meine Cousine konnte mit ihrem Mund kleine Ringe formen, die aufstiegen, wanderten und sich langsam auflösten, wenn ein Lufthauch sie erfasste. Eine Lehrerin ging an uns vorbei. Daggi drehte gekonnt die Zigarette in die Handfläche und grüßte mit ihrem unschuldigsten Lächeln.
„Kannst du Arthur nach ihrer Familie fragen? Der erfährt doch von Pirosch immer alle Neuigkeiten der Stadt“, bat ich.
Die Glocke beendete die Pause. Meine Cousine drückte die Zigarette aus, schnippte den Filter über die Mauer und nahm eine Pfefferminzpastille in den Mund. Dann strich sie ihren Rock glatt und hakte sich bei mir ein. Auf dem Weg zurück ins Schulgebäude versprach sie, etwas über das fremde Mädchen herauszufinden.
„Ella, kommst du bitte?“
Ich klopfte die Schuhe ab und trat in die Küche. Mutter begrüßte mich mit einem Kuss auf die Stirn. Jeden Montag nach der Schule brachte ich den Teig für die Wochenbrote zum Bäcker. Am Morgen standen Mehldose, Wasserkrug und der mit Mostschaum und Akazienblüten gewürzte Sauerteig noch auf dem Tisch. Inzwischen war der Teig aufgegangen, der Brottrog, ein ausgehöhlter Buchenstamm, im Hof abgespritzt und die Küche wieder aufgeräumt. Großmutter öffnete eine Schublade der Kredenz und drückte mir mit prüfendem Blick Geld in die Hand. Menschen, die Ursula-Oma das erste Mal begegneten, erstarrten unter diesem Blick.
Ich wusste nicht, woher ihre Strenge rührte, weder Mutter noch Marga-Tante ähnelten ihr in dieser Hinsicht. Beiden Schwestern war ein weichherziger, nachgiebiger Zug zu eigen, der sich bei Mutter als Großzügigkeit, bei meiner Tante bisweilen als Gleichgültigkeit zeigte. Großmutters Blick dagegen kannte keine Gnade. Unter ihm konnte man nicht lügen, täuschen oder schöntun. Man war ihm ausgeliefert bis auf die Knochen.
„Habt ihr Hausaufgaben bekommen?“, fragte Mutter.
Ich schüttelte den Kopf, sah sie dabei jedoch nicht an. Von Ursula-Oma hatte ich gelernt, dass jemand, der lügt, zum Starren neigt. Die meisten Menschen denken, ein Lügner würde wegsehen, doch das Gegenteil war laut Großmutter der Fall. Er braucht die Vergewisserung, die Sicherheit, dass der andere ihm glaubt, und lässt ihn nicht aus den Augen.
Ich sah also weg und hoffte, dass Mutter mir Glauben schenkte. Die Schule war ein leidiges Thema. Ich hatte keine Strafeinträge, aber auch keine Belobigungen, machte die Hausaufgaben gerade so, dass es reichte, und wenn ich an die Tafel gerufen wurde, widmete ich mich der Lösung mit der Ruhe einer mittelmäßig begabten Schülerin. Ich interessierte mich für kein bestimmtes Fach, hatte an mir noch kein besonderes Talent entdeckt, auch meine Lehrer nicht. Dieser Umstand war weder unangenehm noch beklagenswert, im Gegenteil, er sicherte meinen Frieden.
„Denk an deine Zukunft“, sagte Mutter oft, wenn sie sah, wie schnell ich die Schulbücher zuklappte, um den Nachmittag mit den Nachbarskindern auf der Straße zu verbringen. Doch die Zukunft war etwas Unwirkliches. Ich konnte sie mir nicht vorstellen, sie war ein weiter, offener Raum. Etwas in ihr hoffen und verwirklichen zu wollen war, als stünde man auf einem Berg, von Nebel umgeben, und suche den Horizont mit dem Feldstecher ab.
Manche von Daggis Freundinnen hatten kein anderes Gesprächsthema als die gute Partie, die sie heiraten, den Hausstand, in dem sie wirtschaften wollten. Andere wollten nach Wien oder nach Berlin reisen. Ich konnte mich an solchen Gesprächen nicht beteiligen. Weder das Leben einer Hausfrau noch einer Reisenden zog mich an. Alles war gut so, wie es war. Ich kannte jede Straße unseres Viertels, jede Abkürzung auf den Wegen, die ich oft ging – zur Schule, zu Freunden oder auf den Botengängen für Großmutter. Meine Welt war an den meisten Tagen nicht größer als unser Haus, der Hof und einige Straßen. An anderen Tagen wurde sie ein wenig weiter und erstreckte sich auf den Markt, die Oberstadt oder den Jungen Wald. Und an wenigen Tagen wurde sie himmelweit, wenn wir einen Ausflug ins Zibinsgebirge machten.
Unser Hof lag an einer Straßenecke, an zwei Seiten von einem Bretterzaun umgeben. Wie es in Siebenbürgen üblich war, konnte man den Hof oder Garten der Nachbarn nicht einsehen. Der Schuppen war, ebenso wie der Zaun, schon etwas baufällig. Es ließ sich, wie Großmutter sagte, gerade noch so darüber hinwegsehen. Der Hof konnte nur von der Ziegelgasse aus betreten werden, ein Umstand, der bei Besuchern immer wieder für Verwirrung sorgte. Erst wenn man rechts an Schuppen und Brunnen vorbei zur Seite des Hauses ging, führte eine Treppe zur Veranda und dem eigentlichen Hauseingang der Familien Seiler und Franchy. Dieser unlogische Aufbau des Hauses schenkte ein wenig Vorsprung, bevor es, nach dem geräuschvollen Öffnen des Hoftors, an der Haustür klopfte.
Das Hundehaus neben dem Tor stand leer, seit unser Rottweiler Luz vor einem Jahr gestorben war. Während seiner letzten Wochen hatte er regungslos vor dem Tor gelegen und jeden Eintretenden nur noch kläglich angewinselt. Eine Narbe an meinem Zeigefinger erinnerte mich an ihn. Luz hatte nie zu unterscheiden gelernt, wann aus dem Spiel Ernst wurde.
Als wir jünger waren, gab es auf diesem Fleckchen Erde keine Grenzen. Ein ganzes Dorf fand darauf Platz, Jagdgründe, Verstecke, Aussichtspunkte, Brücken, Feuerstellen und Badeseen. Der Boden war unbefestigt, im Sommer ein großer Sandkasten, über den die Erwachsenen an Regentagen Bretter legten, um ihre Schuhe nicht schmutzig zu machen. Im Winter ein Ort für Eislaufbahnen und Schneemänner mit Karottennasen und Steinaugen.
Im Garten wuchsen Stachelbeeren, Ribisel und Brombeeren, zwei Apfelsorten und wilde Pfirsiche. Im Frühling Tulpen, die das rumänische Nachbarmädchen Lalele nannte, kriechender Günsel und Himmelsschlüsselchen, dann violetter Flieder, im Sommer Hortensien und Rosen. Neben den Teppichstangen waren Wäscheleinen befestigt. Großmutters Gemüsebeet war unlängst erweitert worden. Vater und Gerhard-Onkel unterhielten eine Hasenzucht, die Käfige nahmen einen Teil des hinteren Gartens ein. Allein unter der weinbewachsenen Laube und im Schuppen, wo unser Geheimversteck war, hatten Daggi, Ferdi und ich noch unser Refugium verteidigen können.
„Träum nicht“, mahnte Mutter.
Ich befestigte die Teigschüssel mit einem Gürtel und zog den Karren über den Hof hinaus auf die Straße. Pferdewägen rollten vorbei, ein Fahrradkurier schlängelte sich zwischen Fußgängern und Fuhrwerken hindurch. An der Ecke verkaufte eine Bäuerin Blumen, hinter den Bahngleisen, aus dem Schornstein der Ziegelfabrik, stieg Rauch auf. Ich wartete an den Kreuzungen, bis sich eine Lücke ergab, und war darauf bedacht, Unebenheiten im Trottoir zu umfahren. Ein Steinchen verirrte sich in meine Sandale, ich blieb stehen, balancierte auf einem Bein und schüttelte den Schuh aus. Als ich ihn etwas unbeholfen wieder anzog, grüßte mich eine vertraute Stimme. Vor Schreck stieß ich gegen den Karren.
Ich kannte Leopold Orendi seit dem Kindergarten. Wir hatten uns angefreundet, als Leos Schwester sich regelmäßig mit einem Nachbarmädchen traf. Zwischen vielen Grundstücken gab es Freundschaftstürchen, die Nachmittage lang offen standen, wenn es nach uns ging. An solchen Tagen versammelten sich auf unserem Hof bis zu einem Dutzend Kinder. Leo und ich waren uns damals vertraut gewesen, unser Umgang so geläufig wie es unsere Spiele mit sich brachten.
Ich spürte, wie mir das Blut in den Kopf schoss und senkte den Blick. Irgendwie gelang es mir, ein paar Worte zur Begrüßung hervorzubringen. Mehr hätte ich nicht sagen können und musste es zum Glück auch nicht. Ich sah, wie seine Hand den schwankenden Karren festhielt und dann, nachdem einige Augenblicke vergangen waren, in denen ich nicht den Mut gefunden hatte aufzusehen, wie er wieder seines Weges ging.
Jeden Abend, wenn ich zu Bett ging, malte ich mir aus, wie Leo mich ansah, wie er meine Wangen streichelte, meinen Hals und mein Haar, wie sein Kopf sich zu mir neigte. Wieder und wieder kostete ich diese Szene aus, erdachte sie in allen Einzelheiten. Ich wurde nie überdrüssig, mir vorzustellen wie er mich küsste – auf einer Bank im Erlenpark, auf der Zibins-Brücke, im Schuppen. Jeden Abend blätterte ich durch diese Szenen wie durch ein Album, bis mir eine besonders zusagte, und schmückte sie weiter aus. Ich ließ mich in diesem Bilderstrom treiben, die Bettlaken, weiß und kühl, nahmen die Temperatur der Haut an. Mehr als diese Zärtlichkeiten wagte ich mir nicht vorzustellen. Die Gefühle, die ich dabei empfand, reichten von ausgelassener, kopfloser Erregung bis hin zu reuevoller Scham.
Der Gedanke, dass der Spielgefährte meiner Phantasie dies nicht wusste, trieb mir immer, wenn ich ihm begegnete, die Schamesröte ins Gesicht. Dass jemand nicht weiß, dass er der Phantasie eines anderen Menschen ausgeliefert ist, in manchen Augenblicken ganz ihm gehört, dass seiner Stimme eingeflüstert wird, was sie sagen soll, seine Hände und Arme, seine Schritte befehligt werden – dies alles war, bei Tageslicht betrachtet, ungeheuerlich, befremdend und in höchstem Maße peinlich. Es nährte mein Schuldgefühl und machte es mir unmöglich, auch nur ein Wort an Leo zu richten, der mich immer geradeheraus grüßte und manchmal, vielleicht war es nur Einbildung, seinen Blick forschend auf mir ruhen ließ.
Ich setzte meinen Weg erst wieder fort, als ein Mann mich anrempelte und sich auf Hochdeutsch entschuldigte. Es war ein Wehrmachtsoffizier in reichsdeutscher Uniform. Die Offiziere waren, seit Rumänien neunzehnhunderteinundvierzig auf deutscher Seite dem Krieg gegen die Sowjetunion beigetreten war, bei sächsischen Familien untergebracht. Es galt allgemein als Auszeichnung und Ehre, und ich bedauerte, dass niemand in unserem Hof einquartiert worden war. Mutter wiederum war froh, sie mochte die national-sozialistische Propaganda nicht. Man sei, so sagte sie, auch ohne gut ausgekommen.
Die Bäckersfrau begrüßte mich mit meinem Namen, sie zog dabei den ersten Buchstaben in die Länge und sprach ihn wie ein „ä“ aus. Seit einigen Monaten brachte ich ihr montags den Teig für unser Brot. Zuerst hatten Daggi und Ferdi diese Pflicht gehabt, doch da die beiden unzuverlässig waren – man konnte nie wissen, wann sie nach dem Unterricht nach Hause kamen – und der Teig nicht zu lange aufgehen durfte, wurde mir diese Aufgabe übertragen.
Die Bäckersfrau umrundete die Theke und fragte aus Gewohnheit, denn die Zahl unserer Brote hatte sich seit über einem Jahr nicht geändert, wie viele Brotlaibe sie backen sollte.
Sie würde aus dem Teig drei Laibe formen, groß und bis zu drei Kilogramm schwer, und Zettel mit unseren Familiennamen hineindrücken. Die Brote blieben im Ofen, bis sie dunkelbraun wurden, anschließend musste die erkaltete Kruste mit einem Holzstock abgeklopft werden, bis eine hellere Schicht zum Vorschein kam. Heute Abend würde ich wieder hierher kommen und drei Brotlaibe entgegennehmen, die den Familien Seiler und Franchy, mitsamt Großmutter, in dem Haus in der Ziegelgasse für genau eine Woche reichen würden.
Während der Kindheit sind wir eins mit dem, was uns umgibt. Alles gehört selbstverständlich und unzweifelhaft zu uns, Eltern, Verwandte, Freunde, Zimmer, Straßen, Jahreszeiten – man lebt in dem Gefühl, als bestünde nichts ohne das eigene Zutun, als wäre der Schnee nur für uns gefallen, für den Schlitten, der endlich aus dem Schuppen darf, die Schlittschuhe aus dem Keller, und die Wintersachen, die wundersamerweise immer gewaschen, immer gestopft und geflickt sind. Als gäbe es den Sommer allein für unsere Streifzüge, für die Nachmittage am See und die langen Abende im Hof. Alles umgibt uns wie eine zweite Haut, und der Körper bemächtigt sich des Raums, als gehöre er ihm. Man rennt die Treppen hinunter, klettert auf Bäume, weint, wenn Trauer oder Schmerz einen überkommt, windet sich, wenn man etwas nicht mag. Und langsam, unabwendbar, verwandelt sich dieser Instinkt, klafft ein Riss, den die fortschreitenden Jahre immer weiter öffnen. Der Körper schießt in die Höhe, verändert sich, wird fremd und beschämt uns. Und ob wir uns fürchten oder glücklich sind, ganz gleich, ob wir etwas mit Freude begrüßen oder nur schwer ertragen, unser Körper nimmt immer denselben Raum ein. Wir lächeln, wenn uns etwas gefällt, statt einen Luftsprung zu machen, wir erstarren, wenn uns jemand mit seinen Worten quält, statt den Raum zu verlassen. Wir fangen an, unseren Körper zu beherrschen, doch nicht weil wir ihn kennen und schützen wollen, sondern weil wir ihm misstrauen, und es scheint mit einem Mal unvorstellbar, dass jemand uns dessen ungeachtet lieben kann.
In dem Frühling, als Harriet in unsere Klasse kam, war beides gegenwärtig. Oft hatte ich das Gefühl, ich würde auf etwas warten. Als wären die Stunden mit sinnendem, träumendem Warten gefüllt, und nicht mehr wie früher mit blindem und rückhaltlosem Tun. Wenn ich nicht mit den Jungmädeln unterwegs war und Mutter keine Aufgabe für mich hatte, kletterte ich nach dem Mittagessen auf den Schuppen und streckte mich, verborgen vom Flieder, auf dem warmen Holz aus. Oder ich setzte mich aufs Bett und nahm die Bücher zur Hand, die Vater mir geschenkt hatte, „Gullivers Reisen“, griechische und deutsche Sagen, „Robinson Crusoe“, „Effi Briest“. Ich dachte viel an die Roman- und Sagenhelden, an ihre Ängste und ihren Wagemut. Ich malte mir Szenen aus, in denen ich selbst mutig war und schön. Großmutter fühlte sich immer wieder bemüßigt, zu mahnen, dass übermäßige Lektüre Realitätssinn und Tatkraft schwächte. Für sie ergab es keinen Sinn, erfundene Geschichten über erfundene Leute zu lesen.
Am Badetag bestieg ich den Zuber vor den Augen meiner Mutter mit einem Gefühl der Verlegenheit, das sich erst auflöste, wenn das Wasser meinen Körper vollständig bedeckte. Durch das milchig gefärbte Seifenwasser schimmerten Haut, Brustwarzen und das krause Haar zwischen den Schenkeln. Bei dem leisesten Gedanken an Leo regte sich ein Prickeln, das unterhalb des Bauchnabels seinen Anfang nahm und sich über den ganzen Körper ausbreitete. Gingen wir schwimmen, weigerte ich mich standhaft, mich vor jemandem auszuziehen, selbst vor Daggi, die mit ihrer Nacktheit unbekümmert, wenn nicht provozierend, umging. Gleichzeitig konnte es sein, dass sich die Steifheit meines Körpers auflöste, unvermittelt stürzte ich einem Ball hinterher, jagte eine Katze oder brach in albernes Lachen aus, weil sich jemand versprach oder auf der Straße in seinem Mantel verhedderte und stolperte.
Was mir erspart blieb, waren Anfälle von Verzweiflung und das Gefühl der Weltverachtung, wie ich es bei anderen beobachtet hatte. Etwa bei Gregor, dem missratenen Sohn von Ottokar und Melitta, Freunden der Familie. Er konnte das schmackhafteste Essen verschmähen, mit abweisender Miene am Esszimmertisch sitzen, während der Rest der Verwandtschaft in ausgelassener Runde feierte. Er konnte mit gelangweiltem Gesichtsausdruck auf den Treppen der Veranda herumlungern, während Daggi, Ferdi und ich auf ein selbst gezimmertes Tor schossen. Und er hatte eine eisige, abschätzende Art, einem die Hand zu geben, selbst Großmutter, die seine Geste mit einem vielsagenden Blick auf die Eltern quittierte.
Mir blieben diese widerstreitenden Gefühle von Selbsthass bis Eitelkeit erspart. Der Riss, der sich zwischen Kindheit und Jugend ausbreitete, sollte zum Stillstand kommen. Es geschah schleichend, und ich hätte die Anzeichen mit Leichtigkeit erkennen können: Vaters Gesichtsausdruck, wenn er die Nachrichten im Radio hörte. Das Rufen des Zeitungsjungen, wenn es Neuigkeiten von der Front gab. Familien, die fortzogen, Lehrerinnen und Lehrer, die von einem auf den anderen Tag ersetzt wurden. Etwas von der Unbeschwertheit unserer Tage war fort. Doch ich lebte in der Gewissheit, dass alles so bleiben würde wie es war. Dafür trafen meine Eltern Vorkehrungen und dafür sorgte mein Charakter. Ich ließ mich begeistern, wo es meinen Neigungen entgegenkam, und beharrte auf meiner Freiheit, wenn ich gehorchen sollte. Ich mochte die Wanderungen der Jungmädel, kannte alle Soldatenlieder und war, ohne mich für das Kriegsgeschehen zu interessieren, überzeugt von der Unbesiegbarkeit der Deutschen – ich hatte seit Jahren nichts anderes gehört, als dass wir zum auserwählten Volk gehörten. Wir hatten dieselbe Sprache, waren untrennbar miteinander verbunden, und diese Gewissheit erfüllte mich mit Stolz.
Meine Eltern ließen mich gewähren, doch sie waren weit davon entfernt, der allgemeinen Deutschtümelei zu verfallen. Großmutter, die Krämerin und Handelsfrau, die jeden kannte und alles tauschen oder besorgen konnte, sagte, sie könne es sich gar nicht leisten, nur noch mit Sachsen zu verkehren.
Doamne ajutǎ, seufzte Mutter halb im Ernst halb im Scherz, wenn Daggi, Ferdi und ich ihr zu fanatisch wurden. Ihrer Meinung nach ließ sich im Rumänischen manches besser auf den Punkt bringen, vor allem wenn es mit starken Gefühlen verknüpft war. Darunter falle insbesondere das Fluchen, pflichtete Ferdi ihr bei; doch davon mochte Mutter nichts wissen. Vater wiederum hatte eine Vorliebe für das von der Norm abweichende, für Eigenbrötler und Außenseiter. Er hielt einige der Purligare auf dem Kleinen Ring für verkannte Philosophen, wechselte mit den Zigeunern auf dem Zibinsmarkt stets ein paar Worte, und ging, sooft er konnte, auf Buchflohmärkte. Er brachte seine Beute heimlich ins Haus und deponierte sie bei mir, bis er sich traute, sie nach und nach meiner Mutter zu zeigen, die seine Leselust schätzte, doch das Ausmaß seiner Einkäufe fürchtete.
Ich hatte angefangen, nach dem Unterricht mit Daggi durch die Oberstadt zu flanieren, die Jungs im Brukenthalgymnasium zu besuchen, und verwehrte mich dagegen, wenn jemand aus meiner Familie mich von der Schule abholen wollte. In Marias asphaltiertem Hinterhof übte ich mich im Turnen, in ihrer Sommerküche bereiteten wir experimentelle Gerichte zu, für die wir alles in einen Topf warfen und einander dann versicherten, wie hervorragend es schmeckte. Bei Grete saß ich auf der Terrasse bei Himbeersirup und Blechkuchen und hoffte, dass ihr Vater aus seiner Praxis kommen und uns hinein bitten würde. In die Zimmer, die wie ein Schlauch angeordnet waren, durch das Garderobenzimmer mit der Truhe, auf der die Magd schlief, hinein in den Salon, das Herz der Binderschen Bürgerwohnung, das so anders schlug als in unserem Großfamilienhaus. Gretes Mutter imponierte mir, da sie zu betonen pflegte, dass wir auf dem Balkan lebten, man sich einiges von seinen Nachbarn abschauen könne, wie etwa, dass man Essen nicht portioniere und es sich nicht lohne, ständig Staub zu putzen – und damit ganz und gar nicht dem entsprach, was ich gelernt hatte: sehr wohl Staub zu putzen und niemals zu vergessen, was uns von unseren Nachbarn unterschied.
Die Welt war voll von Vertrautem und Fremdem, und ich war dabei, ihre Grenzen immer weiter auszudehnen. Ich fühlte mich mit meinen fast vierzehn Jahren sehr erwachsen und wusste noch nicht, dass sich das Leben auch ohne unser Einverständnis verändert, dass es uns beschenkt und fordert, manchmal ins Leere laufen lässt, unsere Freiheit nicht achtet, und größer ist, als das, was uns von ihm einsichtig ist.
Am See
Harriet war fortan das geheime Zentrum, auf das sich alles bezog. Sie war auf überwältigende und doch anspruchslose Weise Teil meines Lebens. Ohne ein Wort, ohne eine große Geste. Und doch wie etwas, mit dem man hätte rechnen müssen.
Ich dachte oft an sie. Wenn ich meine Bücher sortierte, im Hof spielte oder vor dem Spiegel stand. Ich dachte an ihre gestrafften Schultern, an den Rücken, der so aufrecht war, dass er die Stuhllehne kaum berührte. An ihren gesenkten Kopf auf dem Schulhof und das Notizbuch, in das sie in jeder Pause hineinschrieb.
An diesem Mädchen sprach alles. Ihr Körper sprach mit jeder Bewegung, drückte sich mit jedem Nicken, jeder Geste aus. Harriet hatte eine Art, ihre Schulhefte aufzuschlagen, dass niemand wagte, sie zu stören. Andere Schülerinnen bekamen Fluggeschosse in den Rücken oder wurden Opfer eines Streichs. Nicht so Harriet. Mir fiel auf, dass sogar die Lehrer es nicht wagten, sie zu stören. Wenn Harriet nicht an die Tafel wollte, wurde sie nicht aufgerufen. Ihre Haltung wies jede in diese Richtung gehende Aufforderung ab. Doch nicht, weil sie bemüht wegsah – denn das war, wie jeder wusste, der sicherste Weg, um aufgefordert zu werden –, sondern, wie ich im Physiksaal feststellen konnte, indem sie dem Lehrer nicht auswich, ihn geradezu fixierte. Obwohl ich rasch durchschaute, dass sie um diese Wirkung wusste, spielte sie ihre Konzentration nicht. Es mochte sein, dass sie sich am Anfang bewusst für sie entschied, vermutlich um sich zu schützen oder schlicht ihre Ruhe zu haben, doch nach einiger Zeit war sie ihr in Fleisch und Blut übergegangen. Ihr Atem war ruhig, der Kopf leicht nach vorne geneigt, vielleicht löste sich eine Strähne aus dem Haar – mehr Unordnung und Nachlässigkeit hatte ich noch nicht an ihr entdeckt. Sie hatte in den Wochen, die sie in unserer Klasse war, nicht ein einziges Mal ihre Beherrschung verloren. Man könnte mutmaßen, dass sie sich in unbeobachteten Momenten zurücklehnte, vielleicht die Augen schloss oder sich achtlos über die Stirn strich. Dass die Spannung ihres Rückens nachgab und sie sich unauffällig umsah. In all dieser Zeit war es nicht ein einziges Mal geschehen.
Ich konnte nicht anders, als mir immer wieder ihre Schönheit bewusst zu machen, sie zur Kenntnis zu nehmen, wie etwas, das man nicht verstand, wie sehr man sich auch darum bemühte. Ihre Augen hatten etwas Katzenhaftes: Lange Wimpern, ein klares Weiß, in dessen Mitte grauschwarze, von einzelnen hellen Punkten durchbrochene Iris schwammen. Ein genauer, beobachtender Blick, dem nichts zu entgehen schien, der eine Weichheit offenbarte, die nicht urteilte und nichts verlangte, und der doch schwer aufzufangen war.
Der einzige Makel, den ich an ihr entdeckt hatte, war ein spitzer Zahn, der zwischen den wie Perlen aneinandergereihten Zähnen hervorstach. Doch gerade diese Unregelmäßigkeit war auf irritierende Weise schön. Sie ließ mich stets auf ein Lächeln hoffen, das sich selten genug von ihrem Mund löste.
Ihre Schönheit wäre auch in einem Leinensack nicht zu verbergen gewesen, doch Harriet war das bestangezogene Mädchen der Schule. Ihre Kleider waren nicht aufdringlich, sie hatten keine grellen Farben oder auffällige Muster, doch der Schnitt war nach der neuesten Mode gefertigt und sie trug, was mir schmerzlich auffiel, an jedem Tag ein anderes.
Ich besaß zwei Kleider. Darüber hinaus hatte ich meine Uniform, den blauen Rock, mehrere weiße Blusen und das schwarze Halstuch – doch Kleider nur zwei. Das Grüne hatte mir Mutter aus einem gebrauchten Stoff nähen lassen und das Blaue hatte ich von Daggi geerbt. Eines war immer in der Wäsche und somit unerreichbar, auf das andere, das ich am Leib trug, versuchte ich gut aufzupassen. Häufig spritzte das Tintenfass oder tropfte ein Eis, und Mutter musste es lange über der Waschschüssel behandeln, damit die Flecken wieder herausgingen. Noch vor nicht allzu langer Zeit waren mir Röcke lieber gewesen als Kleider. Man konnte sich freier darin bewegen, besser klettern, und wenn sie schmutzig waren, fiel es meist nicht weiter auf. Doch irgendwann, vielleicht, als Leo begann mir nicht mehr aus dem Sinn zu gehen, wuchs mein Begehren nach Kleidern. In einem Kleid war man eine junge Frau, in einem Rock noch ein Mädchen. Das hatte Daggi, die älter war, und mir somit immer voraus, auch erkannt. Sie hatte so lange bei ihrer Mutter gebettelt, bis diese ihr einige Kleider nähen ließ. Ich versuchte dieselbe Taktik bei meiner Mutter Meta. Sie sah mich lange an und schüttelte dann den Kopf. Ein solches Kopfschütteln, dem ein Schweigen vorausgegangen war, war unumstößlich.
Harriet hatte an jedem Tag ein anderes Kleid an. Besonders gut standen ihr Pastelltöne, Altrosa, Blassgrün oder Lichtblau. Dann stach ihr schwarzes Haar wie Samt hervor und ihre Haut setzte sich ganz sacht von den hellen Tönen des Kleides ab. Sie kleidete sich in Stoffe, die den Schimmer fließenden Wassers hatten, und wenn sie an kühlen Tagen mit einer Strickweste um die Schultern den Schulhof betrat, sah die Wolle aus, als hätte man mit leichtem Atem den Inhalt einer Puderdose aufgewirbelt. Ich genoss es, sie betrachten zu dürfen. Dieses unmittelbare Schauen, bei dem man sich im Anblick eines anderen verliert, hatte ich noch nie so intensiv erlebt, und ich konnte die Gefühle, die damit verbunden waren, nicht einordnen. Manchmal war ich hingerissen von ihrem Äußeren, manchmal durchfuhr mich Neid wie ein stechender Schmerz.
Sie hielt alle auf Distanz. Ihr Blick machte es unmöglich, sich ihr zu nähern. Einige Mädchen aus der Klasse hatten versucht, mit ihr ins Gespräch zu kommen, doch außer ein paar höflich erwiderten Sätzen war sie nicht darauf eingegangen. Nur Maria, die sie bedauerte, vielleicht ebenso wie ich bewunderte, verzieh ihr ihre Schweigsamkeit und sprach sie immer wieder an.
Ich mochte nicht auf Harriet zugehen. Der Abstand zwischen uns gab mir die Sicherheit, sie noch eine Weile aus der Ferne studieren zu können.
„Woher weißt du das?“
„Pirosch hat im Büro seines Vaters die Wohnsitz-Anmeldung der Familie gefunden.“
„Und du bist sicher, dass das stimmt?“
Daggi zupfte nachdenklich an ihrer Unterlippe: „Und wenn schon, warum ist das wichtig?“
„Es ist wichtig!“, sagte ich lauter als beabsichtigt.
Daggi sah mich fragend an, dann ging sie weiter. Wir waren auf dem Weg zur Schule. Es hatte in der Nacht geregnet, die Straßen waren nass. Maiglöckchen und Flieder hatten noch Mitte des vergangenen Monats dem Raureif trotzen müssen. Doch dem kühlen, feuchten Frühjahr folgte ein sommerlich warmer Junibeginn. Vielleicht konnten wir in dieser Woche zum ersten Mal schwimmen gehen.
„Ihre Mutter ist also gestorben…“
Daggi nickte.
„Und ihr Vater ist Advokat?“
„Ja, stell dir vor, drei Monate nach dem Tod seiner Frau hat er wieder geheiratet. Eine gewisse Asta Lienerth.“
„Aber Harriet ist das einzige Kind?“
„Soweit ich weiß, ja. Herr Weissenberg hat bei der Volksgruppe eine Entschuldigung für seine Tochter erwirkt. Sie ist vom Jungmädelbund befreit, wegen gesundheitlicher Probleme.“
Sie sprach die letzten beiden Worte wie in Anführungszeichen aus. Für Daggi, seit letztem Jahr zum Bund Deutscher Mädel gehörend, war dies keine Auszeichnung für Harriet.
Ich zuckte mit den Schultern. Es war eigenartig, diese Dinge zu erfahren. Obwohl ich oft an Harriet dachte, hatte ich nie versucht, mir ihr Leben vorzustellen.
„Kannst du glauben, dass sie in der Villa Löw wohnt?“
Dieser Umstand schien Daggi am meisten zu beschäftigen.
„Es passt zu ihr“, sagte ich, vielleicht dachte ich es aber nur. Wenn ich mir ein Haus für dieses Mädchen hätte aussuchen können, dann wäre es die Villa Löw auf der Hallerwiese gewesen. Das Villenviertel war ein sagenumwobener Ort, ein fernes, unerreichbares Quartier jenseits der Promenade, in dem Menschen wohnten, die Bedienstete hatten, eigene Kutschen oder Automobile, und die in Geschäfte auf der Heltauergasse hineingingen, die man nie betreten würde.
Harriet war also eine von ihnen. Doch sie war anders als die anderen Villenkinder, die ich kannte. Sie war in meinen Augen die einzige, die es verdient hatte, dort zu leben. Vielmehr: Es war kein anderer Ort für sie vorstellbar.
Die Villa Löw hatte helle Mauern aus Stein, die aussahen, wie die Überreste einer Festung. An der linken Seite lag die bogenförmige Tür, im Erdgeschoss und dem ersten Stock erhoben sich Sprossenfenster, darüber ein verzierter Giebel. Ein marmorner Springbrunnen stand am Tor, eine nackte Figur, halb Kind halb Mann, mit einem Krug auf der Schulter. Die Villa war um die Jahrhundertwende von einem Ingenieur erbaut worden. Obwohl sie nicht besonders alt war, hatte sie schon zwei Mal den Besitzer gewechselt. Die Vorhänge waren über ein halbes Jahr zugezogen gewesen.
Eines Abends im vergangenen Herbst, als ich für Mutter einen Botengang in der Friedenfelsgasse erledigte, hatte ich bemerkt, dass das Gartentor offen stand. Ohne zu zögern betrat ich das Grundstück. Das Haus lag vor mir wie ein schläfriger Wächter, der Springbrunnen war ausgetrocknet und vor der Eingangstür stand verloren ein Stuhl. Jemand hatte einen Karton darauf abgelegt. Ich spielte kurz mit dem Gedanken, nachzusehen, was darin war. Dann ging ich weiter, um das Haus herum, in den hinteren Teil des Gartens. Efeu hatte die Mauern umschlungen und die Fensterscheiben wie die Schießscharten einer Burg eingefasst.
Laub bedeckte die Wege, vom Wind wahllos zusammengekehrt. Rosenumrankte Bögen führten auf eine weiße Bank zu. Viele Blumen waren verwelkt, nur die Katzenminze scherte sich nicht darum, ob jemand sie allabendlich goss. Die Sonne war zu dieser Stunde hinter dem Horizont verschwunden, doch der Himmel leuchtete strahlend blau. Für mich gab es keinen schöneren: wenn keine Wolke, nicht einmal der zarteste Schleier zu sehen war, wenn der Himmel kristallklar und von solch einer Reinheit war, wie ein frisch gewaschenes Leintuch. Nicht die Dunkelheit, die die Sterne umgab, nicht das von Wolken zerrissene Grau so vieler durchwachsener Tage. Jenes klingende, leuchtende Blau, das sich so ebenmäßig über den Himmel verteilte, dass kein Schatten, kein anderer Ton auszumachen war. Unter diesem Himmel mutete der Garten wie ein verwunschener Ort an. Losgelöst von den Straßen der Stadt, den Feldern und Karpaten, als wäre ein Glasgewölbe darüber gespannt, einer Schneekugel gleich. Ein Haus stand darin, ein Mädchen ging durch den Garten, das Laub wirbelnde Flocken unter den Füßen.
Ich ging durch die Rosenbögen an Buchsbäumen, verwilderten Brombeerhecken und wild wachsendem Sonnenhut vorbei. Wie ein Kirchengewölbe umschlossen die Bäume die weiße Bank mit ihren ausladenden, überhängenden Ästen. Es musste schön sein, sie an heißen Sommertagen aufzusuchen, im Schatten zu sitzen und zu wissen, dass einem dies alles gehörte. Ich nahm Platz, schloss die Augen, und folgte den orangen Punkten, die über die Netzhaut wanderten. Der Wind bewegte den Baldachin aus Blättern und strich durch die Eschen und Akazien, die das Anwesen begrenzten. Die wirbelnden Blätter glichen dem Geräusch einer Meeresbrandung, zumindest so, wie ich mir eine Brandung vorstellte.
Bevor ich an jenem Abend den Garten der Villa Löw verließ, hatte ich so viele rote Rosen gesammelt, wie in meinen Beutel hineinpassten. Mutter hatte die Rosenblätter drei Tage in einen Glasbehälter mit kaltem Wasser eingelegt und, als sie ihr Aroma an das Wasser abgegeben hatten, mit Zucker und Zitrone abgeschmeckt.
In unserer Vorratskammer, das wurde mir nun bewusst, stand Rosenwasser aus Harriets Garten. Dem Rosengarten mit seiner Baumkapelle, den gestutzten Buchsbäumen und dem Zaun, der das Grundstück auf einer Fläche begrenzte, auf dem zwei weitere Häuser Platz gefunden hätten.
Harriet wohnte also in der Villa Löw – nein, ich war nicht im Geringsten darüber verwundert.
Wir gingen am Stadtpark vorbei, Daggi schlug den Weg zu dem Holzhäuschen ein. Ich übernahm ihre Schultasche und bewachte den Eingang. Was folgte war ein routinierter Prozess. Der Rock wurde mit Sicherheitsnadeln hochgesteckt, die Kniestrümpfe heruntergerollt und die Lippen nachgezogen. Seit mehr als einem halben Jahr hatte sich dieses Ritual an Schultagen wiederholt. Die Kunst war, die Veränderungen so behutsam vorzunehmen, dass es dem geübten Auge zwar auffiel, den Lehrern aber zu gering erschien, um einen Verweis zu erteilten. Nur ein einziges Mal war Daggi bestraft worden – es sei keine natürliche Schönheit, die sie da zur Schau stellte. Sie hatte das Klassenzimmer verlassen, sich den Lippenstift abwischen müssen und den Rest der Stunde in der Ecke verbracht. Kniend, das Gesicht zur Wand. Doch das war es ihr wert gewesen. Auf dem Schulweg genoss sie die Blicke der Jungen, denen nicht entging, dass der Rock ein klein wenig mehr von Daggis Beinen enthüllte als erlaubt, und wie aufregend der Kontrast zwischen ihren roten Haaren und dem kirschfarbenen Lippenstift war.
Nach wenigen Minuten trat Daggi wieder heraus. Als ich ihr die Schultasche überreichte, kam eine alte Frau hinter dem Gebüsch hervor.
Daggi reagierte blitzschnell und rannte los.
„Gesindel!“, rief die Frau. „Glaubt ihr, ich weiß nicht, was ihr jeden Morgen hier treibt?“
Es war die Frau des Parkgärtners, von Daggi „Verhutzelte“ genannt, die uns in den letzten Wochen vermehrt aufgelauert hatte. Sie vermutete in dem Holzhäuschen einen sittenwidrigen Treffpunkt und rief uns wenig schmeichelhafte Schimpfworte hinterher. Ich konnte ihre Stimme noch hören, als wir bereits wieder auf der Straße waren.
Daggi blieb lachend stehen. Es war wohl an der Zeit, sich nach einer neuen Morgengarderobe umzusehen.
Ich ließ mich nach hinten fallen.
Die Gänsehaut an Beinen und Armen verschwand langsam unter der Sonne. Die Nächte waren noch zu kalt, das Wasser konnte die tagsüber empfangene Wärme nicht speichern. Im letzten Sommer waren wir jede Woche am Fischteich gewesen. Manchmal nahmen wir bereits am Vormittag den Weg aus der Stadt, Brote, hartgekochte Eier und Äpfel als Proviant. Ein anderes Mal erreichten wir seine Ufer erst am Nachmittag, wenn wir nach der Schule mit den Rädern die Schewisgasse weiter stadtauswärts ins Goldtal fuhren.
Die beiden Seen hatten zu jeder Tageszeit ein anderes Gesicht. Am Morgen waren sie klar wie ein Spiegel, man sah Fischschwärme, Steine und die Pfähle des Bootsstegs. Dann kamen die Ausflügler aus der Stadt und wirbelten Schlamm auf, der das Wasser trübte. Erst am Abend wurden sie wieder durchsichtig, wenn die Boote vertäut waren, nur noch vereinzelt Menschen an ihren Ufern saßen und zusahen, wie der Mond begann, eine silberne Spur übers Wasser zu legen.
Heute waren wir zum hinteren See gewandert. Hierher verirrten sich weniger Besucher, die meisten blieben am ersten See in der Nähe des Zoos. Daggi und Arthur lagen etwas abseits und küssten sich. Neugierig und ein wenig verlegen sah ich hin. Arthur, den seine Freunde Rocco nannten, war bereits achtzehn Jahre alt, ein hochgewachsener Junge mit einer im Ansatz vorhandenen Hasenscharte. Er war impulsiv und leicht für eine Sache zu gewinnen. Daggi mochte seine Unabhängigkeit, eben jene Eigenschaft, die seine Mutter am meisten zu maßregeln wusste.
Außer uns war noch eine Gruppe Jugendlicher am See. Sie saßen an der Feuerstelle und spielten Karten. Ich legte mir ein Handtuch unter den Kopf, spürte das warme Gras an meinem Rücken und folgte ihren Gesprächen. Nach einiger Zeit hörten sie auf, sich zu unterhalten, und in der Stille spürte ich, dass etwas sich verändert hatte. Ich hob den Kopf und sah mich um. Zwischen den Bäumen, die den See umrundeten, trat eine Frau hervor, gefolgt von einem Mädchen. Die Frau breitete eine Decke auf der Wiese aus und stellte einen Weidenkorb ab. Das Mädchen zog ihr Kleid über den Kopf und ging, ohne sich umzusehen, bekleidet mit einem hellgelben Badeanzug, ans Ufer.
Es war Harriet. Sie hatte die Haare zu einem Knoten festgesteckt, zwei Bänder überkreuzten ihren Rücken. Ich sah ihre Schulterblätter, die hervorstehenden Knochen, die helle, makellose Haut, sah ihren schlanken Hals und ihre Hände, die behutsam Wasser schöpften, Arme und Beine benetzten. Sie ließ sich Zeit, um sich an die Temperatur zu gewöhnen, dann ging sie zügig ins Wasser, hob die Arme und tauchte kopfüber in den See.
Harriet erreichte mit schnellen, kräftigen Zügen die Seemitte, die Frau auf der Decke schälte einen Apfel und zog ihren Strohhut tiefer ins Gesicht, als fürchte sie die Sonnenstrahlen. Ich fragte mich, ob die beiden wussten, dass es nicht üblich war, hier zu schwimmen. Wenn sich jemand hineinwagte, dann, so wie wir, ins seichte Wasser, doch zumeist wurde der See nur mit Ruderbooten befahren.
Daggi und Arthur hatten die Neuankömmlinge nicht bemerkt. Den Jugendlichen indessen war Harriet nicht entgangen. Sie stießen anerkennende Pfiffe aus, und einem blonden Jungen wurde auf die Schulter geklopft. Ich spürte einen Stich in der Magengrube und setzte mich auf. Alles, was ich von Harriet sah, waren ihre weißen Arme und eine aufspritzende Wasserspur.
Wenn ich später an diesen Nachmittag zurückdachte, so kam mir das, was nun geschah, so unausweichlich wie logisch vor. Als wäre es auf einer Bühne arrangiert, folgten die Akteure einer genau einstudierten Dramaturgie: Daggi und Arthur, die von der Welt nichts mitbekamen. Eine Frau mit Hut, die kurz zwischen den Bäumen verschwand. Vier Jugendliche, eine aufspritzende, schaumweiße Spur auf dem Wasser, darüber die Sonne, halb verborgen von Schleierwolken, und der See, der in seinen Tiefen noch die Kälte des Frühlings bewahrte.
Ich erinnere mich an jedes Detail, als habe ich diese Situation viele Male erlebt. Vielleicht aber rührt dieser Eindruck allein daher, dass mich die Erinnerung an jenen Nachmittag nie wieder losgelassen hat. Manchmal glaube ich, ich säße immer noch am Ufer, verfolgte immer noch Harriets Spur auf dem See. Manchmal höre ich das Klackern der Boote und ein kalter Schauer überkommt mich, als habe ich Harriet nicht erst später verloren, sondern bereits in jenem Augenblick.
Der blonde Junge war aufgestanden und ging ans Ufer. Er blieb zunächst stehen, nahm dann den Weg zum Bootssteg, der an wenigen vertäuten Booten vorbei in den See führte. Er ging in die Hocke, tauchte die Hände ins Wasser und wartete, bis Harriet näher kam. Seine Freunde riefen ihm etwas hinterher. Kurz darauf ließ er sich ins Wasser gleiten und schwamm auf Harriet zu. Sie bemerkte ihn und machte kehrt. Er folgte ihr. Sie änderte erneut die Richtung, doch wenige Meter vom Bootssteg entfernt hatte er sie fast eingeholt. Vielleicht sollte es ein Scherz sein, eine halb ernst gemeinte Verfolgungsjagd, ein törichter Streich, aus der Laune eines Sommernachmittags geboren. Doch die Wirkung war eine andere. Harriet geriet in Panik. Ihre Bewegungen wurden fahrig, sie tauchte immer länger unter. Er ließ nicht von ihr ab, hatte sie erreicht, und als er schließlich die Hand nach ihr ausstreckte, waren sie an einem Kahn angelangt und ich konnte sie nicht mehr sehen.
Ich sprang auf und rannte zum Bootssteg. In diesem Moment rief Daggi meinen Namen. Die drei Jugendlichen verharrten an der Feuerstelle, hatten jedoch inzwischen ihre Zurufe unterlassen. Wilde Verzweiflung packte mich, als ich den See erreichte und Harriet nirgends entdecken konnte.
Ich lief über den Steg, rutschte aus, schlug mir das Knie blutig, stand auf und rannte weiter. Hinter einem Ruderboot schwamm der Junge. Er sah sich suchend um, die Angst stand ihm ins Gesicht geschrieben. Harriet war fort. Er drehte sich wie eine Marionette im Kreis, spritzte Wasser auf, tauchte, kam wieder herauf, sah sich suchend um. Ein Laut drang aus seinem Mund, es klang wie ein Winseln. Mit einem Sprung war ich im Wasser. Ich hörte Schritte auf dem Steg, dann nur noch den dumpfen Laut der vertäuten Boote, das Knacken der Holzpfähle und den gedämpften, rätselhaften Klang der Unterwasserwelt. Ich holte Luft und tauchte unter.
Zuerst sah ich nur aufgewirbelten Schlamm, Schlingpflanzen, Grasbüschel und Glasflaschen auf dem Grund. Dann konnte ich undeutlich Gliedmaßen ausmachen. Die Luft ging mir aus, ich spürte, wie meine Lungen brannten und kam wieder an die Wasseroberfläche. Arthur beugte sich vom Steg zu mir. Daggi, neben ihm, sprach auf die Frau mit dem Sonnenhut ein.
„Sie ist hier irgendwo“, rief ich verzweifelt. „Arthur, ich glaube sie ist unter den Booten!“
Zwischen miteinander vertäuten Booten, schwebend wie unter Wolken, die Glieder leblos baumelnd, fanden wir Harriet. Ihre Haare hatten sich gelöst, sie umkränzten ihr Gesicht, in dem ein solches Einvernehmen stand, dass mir unwillkürlich ein Schrei entfuhr. Arthur griff ihr unter die Arme und merkte, dass sich ein Tau um ihren Hals geschlungen hatte. Ich versuchte, die Schlinge zu lösen, schlug mit dem Kopf gegen die Unterseite des Bootes, verhedderte mich in ihren Haaren, und war ihrem Gesicht, das so beängstigend gelöst aussah, nahe wie nie zuvor. Auf einmal wusste ich, dass ich genau zwei Möglichkeiten hatte. Ich konnte an dem Tau zerren und ihr Haar verfluchen, das es meinen Fingern schwer machte, die Schlinge um ihren Hals zu lösen. Ich würde sie verloren geben und nur gegen das rebellieren, was sich bereits erfüllt hatte. Oder ich konnte daran glauben, dass sie leben würde, leben musste, weil der Zufall uns