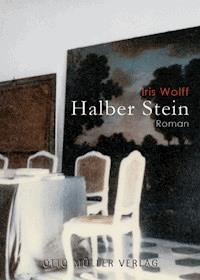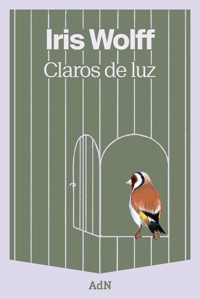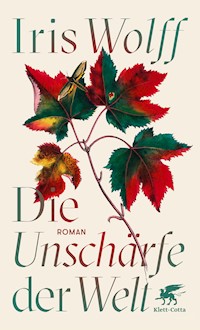9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Du hättest zurücksehen müssen, dachte er, allein um zu wissen, ob sie sich nach dir umgewandt hat.« Zwischen Lev und Kato besteht seit ihren Kindertagen eine besondere Verbindung. Doch die Öffnung der europäischen Grenzen weitet ihre Lebensentwürfe und verändert ihre Beziehung für immer. Voller Schönheit und Hingabe erzählt Iris Wolff in ihrem großen neuen Roman von zeitloser Freundschaft und davon, was es braucht, um sich von den Prägungen der eigenen Herkunft zu lösen. Als der elfjährige Lev über Wochen ans Bett gefesselt ist, wird ausgerechnet die gescheite, aber von allen gemiedene Kato zu ihm ans Krankenbett geschickt, um ihm die Hausaufgaben zu bringen. Zwischen dem ungleichen Paar entsteht eine unverbrüchliche Verbindung, die Lev aus seiner Versteinerung löst und den beiden Heranwachsenden im kommunistischen Vielvölkerstaat Rumänien einen Halt bietet. Ein halbes Leben später läuft Lev noch immer die Pfade ihrer Kindheit ab, während Kato schon vor Jahren in den Westen aufgebrochen ist. Geblieben sind Lev nur ihre gezeichneten Postkarten aus ganz Europa. Bis ihn eines Tages eine Karte aus Zürich erreicht, darauf nur ein einziger Satz: »Wann kommst du?« Kunstvoll und poetisch verwandelt Iris Wolff jenen Moment in Sprache, wenn ein Leben ans andere rührt, und zeichnet in ihrem großen europäischen Roman das Porträt einer berührenden Freundschaft, die sich als Reise in die Vergangenheit offenbart und deren Leuchten noch lange nachklingt. Ausgezeichnet mit dem Uwe-Johnson-Preis
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2024
Sammlungen
Ähnliche
Iris Wolff
Lichtungen
Klett-Cotta
Die Arbeit der Autorin am vorliegenden Buch wurde vom Deutschen Literaturfonds e. V. gefördert.
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2024, 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: Favoritbüro München
unter Verwendung einer Abbildung von © Granger / Bridgeman Images
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von Druckerei C.H.Beck, Nördlingen
ISBN 978-3-608-98891-8
E-Book ISBN 978-3-608-12285-5
Für meine Mutter & Mane
Sas pe thai nas pe.
Neun
Die Fähre zog eine schäumende Gischtspur hinter sich her. Ein weißer Bogen im Blau, der noch lange ihren Weg nachzeichnete. Dieselgeruch, Lautsprecherdurchsagen, vom Wind zerhackt; er war so stark, dass sie sich schräg gegen ihn lehnen konnten, mit aufgeblähten Shirts, flatternden Hosen, Brausen in den Ohren, im Kopf, im Körper. Noch Minuten später, im Inneren der Fähre, war dieses Brausen zu spüren, ein Nachbeben, Nachklang, und Lev dachte unwillkürlich daran, wie Sägeblätter in eigenwillig-summendem Takt nachschwangen, wie der Boden mit einem Mal ruhig wurde, und das Sägemehl, das über der Maschine schwebte, herabfiel – leicht verzögert, verwundert, von der Schwerkraft überrascht.
Kalte Luft strömte aus der Klimaanlage, griff nach Händen und Knöcheln, nach Papieren, Steinen, Muscheln, die in ihren Taschen lagen wie angeschwemmtes Strandgut. Kato wickelte einen Schal um ihre Schultern, zog die Beine heran. Lev drehte einen Pinienzapfen in den Händen, er stammte von dem Baum, in dessen Schatten sie zu Mittag gegessen hatten. Kato skizzierte mit schnellen, suchenden Strichen ein Mädchen, das auf dem gegenüberliegenden Sitz eingeschlafen war. Sie hatte jeden Tag ihrer gemeinsamen Reise dokumentiert, Szenen festgehalten, die sie beobachtet, erlebt hatten, und manches Mal auch ihn: einen Mann mit ungewohnt langem Bart, lesend im Café, an einem Zeitungskiosk, an den Wagen gelehnt, eine Straßenkarte in der Hand.
Lev suchte ihren Blick, doch der war zwischen Mädchen und Skizzenblock gefangen. Der Kohlestift schwärzte Papier, Finger und Handballen. Sie blätterte um, begann von Neuem. Es war unmöglich, sie in ihrer Versunkenheit zu stören.
Unter der Pinie hatte er ihr eröffnet, dass er zurückmüsse.
Kato schien weder verärgert noch überrascht, sie reagierte so gelassen, als wüsste sie schon lange, was ihn beschäftigte. Möglicherweise wollte auch sie in ihre gewohnte Routine, in ihr Leben zurück. Nur: In welcher Stadt, in welchem Land? Für ihn war diese Reise ein Aufbruch, für sie ein Übergang, vielleicht sogar Abschluss. Und doch hatten sie sich in diesen gegensätzlichen Bewegungen wiedergefunden.
Seit sechs Wochen waren sie unterwegs, von Zürich aus nach Paris, dann Nantes, Montpellier und weiter Richtung Osten die Küste entlang. Sie hatten sich treiben lassen, manchmal auch Tage getrennt voneinander verbracht, sie brauchten für ihre Launen und Einfälle nicht viele Worte. Dafür kannten sie sich zu gut, dafür waren sie zu lange getrennt gewesen. Sie besichtigten Städte und Dörfer, unternahmen Wanderungen, gingen schwimmen, während sich zum Herbst hin die Strände leerten, als gäbe es keine Zeit, nur diesen endlosen Raum aus Straßen, der vor ihnen lag. Und für eine Weile war es so gewesen, er täuschte sich nicht – zwischen Gestern und Morgen gab es nur eine hauchdünne Schicht. Irgendwann waren die Gedanken an zu Hause mehr geworden, ein sorgend-sehnendes Gefühl, das ihn zurückrief, doch er sagte nichts, wartete auf den richtigen Augenblick, der nicht kam.
Man müsse immer bereit sein, aufzubrechen, sagte Kato, ohne von ihrer Zeichnung aufzusehen.
»Auch wenn man gerade erst angekommen ist?«
»Dann besonders.«
Kato legte die Zeichnungen des Mädchens in ihre Mappe.
Auf ihrer Reise hatte sie nicht gearbeitet, nur in Paris am Louvre ein Gemälde auf die Straße gemalt. Für all diejenigen, die die Mona Lisa nicht im Original sehen konnten.
Vor den Fenstern rückte die Küste heran, der Hafen, Wellenbrecher, Schiffe, die palmengesäumte Promenade. Die hohen, bunten Häuser mit ihren hundertfachen Augen und Fensterläden. Laternen gingen an, Straßenlichter überzogen die Hügel mit flackerndem Licht. Auf dem Festland schien es windig zu sein.
Mit einem Mal ging alles ganz schnell.
»Ich komme mit«, sagte Kato.
Lev, der Wasserflasche und Pinienzapfen in die Tasche räumte, hielt inne. Vor Überraschung vergaß er fast, Luft zu holen. Kato sah ihn amüsiert und ein wenig spöttisch an. Unruhe erfasste das Innere der Fähre. Passagiere packten ihre Sachen zusammen, drängten zu den Ausgängen. Am Kiosk ratterte das Rolltor herab. Das Mädchen wurde geweckt, ging an der Hand ihrer Mutter zur Treppe, ihr Lächeln streifte Kato.
»Wir reisen gemeinsam zurück?«, vergewisserte er sich, als sie bei dem Land Rover am Parkdeck angekommen waren. So lange hatte er gebraucht, um seine Sprache wiederzufinden.
Er wollte nicht zu früh glücklich sein.
Er wollte sie nicht noch einmal verlieren.
»Ja«, sagte Kato. Einfach nur: Ja.
Das reichte ihm für den Moment.
Jestem znakiem podróży.Nieruchomym.
Acht
»Verzeihung.«
Lev blieb stehen.
Er wurde angerempelt, mit Blicken taxiert, alle waren in Bewegung, eilig, getrieben, mit demselben zügigen Schritt. Lev hatte sich eingereiht in diesen Strom, mitziehen lassen, im Abteil, am Gleis, wo die Züge bereit zur Abfahrt standen, Reisende warteten, erwartungsvoll, in sich gekehrt. In der hohen Halle war er stehen geblieben, Lautsprecherdurchsagen, Schritte, Stimmen, Rollkoffer, alles verlor sich in der enormen Höhe. Dann entdeckte er die große Uhr, ging weiter, bog rechts in den Durchgang ab, zum Brunnen. Der Straßenlärm wurde lauter, Autohupen, Motorengeräusche, das Rollen, das Rauschen verschwand, die Leute verteilten sich auf dem Platz, endlich konnte er in Ruhe stehen bleiben, sich umsehen.
Vor ihm lag eine mehrspurige Straße, Zebrastreifen, fünfstöckige Häuserzeilen; blauweiße Straßenbahnen fuhren ein, er hielt seinen Zettel in der Hand, die Nummer der Bahn stand darauf, die Richtung, die Haltestelle. Er verglich die Linien mit seinen Notizen, traute seinem Urteil nicht, ging nochmals alle Aushänge durch. Stadteinwärts lag eine weitere Haltestelle. Das Gefühl der Erleichterung war nur von kurzer Dauer, am Ticketautomaten setzte sich ein heißes Gefühl in seinem Nacken fest, Schwindel erfasste ihn beim Anblick des Kastens, Tasten, Tarifstufen, Münzschlitze, Korrekturtaste – musste erst Geld hineingeworfen oder etwas gedrückt werden? Unsicher presste er einige Knöpfe, jemand stellte ihm eine Frage. Lev trat zur Seite, ließ den Mann zahlen, versuchte sich zu merken, wie er vorging, doch als er erneut an der Reihe war, kam schon seine Bahn. Die Leute stiegen ein, kurz überlegte er, ebenfalls einzusteigen, aber wie beschämend wäre es, ohne Fahrschein erwischt zu werden, und ein Gefühl von Vergeblichkeit überkam ihn, als könnte dies die letzte Bahn gewesen sein, und er hatte seine Chance verpasst.
Mit einem Knistern, das den Schienen vorauseilte, fuhr sie davon. Lev blieb an der Haltestelle stehen, legte die Reisetasche ab, drehte seinen Zettel in den Händen, als ob etwas darauf stand, das er noch nicht entdeckt hatte. Eine Frau mit hüftlangen, hellroten Haaren flocht sich einen Zopf aus drei Strängen, ein Mann auf einer Bank sah ihr mit offenem Mund dabei zu. Tauben stiegen auf, flogen von einer Straßenseite zur anderen, reihten sich auf das Gesims eines Gebäudes ab. Etwas scheuchte sie wieder auf. Sie waren dunkelgrau mit weißen Unterseiten.
Lev sah ihnen zu, den Drehungen ihres Fluges.
Von hell zu dunkel. Von dunkel zu hell.
Etwas veranlasste ihn, sich umzudrehen. Vielleicht hatte sie ihn bereits eine Weile beobachtet, vielleicht wusste sie nicht, wie sie ihn ansprechen sollte, wollte mit ihrem Erkennen eine Weile allein sein – er hätte es gewollt. Stehen bleiben, kein Wort sagen, sie ansehen: Ihre hellen Augen, die Linie der drei Muttermale auf ihrer Wange, ihren herausfordernden, überlegen-distanzierten Blick.
In diesem Spiel hatte sie immer schon triumphiert. Sie konnte den Blick länger halten, sie löste eine Umarmung nicht als Erste auf, durch jenen kleinen Impuls, jenes winzige Zurückweichen, das dazu führte, dass sich zwei Körper voneinander lösten. Lev hatte nicht viel Zeit für dieses erste, rasche Abtasten, betrachtete ihre Gesichtszüge, ihre Körperhaltung, bemerkte die Veränderungen und das, was gleich geblieben war; überrascht von der Größe seiner Freude, Aufregung, und stellte erleichtert fest, es fehlte die alte Bitterkeit.
Sie trug Jeans, Turnschuhe und ein grünes Shirt, keine Jacke, obwohl es an diesem Abend kühl war. Eine große Tasche hing über ihrer Schulter. Sie schien dünner geworden zu sein, aber auch muskulöser, soweit er ahnen konnte, ihre Haare waren schulterlang, noch immer unentschieden, ob sie glatt sein wollten oder lockig. Er sah auf ihre Hände, die spitzen Knöchel der Handgelenke, die Farbreste unter den Fingernägeln.
Etwas war wie immer, etwas war neu.
»Was machst du hier?«
»Ich hatte so ein Gefühl«, sagte Kato.
Sie kaufte für ihn am Automaten eine Wochenkarte. Als sie einige Stationen mit der Tram fuhren – Kato sagte »das Tram« –, kam es ihm vor, als setzten sich die Straßen mit ihren hohen, gepflegten Gebäuden, den Ladenzeilen und Cafés immer weiter fort. Irgendwann hatte er das Gefühl, in die Irre zu fahren, sich zu verlieren, er achtete nur auf sie, auf ihre Stimme, die unvermittelte Nähe, auf die Selbstverständlichkeit, mit der sie sich zurechtfand, Deutsch sprach, und obwohl er die ganze Zugfahrt Zeit gehabt hatte, sich diesen Moment vorzustellen, war er ihm entglitten – er hatte nicht gewusst, wie es sein würde, sie nach fünf Jahren wiederzusehen.
Kato begleitete ihn zu einer Pension, zahlte eine Woche im Voraus, obwohl Lev sich wehrte (es gelang ihr, weil sie mit der Frau hinter der Theke sekundenschnell Komplizenschaft schloss), zählte die Scheine auf die Theke, und Lev nahm sich vor, die Franken nicht in Lei umzurechnen, es war zu deprimierend. Er strich übers Holz, dachte: Ahorn, befühlte die abgerundeten Kanten. Die Frau teilte ihm mit, wann es Frühstück gab, wann am Abreisetag das Zimmer zu räumen, zu welchen Zeiten die Rezeption besetzt war, langsam, als wäre er schwer von Begriff, und zerdrückte, wie nebenbei, einen Falter, der sich auf die Theke gesetzt hatte.
Kato fragte, ob sie gemeinsam zu Abend essen wollten, doch er schob seine Müdigkeit vor. Sie verabschiedeten sich mit einer Umarmung, aus der er sich als Erster löste.
Sein Zimmer lag im zweiten Stock. Er öffnete die Türen des Schranks, sah in die Schubladen des Tisches, prüfte die Matratze, knipste Lichter an und wieder aus, trat auf den Balkon. Dann packte er seine Tasche aus, duschte lange und legte sich ins Bett.
Über die Zimmerdecke wanderte Scheinwerferlicht. Durchs offene Fenster drang Trambahnknistern, auf dem Balkon nebenan unterhielt sich ein Paar. Die Stadt war ihm fremd in ihrer Ausdehnung, Ordnung, Mäßigung, und er versuchte, sich mit dem Gedanken zu beruhigen, dass hier wie dort dieselben Gesetze galten. Es gibt die Zeit, sagte er sich, es gibt die Sprache, die auch die deine ist, und niemand wird dich hinauswerfen, weil du nicht dazu gehörst. Erst recht nicht, und der Gedanke ließ ihn lächeln, wo du eine Wochenkarte hast.
Aus jedem Land, durch das Kato mit Tom gefahren war, hatte sie ihm Postkarten geschrieben, ihre schräge Schrift füllte die Rückseiten aus; wenn sie unten angelangt war, schrieb sie an den Rändern weiter, so dass er die Karten im Uhrzeigersinn drehte, einmal, zweimal, bis er bei ihrer Unterschrift ankam. Manchmal erreichten ihn Karten ohne Text: Straßenschluchten, Brunnenfiguren, Blumen, Bäume, immer wieder Porträt-Studien. Vor vier Wochen dann die Karte mit dem Satz: »Wann kommst du?«
Nur drei Worte und ein Fragezeichen.
Er hatte den Satz wieder und wieder gelesen. War er über längere Zeit gereift oder aus einer Laune heraus geschrieben worden? Meinte sie damit die nähere oder unbestimmte Zukunft? Hieß der Satz, dass sie ihn vermisste oder ihn brauchte? Hieß »kommen« besuchen oder bleiben? Oder war damit eine Vorstellung gemeint, wie manchmal etwas gesagt wurde, nur um in einem bestimmten Gefühl Zuflucht zu suchen?
Als sie telefonierten, um Ort und Zeit abzusprechen, war nicht der Moment gewesen, sie zu fragen. Da sie nie miteinander telefonierten, beschränkte sich das Gespräch auf den Austausch nötiger Informationen. Zuletzt hatte er gewartet, dass sie auflegte, doch er hörte kein Klicken, und er sah sie vor sich, in der abgestandenen, warmen Luft der Telefonzelle, den Hörer am Ohr, den Kopf ans Glas gelehnt, darauf horchend, ob er auflegte – was er dann auch tat.
Eintausendfünfhundert Kilometer weiter östlich war der Sommer trocken und staubig. Hier jedoch spendete der See eine erträgliche Kühle an die Stadt. Der Paradeplatz war schattig und belebt. Lev orientierte sich am Stadtplan mit Katos Markierungen, hielt sich links und kam auf den Münsterhof. Jemand spielte Akkordeon, aus einem Antiquitätengeschäft wurde ein Tisch herausgetragen, Lev hielt die Tür auf, die einer der Männer mit seinem Rücken aufgestoßen hatte, ging weiter Richtung Fluss.
Wasserrauschen, Glocken, Schritte. Katos Stimme.
Die immer ein wenig dunkler war als erwartet.
Sie war an der Brücke; Leinwand, Farbenkasten, einzelne Kreiden waren auf dem Trottoir verstreut. Er erfasste das Bild auf dem Boden nur flüchtig – es war von überwältigender Größe und Detailliertheit –, alles andere erschien ihm gerade wichtiger. Ihre farbigen Hände, ihre Haltung, kauernd, dem Bild zugewandt, und doch halb aufgerichtet; diese Zuwendung, Hingabe, diese konzentrierte Abwesenheit hatte sie von Anfang an beim Malen gehabt.
Bei allen, die etwas in den Korb warfen, bedankte sie sich.
Gerne hätte er weiter zugesehen, doch sie bemerkte ihn. Der konzentrierte Ausdruck in ihrem Gesicht verschwand, wich einem Lächeln, ein überraschtes Lächeln, das etwas von der Unwahrscheinlichkeit offenbarte, dass er hier war. Sie stand auf, wischte die Hände an ihrer Hose ab, und ohne dass er lange darüber nachdachte, umarmte er sie. Ihre Haut war warm und trug einen Geruch, den er nicht kannte.
Am Brückengeländer stand der Trolley, mit dem sie jeden Tag die Malutensilien zu ihrem Platz brachte. Sie hatte ihm gestern erzählt, dass sie inzwischen nicht mehr auf Asphalt malte, sondern Leinwände auslegte, auf denen bereits die Zeichnung angefertigt war. Die Passanten spendeten erst, wenn Farbe zu sehen war.
Lev lehnte sich in einigem Abstand ans Geländer. Eine ältere Frau in hellem Sommermantel blieb stehen, die beiden unterhielten sich, als knüpften sie an ein vorheriges Gespräch an. Zu Mittag gab ihr ein Mann in Anzug und Krawatte ein belegtes Brötchen. Offensichtlich kannte Kato die Berufstätigen, die ihre Pause am Fluss verbrachten, die Kinder, die von der Schule nach Hause gingen, die Obdachlosen, die die Nacht in den Parks verbracht hatten. Am liebsten höre sie Musik, sagte sie, aber meist wolle sie ansprechbar bleiben, die Gespräche gehörten dazu. Sie verdiente mit ihrer Straßenkunst Geld, so viel Geld, dass sie ein Konto eröffnet und einiges zurückgelegt hatte. Manchmal gab jemand ein Bild in Auftrag, manchmal fragten Restaurants an, ob sie die Innendekoration anfertigen konnte. Sie arbeitete jeden Tag. Nur wenn es regnete, besuchte sie Museen, um neue Bilder zu finden, die sie malen wollte.
Kato lehnte sich neben ihn, hielt ihm eine Hälfte des Brötchens hin.
»Malst du immer hier?«, erkundigte er sich.
Sie habe nicht in der Hand, welchen Pitch sie zugeteilt bekomme, erklärte Kato, die Genehmigung für einen Platz müsse wochenweise, manchmal täglich erworben werden. »Aber sagen wir mal so: Ich verstehe mich gut mit der zuständigen Dame im Amt.«
»Und den Passanten«, ergänzte er.
Man lebe wie in einem Schaufenster, sagte Kato. Dafür sei dies die größte Galerie, die man sich vorstellen kann. Es gäbe Tage, da komme sie kaum zum Malen, weil die Leute mit ihr reden, ihre Lebensgeschichte loswerden wollten. Manche boten ihr an, ihre Wäsche zu waschen, andere wiederum jagten sie fort. Sie gehöre zu den Reisenden, den Gestrandeten, die andere meist nicht wahrnahmen oder wahrnehmen wollten.
Schon nach wenigen Stunden, die Lev damit verbrachte, ihr zuzusehen, ahnte er, was sie meinte. Die Leute eilten zur Arbeit, zum Einkaufen, trafen sich in Parks und Cafés, während vor der Tür ihres Hauses, ihres Geschäftes, in den Straßen ihrer Stadt, jene unbekannte Welt lag, aus Menschen, die einige Zeit da waren und dann, ohne jede Ankündigung oder Erklärung, wieder verschwanden.
Am Nachmittag machte er einen Spaziergang, damit sich die Topographie der Stadt in seinen Körper übertrug, was nicht geschah, war man mit dem Auto oder der Bahn unterwegs. Dies war eine Stadt des Wassers, der Parkzufluchten, Banken und prachtvollen Häuser, eine Stadt, die neu war, unbeschrieben, an der an keiner Ecke eine Erinnerung wartete. Und doch: rückte vieles hier an ihn heran.
Er betrat einen Supermarkt, ging durch die Reihen, alle Produkte gab es in dutzendfacher Auswahl, er ließ sich Zeit für jede Entscheidung, griff nach etwas, legte es wieder zurück, entschied sich für das Günstigste. Er mochte Einkaufsläden nicht, jene riesigen, funktionalen Hallen, die es jetzt auch in seinem Land gab und durch die Menschen in dieser aufgesetzten Selbstverständlichkeit hetzten, die den Mangel früherer Tage verwischen sollte.
Hier gab es an jeder Ecke ein Übermaß an Leben, Einkaufsmöglichkeiten, Cafés und Restaurants, in denen sich Menschen trafen, zum Gespräch, zum Kaffee, zur Abwehr der Langeweile. Er überließ sich dem Puls, der Ausdehnung der Stadt, doch jedes Mal, wenn er etwas sagen sollte, spürte er die Worte schwer und träge im Mund. Seine Herkunft war in seinem Akzent, war ihm eingenäht in Kleidung und Schuhe.
Eine Familie wartete vor einem Eiscafé, offensichtlich Touristen; die beiden Mädchen mit lustlos-unbeteiligten Blicken. Lev kannte jenen Hochmut, der allein daraus resultierte, dass man jung war.
Auf einer Bank hatte jemand ein Buch liegen gelassen.
Eine Frau brach in Tränen aus, ohne dass jemand sie tröstete.
Wolken zogen auf, die Straße wurde dunkel.
In dieser Dunkelheit ließ sich die Distanz besser überwinden zwischen Zugehörigkeit und Fremdsein, Erinnern und Vergessen.
Beim Abendessen erzählte Kato, dass sie nicht wusste, wie es nach diesem Sommer für sie weiterging. Sie mochte das Unterwegssein, aber sie hatte auch Sehnsucht nach einer neuen Aufgabe. Man gewöhne sich an einen Ort, schließe Freundschaften, lasse unweigerlich etwas zurück. Dann hielt sie inne, vielleicht weil ihr bewusst wurde, dass es auch für Lev gegolten hatte – das Zurücklassen.
»Wo hast du dich am wohlsten gefühlt?«
»In Rom«, sagte sie, »die ganze Stadt ist eine Aufforderung zu malen. Und hier. Ich mag die Klarheit und Weite. Auf eine Weise hält die Stadt mich, gibt mir Sicherheit«, und sie sah ihn dabei an, als würde sich der Satz in ihren Gedanken weiter fortsetzen.
Es sei schwer gewesen, besonders am Anfang. Bereits nach wenigen Monaten tauschte sie das Rad von Sigi gegen ein neues, das leichtgängiger war. »Sag es ihm nicht«, hatte sie geschrieben, und Lev hatte sich daran gehalten, so dass Sigi noch heute herumerzählte, sie fahre mit seinem Rad um die Welt.
Lev wusste, dass sie und Tom in den Wintermonaten pausierten, dass Kato in Slowenien Werbeprospekte austrug, in Italien kellnerte, in Deutschland in einem Kaufhaus arbeitete; erfuhr, als sie einen Wagen kauften, weil sie nicht mehr im Zelt schlafen wollten, da ihre Habseligkeiten, trotz aller Bemühungen, mehr geworden waren und inzwischen fast in jedem Land eine Kiste bei Bekannten deponiert war. Kato erzählte, dass sie vieles lernen musste: Wie man unterwegs mit wenig Geld zurechtkam, wo man sich waschen konnte, dass es eine Höflichkeit gab, die andere auf Distanz hielt.
Sie wollte alles wissen: wie es seiner Mutter und seinen Geschwistern ging, was es Neues von ihren Freunden Imre und Milena gab, wie der Besuch bei seinem Großvater in Wien gewesen war. Lev bemühte sich um einen Plauderton und fragte sich, warum sie manche Themen vermieden, warum sie nicht von Tom sprach, warum sie ihm nicht sagte, was die drei Worte zu bedeuten hatten.
Er berichtete von den Neuerungen im Sägewerk, dass sein ältester Bruder inzwischen eine hohe Stellung in der Kirche innehabe, sein jüngerer Bruder mit seiner Familie in Klausenburg lebe, seine Schwester sich von ihrem Mann trennen wolle, welche Wege seine Nichte und seine Neffen gingen. Er erzählte von Imres und Milenas Hochzeit, von der Brücke, die eingestürzt und bis heute nicht wieder errichtet worden war, von dem Laden, den es jetzt im Dorf gab.
Etwas an der Art, wie Kato auf diese Nachrichten reagierte, überlegen, wissend, machte ihn wütend. Sie wusste gar nichts, beurteilte die Welt, von der er erzählte aus der Erinnerung, als hätte sich nichts verändert, als befände sich das Dorf in einer gläsernen Schneekugel, in der ab und zu etwas aufwirbelte, ansonsten aber nichts Nennenswertes geschah.
Alles war anders, alles hatte sich geändert.
Das Glas war fort.
Auf seinem Weg nach Zürich hatte Lev bei seinem Großvater Zwischenstation gemacht. Ferry lebte mit seiner Frau im Vierten Bezirk in Wien. Das Café Goldegg war sein Arbeits- und Wohnzimmer, dort nahm er die Mahlzeiten ein, las Zeitung, spielte Schach, dort hatte er seine Frau Krista kennengelernt. Auch mit seinen fast achtzig Jahren war Ferry ein attraktiver Mann, er trug seine Haare schulterlang, rauchte noch immer mit Zigarettenspitze, und wenn er sprach, war da jene Überlegenheit, die manchmal wie Vergeistigung, ein anderes Mal wie Arroganz wirkte.
Krista hatte Lev am Bahnhof abgeholt.
Er fragte, woran sie ihn wiedererkannt habe.
»Du siehst ihm ähnlich«, sagte sie, aber er bezweifelte das. Mit seinen Sommersprossen und dem rötlich-braunen Haar ähnelte er niemandem in seiner Familie.
Seine rumänische Großmutter hatte immer behauptet, Lev ähnele seinem verstorbenen Vater, Ferry wiederum reklamierte ihn für seine Linie – und Lev hatte es nie gemocht, wenn sie ihn vereinnahmen wollten. Er verweigerte sich der Zuteilung in Deutsch oder Rumänisch. Manche setzten einen Bindestrich dazwischen, doch das kam ihm für seine Familienverhältnisse nicht stimmig vor. Er hatte eine siebenbürgisch-sächsische Mutter und einen rumänischen Vater; sein Großvater berief sich auf seine österreichischen Vorfahren. Lev, eine Mischung aus all dem, fühlte sich nicht verpflichtet, sich irgendwo einzuordnen.
Ferry saß auf einer grünen Polsterbank am Fenster, in weißem Hemd und grau-karierter Weste. Er legte die Zeitung zur Seite und sah ihn an, als wäre ihm nicht gleich gegenwärtig, wer vor ihm stand. Erst als er über den Marmortisch hinweg allen Gästen mitteilte, dass Lev sein Enkel sei, wurde ihm klar, wie durcheinander sein Großvater war, voller Freude, ihn wiederzusehen.
Gerne würde er ihm Wien zeigen, sagte Ferry beim Nachtisch, Cremeschnitten und Kaffee mit Schlagobers; den Stephansdom, den Naschmarkt, die Hofburg, das Westend, das Prückel, überhaupt – die Cafés, die Geschäfte, die Museen, die Leute.
Ob es auch in Wien jene vier Typen gab, nach denen sein Großvater die Menschheit seit jeher einteilte? Ferrys Ansicht nach gab es eigentlich nur Heilige und Verrückte, kluge Leute und Idioten. Bedauerlicherweise wurde das Verrückte immer normaler, und das Idiotische immer salonfähiger, so dass man kaum mehr dahinter kam, wer was war.
Nächstes Mal bleibe er länger, versprach Lev. Er wünschte es sich und wusste doch, wie wenig glaubwürdig es klang. Er hätte schon längst nach Wien kommen können, aber etwas von Ferrys Zurückhaltung, seiner Distanz, war über die Jahre auch auf ihn übergegangen. Seit der Revolution war Ferry nur zwei Mal zu Besuch gekommen, einmal gleich nach der Öffnung der Grenzen, um die Sachen abzuholen, die er bei seiner Tochter zurückgelassen hatte, und dann in einem Sommer, um Krista zu zeigen, wo er geboren worden war. Ferry konnte nicht verstehen, warum seine Tochter Lis nicht auswanderte, warum überhaupt einer der Deutschen in Rumänien blieb nach dem jahrzehntelangen Eingesperrtsein. Ferry vertrat die Meinung, dass ihre Zeit zu Ende war – von einer Nation zu einer nationalen Minderheit zu einer, ja was?
»Aber du bist doch angekommen, oder?«
»Von wegen«, sagte Ferry mit einem Seitenblick auf seine Frau.
»Man ist, einmal gegangen, immer ein Gehender.«
Sie beschlossen den Abend mit Portwein auf dem Balkon, einem winzigen Vorsprung, den man von der Küche aus betreten konnte; wobei betreten zu viel gesagt war, die hinteren Stuhlbeine verblieben im Zimmer. Krista hatte sich bereits zur Nacht verabschiedet. Man hörte noch eine Weile ihre Schritte in der Wohnung, dann wurde es still. Ferry rauchte schweigend, die Beine aufs Balkongeländer gelegt. Lev tat es ihm gleich.
»Geht es dir gut?« Ferry zögerte und wies mit einer Kopfbewegung in Richtung des Geländers: »Was machen deine Beine?«
Lev schloss die Augen, hörte auf die Geräusche des Hinterhofs. Aus offenen Balkontüren und Fenstern drang das Klappern von Geschirr, gedämpfte Stimmen.
»Sie tun ihren Dienst.«
Er verschwieg, dass ihn noch immer ein Gefühl der Taubheit lähmte, wann immer die Erinnerung an den Unfall zurückkam.
»Ich habe dir nie die Schuld gegeben«, sagte Lev. Er wusste nicht, woher diese Worte kamen, sie mussten lange in ihm gewesen sein, und dies war der Moment, in dem er sie aussprechen konnte, aussprechen musste, er hatte sie dem Großvater lange genug vorenthalten. Lev fühlte sich mit einem Mal leicht. Hinter dieser Leichtigkeit lag noch etwas anderes, eine Ahnung, ein Einverständnis, aber an dieses Gefühl kam er augenblicklich nicht heran.
»Deine Mutter schon«, sagte Ferry. »Sie hat mir nie verziehen. Es scheint, als hätte ich nicht viel richtig gemacht. Ich habe euch zurückgelassen. Ich habe damals nicht gut genug auf dich aufgepasst. Ich konnte nie verstehen, was sie an deinem Vater gefunden hat.«
Ferry hatte immer einen Grund gefunden, Distanz zu ihnen zu wahren, aber das wollte Lev ihm jetzt nicht vorwerfen. Er konnte sein Gesicht nicht sehen, dafür war es zu dunkel, dafür war sein Körper zu abgewandt, doch der Klang seiner Stimme reichte.
Es führe nirgendwohin, die Vergangenheit anders haben zu wollen, sagte Lev. Sonst wäre er wahrscheinlich nicht hier. Auf diesem winzigen Teppichbalkon in Wien, neben ihm. Auf dem Weg zu Kato.
Und weil der Großvater nichts darauf sagte, nahm er seine Hand.
Bis Lev am nächsten Tag an Katos Pitch ankam, war es früher Nachmittag. Als sie ihn entdeckte, stand sie lächelnd auf, und er dachte, dass sich das Fortgehen allein dafür gelohnt hatte: Diese Freude auf ihrem Gesicht.
Er lehnte sich erneut ans Geländer und sah ihr bei der Arbeit zu. Diesmal betrachtete er das entstehende Bild. Kato legte zunächst ein Raster für die Proportionen an, skizzierte das Gemälde, dann erst arbeitete sie mit Farbe. Neben ihr lag eine Fotografie des Originals, Botticellis Venus, aus einer Muschel aus dem Meer aufsteigend, mit langen, roten Haaren, überlangem Hals und geneigtem Kopf, festen runden Brüsten. Den Gesichtsausdruck der Göttin konnte Lev nicht deuten, in sich gekehrt, vielleicht aber auch voller Erwartung.
Kato kauerte neben der Leinwand, und er musste an das Mädchen denken, als das er sie kennengelernt hatte, in zerschlissener Kleidung, mit jenem klugen, überlegenen, ein wenig gehetzten Blick. Wie sie die Nachmittage auf der Schaukel in ihrem Garten verbracht hatte, wie sie während der Unterrichtspausen zeichnete, sichtlich bemüht, nicht verloren zu wirken, und er schämte sich noch heute, dass er sie damals allein gelassen hatte.
Sie trug ihre Arbeitskleidung, wie sie es nannte, Jeans, Shirt oder Pullover, manchmal einen Overall, so musste sie seltener waschen. Über die Jahre hatte sie Routinen entwickelt, konnte sich organisieren, wusste instinktiv, wo ein guter Platz war. Gut waren Straßen, in denen viele Leute vorbeikamen, mit breitem, sauberem Trottoir und Licht. (Lev fand, dass hier alle Straßen hell und sauber waren, noch nie hatte er so saubere Straßen gesehen.) Zunächst einmal brauchte es die Genehmigung, dann musste man sich mit den Leuten gut stellen, Ladenbesitzerinnen, Pfarrern, Taxifahrern, Eisverkäuferinnen, Straßenkehrern, allen, die an einem Platz etwas zu sagen hatten – was ganz andere sein konnten, als zunächst angenommen.
Kato arbeitete konzentriert, sah nur hoch, wenn jemand etwas spendete. Lev überlegte, ob dieses kurze wechselseitige Wahrnehmen einen Teil ihres Erfolgs ausmachte, auch nach all der Zeit war es nicht selbstverständlich, dass ihre Kunst wertgeschätzt wurde. Die Leute blieben stehen, manche für einen Moment, andere, wie die ältere Dame im Sommermantel, kamen jeden Tag, um den Fortgang eines Bildes zu verfolgen. Ein Hund riss sich los, setzte sich auf die Frau, die Venus einen Mantel reichte. Kato ließ es lachend geschehen, der Besitzer warf einen Schein in ihren Korb.
Wenn sie ein Bild male, hoffe sie, dass die Betrachter auf die andere Seite gerieten. Es genüge nicht, es von oben anzusehen, mit dem Verstand Linien und Farben zueinander ins Verhältnis zu setzen, zu urteilen, ob es gut sei oder schlecht, einem gefalle oder nicht. Erst, wenn man die Welt aus den Augen der Figur heraus sieht, sagte Kato, sei es richtig.
Lev passte auf das Bild auf, wenn Kato zur Toilette ging (was früher Toms Aufgabe gewesen war), holte Kaffee, besorgte etwas zu essen. Und während die Sonne über den Platz wanderte, Boote vorbeifuhren, offenbarte sich eine Welt voller Ruhe und Schönheit, die sich, wenn man eine Weile stillhielt, mitten in der Geschäftigkeit der Stadt auftat.
Abends gingen sie zu einer Uferwiese, mitsamt Trolley und dem Geld, das Kato an diesem Tag eingenommen hatte. Öffentlich zählen wollte sie es nicht. Wenn große Scheine im Korb waren, nahm Kato sie gleich heraus. Im Laufe der Jahre war sie mehrmals bestohlen worden.
Auf dem Weg hatte er an einem Platz eine riesige Zeder bemerkt und einen Zapfen in seine Tasche gesteckt. In dem nahen Pavillon tanzten Paare zu Musik aus einem Kassettenrecorder. Zwei Jungs mit Skateboards fuhren so nah vorbei, dass Lev ausweichen musste. Am Kiosk kauften sie Chips und Bier, diesmal zahlte Lev.
»Du bist doch mein Gast«, wandte sie ein.
Und er fand, er sei bislang eher ein Zuschauer.
Die Farbe des Sees überraschte ihn, die Klarheit der Alpen an diesem Sommerabend. Ein See, hieß es, spiegele die Farbe des Himmels, aber konnte es sein, dass der Himmel hier so gänzlich anders war als in der Maramuresch? Am Yachthafen, wo Kato eine Decke auf der Wiese ausbreitete, öffnete er ihren Farbkasten.
Ultramarin, zu dunkel.
Türkisblau kam hin.
Blaugrün beigemischt.
Die Farbe des Sees verändere sich jeden Tag, sagte sie und öffnete die Bierflaschen mit dem Feuerzeug. Mehr und mehr Menschen bevölkerten die Wiese, manche allein, andere zu zweit, in einer Gruppe hatte jemand eine Gitarre dabei. Wiederum andere gingen schwimmen, liehen sich ein Boot oder führten ihren Hund aus. Nach dem zweiten Bier musste Lev aufs Klo, Kato erklärte ihm, wo die öffentliche Toilette war. Er solle sich nicht über das blaue Licht wundern, das sei so, damit die Fixer ihre Venen nicht fanden. Als er zurückkam, hatte sie sich auf der Decke ausgestreckt, entzündete eine selbstgedrehte Zigarette, die seltsam roch.
Ein herausforderndes Lächeln spielte um ihren Mund. Sie inhalierte, hielt den Rauch in der Lunge und stieß ihn langsam wieder aus. Der Filter, ein zusammengerolltes Stück Pappe, zeigte zu ihm, als sie ihm die Zigarette reichte. Sie beobachtete, wie er einen Zug nahm, sagte, er müsse anders rauchen, mit viel Luft einatmen, und dann fragte sie, ob er eine Ahnung habe, was er da rauche. Lev schüttelte den Kopf, nahm einen Zug. Dann dämmerte es ihm.
Er hatte noch nie gekifft.
Doch er fand, es war ein guter Abend für ein erstes Mal.
Kato pfiff, Daumen und Zeigefinger im Mund.
Eine Frau wandte sich um.
»Du bist also Lev«, sagte sie und setzte sich zu ihnen.
Er wusste nicht, was darin anklang: Ich habe schon viel von dir gehört, du siehst anders aus, als ich mir dich vorgestellt habe, alles war möglich. Warja, mehr als ihren Namen erfuhr er zunächst nicht, denn sie und Kato unterhielten sich (eine Frage ergab die nächste, ein Thema führte zum anderen), mochte ebenfalls Mitte, Ende Dreißig sein, sprach mit leichtem Dialekt und berührte beim Sprechen gedankenverloren Katos Arm; kurze rückversichernde Gesten, vertraut, und als überspielte sie damit eine Unsicherheit.
»Ich war auch einmal in Rumänien«, sagte Warja, zu ihm gewandt. »In Bukarest bei einem Kongress.«
Lev fragte nach ihren Erfahrungen, und sie erzählte, dass sie die Architektur der Stadt mochte, jene Gleichzeitigkeit von Geschichte, Verfall und Moderne. An den Menschen sei ihr eine feine Ironie aufgefallen, Humor, Gastlichkeit. Sie möge das, dieses Uneigentliche, Diskrete, aber manchmal sei es ihr auch schwergefallen, sich darauf einzulassen, manchmal wolle man einfach auf den Punkt kommen. Auffällig sei, dass Passanten einander im öffentlichen Raum kaum wahrnahmen, und selbst die Kellner im Café ihren Gästen mit ausgesuchtem Desinteresse begegneten. Es sei geradezu unmöglich, die Blicke eines anderen aufzufangen.
Es sei nicht unmöglich, sondern unhöflich, sagte Lev.
Warja lachte. Lev konnte sich vorstellen, wie gegensätzlich Warjas Eindrücke waren. Schon während der Gespräche im Zug war ihm der Gedanke gekommen, dass alle Reisenden auf gewisse Weise ihr Land vertraten. Aber durften einzelne Menschen und Erfahrungen fürs Ganze stehen? Die Walachei war anders als das Banat oder die Bukowina, Siebenbürgen anders als die Maramuresch – und so sagte er wenig, auch weil in seinem Mund eine große Trockenheit herrschte.
Warja hatte Trauben dabei, wusch sie an einem der Brunnen, die es überall in der Stadt gab.
Lev und Kato nahmen davon, sagten fast gleichzeitig: Danke.
Sich fürs Essen bedanken, immer, auch das war Südosteuropa.
Eine Amsel setzte sich auf einen Bootsmast in der Dämmerung des Sees. Die ruckartigen Bewegungen gaben ihr etwas Erstauntes, Überraschtes. Der Schnabel war leuchtend orange, ebenso der Ring um die Pupille. Sie balancierte auf dem Mast, wenn sie die Blickrichtung wechselte, sprang sie in die Höhe wie ein Akrobat.
Sie saßen jetzt dem See zugewandt, Kato in der Mitte. Ob auch sie an Camil dachte? Jede Amsel erzählte von ihm, seiner Liebe zu diesen Vögeln, seinem Verschwinden. Nachdem Camil fort war, hatte Kato aufgehört zu malen. Sie vernichtete Bilder, die aus der Zeit mit ihm stammten, und jedes Mal, wenn Lev bei ihr war, nahm er heimlich welche mit. Zuvor hatte er sich nicht um ihre Kunst geschert, kaum war Camil fort, fühlte er sich dafür verantwortlich. Er rettete Vogelbilder, frühe Landschaftsskizzen, erste Versuche in Farbe, die ihm damals schon perfekt vorgekommen waren – doch egal, was er sagte, wie sehr er sie ermutigte, sie rührte ihre Farben nicht mehr an.