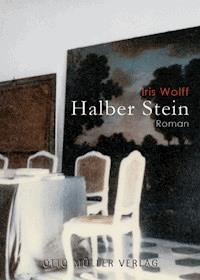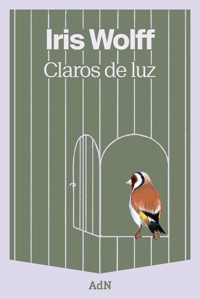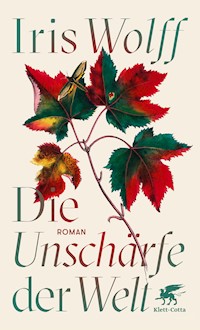15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Otto Müller Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Erste Weltkrieg bringt einen österreichischen Soldaten in ein Karpatendorf. Eine junge Frau besucht nachts die "Geheime Gesellschaft der Schlaflosen". Ein Motorradfahrer ist überzeugt, dass er sterben und die Mondlandung der Amerikaner versäumen wird. Eine Frau beobachtet die Ausfahrt eines Fischerbootes, das nie mehr zurückkehren wird. – Über vier Generationen des 20. Jahrhunderts und vier Ländergrenzen hinweg erzählt Iris Wolff davon, wie historische Ereignisse die Lebenswege von Einzelnen prägen. Zwischen Freiheit und Anpassung, Zufall und freiem Willen erfahren ihre Protagonisten: Es gibt Dinge, die zu uns gehören, ohne dass wir wüssten, woher sie kommen. Und es gibt Entscheidungen, die etwas bedeuten, Wege, die unumkehrbar sind, auch wenn wir nie wissen werden, was von einem Leben und den Generationen vor ihm bleiben wird. Iris Wolff hat ein poetisches und beglückendes Buch geschrieben, schonungslos, klug und sprachlich brillant. Mit sensiblen Beobachtungen, atmosphärisch dichten Dialogen und starken, eigenwilligen Figuren zeichnet sie in ihren Erzählungen behutsam eigene Welten, die im Zusammenspiel neue Tiefe entfalten und vielschichtige Perspektiven aufeinander eröffnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Iris WolffSo tun, als ob es regnet
Iris Wolff
So tun, als ob es regnet
Roman in vier Erzählungen
OTTO MÜLLER VERLAG
Der Verlag dankt Mehrdad Zaeri für die Illustration
www.omvs.at
ISBN 978-3-7013-1250-4
© 2017 OTTO MÜLLER VERLAG SALZBURG-WIENAlle Rechte vorbehaltenSatz: Media Design: Rizner.atDruck und Bindung: Druckerei Theiss GmbH, A-9431 St. StefanUmschlaggestaltung © Illustration: Mehrdad Zaeri,www.mehrdad-zaeri.de;Grafik: Stine Wiemann, www.stine-wiemann.comSeite 162, zitiert aus: Das Zauberpferd.Märchen aus Siebenbürgen und den Karpaten.Hrsg. v. Sigrid Früh. Fischer Taschenbuch Verlag,Frankfurt am Main, 1984
Die erste für Stine, die zweite für Julia, die dritte für Bille, die vierte für Esther
Du musst dich umschauen, sieh um dich; was du bemerkst, das gehört dir.
Hermann Lenz
Er lag neben der Quelle, versuchte seinen Atem zu beruhigen und bemerkte mit einem Mal die Stille, die alles umfangen hielt.
Budapest?
„Budapest“, sagte Jacob, als er aufwachte.
Vor den Wagenfenstern rollte die Landschaft vorbei. Unablässig war sie ihm in seine Träume gesickert, milchig getrübt durch die verschmutzten Fenster, hartnäckig, da es nichts anderes gab, womit er sich beschäftigen, ablenken konnte.
Die Maisfelder muteten an wie Schilfgebiete. Der Himmel war gehäutet, die Sonne ein blasser Lampion. Der Zug ratterte durch Dörfer, an Häusern vorbei, die ihre Dächer wie Hüte trugen, unter denen ab und an ein Auge hervorblitzte, schläfrig, gleichgültig. Bahnhofsgebäude tauchten auf, verlassene und bevölkerte, gepflegte und verfallene. Und dann, irgendwann, flog den Bergen, viele Kilometer weißgrau gehöht, ein übersättigtes Grün an.
Wo war sein Tabak? Sein Feuer? Er räumte die Hosentaschen aus. Ein Zettel kam zum Vorschein, ein loser Knopf, den er wieder annähen musste. Er setzte sich auf, indem er sich mit den Ellenbogen aufstützte, lehnte den Kopf seitlich gegen die Wand des Zugabteils. Seine Haut fühlte sich an, als sei sie durchlöchert. Wiederholt hatte ihn ein Fiebertraum geplagt, das Bild eines Perforators, der sich in Papier fraß, Löcher stanzte, eines nach dem anderen, bis das Blatt mit dem Aussehen eines behördlichen Dokuments nur noch ein Labyrinth aus dünnen, angerundeten Papierstegen war. Jacob spürte die Hand Liliensteiners, die ihm einen feuchten Lappen auf die Stirn legte, die des Arztes, die ihm den Puls fühlte. Nur ein leichtes Fieber, kein Grund zur Sorge.
„Budapest“, hatte ihm sein Freund zugeflüstert. Er versuchte erst gar nicht, seine Aufregung zu verbergen. Das hieß, sie würden Stadtquartiere beziehen. Wie eine Losung wurde dieses Wort weitergegeben, von Abteil zu Abteil, von Waggon zu Waggon, bis zu den offenen Ladeflächen, wo die Männer dem Fahrtwind ausgesetzt waren – Budapest. Jacob dachte an Kaffeehäuser, Straßenschluchten mit sechsgeschossigen Gebäuden, die Oper, die Markthalle, den Burgpalast, die Széchenyi-Brücke über die Donau … Dann stieg ein anderes Traumbild auf, das alle Sehenswürdigkeiten verblassen ließ. Er sah ein Bett vor sich, Kopfkissen und Decke mit weißer Wäsche bezogen. In dieses Bett würde er sich fallen lassen, nein, er würde sich waschen und dann fallen lassen, sich dem Trost von frischer Bettwäsche hingeben. Das Rattern des Zugs, das ihm in den Knochen saß, das Löchrige, Durchlässige würde über Nacht verschwinden.
Jetzt drängten sich alle an den Wagenfenstern zusammen, begierig, die Silhouette Budapests zu sehen, doch bereits in den Vororten nahm der Zug eine andere Richtung, schob sich unerbittlich in den werdenden Abend. Die Straßen und Laternen waren fort, die Lichter der großen Stadt bald nur noch ein sanftes, verstimmtes Glimmen am Horizont.
Liliensteiner öffnete das Abteil, entschuldigte sich noch in der Tür. Jemand musste den Adjutanten falsch verstanden haben. Wunschvorstellungen und Luftschlösser gingen auf den offenen Ladeflächen, in den Gängen, den Kranken-Abteilen entzwei. Jacob machte eine wegwischende Bewegung, wie um diesen Geräuschen Einhalt zu gebieten, wandte den Blick vom Fenster ab und lehnte sich wieder zurück aufs harte Polster.
„Gibst du mir Feuer?“
Am nächsten Morgen war das Fieber fort. Aus der Donau war die Theiß geworden, und als der Zug in Arad einfuhr, wussten sie, dass Siebenbürgen ihr Ziel war.
Die Marosch hatte sich zwischen bewaldeten Bergen an die Gleise herangeschlichen. Es war, als wollte sie den Zug nicht mehr verlassen, spülte schattige Uferböschungen, Halbinseln und graugrünes Wasser vor die Zugfenster. Jacob hatte ihren Namen immer wieder ausgesprochen: Marosch, mit einem langen „a“, einem „r“, das nicht an der Zunge, sondern in der Kehle rollte, und einem vollen „sch“ am Wortende.
Sie wechselten den Zug, in einem Ort, dessen Namen er gleich wieder vergaß. Die Bewohner trugen flache Hüte, Westen mit Silberknöpfen, Lederhosen und schwere Stiefel. Die ungepflasterten Gassen, die geduckten Häuser und das Federvieh vermittelten ihm das Gefühl, er habe nicht den Ort, sondern die Zeit gewechselt. Der angekündigte Zug kam nicht und die Truppe hatte die Aufgabe, Quartiere für die Nacht zu suchen. Jacob wurde mit dem Kommandanten in einem verlassenen Bauernhof untergebracht. Der Kommandant ließ sich von Jacob bei der Zensur der Post helfen, da er Handschriften gut entziffern konnte und einige Sprachen beherrschte. Zumindest soweit, dass er eingestreute ungarische, tschechische und italienische Wörter übersetzen konnte, meist nichts als Kosenamen oder von anderer harmloser Bedeutung.
Jacob mochte es, die Schriftbilder zu studieren: Waren die Buchstaben verbunden oder standen sie vereinzelt? Wie viel Rand blieb auf den Blättern? Fielen die Zeilen oder stiegen sie auf? Die einzelnen Merkmale waren oft nicht eindeutig. Längenunterschiede konnten die Erhebung übers Alltägliche anzeigen oder auf Selbstgefälligkeit hinweisen. Eine lang gestreckte Schriftweite konnte Aufgeschlossenheit bedeuten, aber auch Ungeduld, Flüchtigkeit; verzierte Buchstaben einen Blick fürs Detail oder Eitelkeit.
Jacob machte sich einen Spaß daraus, anhand der Briefe und seiner Beobachtungen fünf Grundtypen unter den Soldaten auszumachen – harmlose und weniger harmlose, aus denen sich viele Charaktere zusammensetzten. Die erste Kategorie waren die Selbstverkünder. Da kaum jemand ihre Klugheit zu bemerken schien, fühlten sie sich berufen, dieses Versäumnis durch mehr oder weniger bescheidene Hinweise aus der Welt zu schaffen. Alles, was sie taten, und sei es noch so unbedeutend, würde sich später als wesentlicher, ja entscheidender Schritt herausstellen. Alles, was sie sagten, hatte Bestand, und war sicher noch für künftige Generationen von Interesse. Sie wussten es ja schon immer, wie bedauerlich, dass andere auch manchmal etwas wussten – aber sie wussten es einfach immer schon länger.
Die zweite Kategorie waren die Träumer. Sie ersparten sich die Anstrengung, sich auf den Augenblick einzulassen. Schwer zu sagen, ob sie noch an etwas anderes dachten als ans nächste Ruhekissen. Sie konnten strammstehen, keine Miene verziehen und dabei doch ein Schläfchen machen. Ihnen war alles zu viel, der nächste Schritt, die nächste Übung, sie lebten in der Hoffnung, dass eine leichte Verwundung sie untauglich machen und an den Kachelofen zurückschicken würde.
Die dritte Kategorie waren die Trottel. Es war der einzige Typ, der sich in allen Gesellschaftsschichten finden ließ und in allen Physiognomien daherkam: Es gab sie als hemdsärmelige, tatkräftige Typen oder mit Bäuchen, fliehendem Kinn und weltmännischem Gehabe. Es gab sie gut ausgebildet oder strohdumm. Trotzdem war es der am leichtesten zu erkennende Typ, meist genügte ein einziger Satz. Sie waren nur in einer Sache zu beneiden: Sie litten wenig. Ein überschaubarer Verstand verhinderte größere Verzweiflung.
Die vierte Kategorie waren die Scheinheiligen, es war, als hielten sie immer eine Kerze in der Hand. Während alle um sie herum im Morast steckten, umgab sie der Geruch einer Wäschekammer – Regalreihen von weißen, akkurat gefalteten Tischdecken, frisch gewaschen, vielleicht nie benutzt. Sie wogen ihre Worte sorgsam ab, Silben durften nicht verschluckt werden, An- oder Verschlusslauten wurde gehuldigt. Dass die Welt im Argen lag, überraschte sie nicht. Jeder Tod, jedes Unglück war ihnen ein Gleichnis.
Die fünfte Kategorie waren die Dichter. Seltsamerweise gab es an der Front viele von ihnen. Sie führten Tagebuch, suchten in den Städten nach Bücherkisten, lasen am Abend im Feuerschein. Sie waren oft traurig. Sie schrieben die längsten Briefe. Bekamen sie Post, steckten sie das Kuvert in die Brusttasche und stellten sich erst einmal eine Weile vor, was darin stand. Es gab sie gern als Mischtyp, gepaart mit Selbstüberschätzung und -darstellung, überzeugt von ihrem außergewöhnlichen Blick auf die Welt. Oder voller Zweifel und Verlegenheit, mit unzusammenhängendem, sprunghaftem und narkotisierendem Geschreibsel.
Seit bekannt war, dass Jacob die Briefe las, begegneten ihm einige Männer mit Misstrauen. Andere ließen ihm eine auffällige Höflichkeit angedeihen. Nur der Liliensteiner hatte sich nicht beeindrucken lassen. Er nahm die Dinge mit einer Unaufgeregtheit, aber auch Umständlichkeit hin, die aus ihm zuweilen einen Narren machte.
„Der Kommandant wollte dich sehen, doch es hat sich in der Zwischenzeit erledigt, so dass mir nur zu sagen bleibt, dass du, wenn es nicht anders gekommen wäre, zum Kommandanten hättest gehen müssen“ – war ein typischer Liliensteiner-Satz. Sicher war niemand anderes als er es gewesen, der das Gerücht über Budapest in die Welt gesetzt hatte, weil er sich dieses Ziel wünschte und somit nicht anders konnte, als alle Anzeichen falsch zu deuten.
Jacob las die Briefe neben einem Ofen mit weißblau glasierten Kacheln. Durch niedrige Fenster fiel Licht auf eine Reihe Krüge an der Wand. Nachdem er im Hinterhof geraucht und die Hühner beobachtet hatte, ging er zu Bett. Aus tiefem, traumlosen Schlaf weckte ihn ein Klopfen. Es war der Eigentümer, der höflich Einlass in sein Haus verlangte, das in seiner Abwesenheit besetzt worden war. Anderntags wurde Jacob bei einer Frau einquartiert, die ihn in den Keller führte, in dem mehrere Weinfässer und kleinere Gebinde mit Schnaps standen. Als er ablehnte, setzte sie ihm Brot und Milch vor und zeigte ihm die Bilder ihres Mannes und ihres im Krieg gefallenen Sohnes. Sie stellte die Bilderrahmen auf den Esstisch, so, dass sein Blick darauf fiel, wenn er aufsah. Er nahm das Abendbrot in ihrer Anwesenheit ein und schmeckte bei jedem Bissen, dass er der Noch-Lebende war, der Noch-Verschonte.
Die Rumänen hatten bei ihrem Rückzug mehrere Brücken gesprengt. Etliche Kilometer folgte Jacobs Truppe dem Flusslauf, bis sie auf eine neue, notdürftig errichtete Holzbrücke trafen und der Kommandant die überfällige Rast erlaubte.
Das Herbstwetter war mild, ein September, der weniger vom kommenden Winter als dem vergangenen Sommer erzählte. Jacob setzte sich abseits unter eine Linde, lehnte sich an den Stamm und sah auf den Alt, der sich durch den Roten-Turm-Pass bis in die Walachei zog. Eine flüssige Trennlinie zwischen Bergen, deren Grün, ebenso wie die Blätter der Linde, herbstlich durchbrochen war. Die ihm zugewandte Hügelseite lag im Schatten und streute tiefschwarze Töne in die Landschaft.
Jacob war am 1. Oktober 1891 im Burgenland geboren worden und bezeichnete sich als Herbstgeselle. Er hatte die heimliche Theorie (die er heimlich nannte, obwohl er jeden damit behelligte), dass man sich besonders zu der Jahreszeit hingezogen fühlte, in der man zur Welt gekommen war. Als habe der Körper anhand dieser ersten prägenden Eindrücke die Sinne ausgerichtet und daraus den Vergleich mit allen anderen Monaten und Jahreszeiten abgeleitet.
Für ihn war die erste Herbsthälfte kein Sterben, vielmehr ein Innehalten; kein Vergehen, sondern ein Ruhen, das einen selbst zum Stillsein bewog. Im Frühling begann das Blühen, im Sommer setzte das Reifen ein, alles diente einem Zweck, bewegte sich zielstrebig in eine Richtung. Hier, vielleicht nur hier, war der Moment, in dem die Natur verweilte, eine Ruhepause einlegte, die ersehnte Unterbrechung der Zeit. Bald würde das Welken einsetzen, die Bäume, eben noch durchsprenkelt von Gelb und Grün, stünden lichterloh in Flammen. Die Luft würde kalt und klar werden, die Dunkelheit zunehmen, und seine Angst und Müdigkeit offenbaren. Ein Jahr Frankreich, mit allem, was dazugehörte: Hunger, brütende Hitze und Schnee, der an einem denkwürdigen Abend ein Lied für ihn gesungen hatte, jede Flocke ein Ton – betäubend, betörend schön –, und er wäre nicht wieder aufgewacht, wenn der Liliensteiner ihn nicht gefunden hätte. Jacob saß unter der Linde und erkannte, dass alles, was er erlebt hatte, eine Art innerer Besitz geworden war, zu ihm gehörte, ihn verändert hatte.
Noch war es windstill, die Mücken kreisten, das Wasser des Flusses schien stehenzubleiben, der Moment dehnte sich aus, und Jacob schlief, bis er durch den Appell des Kommandanten geweckt wurde. Er stolperte der Truppe hinterher, über die Holzbrücke auf die andere Seite, schattig und kühl, und sah immer wieder zur Linde zurück, die lichtbemalt vor sich hin schlummerte und ihn bis vor wenigen Augenblicken in ihren Schlaf mitgenommen hatte.
Wo ebene Erde zu finden war, wurden Zelte aufgeschlagen. In Ermangelung von Heu und Stroh diente Moos als Unterlage. Einige schliefen zwischen Gestrüpp auf dem Boden, eingehüllt in Mäntel und Decken. Die Spitzen der Zelte hoben sich gegen einen Himmel ab, den die Sterne trugen, nicht umgekehrt. Zu hören waren nur Gebirgsbäche und das Geräusch des Windes an den Zeltplanen. Jacob sah auf das nächtliche rumänische Grenzgebirge, spürte seine ganze Masse, seine Kälte und Unwegsamkeit, die ihn mit trügerischer Ruhe besänftigte und in der Deckung der Berge und Wälder die Strategien des Krieges verbarg.
Am 27. August war der Rote-Turm-Pass von rumänischen Truppen überfallen worden. Ungarische Grenzwachen konnten sie mehrere Tage aufhalten, die Hermannstädter Bevölkerung wurde evakuiert. Ein Teil des Bürgertums floh nach Budapest, Jacobs Sehnsuchtsort auf Zeit. Die Rumänen besetzten Ortschaften am Fuße der Südkarpaten, schickten jedoch nur schwache Abteilungen durch die Rote Stadt, unentschlossen, als gelte der Mythos ihrer Unbesiegbarkeit, als würden sie die gekreuzten Schwerter aus der Ursprungssage noch immer abwehren.
Jacobs Truppe sollte dem Feind durch einen Umgehungsmarsch über das Zibinsgebirge in den Rücken fallen. Sobald der Rote-Turm-Pass für den Rückzug der Rumänen versperrt war, würde der Angriff der deutsch-ungarisch-österreichischen Kräfte beginnen. Der Marsch war kräftezehrend. Jacob sah, wenn ihn nicht der Anblick der aufragenden Felswände und des weiten, siebenbürgischen Berglands gefangen nahm, zu Boden, damit ihm die Steigungen nicht ins Bewusstsein drangen. Hob er den Blick auf die lange Reihe der Feldgrauen, suchte er sich einen Fixpunkt in der Höhe. „Nur noch bis dorthin“, war ein Spiel, mit dem er und der Liliensteiner sich ablenkten und das sie wiederholten, bis sie die Zelte zur Nacht aufschlugen.
Sie konnten unbemerkt auf über zweitausend Meter steigen. Die Einkesselung gelang. Beim Überschreiten des Alt an einer Lichtung wurde unvermittelt Feuer gegen sie eröffnet. Nach den Stunden, in denen es nur darum gegangen war, die eigene Kraft gegen die der Berge zu setzen, brauchte Jacob einen Augenblick, um das Geräusch zuordnen zu können. Er hielt es zunächst für einen irrtümlichen Schuss, wandte sich um, und während er sich orientierte, war es, als drehte sich die Flusslandschaft um ihre eigene Achse und offenbarte eine rasende Kehrseite. Überall wurde geschossen, Männer rannten zum Ufer, suchten Deckung, sanken neben ihm zu Boden, Pferde bäumten sich auf, wurden vom Kugelregen erfasst, fielen in den Fluss, jagten Wassersäulen auf, blieben mit verrenkten Gliedern liegen.
Alles fiel von ihm ab, auch die Angst. Er zielte in den Wald, rannte, duckte sich, und es war gleich, ob hinter Felsen oder Pferdeleibern. Er schrie und hörte doch nichts; es gab einen Lärm, der an Stille grenzte. Im Flussbett verhakten sich Fahrzeuge, Menschen und Tiere. Das Wasser färbte sich rot. Und einfach so, ohne Vorwarnung, kippte die Flusslandschaft in ihren ursprünglichen Zustand. Die Angreifer zogen sich zurück. Der Herbstwald leuchtete wie zuvor, Sonnenschein lag auf dem Alt. Die Landschaft war unversehrt, und die Berge fingen wieder an, sie mit ihrer Ruhe zu beschwichtigen. Vier Tage dauerten die Kämpfe am Alt. Die Rumänen versuchten vergeblich, den Roten-Turm-Pass wieder zu öffnen, Brücken und Stellungen zurückzugewinnen. Dreitausend Soldaten wurden gefangengenommen, Lebensmittel, Munition, Geschütze, Züge und zwei Flugzeuge beschlagnahmt. Aus dem Fluss ragten Fahrzeugteile auf; die Gespanne mit ihren Deichseln glichen gekenterten Schiffen. Zwischen den Weidenzweigen am Ufer hatten sich tote Soldaten verfangen, Pferdekadaver, erschossene Hunde. Die Wiesen waren voller Papierbögen, Postkarten und den verstreuten Teilen einer Bibliothek. Zu Jacobs Überraschung darunter auch Diderot, Schiller, Goethe und Balzac. Sie sollten Feinde sein, und lasen doch dieselben Bücher.
Jacob und Liliensteiner wurden einer Truppe zugeteilt, die den Roten-Turm-Pass nach Süden verteidigen sollte. Der Widerstand der Rumänen war ungebrochen. Sie waren verzweifelt und kannten das Gelände besser. Einmal konnten sie bis auf dreißig Meter an Jacobs Truppe herankommen, und im Maschinengewehr- und Handgranatenfeuer hatte es viele Tote gegeben. Die Männer waren erschöpft, das Schuhwerk befand sich in jämmerlichem Zustand, und die angekündigte Stiefelsendung kam nicht.
Jacob wurde ausgeschickt, um am nächsten Stützpunkt danach zu sehen, und kam mit der Nachricht zurück, dass sich die Ankunft der Stiefel erneut verzögern würde. Er nahm einen Pfad, der etwas abseits, zuerst am Waldrand verlief und dann ins Unterholz führte. Raureif hatte alles mit Eiskristallen überzogen, bizarre Formen, die eigensinnig gegen den Wind wuchsen. Nebel fiel ins Tal, oder stieg er auf? Der Tag ging in den Abend über und Jacob versuchte, sich an das Gefühl der Sonne auf geschlossenen Augenlidern zu erinnern.
Er bemerkte einen Schatten in seinem linken Blickfeld, begleitet von einem Rascheln, blieb stehen, unwillkürlich die Luft anhaltend, musterte Baum für Baum und zog dabei langsam das Gewehr hervor. Hinter einem Stamm entdeckte er die Rundung einer Schulter. Sie bewegte sich kaum, und doch konnte er die Anspannung und das Zittern spüren, so stark, dass der ganze Baum hätte beben müssen. Das war kein Zivilist, der sich verlaufen hatte. Die Schulter offenbarte die rumänische Uniform.
Jacob richtete das Gewehr auf ihn.
„Komm heraus. Mit erhobenen Händen.“
Ein Mann in moosgrüner Uniform trat hervor. Jacob wusste, er sollte schießen, gleich, ohne noch einem einzigen Gedanken zu folgen – es wäre nichts weiter als ein Aufprall auf einem Bett aus Eiskristallen, ein Abwenden, Weitergehen.
Die Augen des Mannes waren überraschend hell, sie gaben dem Gesicht mit den schwarzen Augenbrauen und Haaren etwas Offenes, Warmes. Jacob mochte eine solche Offenheit des Blicks. Man bemerkt sie gleich, auch im Vorübergehen, eine Art Zugewandtheit, Verletzlichkeit. Es hatte einige Männer gegeben, denen er in die Augen sah, als er sie tötete. Immer hatte sich in ihrem Blick das in die Enge getriebene Leben gezeigt, die Hoffnung auf Gnade, Rettung, Erbarmen. Dieser Mann aber sah ihn geradewegs an, mit einem Verständnis und einer Nachsicht, fast Zutrauen, die Jacob zögern ließ. Es war ihm längst klar, dass er nicht schießen konnte, doch er stand noch einige Zeit unbewegt, das Gewehr auf den Mann gerichtet. Er wusste nicht warum, doch einige Zeilen von Georg Trakl fielen ihm ein.
Sieh ein ängstlicher Kahn versinkt
Unter Sternen,
Dem schweigenden Antlitz der Nacht.