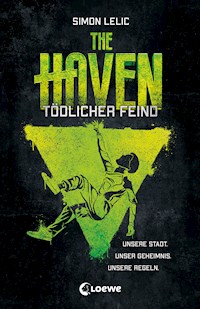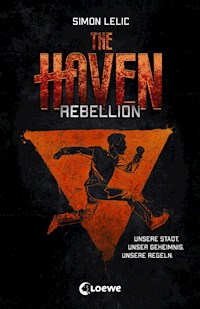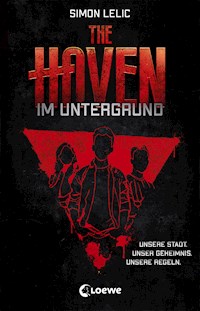9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Susanna Fenton hütet ein Geheimnis. Und deswegen blieb ihr nur die Wahl, ihr altes Leben hinter sich zu lassen, sich neu zu erfinden. Heute, vierzehn Jahre später, ist sie erfolgreiche Psychotherapeutin.
Ihr aktueller Klient verursacht ihr jedoch Unbehagen. Adam Geraghty erzählt ihr nicht nur von schrecklichen Gewaltfantasien, sondern erscheint ihr auch seltsam vertraut. Fast zu spät erkennt Susanna, dass er von ihrer Vergangenheit weiß - und gekommen ist, alte Rechnungen zu begleichen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungWer bin ich?15 Uhr – 16 Uhr1234Emily8. August 201716 Uhr – 17 Uhr56789Emily19. August 201717 Uhr – 18 Uhr10111213Emily22. August 201718 Uhr – 19 Uhr14151617Emily13. September 201719 Uhr – 20 Uhr1819202122Emily14. September 201715. September 201716. September 201717. September 201718. September 2017Im Haus herrschtDanachDer Himmel hat»What will survive of us is love.«DanksagungenÜber dieses Buch
Susanna Fenton hütet ein Geheimnis. Und deswegen blieb ihr nur die Wahl, ihr altes Leben hinter sich zu lassen, sich neu zu erfinden. Heute, vierzehn Jahre später, ist sie erfolgreiche Psychotherapeutin. Ihr aktueller Klient verursacht ihr jedoch Unbehagen. Adam Geraghty erzählt ihr nicht nur von schrecklichen Gewaltfantasien, sondern erscheint ihr auch seltsam vertraut. Fast zu spät erkennt Susanna, dass er von ihrer Vergangenheit weiß – und gekommen ist, alte Rechnungen zu begleichen …
Über den Autor
Simon Lelic ist ein britischer Autor, von dem bereits drei Romane erschienen sind und international veröffentlicht wurden. Sein Debüt Ein toter Lehrer gewann den Betty Trask Award und stand auf der Shortlist des John Creasy Debut Dagger. Lelic wurde in zahlreichen Ländern veröffentlicht: in den USA (Viking), in Holland (Mouria), Schweden (Natur och Kultur), Frankreich (Le Masque), Deutschland (Droemer), Serbien (Alnari), Italien (Fanucci), Brasilien (Nova Fronteira/Ediouro), Israel (Kinneret), Finnland (Like), Russland (Phantom), Dänemark (Punktum) und der Türkei (Arti). The House ist sein vierter Roman, ein Psychothriller, mit dem er eine besonders populäre und kommerzielle Richtung einschlägt. In UK wird er im Herbst 2017 als Spitzentitel bei Penguin erscheinen, die einen großen Relaunch des Autors planen.
S I M O N L E L I C
ZWEI LÜGNER, EIN RAUM,KEIN ENTKOMMEN
THRILLER
Aus dem Englischen vonFriederike Achilles
Vollständige E-Book-Ausgabe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2018 by Simon Lelic
Titel der englischen Originalausgabe: »The Liar’s Room«
Originalverlag: First published 2018 in Great Britain
by Penguin Books, Penguin Random House UK.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Stefanie Kruschandl, Hamburg
Umschlagmotive: © Cover design by
Sarah Oberrender | © Willowpix / Getty Images
Umschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-7787-3
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Für Sarah, auf ewig.
Wer bin ich?
Als sie aufwacht, fühlt sie sich völlig zerschlagen, und das Erste, was ihr in den Kopf schießt, ist diese Frage. Gefolgt von: Wo bin ich?
Sie kommt sich vor wie sediert, gelähmt. Ihr Kopf ist schwer, ihre Sinne sind getrübt, als befände sie sich unter Wasser. Und ihre Kehle brennt wie Feuer. Wenn sie schluckt, ist es, als würde sie zerstoßenes Glas hinunterwürgen.
Sie blinzelt. Allmählich wird ihre Sicht klarer, doch zuerst dringt der Geruch zu ihr durch. Der Raum stinkt muffig, nach Alkohol und altem Urin. Der Gestank trifft sie wie ein Schlag; sie muss würgen. Dass sie sich nicht übergibt, liegt allein daran, dass ihr Magen offenbar vollkommen leer ist. Wann hat sie zuletzt etwas gegessen? Wie lange ist es her, dass sie sich gestattet hat, überhaupt an Essen zu denken?
Sie rollt sich von ihrem Lager – einer viel zu dünnen Decke, die genauso vor Dreck starrt wie die restliche Umgebung – und auf alle viere. Sofort knickt der rechte Arm unter ihr weg. Sie schreit vor Schmerz auf und schlägt mit der Schulter voran hart auf den Boden auf, woraufhin sie erneut aufschreit. Schluchzend wartet sie, bis der Schmerz abebbt, und untersucht dann ihren nackten Arm. Da ist keine Wunde, aber ein riesiger Bluterguss, der sich wie ein hässlicher Sonnenuntergang von ihrem Ellenbogen bis zum Handgelenk erstreckt. Sie hat keine Ahnung, wie er da hingekommen ist … bis sie sich erinnert.
Er.
Er hat sie am Arm verletzt. Er hat sie hierhingebracht.
Und die schreckliche Wirklichkeit dringt in ihr Bewusstsein.
Wo sie ist. Und aus welchem Grund.
15 Uhr – 16 Uhr
1
Sofort, als sie den Jungen sieht, hat sie das Gefühl, ihn von irgendwoher zu kennen. Oder eher – es ist merkwürdig –, dass er sie kennt. Die Person, die sie verbirgt, genauso wie diejenige, zu der sie geworden ist.
Er sieht aus, als hätte er sich für einen besonderen Anlass gekleidet. Die meisten Menschen würden es wahrscheinlich gar nicht bemerken, aber Susanna kennt sich mit Jungs im Teenageralter aus. Und auch wenn dieser hier etwas älter ist – vielleicht neunzehn, zwanzig? –, sieht man, dass er seine Kleidung mit Bedacht gewählt hat. Er trägt eine dunkle Jeans, die sauber ist, nicht zerrissen. Das Hemd steckt zwar nicht in der Hose, ist aber ordentlich zugeknöpft und hat ein Designer-Logo auf der linken Brustseite. Seine Anzugschuhe passen eigentlich nicht zu der Jeans, doch wie die anderen Kleidungsstücke hat der Junge sie – vermutet Susanna – ausgewählt, weil es die besten sind, die er besitzt. Genau so würde er sich für ein erstes Date anziehen. Was irgendwie ziemlich süß ist. Es rührt sie, dass er sich ihretwegen solche Mühe gegeben hat.
Das Gefühl, dass sie ihn kennen müsste, löst sich auf wie ein Déjà-vu. Als sie sich wieder gefangen hat, erklärt sie sich ihr Aufschrecken beim Anblick des Jungen – des jungen Manns – mit seinem unbestreitbar guten Aussehen. Sein Gesicht könnte das Cover einer Zeitschrift zieren, jener Art von Zeitschrift, die zu lesen Susanna nicht mehr erträgt, aber auf dem Tisch draußen im Wartezimmer bereitlegt. Eigentlich ist es weniger ein Wartezimmer als vielmehr ein umfunktionierter Flur, den sie mit Ruth, einer Zahnärztin, teilt. Ruth praktiziert auf der rückwärtigen Seite des renovierten Hinterhauses. Zwischen Ruths und Susannas jeweiligen Räumen befindet sich in einem offenen Bereich am Treppenaufgang der Empfangstresen. Er wird hauptsächlich von Alina genutzt, einer Ukrainerin, die sowohl Ruths zahnmedizinische Assistentin als auch ihrer beider Rezeptionistin ist. Im Erdgeschoss befindet sich ein Antiquitätengeschäft mit separatem Eingang, das komplett voller Möbel steht, aber nie geöffnet hat; weder Susanna noch Ruth haben jemals den Besitzer gesehen. Sie machen Witze darüber, dass der Antiquitätenhandel bestimmt nur als Tarnung dient – für Geldwäsche, die Mafia von Devon oder den IS. In Wahrheit, denkt Susanna, betreibt der Besitzer seine Geschäfte wahrscheinlich online und trifft die Käufer nur nach Vereinbarung. Auch wenn die Wahrheit langweiliger ist, ist sie Susanna lieber. Ruth hingegen hat ein Faible fürs Dramatische. Manchmal fragt Susanna sich, wie Ruth reagieren würde, wenn sie die Wahrheit über sie herausfände.
Aber zurück zu dem jungen Mann. Dieses Gesicht. Er könnte ein Model sein – perfekte Konturen, ganz reine Haut und braune, grüblerisch wirkende Augen. Er hat sogar den richtigen Haarschnitt und die leicht arrogante Ausstrahlung. Als er eben den Raum betreten hat, schien es, als würde er den Dielen nicht ganz trauen. Sein Pony fällt ihm über ein Auge, weshalb es so aussieht, als würde er hinter einem Vorhang hervorschauen.
Quer über seinen Brustkorb läuft der Trageriemen einer Messenger Bag. Während er zögerlich einen Schritt weiter in den Raum hereinkommt, nimmt er sie von der Schulter.
»Ähm … hallo«, sagt er. Es klingt eher nach einer Frage als nach einer Begrüßung.
»Adam?« Susanna steht auf und reicht ihm die Hand. Der junge Mann ergreift sie, was Susanna als Bestätigung dafür deutet, dass er derjenige ist, auf den sie gewartet hat. Adam Geraghty. Der erste von zwei neuen Klienten, die sie für diesen Nachmittag einbestellt hat. Zwei Neuzugänge an einem Tag sind eher ungewöhnlich, aber in Anbetracht ihrer derzeitigen finanziellen Lage kommen sie nicht ganz ungelegen. »Ich bin Susanna. Kommen Sie doch herein, bitte.«
»Susanna?«
»Oder Susie, wenn Ihnen das lieber ist. Alles außer Mrs Fenton, denn dann würde ich mich ständig umdrehen, weil ich denke, dass meine Mutter hinter mir steht.« Die Lüge ist als Scherz verpackt, womit sie in Susannas Augen weitestgehend vertretbar ist.
Adam lächelt. »Susanna«, wiederholt er.
»Setzen Sie sich.« Susanna macht eine Geste, und Adam folgt der Richtung ihres ausgestreckten Arms. Vor dem ungenutzten Kamin stehen zwei gepolsterte Stühle – schlicht, aber bequem – einander schräg gegenüber. Dazwischen befindet sich ein kleiner Tisch mit Gläsern und einer Wasserkaraffe darauf. Die Stühle sehen genau gleich aus, eine bewusste Entscheidung. Adam wählt den, der weiter von der Tür entfernt steht. Susanna fragt sich, ob der Junge vielleicht doch schon mal eine Therapie hatte, denn ihrer Erfahrung nach tendieren Ersttäter dazu, sich die Möglichkeit eines schnellen Fluchtwegs zu bewahren.
Er stellt seine Tasche dicht neben sich auf den Boden und setzt sich auf die Stuhlkante. Einen Moment lang nimmt er die Umgebung in sich auf. Der Raum ist klein, relativ leer. Durch die Georgianischen Fenster dahinter fällt das Licht auf Susannas Schreibtisch, den sie vor jeder Sitzung so weit wie möglich leerräumt. In der Ecke hinter der Tür befindet sich ein Kleiderständer, der so dürr und trist aussehen würde wie ein Baum im Winter, wenn Susanna nicht extra zu Dekorationszwecken einen Hut gekauft hätte. Dann gibt es noch die überladenen und unordentlichen Bücherregale, und an der Wand hängen neben einem Druck von Matisse ihre gerahmten Zertifikate (sie hätte die Zertifikate nicht aufgehängt, wenn Ruth nicht beharrlich behauptet hätte, dass sie ihr größere Seriosität verleihen würden). Ansonsten sind da nur noch ein paar Pflanzen und die weiß getünchten Wände.
»Susanna«, sagt der junge Mann wieder. »Das klingt nicht richtig.« Eine Pause. »Ich meine, sollte ich Sie nicht irgendwie Doktor nennen oder so?«
»Gerne, wenn Sie möchten«, sagt Susanna, »nur bin ich das nicht.« Dieses Mal flankiert sie den Witz mit einem Grinsen. »Ich bin Therapeutin«, stellt sie klar. Der Scherz ist offenbar ins Leere gelaufen, und sie versucht, wieder zu einem professionellen Ton zurückzukehren. »Psychotherapie ist etwas ganz anderes als Psychiatrie. Was aber nicht heißt, dass ich nicht qualifiziert wäre.« Sie setzt sich aufrechter hin. »Was ich damit nur sagen will: Man braucht keinen Doktortitel, um in meinem Bereich zu praktizieren. In einigen Kreisen wird einem sogar ausdrücklich davon abgeraten.«
Das passiert ihr ständig: Sie nutzt Humor als Abwehrmechanismus, nur um daraufhin zu weit in die andere Richtung zu schlingern. Noch immer ist sie sich nicht sicher, ob sie den jungen Mann von irgendwoher kennt. Aber so oder so – etwas an ihm macht sie nervös. Wahrscheinlich wirklich nur sein gutes Aussehen. Großer Gott, Susanna. Flirtest du etwa? Schäm dich! Du musst mindestens dreißig Jahre älter sein als er.
Susanna merkt, dass ihre Wangen glühen, senkt den Blick auf ihren Schoß und zupft einen Fussel von der schwarzen Hose.
»Also«, hebt sie noch einmal an und arrangiert ihr Lächeln neu, »warum erzählen Sie mir nicht ein bisschen was darüber, warum Sie hier sind?«
Der Junge schreckt auf. »Sie meinen, ich soll direkt loslegen?«
»Wir können mit dem Grundsätzlichen anfangen, okay? Ihr Name, Alter, ein bisschen was darüber, wo Sie herkommen. Solche Dinge. Und später können wir dann dazu übergehen, was genau Sie sich von unserem Gespräch erhoffen.«
Adam verändert seine Position. »Okay, klar. Ich heiße Adam. Adam Geraghty. Ich wurde hier geboren. In England, meine ich. Also in London, nicht hier hier. Und ich glaube …« Er hält inne, rutscht wieder etwas herum, zuckt ein bisschen. »Hören Sie, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich es direkt sage? So wie Sie vorgeschlagen haben. Kann ich Ihnen einfach sagen, warum ich hier bin, und dann sagen Sie mir, was Sie dazu meinen und ob Sie mir helfen können oder nicht?«
»Nun …«
»Ich will nicht unhöflich sein oder so. Es ist nur, ich möchte nicht Ihre Zeit vergeuden, und um ehrlich zu sein, habe ich auch nicht so viel Geld. Und außerdem bin ich ziemlich nervös. Mehr als ziemlich.« Er grinst verschämt. Es ist das Grinsen eines Schuljungen, und Susanna spürt einen kleinen Stich im Herzen.
»Tut mir leid«, sagt Adam. »Entschuldigen Sie. So macht man das hier nicht, oder? Tut mir leid«, sagt er erneut und fährt sich mit den Händen durchs Haar. »Sie hätten nie gedacht, dass das mein erstes Mal ist, oder?« Er wird rot und fügt etwas hastig hinzu: »Das erste Mal, dass ich mit jemandem wie Ihnen rede, meine ich.«
Auch Susannas Wangen sind bei der versehentlichen Anspielung wieder ganz warm geworden. »Ist schon gut, Adam. Wirklich. Sie sind derjenige, der das Gespräch lenkt, nicht ich. Wir können so anfangen, wie es Ihnen am liebsten ist. Und wir müssen über nichts sprechen, für das Sie noch nicht bereit sind.«
Als sie Adams Reaktion beobachtet, wird Susanna klar, warum sie das Gefühl hatte, ihn zu kennen. Es ist nicht sein Aussehen. Es ist sein Lächeln. Wie er den linken Mundwinkel etwas höher zieht als den rechten; das kurze Aufblitzen seiner milchig weißen Zähne. Es ist ein unbeholfenes Lächeln. Unschuldig. Vertraut.
»Ich glaube, was ich mich frage, ist, wie lange das hier normalerweise dauert«, sagt Adam. »Sie wissen schon. Um alles wieder zu reparieren.«
Susanna blinzelt und sieht Adam dann fest an.
»Es gibt da ein großes Missverständnis in Bezug auf den Therapieprozess«, erklärt sie. »Nämlich, dass wir auf die Lösung eines speziellen Problems hinarbeiten.« Sie macht eine Pause, sieht, wie Adams Augenbrauen sich in der Stille leicht heben. »Aber das ist nicht das, worum es wirklich geht. Ich bin hier, um Ihnen dabei zu helfen, sich selbst zu helfen. In jeder Situation. Ganzheitlich.« Sie persönlich glaubt aus tiefstem Herzen daran, doch sie befürchtet, Adam mit der Terminologie zu verschrecken.
»Was ich damit sagen will«, fährt sie fort, »ist, dass es ein Prozess ist. Mit offenem Ende. Auf Ihre Frage, wie lange es normalerweise dauert, kann ich also leider keine Antwort geben. Es kann sein, dass wir nach sechs Terminen einen Fortschritt sehen. Es kann sich aber auch herauskristallisieren, dass Sie und ich überhaupt nicht zueinander passen. Es tut mir leid, dass das alles so vage klingt, aber es gibt dabei einfach sehr viele Variablen.«
»Zum Beispiel das, was mich fertigmacht.«
»Wie bitte?«
»Zum Beispiel das, was mich fertigmacht. Sie sagten, es gibt viele Variablen. Ich vermute mal, eine davon ist die Ursache, warum es mir überhaupt so schlecht geht. Richtig?«
»Nun ja, schon. Wobei …« Mach es nicht noch komplizierter, Susanna. »Ja, das ist eine der Variablen. Ganz genau.«
»Also, was das betrifft … Ich meine, ist es okay, wenn wir jetzt darüber reden?«
Susanna kann ihm ansehen, wie sehr er sich danach sehnt, es loszuwerden. Diese Sache. Das vermeintliche Problem, das ihn hierhergebracht hat und von dem sie ziemlich sicher weiß, dass es ganz und gar nicht das ist, was ihn wirklich umtreibt. So ist es fast immer. Die Klienten sind meist völlig auf eine bestimmte Sache fokussiert – irgendeine Erfahrung, von der sie sicher sind, dass diese die Quelle ihres Unglücks ist –, und dann stellt sich heraus, dass es in Wahrheit um etwas ganz anderes geht.
»Natürlich«, sagt sie. »Wenn Sie glauben, dass es Ihnen helfen würde, dann erklären Sie es mir.«
Adams Reaktion ist nicht die, mit der Susanna gerechnet hat. Aufgrund der Art, wie er bisher von seinem »Problem« gesprochen hat, seiner offensichtlichen Scham über das, was auch immer ihn beschäftigt, hat sie erwartet, dass er auf seinem Stuhl herumrutscht, sich räuspert, dass er einen Moment braucht, um seinen Mut zusammenzunehmen, und dann letztlich nur etwas in Richtung Fußboden nuschelt.
Doch all das tut er nicht. Er sitzt ganz still da, und während er spricht, blickt er Susanna direkt in die Augen.
»Es gibt da etwas, das ich gerne tun würde.«
»Etwas, das Sie tun wollen?«
»Etwas … Schlimmes. Und die Sache ist die …« Er hat sich nicht bewegt. Hat seinen Blick kein einziges Mal von ihr abgewendet, und jetzt umspielt ein schmales Lächeln seine Lippen. Doch diesmal ist es kein unbeholfenes Lächeln. Es ist ganz und gar nicht unbeholfen. »Die Sache ist die, Susanna«, fährt Adam fort, und jegliche Unschuld ist aus seinem Gesicht gewichen, »ich weiß nicht, ob ich mich davon abhalten kann.«
2
»Sie sagen gar nichts«, konstatiert Adam. Er fährt sich abermals mit der Hand durch die Haare, beinahe zieht er an ihnen, so wie Susannas Exmann es immer getan hat, wenn sie gestritten haben – was sie zum Ende hin buchstäblich jedes Mal taten, wenn sie zusammen waren.
»Ich hätte nichts sagen sollen«, fährt Adam fort. »Sie kennen mich noch gar nicht, und ich … Ich meine, ich habe Sie noch nicht mal nach Ihrer Verschwiegenheitspflicht gefragt. Ob Sie, Sie wissen schon. Ob Sie irgendetwas sagen müssten. Ob ich … Ob man mich …«
»Adam.« Sie nennt ihn beim Namen, damit er sich sammelt. Damit sie sich sammelt. »Adam, hören Sie zu. Alles ist gut. Ich verspreche es Ihnen. Sie sollen sich frei fühlen, alles zu sagen, was Sie möchten. Alles, was Sie sagen müssen. Genau darum geht es in unseren Gesprächen. Offenheit. Ehrlichkeit.«
Adam sieht sie zweifelnd an, so wie ein Schuljunge einen Lehrer ansehen würde, der ihn bei etwas Verbotenem erwischt hat, ihm aber sagt, dass er gerne damit weitermachen darf. Anders ausgedrückt: so, als würde sie ihn in eine Falle locken. Als wolle sie ihn austricksen.
»Was meine Schweigepflicht betrifft – alles, was in diesem Raum geschieht, ist vollkommen vertraulich«, fährt Susanna fort. »Das heißt, Sie können mir genauso vertrauen wie zum Beispiel Ihrem Arzt oder, sagen wir, einem Anwalt. Die einzige Ausnahme wäre, wenn ich Sie als Gefährdung einschätze. Für sich selbst, meine ich. Oder für andere.«
Es geschieht so unterschwellig, dass Susanna es fast nicht bemerkt: Der Hauch eines Zuckens läuft durch Adams Körper.
»Adam? Ich verspreche Ihnen, dass ich unser Vertrauensverhältnis niemals brechen werde, solange wir nicht in einer totalen Sackgasse feststecken. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Das ist mein Anliegen. Und ich weiß, dass ich wahrscheinlich nur in der Lage dazu bin, wenn Sie das Gefühl haben, mir vertrauen zu können. Sich mir anvertrauen zu können.«
»Das sind also die Regeln«, erwidert Adam. »Quasi das Gesetz? Dass Sie niemandem etwas sagen dürfen, außer ich erkläre mich damit einverstanden? Zum Beispiel … Ich weiß nicht. Den Behörden oder so. Zum Beispiel …«, durch seinen Pony hindurch fixiert Adam sie, »… der Polizei.«
Susanna bemüht sich nach Kräften, keine Reaktion zu zeigen.
»Das ist richtig«, antwortet sie. »Ich darf niemandem etwas über Sie sagen, außer wenn ich befürchte, dass Sie jemanden verletzen werden. Das gilt auch für den Fall, dass Sie sich selbst verletzen werden, und ich sicher bin, dass ich nichts mehr zu Ihrem Schutz tun könnte.«
Adam überlegt. Trifft eine Entscheidung, vermutet Susanna.
Schließlich stößt er den Atem aus. »Kann ich von Anfang an erzählen?«
»Sehr gerne«, sagt Susanna.
»Also, es gibt da dieses Mädchen …«
Hätte Susanna raten müssen, sie hätte wohl darauf getippt, dass Adams Geschichte so beginnen würde. Mädchen/Junge – eins von beiden. Adam macht auf sie nicht den Eindruck, als wäre er schwul, doch Susanna wurde schon häufiger von den sexuellen Neigungen ihrer Klienten überrascht. Nicht dass sie darüber urteilen würde. Sie hat viele Schwächen, aber dies gehört sicher nicht dazu. Im Gegensatz zu Neil, ihrem Exmann, der ihr einmal gestanden hatte, dass es seine größte Angst sei, ihr Sohn Jacob – für seine Eltern und Freunde nur »Jake« – könnte schwul sein. Damals war Susanna schockiert, doch inzwischen kann sie fast darüber lachen: über Neils Vorurteile, ja, aber auch darüber, dass es eine Zeit gab, in der die größte Angst ihres Mannes darin bestand, auf welche Weise ihr Sohn sich verlieben könnte.
»Sie ist jünger als ich. Das Mädchen. Nicht viel. Nur ungefähr drei Jahre.«
Susanna wird bewusst, dass sie immer noch nicht Adams genaues Alter kennt. Wenn er wirklich neunzehn oder zwanzig ist, dann wäre seine Freundin sechzehn oder siebzehn. Also zwei, drei Jahre älter als Emily: ihre Tochter, nach Jake ihr zweites Kind.
»Sie ist hübsch, finde ich. Nicht nur hübsch. Sie ist wirklich wunderschön. Schlank und eher klein, würde ich sagen. Sie hat tolle Haare, wie … Na ja, poliertes Holz vielleicht. Sie sind irgendwie braun, aber an manchen Stellen auch rot, sogar golden, und sie glänzen, als würde sie Werbung für Shampoo machen. Und sie hat dieses Lachen. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist irgendwie dreckig, kann man sagen, aber gleichzeitig auch genau das Gegenteil. Einfach total echt. Ohne irgendetwas Bösartiges. Wenn sie lacht, will man einfach mitlachen. Verstehen Sie?«
Susanna nickt, aber anstatt fortzufahren, presst Adam auf einmal die Lippen zusammen. Als würde er sich schämen. Möglicherweise befürchtet er, dass sie ihn schwülstig, ja sogar dämlich findet, was er teilweise vielleicht auch ist, aber für sie klingt er einfach nur wie ein sehr verliebter junger Mann.
»Sie ist offenbar eine sehr attraktive junge Frau.«
Adam scheint im ersten Moment zu glauben, dass Susanna ihn aufzieht, aber dann schenkt er ihr sein Schuljungengrinsen.
»Das ist sie«, sagt er. »Absolut. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich solche Angst habe. Davor, dass …« Sein Grinsen gefriert und verschwindet dann.
»Wovor, Adam? Wovor haben Sie Angst?«
»Ich habe Angst, dass …«
Susanna wartet ab.
»Ich habe Angst davor, sie zu verletzen.« Es entsteht eine Stille, in der sich zwischen ihnen beiden die Erkenntnis entfaltet, dass er nicht von einer Verletzung der Gefühle spricht.
Susanna gibt sich Mühe, ruhig zu bleiben.
»Was genau lässt Sie annehmen, dass Sie sie verletzen könnten?«
Diese Weise, auf die Adam sie jetzt ansieht … Es ist genau wie vorhin, als er direkt auf sein »Problem« anspielte (Es gibt da etwas, das ich gerne tun würde) und alle Unschuld aus seinem Gesicht wich. In jenem Moment dachte Susanna, dass er wohl mehr mit sich herumschleppt, als sie ursprünglich angenommen hatte, und dass es vielleicht richtig war, ihm mit Misstrauen zu begegnen.
Aber dieses Gefühl verflüchtigt sich, und Susanna kommt schnell zu der Überzeugung, dass der Grund für ihre Verunsicherung anderswo zu suchen ist. In ihrer eigenen Vergangenheit, nicht in Adams. Es ist ihr Problem, ihr Ballast.
»Adam? Was genau lässt Sie annehmen, dass Sie sie verletzen könnten?«, wiederholt Susanna.
»Es ist einfach …« Adam holt tief Luft und lässt den Atem langsam wieder entweichen. »Es fühlt sich irgendwie richtig an«, erklärt er schließlich. »Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben kann. Es ist wie …« Er will noch mehr sagen, doch dann schüttelt er den Kopf.
»Sprechen Sie weiter, Adam«, sagt Susanna. »Denken Sie daran, ich bin nicht hier, um Sie zu verurteilen. Wenn es sich erst mal nicht richtig für Sie anhört, können Sie jederzeit alles revidieren. Wir haben alle Zeit der Welt, um es in die richtigen Worte zu fassen.«
Sie wartet.
»Adam? Warum glauben Sie, dass …?«
»Weil sie es verdient«, stößt Adam plötzlich hervor. Und dieses Mal liegt echte Wut in seiner Miene. Er lehnt sich vor, die Ellenbogen auf den Knien, und da ist diese Leidenschaft – oder Glut – in seinen Augen. »Allerdings könnte es auch sein, dass ich eigentlich gar nicht sie meine«, fährt er fort. »Vielleicht meine ich in Wahrheit …«
Susanna, immer noch erschrocken über seinen Ausbruch, schaut ihn an. In Wahrheit … wen? Susanna hat es schon häufiger erlebt, dass Klienten auf sich selbst verweisen. Wäre das der Fall, dann ist Adam derjenige, der seiner Meinung nach leiden soll – vielleicht weil er unterbewusst glaubt, keine Liebe zu verdienen. Aber es ist seltsam. Aus irgendeinem Grund kann sie sich des Gefühls nicht erwehren, dass er eine andere Person meint.
»Ach, ich weiß es nicht«, sagt er, lehnt sich wieder zurück und verschränkt die Arme.
Susanna gestattet ihnen eine ausgedehnte Pause.
»Lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen«, schlägt sie dann vor. »Sollen wir?«
Adam sieht sie fragend an.
»Können Sie mir etwas über Ihre Eltern erzählen? Über Ihre Kindheit?«
Wieder ist da ein Leuchten in Adams Augen, das Susanna nicht ganz einordnen kann. Ist das Verwirrung? Erneuter Zorn? Oder gar ein Triumphieren? Es könnte jedes dieser Gefühle sein. Alle zusammen. Oder keins von ihnen.
»Sie haben zum Beispiel erwähnt, dass Sie in London aufgewachsen sind«, hakt Susanna nach. »Richtig?«
»Ja. Nein. Ich meine, ich wurde in London geboren, aber ich bin nicht dort aufgewachsen. Ich bin eigentlich irgendwie überall aufgewachsen.«
»Ihre Eltern sind viel gereist?«
»Mein Alter schon, ja. Wobei ich nicht sicher bin, ob reisen das richtige Wort ist. Weglaufen trifft es eher.«
»Das heißt …?«
»Das heißt, dass er der reinste Versager war.« Wieder blitzt Wut auf, die er kaum zurückhält. Und unter dieser Wut liegt nach Susannas Empfinden noch etwas anderes, etwas, das sie nicht richtig greifen kann.
Sie beschließt, es für den Moment dabei zu belassen. »Was ist mit Ihrer Mutter, Adam?«, fragt sie stattdessen.
Adams Lippen kräuseln sich in einem Mundwinkel. Er ignoriert Susannas Frage und sagt stattdessen: »Ich weiß, was Sie denken.«
Für einen Augenblick ist Susanna sicher, dass er das wirklich tut.
»Sie denken an meine Vergangenheit«, ergänzt Adam. »Sie fragen sich, ob die etwas damit zu tun hat. Mit dem, was ich fühle.«
Susanna lächelt, um seinetwillen genauso wie um ihretwillen.
»Ja, das überlege ich tatsächlich.«
»Sie haben wahrscheinlich recht«, sagt Adam. »Ich bin sogar sicher, dass Sie recht haben.«
Susanna spürt, wie sich ihre Augen verengen. »Warum sagen Sie das?«
»Ist doch einfach so. Wir können unserer Herkunft, der Vergangenheit, die wir gerne geheim halten würden, nie wirklich entkommen. Diese Dinge definieren uns. Kontrollieren uns. Halten uns manchmal sogar gefangen.« Adam sieht sie gespannt an. »Glauben Sie nicht?«
Susanna starrt ihn wie gelähmt an. Und ein eiskalter Griff schließt sich um ihre Schultern.
Sie steht auf. In dem Bewusstsein, dass Adam sie beobachtet, geht sie durch den Raum, bis sie schwankend vor der Besucherseite ihres Schreibtischs stehen bleibt.
»Ist alles in Ordnung?« Sie hört, wie Adam sich in seinem Stuhl vorbeugt. »Habe ich was Falsches gesagt?«
Susanna zwingt sich zu einem Lächeln. Sie versucht, es Adam zu präsentieren, ohne sich ganz zu ihm umzudrehen. Sie braucht einen Moment. Nur einen Moment.
»Nein, natürlich nicht, ich … Ich suche nur einen Stift. Und meinen Notizblock.« Sie tut so, als würde sie ihren Schreibtisch durchsuchen.
»Sie wollen sich Notizen machen? Ich dachte, das macht man nicht? Der letzte Therapeut, bei dem ich war, meinte so was wie, dass das den Prozess beeinträchtigen würde.«
Und da geschieht es: Zum ersten Mal begreift Susanna unmissverständlich, dass Adam ihr gegenüber nicht ganz ehrlich war. Er hatte behauptet, dass er noch nie eine Therapie gemacht hat, doch mit dieser unbedachten Bemerkung hat er sich verraten.
»Es ist so«, erklärt Adam, »ich sage irgendetwas, Sie schreiben es auf, und je nachdem, was Sie entschieden haben zu notieren, verändert es das, was ich als Nächstes sagen würde. Oder?«
Etwas Schlimmes.
Weil sie es verdient.
Er hat also gelogen. Kein Grund zur Panik. Klienten verschleiern ständig etwas. Und die Wahrheit, weiß Susanna, ist subjektiv. Hat sie das nicht in ihrer Ausbildung gelernt? Was zählt, ist das, was sich für den Klienten wahrhaftig anfühlt.
Die Vergangenheit, die wir gerne geheim halten würden …
Susanna fühlt einen Kuli zwischen ihren tastenden Fingern und zwingt sich, ihn aufzunehmen. »Das stimmt«, sagt sie. »Das ist absolut richtig. Den Stift, den Notizblock – die brauche ich erst hinterher.«
Sie erneuert ihr Lächeln. Dann dreht sie sich um …
… und ist erschüttert von dem, was sie in Adams Blick sieht: puren, unverhohlenen Hass.
Es ist, als hätte man ihm eine Maske abgenommen. Er wirkt … älter? Jünger? Ganz bestimmt grausamer und damit zugleich auch irgendwie vertrauter: So wie Susanna ihn wahrnahm, als er ihren Praxisraum betrat. Als wäre die Unschuld, die sie vorhin noch in seinem Verhalten gesehen hatte, nur ein schimmernder Anstrich gewesen, der jetzt getrocknet und abgeplatzt ist.
Sie können mir vertrauen. Wie oft hat sie das schon erlebt? Sie wusste, dass irgendetwas nicht stimmt, also warum hat siesich selbst nicht vertraut?
»Geht es Ihnen gut, Susanna?«
»Wie bitte?«
»Sie sehen plötzlich so verschreckt aus. Ich mache Ihnen doch keine Angst, oder?«
Er klingt erfreut.
»Mir, Angst?« Susanna lacht. »Nein, natürlich nicht, warum sollten Sie …«
Doch das tut er. Ganz eindeutig. Sie kann es nicht länger leugnen: Irgendetwas an ihm hat ihr von Anfang an Angst gemacht. Sie kann noch so sehr versuchen, es wegzuerklären, aber nun, da sie es sich eingestanden hat, lässt sich das Gefühl nicht mehr vertreiben.
»Sie haben mich angelogen«, entfährt es ihr. »Stimmt’s?« So etwas würde Susanna unter normalen Umständen niemals tun. Offen anzweifeln, was ein Klient gesagt hat. Ihn quasi der Lüge zu bezichtigen. Doch sie hat keinen Zweifel daran, dass Adam sie reizen will – testen? –, und setzt instinktiv zum Gegenangriff an.
Einen Moment lang bleibt Adam vollkommen ruhig.
Dann sagt er: »Erwischt.« Und jetzt ist es nicht mehr nur sein Gesichtsausdruck, der Susanna verändert vorkommt. Seine Gestik ist es, seine Stimme, alles. Er knöpft den Hemdkragen auf, sackt etwas in seinem Stuhl zusammen. Susanna muss an einen Schauspieler denken, der jegliche Körperspannung verliert, sobald er die Bühne verlässt. Seltsamerweise auch an einen Nachrichtenmoderator – daran, wie seine Persona sich wahrscheinlich verändert, sobald das Kameralicht erlischt.
»Der Notizblock war’s, stimmt’s?«, fragt Adam. »Als ich gesagt habe, dass es nicht vorgesehen ist, dass Sie sich Notizen machen?« Er schüttelt den Kopf und lacht über sich selbst. »Ich schätze, ich wollte Sie beeindrucken. Ich habe ausgiebig recherchiert, müssen Sie wissen. Ich verstehe mein Handwerk.«
Recherchiert?, will Susanna schon zurückfragen, als Adam sich mit dem Handballen gegen die Stirn schlägt. Fest.
Und dann lacht er wieder.
»Das war aber das Einzige, bei dem ich geflunkert habe«, sagt er. »Ich gebe es zu, ich war schon bei anderen Therapeuten. Aber mein Problem, mein Dilemma, wie Sie es wohl nennen würden. Das ist echt.«
Susannas Hals ist zugeschnürt vor lauter Fragen. Vor Schock, vor Verwirrung, vor Angst.
»Hier, vielleicht hilft Ihnen das dabei, mich zu verstehen.« Adam lehnt sich zur Seite, schiebt eine Hand in die hintere Tasche seiner Jeans und zieht ein Stück Papier hervor.
Zunächst bewegt Susanna sich nicht.
»Hier«, wiederholt Adam, und als er diesmal mit dem Papier wedelt, greift sie danach. Sie nimmt es, dreht es herum.
Und erblickt ihre Tochter, die ihr von einem Foto entgegenlächelt.
3
Die Erinnerungen sprudeln hoch, steigen auf wie Blasen und zerplatzen dann an der Oberfläche.
Die Schwangerschaft, die furchtbar war. Anders als die vorige. Anders als das erste Mal. Auf gewisse Weise war bei Emily alles anders. Wobei eines gleich blieb: Dieses überwältigende Glücksgefühl, das Susanna empfand. Emily, ihr kleines Mädchen, war perfekt – schimmernd wie eine Perle.
Aber diese Übelkeit. Die Übelkeit war ganz sicher neu, so etwas hatte sie bei Jake nicht erlebt. Susanna wurde frühzeitig von ihr überrascht, und statt irgendwann wieder zu verschwinden, wurde sie nur noch intensiver. Susanna musste ins Krankenhaus. Zweimal. Das zweite Mal für fast zwei Wochen. Es ging ihr so schlecht, dass Neil eine Abtreibung vorschlug. Nein, das stimmt nicht. Es war kein Vorschlag. Er wies auf die Möglichkeit hin, deutete sie an. Versuchte, Susanna gut zuzureden, sodass die Entscheidung – die Verantwortung – am Ende bei ihr liegen würde. Und wenn sie zurückblickt, was sie unermüdlich tut, dann würde sie sagen, dass dies der Moment war, in dem ihre Beziehung endgültig zerbrach. Sie war sowieso schon am Bröckeln gewesen. Zu der Zeit, als Emily gezeugt wurde, war ihre Beziehung schon genauso sehr nur noch Schatten ihrer selbst: ein Gedankengebäude, das bei der kleinsten Erschütterung in sich zusammenzufallen drohte.
Doch eine Abtreibung, schon allein der Gedanke daran … war für Susanna der Anfang vom Ende. Es war wie damals, als Neil ihr seine Angst bezüglich Jakes Sexualität gestanden hatte, nur schlimmer – grundlegender, denn Vorurteile waren wenigstens etwas, das Susanna sich erklären konnte. Neil sagte, ihm ginge es nur um ihre Gesundheit. Es habe nichts damit zu tun, dass er ursprünglich kein zweites Kind gewollt hatte; dass er monatelang behauptet hatte, es wäre genau das Falsche für sie beide. Was es vielleicht auch war, doch das änderte nichts an der Tatsache, dass Susanna sich über alles wünschte, dieses Baby möge überleben. Ihr kleines Mädchen, wie sich dann zeigte. Ein Mädchen.
Susanna war keine Radikale. Sie trat sehr energisch für das Selbstbestimmungsrecht werdender Mütter ein. Doch nach allem, was sie durchgemacht hatten, konnte sie einfach nicht fassen, dass Neil dieser Gedanke überhaupt in den Sinn kam. Was er meinte, war, es umzubringen. Ihr Baby zu töten.
Sie setzte sich schließlich über Neil hinweg – natürlich tat sie das –, und die Freude über Emilys Geburt vertrieb den Großteil ihrer Schmerzen. Das heißt, die Schmerzen der Schwangerschaft. Der Wehen. Aber danach, und bis zu jenem Zeitpunkt, ab dem Neil und sie getrennte Wege gingen (besser gesagt: diametral entgegengesetzte), lag sie Nacht für Nacht schlaflos vor Angst wach. Ihr war endgültig bewusst geworden, dass sie mit einem Fremden zusammenlebte. Ehemann, Vater? Lügner.
Eine weitere Erinnerung: auf dem Po rutschen. Ha! Das machten sie beide, Jake und Emily. Also hatten sie vielleicht doch ein paar Gemeinsamkeiten. Bis auf die Tatsache, dass Jakes Fortbewegungsmethode an ein taumelndes Humpeln im Sitzen erinnert hatte, während Emily immer die Elegantere von ihnen war. Die Art, wie sie über den Fußboden glitt, hatte fast schon etwas Anmutiges – sofern man es als anmutig bezeichnen kann, wenn jemand mit dem Po übers Linoleum schleift. Aber so war es. Sie schwebte beinahe. Zen-artig. Ein rosafarbener, mit Babypuder bestäubter Buddha.
Emily mit einem Foto von Jake. Älter inzwischen. Sechs? Sieben? Zufälligerweise hat Jake auf dem Foto ungefähr das gleiche Alter.
»Wer ist das, Mummy?«
Susanna, wie sie sich nach Emily umdrehte. Wie sie allmählich begriff, als sie das Foto sah.
»Woher hast du das?«
»Hey! Gib es mir zurück.«
»Ich fragte, woher du das hast! Du sollst nicht in meinen Schubladen wühlen, Emily. Ich habe dir doch schon mal gesagt, dass ich nicht will, dass du in meinen Sachen herumschnüffelst.«
»Hab ich doch gar nicht! Ich hab es einfach so gefunden.«
Selbst wenn Susanna Emily nicht so gut gekannt hätte, wäre ihr klar gewesen, dass sie log. Im Haus gab es nirgendwo Fotos von Jake, die nicht durch mindestens zwei Schutzschichten vor dem »Finden« bewahrt wurden. Von diesem hier wusste Susanna – so wie ein Bibliothekar weiß, wo sich ein bestimmtes Buch befindet, oder wie eine Kuratorin die Herkunftsgeschichte jedes Ausstellungsstücks kennt –, dass es in einem Umschlag in einem Schuhkarton in ihrer Kramschublade gesteckt hatte. Wobei »Kram« nicht ganz stimmte; in Wahrheit handelte es sich um Dinge, die ihr heilig waren. Sie hatte den Begriff nur gewählt, um Emily abzuschrecken.
»Mummy? Es gehört mir, ich hab’s gefunden, ich will es angucken.«
»Es gehört dir nicht, junge Dame.« Susanna spürte Wut in sich aufsteigen, gegen die sie nichts tun konnte. Rasende Wut, ohne jede Vorwarnung oder einen triftigen Grund.
Sie versuchte es noch einmal.
»Es gehört nicht dir, Emily. Es gehört Mummy. Es ist … wertvoll«, entschied sie sich zu sagen, da ihr kein besseres Wort einfiel.
»Aber ich will es angucken. Zeig’s mir, Mummy, bitte.«
Zunächst zögerte sie, doch dann gab sie nach. Sie erinnert sich, dass sie dachte: Was kann es schon schaden?
Lange starrte Emily das Foto einfach nur an; versuchte offenbar nachzuvollziehen, warum ihre Mutter so wütend geworden war.
»Aber wer ist das denn?«, fragte sie dann.
Susanna sah von Emily auf das Foto. Sie erlaubte ihrer Daumenspitze, über die Wange ihres Sohns zu streichen. »Nur ein Junge«, antwortete sie. »Niemand, den du kennst.«
Und sie lenkte ihre Tochter mit einem Teller Kekse ab.
Ihr perfekter Tag. Der mit Abstand glücklichste, seit dem Beginn von »Susannas Leben, Teil zwei« – wie sie es in Gedanken nur nennt.
Emily und sie. Niemand sonst. Nicht mal Schaulustige, deren Mimik verraten hätte, dass sie genau wussten, wer sie beide waren. Auch nicht das Gefühl, prüfenden Blicken standhalten zu müssen, was lange Zeit ein beinahe ebenso großes Problem für sie war. Sogar ein noch größeres, hätte ihre Therapeutin gesagt. Ihre Therapeutin Patti Moorcock. Susanna war von ihrem Trauerberater an Patti verwiesen worden, die sie später wiederum zu ihrer neuen Berufslaufbahn brachte. Zwei, drei Jahre lang war Patti alles für Susanna – ihre Mentorin, Vertraute und Freundin. Vielleicht die einzig echte Freundin, die Susanna jemals hatte. Natürlich gibt es noch Ruth, aber auch wenn Susanna sie wirklich liebt, existiert da einfach dieses Geheimnis, das immer zwischen ihnen stehen wird. Durch Susannas Schweigen hat es sich in eine Lüge verwandelt – was die Freundschaft zwischen Ruth und ihr zu einer Illusion gemacht hat. Zu einer Lichtschau. Wunderschön, aber ohne jede Substanz. Zu etwas, von dem sie weiß, dass es irgendwann enden wird.
Aber dieser eine Tag. Ihr perfekter Tag mit Emily. Ein Spaziergang am Strand, Doughnuts mit Zuckerguss auf dem Pier. Reden. Einfach reden. Emily war damals zehn, und Susanna wusste (war sich dessen äußerst schmerzhaft bewusst), dass sie bald schon vor Gesprächen mit ihrer Mutter zurückscheuen würde. Doch an jenem Tag war sie mitteilsam, fröhlich, offen. Sie antwortete auf Susannas Fragen, lachte und lächelte.
Mehr noch: Auch Emily stellte Susanna Fragen, schien ehrlich interessiert an ihrer Meinung zu sein. Zwischendurch fragte Susanna sich kurz, ob es albern war, so glücklich zu sein, nur wegen einer schlichten Unterhaltung. Doch es fühlte sich nicht albern an. Im Gegenteil. Schließlich war Susanna nur allzu klar, dass es das Wichtigste ist, was Eltern tun können. Sich mit ihren Kindern zu unterhalten. Ihnen zuzuhören. Ihnen Liebe zu schenken, indem man ihnen seine gesamte Aufmerksamkeit widmet.
»Du kennst doch Gott«, fragte Emily plötzlich inmitten ihres Gesprächs über Achterbahnen – so unmittelbar, wie nur zehnjährige Kinder das Thema wechseln können.
Susanna nahm gerade einen Schluck von der Cola ihrer Tochter, die sie gekauft hatten, um die Doughnuts herunterzuspülen. Emilys Frage (Feststellung?) machte es ihr schwer, das Getränk im Mund zu behalten.
»Ja«, antwortete sie schließlich, nachdem sie heruntergeschluckt hatte. Sie strich sich mit dem Finger übers Kinn. »Allerdings nicht persönlich.«
Es war ein lahmer Scherz – ein Mama-Witz –, doch Emily, gepriesen sei sie, kicherte. »Mu-um«, schimpfte sie.
»Was ist denn mit Gott?«, fragte Susanna und runzelte leicht die Stirn, um ihre Neugier zu verbergen, von der sie befürchtete, dass Emily sie falsch deuten könnte.
»Glaubst du, dass es sie wirklich gibt?«
Wieder musste Susanna ein Lächeln unterdrücken. »Sie?«
»Ja, klar. Oder ihn, vielleicht.«
»Tja …« Die wahre Antwort war Nein. Sie wollte gerne daran glauben, und als Emily auf die Welt gekommen war, hatte sie in Erwägung gezogen, es wirklich zuzulassen. Doch am Ende hatte sie sich diese Selbsttäuschung nicht zugestehen können. »Ich denke, es ist möglich. Viele Menschen würden sagen, dass sie nicht den geringsten Zweifel daran haben.«
»Aber du schon, oder? Du glaubst nicht, dass sie existiert.«
Susannas Grundsatz, immer ehrlich zu sein, ließ ihr keinen Spielraum – und Emily hatte die Antwort sowieso schon erfasst.
»Nein, ich glaube nicht daran. Aber wenn es Gott wirklich gibt, dann würde ich jede Wette eingehen, dass es sich um einen Mann handelt.«
Sie schlenderten nebeneinander her, und Emily sah sie von der Seite an. »Wie meinst du das?«
Susanna schüttelte den Kopf. »Ach, schon gut, Süße. War nur ein Witz, nichts weiter. Ein ziemlich schlechter.«
Normalerweise hätte Emily darauf bestanden, dass ihre Mutter die Aussage näher erklärte, sodass sie die zugrunde liegende Struktur präzise nachvollziehen könnte. Doch Emilys Geist war offensichtlich mit wichtigeren Angelegenheiten beschäftigt.
»Aber was, wenn es sie doch gibt?«
Irgendetwas an Emilys Tonfall ließ Susanna nun wirklich die Stirn runzeln. Angst? Das war es nicht ganz. Aber mit Sicherheit irgendeine Art Furcht. »Was meinst du?«, fragte sie.
Eine Weile lang antwortete Emily nicht.
»Emily? Bereitet dir irgendetwas Sorgen?«
Ihre Tochter schüttelte den Kopf. »Nicht richtig.«
»Was ist es dann?«
»Es würde mir nur leidtun. Wenn Gott existieren würde und niemand an sie glaubt. Ich meine, nicht gar niemand. Aber nur wenige Leute. Verstehst du?«
Susanna blieb stehen und sah ihre Tochter an. Eine leichte Brise blies über den Pier, und sie musste sich die Haare hinters Ohr klemmen, damit sie ihr nicht in die Augen wehten.
»Gott würde dir leidtun«, wiederholte sie.
Emily hielt ebenfalls inne. Sie zog die Stirn kraus und blinzelte gegen das Sonnenlicht. »Also … ja. Und es würde mich traurig machen, glaube ich. Weil sich das sehr einsam anfühlen muss. Oder? Wie würdest du dich denn fühlen, wenn du Gott wärst und niemand dir glauben würde?«
Himmel, wie sehr Susanna sie liebte. Ha! Wenn das mal kein Gebet war, keine Bekundung dessen, woran Susanna glaubte. Ich liebe dich, Emily. Ich glaube an dich.
»Ich glaube, Gott muss dir nicht leidtun, Schatz«, sagte sie. »Wenn Gott existiert, dann ist er bestimmt ganz zufrieden mit sich selbst, denke ich.«
»Wegen der Welt.«
»Wie bitte?«
»Gott ist mit sich zufrieden wegen der Welt. Wegen all der coolen Sachen auf ihr. Meinst du das?«
»Na ja …« Erneut war es nicht das, was sie meinte. Doch wäre es eine Lüge, wenn sie jetzt zustimmen würde? »Was ich meinte«, erklärte sie leicht ausweichend, »ist, dass es ziemlich cool sein muss, Gott zu sein, und dass er deshalb wahrscheinlich sehr glücklich ist. Es muss toll sein, Blitze heraufbeschwören zu können. Oder die Menschen dazu zu bringen, dass sie einen jeden Sonntag lobpreisen. Und vor allem, auf einer Wolke zu leben.« Als Emily erneut kicherte, sah Susanna zu ihr hinunter.
»Aber ja«, fuhr sie fort, »ich glaube, du hast recht. Ich denke, wenn es wirklich einen Gott gibt, dann hat sie es insgesamt verdient, stolz zu sein. Es gibt viel Unerfreuliches auf der Welt, aber auch ganz viel Fantastisches.« Susanna nahm die Hand ihrer Tochter, spürte, wie Emilys Finger sich um ihre schlossen. »Es ist nur oft … tja. Ich glaube, es passiert einfach sehr schnell, dass wir das vergessen.«
Sie gingen ein paar Schritte, ohne etwas zu sagen. Dann ertappte Susanna ihre Tochter dabei, wie sie lächelte.
»Du hast ›sie‹ gesagt«, stellte Emily fest, verlegen und triumphierend zugleich.
»Ha.« Susanna hielt ihr Gesicht in den Wind und wischte sich eine Träne weg. »Das hab ich wohl«, sagte sie, drehte sich wieder um und drückte die Hand ihrer Tochter noch fester.
Das Gegenteil. Der Tiefpunkt. Der schlimmste Tag, zumindest seit dem Ende von »Susannas Leben, Teil eins«.
Wobei es eigentlich auf einen einzigen Vorfall hinauslief. Sie waren … wo noch mal? Wahrscheinlich einkaufen. Die genauen Umstände ihres Ausflugs sind inzwischen in irrelevante Ferne gerückt. Wieder war sie allein mit Emily, die diesmal im Buggy saß. Ihre Tochter war zu diesem Zeitpunkt drei Monate, zwei Wochen und vier Tage alt. Das hatte Susanna später ausgerechnet. Würde sie sich daran erinnern? Diese Frage stellte Susanna sich wieder und wieder. Was zwar lächerlich erschien, wenn sie bedachte, dass ihre eigene früheste Erinnerung (wie sie mit ihrem Vater in einem Tretboot sitzt und Eiscreme auf ihre Knie tropft) aus einer Zeit stammte, als sie vier Jahre alt war. Aber es hieß doch, dass Babys sogar schon in der Gebärmutter von Erlebnissen beeinflusst würden. Es hieß, die gesamte Persönlichkeit eines Kindes würde davon geformt, was es in seinen ersten paar Monaten erlebte. Was bedeuten würde, dass Emily sich mit Sicherheit an irgendetwas erinnerte, selbst wenn diese Erinnerung im tiefsten Unterbewusstsein verborgen war.
Zum Teil geschah es, weil Susanna so unvorbereitet war. Sie hatte angenommen, es wäre vorbei. Das denkbar Schrecklichste war eingetreten, aber sie hatten es überstanden und geglaubt, dass der Rest der Welt sich auch weiterbewegt hatte. Glauben heißt nicht wissen. Das war einer von Neils Lieblingssprüchen. Genau wie Es zählt das, was unter dem Strich rauskommt und, der schlimmste von allen, Es ist, wie es ist – was in fünf Wörtern ziemlich exakt seine gesamte Lebensphilosophie zusammenfasste. Immer lief es auf ein verbales Achselzucken hinaus, und jedes Mal wollte Susanna irgendetwas an die Wand schmeißen.
So sind Jungs nun mal, noch so ein Spruch. Ein weiteres Achselzucken. Ein weiteres Ablehnen jeglicher Verantwortung.
»Ich kenne Sie.«
Diese Bemerkung war es, wegen der Susanna sich umdrehte.
»Entschuldigen Sie?«, sagte sie zu der Frau, die sich ihnen genähert hatte. Sie befanden sich auf der Straße. Irgendwo auf einem Gehweg. Vor dem Tesco-Supermarkt?
»Ich sagte, ich kenne Sie. Ich habe Sie im Fernsehen gesehen.«
Tesco, richtig, und sie waren einkaufen gewesen; Susanna erinnert sich jetzt, wie sie mit den Tüten kämpfte. Die Tüten waren voller Dosen, Packungen und offener Beutel mit losem Gemüse, und Susanna mühte sich damit ab, die Henkel über die Griffe des Buggys zu schieben. Ein paar Dinge purzelten dennoch heraus. Sie weiß noch, wie eine Dose Pfirsiche auf die Füße der fremden Frau zurollte, wie diese sie erblickte und zwischen den Schuhspitzen einklemmte. Um sie dann eine Sekunde später mit der Seite ihres Stiefels in den Rinnstein zu treten.
»Hey«, protestierte Susanna – allerdings nur kleinlaut. Jetzt hatte sie Angst. Nicht so sehr vor dieser Frau, die kleiner als sie war und schmächtiger. Auch jünger. Sie war vermutlich siebenundzwanzig, achtundzwanzig. Und sie hatte ebenfalls ein Kind. Das war das Schlimmste an allem. Ein kleiner Junge hielt sich an ihrer Hand fest. Beobachtete. Lernte.
»Sie sind Abschaum. Genau das sind Sie. Abschaum.«
Okay, vielleicht hatte sie Angst vor der Frau, aber noch mehr vor der Situation. Sie kam sich vor wie in einem Albtraum, in dem man sich auf einmal nackt in der Öffentlichkeit wiederfindet. So fühlte sie sich: gänzlich und auf unerträgliche Weise exponiert.
»Sie mögen vielleicht die anderen hinters Licht geführt haben, aber mich täuschen Sie nicht. Ich weiß es. Ich weiß es.«
Susanna blickte sich um, voller Sorge, wie viele der geschäftigen Menschen um sie herum ihr Gespräch wohl mitbekamen. »Ich glaube, Sie verwechseln mich mit jemandem.«
Sie wollte weitergehen und ihre Einkäufe einfach dort liegen lassen. Und vielleicht war es genau das – der freiwillige Verzicht auf Dinge, die ihr rechtmäßig gehörten –, was die Frau als Schuldeingeständnis auslegte. Sie schöpfte Mut und zog an ihrem Sohn herum, sodass die beiden Susannas Weg blockierten.
Rotes Haar, grüne Augen, ein Kinn, das hervorragte wie ein anklagender Zeigefinger.
»Ist das Ihre?«, fragte die Frau. Mit diesem Kinn, das in Emilys Richtung zuckte. Emily, die vom Buggy aus zu ihnen hochsah.
Ganz kurz zog Susanna in Betracht, Emily als ihre Nichte, Patentochter oder dergleichen auszugeben. Doch zu jenem Zeitpunkt hatte sie sich schon diese absolute Ehrlichkeit antrainiert. Immer die Wahrheit zu sagen erschien ihr als ein klares Lebensprinzip: In seiner Reinheit hatte es fast etwas Heiliges. Wenn sie immer offen und ehrlich war, wie konnte irgendjemand sie dann jemals beschuldigen?
Also wollte sie sagen: Ja, das ist meine Tochter.
Doch dazu kam sie gar nicht.
Die Frau spuckte aus. Nicht in Susannas Richtung. Sie zog die Nase geräuschvoll hoch, sammelte den Schleim im Mund und spie ihn dann kräftig in Emilys Buggy.
Susanna entfuhr ein Kreischen. Ihr erstes und einziges waschechtes Kreischen. Es hätte auch früher schon passende Gelegenheiten für dieses Geräusch gegeben, doch erst der Anblick ihrer Tochter, die mit dem Gift einer Fremden besprüht wurde, verlieh ihrer Angst eine Stimme. Sie bemerkte, dass der kleine Junge angefangen hatte zu weinen, nahm wahr, wie eine Passantin erschrocken vor ihr zurückwich. Sie erinnert sich, dass die Frau – die Spuckende – an ihr vorbeistürzte und Susanna für einen Augenblick daran hinderte, sich um ihr Kind zu kümmern. Und sie erinnert sich noch an Emilys Ausdruck, als sie sich endlich zu ihr hinunterbeugte: schockiert zwar, aber zu unschuldig, um wirklich verängstigt zu sein.