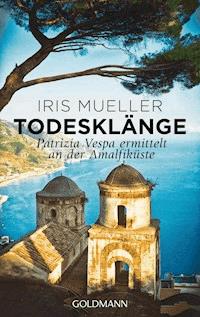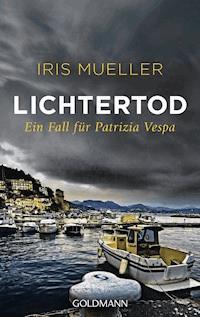
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Patrizia-Vespa-Reihe
- Sprache: Deutsch
In der Vorweihnachtszeit strahlt Salerno in einem ganz besonderen Glanz: Wenn die Tage kürzer werden, verzaubert ein Meer von Weihnachtslichtern die malerische Hafenstadt an der Amalfiküste. Doch dieser Zauber wird jäh durchbrochen, als statt der Lichtinstallation ein kunstvoll an einer Hauswand drapierter menschlicher Kopf für Aufsehen sorgt. – Der zweite mysteriöse Mordfall innerhalb kurzer Zeit für Salernos frischgebackene Hauptkommissarin Patrizia Vespa, die erkennen muss, dass sie sich inmitten eines blutigen Rachefeldzuges befindet. Denn schon bald wird Salernos Lichtertraum durch den nächsten grausamen Mord getrübt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Salerno im November. Die malerische Stadt südlich von Neapel bereitet sich darauf vor, wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit mit Turin um den Titel der »Lichterhauptstadt« zu konkurrieren. Es ist die festlichste Zeit des Jahres, in der das warme Licht des Sommers von Tausenden weihnachtlichen Leuchtdekorationen abgelöst wird, die jede Straße und jeden Platz der mittelalterlichen Altstadt schmücken. Doch die frischgebackene Hauptkommissarin Patrizia Vespa hat keinen Blick für diesen Glanz. Eben erst aus dem nördlichen Meran an die Amalfiküste versetzt, droht schon ihr erster Fall, der mysteriöse Tod eines hochrangigen Polizisten, ungeklärt zu den Akten zu wandern. Als dann auch noch ein kunstvoll an einem Palazzo drapierter menschlicher Kopf für Aufsehen sorgt, ist der vorweihnachtliche Zauber endgültig dahin. Schon bald mehren sich die Anzeichen auf eine Verbindung zwischen den beiden Fällen, und darauf, dass der Täter sein blutiges Werk noch nicht vollendet hat …
Autorin
Iris Claere Mueller, geboren 1971 in Mannheim, zog nach ihrem Studium der Germanistik, Philosophie und Politikwissenschaft an der Universität Heidelberg in die USA. Dort promovierte sie an der renommierten Yale University im Fachbereich Medieval Studies. Seit 2005 lebt sie mit ihrem Lebensgefährten und den beiden Schäferhündinnen Leah und Nüsschen im süditalienischen Salerno. Im nahegelegenen Neapel arbeitet sie an der Internationalen Schule und lehrt mittelalterliche Geschichte an der University of Maryland Europe. Die Mediävistik und die Liebe zu ihrer italienischen Wahlheimat sind es auch, die dem Schreiben von Iris Mueller eine ganz besondere Note verleihen.
IRIS MUELLER
Lichtertod
Ein Fall
für Patrizia Vespa
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Dezember 2016
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: beautiful photos from all over the world/getty images
plainpicture/Rudi Sebastian
Redaktion: Karin Ballauff
An · Herstellung: Str.
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-18945-7V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für meine Mutter,
der ich so viel verdanke.
In memoriam
Lydia Di Leva
1928–2016
1
Dienstag, 1. November 1994
Es war ein herrlicher Tag. Wolkenlos. Einer jener Tage, wie man sie nur hin und wieder nach tagelangem Dauerregen erlebte. Die klare Luft ließ die dunkel gezackte Bergkette der Amalfiküste nach Westen und die leichten Hügel des Cilento nach Osten zum Greifen nahe erscheinen. Das Meer war von einem hellen Türkisblau, das an manchen Stellen von dunkleren Streifen durchzogen wurde. Jetzt am Nachmittag lag die Stadt im goldgelben Licht der Spätherbstsonne, und ihre noch immer warmen Strahlen ließen das schöne Altrosa der neoklassizistischen Fassade des Opernhauses wie von innen heraus leuchten.
Es war derselbe Glanz, der auch auf den Gesichtern der Menschen zu liegen schien, die zu Hunderten über den Lungomare, Salernos Seepromenade, flanierten und von dort aus auf den Largo Luciani und den Theaterbau zuströmten.
Ja, es war ein besonderer Tag. Das historische Opernhaus der Stadt, das Teatro Giuseppe Verdi, würde heute in einer feierlichen Eröffnungszeremonie neu eingeweiht werden. Lange Jahre war das Theater geschlossen gewesen. Das verheerende Erdbeben im Jahr 1980 hatte es verstummen lassen. Erst jetzt, vierzehn Jahre später, waren die Restaurierungsarbeiten abgeschlossen. Heute sollte seine Stimme zum ersten Mal wieder erklingen, und es würde eine fröhliche sein: die Stimme des Rigoletto.
Eine gute Wahl, dachte er. Eine ausgezeichnete Wahl. Mit Giuseppe Verdis Rigoletto war das Theater einst, im Jahre 1872, feierlich eingeweiht worden. Und mit dem Rigoletto würde es heute wiederauferstehen.
Dazu kam, dass die Premiere bewusst mit einem anderen städtischen Großereignis auf denselben Tag gelegt worden war. Denn heute, am 1. November, würden Salernos Straßen zum ersten Mal im Licht der aufwendigen Leuchtdekorationen erstrahlen, die in wochenlanger Arbeit in der gesamten Innenstadt montiert worden waren. Von nun an würde die Stadt neben Turin jedes Jahr zur weihnachtlichen Lichterhauptstadt Italiens und damit zu einem nationalen und internationalen Publikumsmagneten werden.
Eine Stadt feiert sich selbst, dachte er. Eine ganze Stadt ist auf den Beinen. Viele sind auf dem Weg ins Theater, andere werden einfach nur das bunte Treiben in den wirren Gassen der Altstadt genießen, überstrahlt von den filigranen, durch Künstlerhand individuell gefertigten Lichtern.
Wenn wir aus dem Theater kommen, werden auch wir sie sehen, dachte er. Wir werden uns unter die Menge mischen und in dem Lichterglanz spazieren gehen. Dieses Jahr, nächstes Jahr, in all den Jahren, die noch kommen werden. Es wird immer so weitergehen, und es wird immer so schön sein wie heute.
Natürlich, der Preis für die Zusammenlegung all dieser Festlichkeiten war hoch gewesen. Vor allem die Renovierungsarbeiten am Theater hatten sich immer wieder verzögert, und mehr als einmal hatte es so ausgesehen, als müsste die Einweihung verschoben werden. Letzte Arbeiten waren im Akkord erledigt worden, und die Presse erging sich in Schuldzuweisungen für das langsame Vorankommen und die Kostenexplosion. Doch an diesem Nachmittag schien das alles vergessen. Heute würden sich die schön geschnitzten Holzlogen endlich wieder füllen.
Bis zur Aufführung war es noch fast eine Stunde hin, doch die meisten waren früher gekommen, um den neuen Bau in Augenschein zu nehmen und in den umliegenden Lokalen noch einen Snack oder einen Drink zu sich zu nehmen.
Auch sie hatten etwas getrunken, hatten sich vor dem Opernhaus fotografieren lassen. Dann hatten sie ihre Plätze eingenommen. Die Tickets waren nicht gerade Schnäppchen gewesen. Er lächelte, als er daran dachte, wie sie geschluckt hatten, als sie den Preis erfuhren. Aber dafür saßen sie im Parkett in der Mitte des Saales. Und jetzt, da ihre Hände sich berührten, umgeben von dem erwartungsfrohen Rauschen unzähliger sich stimmender Instrumente, wusste er, dass sie sich richtig entschieden hatten. Es hatte sich gelohnt. Jetzt schon.
Mit einem Mal begann das Licht aus den unzähligen Lämpchen zu rinnen wie eine gelbe Flüssigkeit, die langsam, aber stetig aus einem Glas entweicht und nichts als dunkle Leere zurücklässt. Das lachende Wogen Tausender Stimmen verstummte, und die plötzliche Stille ließ ihn den Atem anhalten. Er spürte den Händedruck und hörte das Flüstern.
»Deine Hand ist mein Zuhause.«
Dann setzte die Musik mit mächtigen Klängen ein. Rigoletto. Die Ouvertüre. Der ganze musikalische Rausch einer Oper in diesen ersten Eröffnungstakten.
Er hatte es nicht kommen sehen, hatte nichts geahnt, nichts gehört. Was war es gewesen? Er wusste es nicht. Es war aus dem Nichts gekommen. Woher? Ein Aufprall an seiner linken Seite. Ein ohrenbetäubender Schlag, der den Raum vibrieren ließ. Schreie. Schrill, hysterisch.
Plötzlich war das Licht wieder an. Instinktiv war er hochgefahren, wollte sich umsehen, selber schreien, etwas sagen. Aber er tat es nicht. Er fühlte etwas Heißes an seinem Gesicht herunterlaufen. Waren es Tränen? Aber warum sollte er weinen? Er wusste ja nicht einmal, was passiert war. Und er wollte es auch nicht wissen. Es war nichts. Nur ein kleines Intermezzo. Bald würde die Aufführung weitergehen. Bald würden sie sich wieder setzen, all die schreienden, kreischenden Menschen, die die Ouvertüre unterbrochen und die Musik zum Schweigen gebracht hatten. Diese Männer und Frauen mit ihren verzerrten Gesichtern, die um ihn herum in Bewegung waren, an ihm rissen, ihn wegzuzerren versuchten, Unverständliches schrien. Alle waren außer sich, nur in ihm war Stille. Warum sollte er auch schreien? Wenn er nur ein wenig Zeit verstreichen ließe, weiter ein- und ausatmete – ruhig, ganz ruhig –, dann würde alles wieder gut werden. Die Musik würde aufs Neue einsetzen.
Tosender Beifall. Ja, es würde tosenden Beifall geben.
Er schloss die Augen.
Wie viel Zeit war vergangen? Eine Minute? Eine Stunde? Er öffnete die Augen, als eine Hand sich um seinen Oberarm schloss.
»Komm, ich helfe dir. Du kannst hier nicht bleiben. Und du kannst hier auch nichts mehr tun.«
Er spürte, wie seine Beine sich bewegten. Warum ließ er es geschehen? Einen Schritt vor den anderen. Ganz langsam. Die Stimme redete noch immer. Sie schrie nicht wie die anderen. Sie klang ruhig, beruhigend. Trotzdem konnte er sie nicht verstehen, als hätte er die Worte vergessen. Worte wie ein ruhiger Fluss inmitten des Chaos, aber ohne jede Bedeutung. Einen Schritt vor den anderen. Die Stimme redete weiter.
Doch mit einem Mal riss er sich los und sah sich um. Nein, er konnte nicht einfach so weggehen. Er musste hinsehen, nur ein Mal. Doch da war niemand mehr. Ein Sessel – aber kein Mensch. Nur ein Arm, ein Bein. Blut. Wo waren der Kopf und der Körper? Und was war das, was da lag? Abrupt wandte er sich ab. Er wollte nicht wissen, was es war. Es tat nichts zur Sache.
Plötzlich spürte er die Hand wieder auf seinem Arm. Er drehte sich um und sah in ein Gesicht. Ein Mund. Lippen, die Worte formten. Und plötzlich verstand er: »… tot.«
Das war es, was die Stimme sagte. Er konzentrierte sich auf den Mund, als wäre es die Bewegung, die ihn begreifen ließ.
»… tot, komm, hier kannst du nichts mehr tun.«
Er schloss die Augen, und die Stimme verschwand, als ob es sie nie gegeben hätte. Und dann hörte er sie wieder, die Musik.
Rigoletto. Die Ouvertüre.
2
Montag, 31. Oktober 2011
Patrizia Vespa warf ihr volles Gewicht auf die Bremse und fluchte. Ihr knallroter Fiat Cinquecento mit den dunkel getönten Scheiben, den sie nach ihrer Großmutter Klara benannt hatte, kreischte empört auf, bevor er mit einem Ruck zum Stehen kam. Wo war sie nur mit ihren Gedanken? Ganz offensichtlich nicht beim Verkehr auf Salernos Seepromenade und dem unablässigen Wogen von Pkw, Bussen und Motorini, die pausenlos und ohne jede Vorwarnung die Spur wechselten in der Hoffnung, sich dadurch einen minimalen Vorsprung verschaffen zu können. Vom Blinken schien hier noch nie einer etwas gehört zu haben, geschweige denn vom Gebrauch der Seitenspiegel. Ein Unfall fehlte ihr jetzt gerade noch.
Patrizias Stimmung war ohnehin schon auf dem Tiefpunkt. Und das nicht nur wegen des Wetters. Dass es schon seit Tagen regnete, war natürlich wenig hilfreich. Heute Morgen hatte sie an mehreren Stellen Handtücher auslegen müssen, um das über Nacht unter den Türen eingedrungene Wasser aufzuwischen.
Verdammt! Warum hatte sie auch ein so altes Haus gemietet, obendrein in Ogliara, dem auf den Hügeln über Salerno gelegenen Vorort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagten? Gut, es hatte Charme, keine Frage. Wenn das Wetter schön war und sie tatsächlich einmal zu Hause, liebte sie ihr Haus. Aber in letzter Zeit war das Wetter nicht schön, und zu Hause war sie auch viel zu selten. Und das, obwohl sie in der Questura eigentlich gar nicht viel zu tun hatten. Oder besser gesagt nicht mehr. Sie steckten nämlich fest, auch wenn sie noch nicht bereit war, das zu akzeptieren.
Im Januar hatte Patrizia in Salerno als erste Hauptkommissarin ihren Dienst angetreten. Davor hatte sie in ihrer Heimatstadt Meran gearbeitet. Doch nach dem Tod ihrer Mutter vor zwei Jahren hatte sie sich nach einem Neuanfang gesehnt. Sie hatte sich auf die frei gewordene Stelle in Salerno beworben und den Job bekommen.
Die ersten Monate waren nahezu ereignislos verlaufen, bis man im August die Leiche eines pensionierten Kollegen fand. Dem Mann war die Lunge entnommen worden. Danach hatte man ihn im Meer versenkt, und zwar in unmittelbarer Nähe der Ticketstände an der Molo Manfredi, wo die Touristen tagsüber ihre Fahrscheine nach Positano und Capri lösten.
Ein auffallend zentraler Ort, um eine Leiche loszuwerden, dachte Patrizia. Umso mehr ärgerte es sie, dass die Polizei trotzdem mit leeren Händen dastand. Sie schlug hart mit der flachen Hand aufs Lenkrad. Einen schönen Einstand als Hauptkommissarin hatte sie da hingelegt. Ein toter Exkollege und ein praktisch unlösbarer Fall. Ihre Teamkollegen schienen sich weniger daraus zu machen. Sie hatten ihn innerlich bereits zu den Akten gelegt. Warum fiel es ihr nur so schwer, dasselbe zu tun?
Endlich war die belebte Piazza Amendola in Sicht, und kurz danach kam Patrizia bei der Questura an. Das dreistöckige beige Gebäude mit den hohen, schlanken Arkaden stammte aus der Zeit Mussolinis. Für die einen war es faschistische Architektur, für die anderen ein historischer Bau, der Funktionalität mit klaren, eleganten Linien verband.
Im Augenblick jedoch hatte Patrizia nur Augen für ihren persönlichen Parkplatz vor der Questura, auf dem ein fremder Wagen stand. Nicht schon wieder! Sie verdrehte genervt die Augen. Ein Kollege war das sicher nicht. Eher einer der zahllosen Schlaumeier, die meinten, die Parkgebühren auf den umliegenden, mit blauer Farbe gekennzeichneten Parkplätzen umgehen zu können, indem sie sich einen freien Platz auf dem Polizeiparkplatz unter den Nagel rissen, und das fast jeden Tag. Verbote beachten zählte offensichtlich auch nicht zu den Lokaltugenden. Na warte … Sie zwängte sich neben einen in Eingangsnähe geparkten Polizeiwagen und schlängelte sich aus dem für ihre Größe eigentlich viel zu kleinen Auto. Dabei zerrte sie sich die Kapuze ihrer hellblauen Regenjacke über den Kopf. Der Regen prasselte vom Himmel, als habe er es auf sie persönlich abgesehen. Zum Abschließen blieb keine Zeit. Patrizia versetzte der Autotür von hinten einen Tritt mit dem Fuß, dann rannte sie los.
Auf dem Weg in ihr Büro meldete sie einem Streifenpolizisten den falsch geparkten Wagen. Der Besitzer würde sich wundern, wenn er später vor einem leeren Platz stünde. Aber irgendwo musste man ja mal anfangen, für Ordnung zu sorgen. Vor allem, wenn man sonst so gar nichts auf die Reihe brachte.
Patrizias Büro lag am Ende des Ganges in der zweiten Etage gleich neben dem von Cristina D’Avossa, ihrer quirligen und konstant gut gelaunten Kollegin, die es mit Patrizias Launenhaftigkeit allerdings nicht immer leicht hatte. Sie warf einen Blick auf die Uhr und klopfte an.
»Komm rein, Patrizia!«
»Woher weißt du, dass ich es bin?«
»Weil sonst kein Mensch in diesem Gebäude je anklopft«, antwortete Cristina lachend. »Aber bleib ruhig bei deiner soliden norditalienischen Erziehung. Wer weiß, vielleicht wird’s dir ja hier unten im Süden irgendwann mal zu bunt, und dann wäre es doch schade, wenn du als Barbarin ins zivilisierte Meran zurückkehren und noch mal bei null anfangen müsstest.«
Patrizia schnitt eine Grimasse und ließ sich in den Besuchersessel fallen. Wie immer war es Cristina gelungen, ihren persönlichen Stresspegel innerhalb weniger Sekunden erheblich zu senken.
»Nur noch fünf Minuten bis zur Teamsitzung«, meinte sie. »Hast du nicht was zu essen? Irgendwie bin ich heute Morgen nicht dazu gekommen.«
»Zum Kämmen offenbar auch nicht!« Cristina kramte kichernd in ihrer hoffnungslos überfüllten Schreibtischschublade. Schließlich zog sie eine Schachtel abgepackter Hörnchen und einen Taschenspiegel hervor.
»Bist du bereit?«
Patrizia verzog das Gesicht. »So schlimm?«
»Schlimmer!«
Patrizia griff nach dem Spiegel und seufzte. Ihre kurzen dunkelbraunen Haare waren feucht und zerzaust, und ihr schmales Gesicht mit der hellen Haut der Norditaliener war noch blasser als sonst, wodurch die fast schwarzen Augen, ihre markanten Züge und die leider etwas zu kräftige Nase noch stärker hervortraten. Cristina nahm ihr den Spiegel ab, reichte ihr einen Kamm und zwinkerte ihr zu.
»Hier, nimm. Damit eventuelle neue Fakten sich nicht zu Tode erschrecken und an der Tür zum Sitzungszimmer wieder Reißaus nehmen.«
»Als wenn es wirklich wahrscheinlich wäre, dass von irgendwoher eine neue Informationsquelle auftaucht, von der wir noch nichts wissen.« Patrizia seufzte.
»Vielleicht hat ja einer aus dem Team einen Geistesblitz.«
»Hast du einen?«
Cristina schüttelte nur den Kopf und vermied es, Patrizia dabei anzusehen. Sie wusste, wie schwer es ihrer Kollegin fiel, die Niederlage zu akzeptieren. Aber sie wusste auch, was alle dachten, auch wenn es bislang noch niemand ausgesprochen hatte: Sollte es nicht plötzlich neue Erkenntnisse geben, würden die Ermittlungen wohl noch heute eingestellt.
*
Kurz danach saßen sie am Sitzungstisch im dritten Stock der Questura. Das gesamte Team war anwesend, darunter Gabriella Molinari aus der Rechtsmedizin und Bob Kingfisher, Kriminaltechniker und Amerikaner, der vor Jahrzehnten nach einem wissenschaftlichen Austausch in Italien hängengeblieben war.
Im Raum herrschte Endzeitstimmung. Auch die Miene Pietro Di Levas, ihres Polizeichefs, verhieß nichts Gutes.
Patrizia hatte ihren Kollegen Davide gebeten, noch einmal die Fakten zusammenzufassen, doch der schien über diese undankbare Aufgabe eher unglücklich zu sein. Umständlich raschelte er mit den Papieren, als könne auf diese Weise eine neue Idee oder übersehene Tatsache aus dem Aktenstapel heraus auf den Tisch fallen.
»Also«, meinte er schließlich und räusperte sich. »Also … Wie wir wissen, wurde der pensionierte Polizist Gigi Spinosa mit Sicherheit von der Molo Manfredi aus ins Meer geworfen.« Er machte eine Pause und blätterte erneut in dem Papierstapel, obwohl er den Inhalt sämtlicher Unterlagen längst auswendig kannte. Doch dann schob er die Akten entschlossen zur Seite.
»Okay, ich mach’s kurz. Für Spinosas Versenkung gab es keine Zeugen. Wir haben keinen genauen Todeszeitpunkt und damit auch kein genaues Datum für den Mord. Spinosas Schwester hat ihren Bruder am 7. November 2010 vermisst gemeldet. Allerdings sprachen sie immer nur einmal die Woche miteinander. Deshalb bleibt unklar, an welchem Tag der Mann tatsächlich verschwunden ist. Der Barbesitzer in seiner Straße, bei dem er häufig einen Espresso getrunken hat, meinte, ihn eine ganze Woche nicht gesehen zu haben. Beschwören konnte er es allerdings nicht. Und das wär’s dann auch schon von meiner Seite.«
Er sah in die Runde und zuckte mit den Schultern.
Einen Augenblick lang herrschte Stille.
Dann meldete Bob Kingfisher sich zu Wort. »Sorry, aber von meiner Seite her gibt es leider auch nichts Neues zu berichten. Verwertbare Spuren an der Molo Manfredi hat es Monate nach der Tat natürlich nicht mehr gegeben. An der Leiche selbst konnten wir nach so langer Zeit im Wasser ebenfalls keine Spuren mehr sicherstellen. Und von Gabriella dürft ihr euch, soweit ich weiß, auch nicht viel mehr versprechen.« Er nickte der Rechtsmedizinerin auffordernd zu.
»Ja, so ist es leider«, nahm diese den Faden auf. »Wie ihr ja wisst, war die Leiche in teilskelettiertem Zustand. Das übrig gebliebene Gewebe war stark verwest und von Meerestieren zerfressen. Beide Hände und ein Fuß fehlen, und auch vom Gesicht und den restlichen Körperteilen ist nach dem langen Scheuern auf dem Meeresgrund nicht mehr viel übrig geblieben. Tja, also, die eigentliche Todesursache zu ermitteln ist unter diesen Umständen einfach unmöglich.«
»Und die Lunge? Dem Toten wurde doch die Lunge entnommen. Habt ihr dazu noch irgendetwas herausgefunden?«, wollte Patrizia wissen.
Gabriella schüttelte den Kopf. »Entnahme der Lunge höchstwahrscheinlich nach Eintritt des Todes. Die Öffnung in der Brust ist zwar grob, aber nicht ohne Geschick wieder geschlossen worden. So viel konnte man gerade noch erkennen. Nun ja, und anschließend hat der Täter sein Opfer dann eben versenkt.«
»Ein regelrechter Dreifachmord an ein und demselben Opfer«, meinte Cristina kopfschüttelnd. »Erst bringt er den Mann um, dann entnimmt er ihm die Lunge, und dann versenkt er ihn zu guter Letzt auch noch im Meer. Wirklich bizarr!«
Davide grinste. »Es heißt doch eigentlich, dass das Adjektiv tot grammatikalisch nicht zu steigern sei. Aber vielleicht sollte man das angesichts dieses Falls ändern, was meint ihr? Der Mann war eindeutig tot, toter, am totesten …« Die meisten in der Runde grinsten jetzt auch.
Davide Favetta war der Spaßvogel unter ihnen, und Sprachwitz war sein Steckenpferd. Er hatte schon einige Zeit vor Patrizia in Salerno angefangen. Davide war 42 Jahre alt, Single, und lebte noch bei seiner Mutter in Cava dei Tirreni, einem hübschen Städtchen nicht weit von Salerno. Die leckeren Lunchpakete, die seine Mutter ihm jeden Tag mit viel Liebe zum Detail schnürte, waren in der Abteilung legendär.
»Kein Mörder macht sich diese Mühe, wenn all das, was über den simplen Tötungsakt hinausgeht, nicht irgendeine Bedeutung für ihn hat, symbolisch oder anderweitig.«
Patrizia war eine der wenigen, die Davides Witz kaltgelassen hatte. Sie wusste, wie trotzig ihre Stimme klang, aber auch, wie vage ihr Einwand war. Wie oft hatte sie in den letzten Monaten auf diesem Punkt beharrt, versucht, an dieser Stelle anzusetzen – alles ohne Erfolg.
»Klar, Patrizia, natürlich hast du recht«, warf Cristina ein. »Aber leider zaubert das noch keinen Verdächtigen herbei, geschweige denn ein Motiv.« Sie zuckte mit den Schultern. »Spinosas persönliches Umfeld haben wir schließlich durchleuchtet. Er war unverheiratet. Keine besonderen Hobbys, keine Feinde. Kurz und gut, es fehlt uns jegliches Motiv, zumindest für einen solchen Mord, eine solch dramatische Inszenierung.«
»Aber das ist es doch gerade …«
In diesem Augenblick dröhnte Pietro Di Levas Bariton vom anderen Ende des Sitzungstisches herüber.
»Soweit ich mich erinnere, wollten unsere beiden Neuzugänge noch die Fälle durchgehen, an denen Spinosa in den zehn Jahren vor seiner Pensionierung gearbeitet hat.«
Er wandte sich fragend an die jungen Kriminalassistentinnen Lydia und Antonia, die erst vor wenigen Monaten direkt aus der Polizeischule nach Salerno gekommen waren.
Die beiden wechselten einen raschen Blick.
»Ja und, meine Damen? Ist dabei etwas herausgekommen?«
»Wir sind noch nicht ganz durch«, sagte Lydia fast schuldbewusst. »Zehn Jahre sind eine lange Zeit. Uns fehlen aber nur noch die letzten paar Monate.«
»Schaffen Sie den Rest heute noch?«, fragte Di Leva.
Patrizia bemühte sich um einen Blickkontakt mit den Assistentinnen und schüttelte dabei möglichst unauffällig den Kopf. Sie mussten Zeit gewinnen, und wenn es nur zwei oder drei zusätzliche Tage waren. Doch Antonia hatte Di Levas Frage schon bejaht.
»Benissimo!«
Pietro Di Leva klopfte erfreut mit der Hand auf den Tisch. »Dann nehmen Sie sich alle noch den heutigen Tag und schreiben Sie Ihre Berichte. Heute Abend 18 Uhr treffen wir uns hier wieder. Wenn sich bis dahin nichts Neues ergeben hat, werden wir ab morgen alle wieder anderen Beschäftigungen nachgehen. Es ist ja nicht so, dass in der Zwischenzeit gar nichts anderes passiert wäre. Natürlich, wenn es irgendwann doch noch einmal neue Erkenntnisse geben sollte …« Er machte eine einladende Geste, als wolle er den so gut wie zu den Akten gelegten Fall erneut hereinbitten.
Patrizia lehnte sich resigniert zurück. Jetzt konnte sie nur noch auf ein Wunder hoffen, ansonsten …
Andererseits war es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sie mal wieder ein paar ruhige Abende zu Hause verbringen und am Wochenende ausgedehnte Spaziergänge in den Bergen machen konnte.
Stühle ratschten über den bereits mit zahllosen schwarzen Schleifspuren übersäten Linoleumboden.
Die Sitzung war beendet.
*
Ugo Meriani hatte seinen Spritz ausgetrunken und bezahlt. Meistens trank er Bier, aber heute war ihm nach diesem Modegetränk gewesen, das in letzter Zeit fast alle zu bestellen schienen. Draußen wurde es langsam dunkel. Dass es ohnehin ein verhangener Tag gewesen war, machte die Sache nicht besser. Er verließ das Gran Café Canasta und schlug den Weg nach Hause ein.
Vor einigen Jahren hatten er und seine Frau eine große Wohnung im alten Zentrum gekauft, das früher der verruchteste Teil der insgesamt eher verfallenen Stadt gewesen war. Hafennähe, marode Bausubstanz, übelste Spelunken, Ratten und Prostitution. Salernos heute so pittoreske Altstadt hatte als hoffnungsloser Fall gegolten – damals, in Ugo Merianis Jugend.
Doch es hatte sich viel verändert in den letzten Jahrzehnten. Die heruntergekommenen Häuser der Altstadt waren von Grund auf saniert worden. Historische Zeitzeugen wie Aquäduktbögen, Galerien oder antike Säulen, die häufig als Eckpfeiler in den mittelalterlichen Häusern steckten, hatte man wieder sichtbar gemacht. In den Wohnungen und Geschäften waren die mittelalterlichen Elemente – raues Mauerwerk oder schwere, alte Holzdecken – freigelegt und geschmackvoll in das moderne Ambiente integriert worden.
Heute war die Altstadt von Salerno ein architektonisches Juwel und mit seinen vielen kleinen Gassen und Plätzen, den Bars, Restaurants und Geschäften einer der beliebtesten Treffpunkte der Stadt. Natürlich waren die Wohnungspreise nach den Restaurierungsarbeiten für fast alle früheren Bewohner unerschwinglich geworden, und eine neue Klientel hatte das Zentrum für sich erobert.
Er, Ugo Meriani, war einer von ihnen. Und das war nur rechtens, denn als einer der führenden Ingenieure der Region hatte er über all die Jahre hinweg maßgeblich an den Innenstadtprojekten mitgewirkt. Diese Wohnung war sein Siegespreis, seine Trophäe.
Ugo Meriani senkte den Kopf, als ihm ein fieser, nasser Wind direkt ins Gesicht blies. Er beschloss, die breite Via Roma, durch die die Böen wie durch einen Windkanal getrieben wurden, zu verlassen und bei nächster Gelegenheit in eine der kleinen Seitengassen auszuweichen.
Minuten später stand er vor seinem Haus in der Via Portacatena und hielt inne. Obwohl er nun schon lange hier lebte, konnte er sich doch nie sattsehen an dem kräftigen Apricot der Fassade, von dem sich die weißen Fensterumrahmungen mit ihren barocken Spielereien in der Nacht fast gespenstisch abhoben. Heute Abend leuchteten sie nur im Schein der Straßenlaternen.
Doch morgen war der 1. November, der Tag, an dem in der Stadt »die Lichter angingen«, wie die Salernitaner das nannten. Morgen würden sich die Häuserfassaden mit der bunten Farbenpracht der weihnachtlichen Leuchtdekorationen zu einem Gesamtkunstwerk vereinen.
Ugo Meriani sah sich um. In seiner Straße waren gelbe und orange Blumengewinde installiert worden, die sich in regelmäßigen Abständen wie zierliche Brücken über die Gasse spannten. Sogar einen fliegenden Teppich gab es in diesem Jahr. Noch waren seine Farben fahl, doch man konnte schon erahnen, dass er sich innerhalb weniger Stunden in ein Farbkunstwerk aus Tausendundeiner Nacht verwandeln würde.
Morgen also, dachte er. Ugo Meriani freute sich auf die kommenden Wochen. Es war jedes Jahr etwas Besonderes, vor dem Schlafengehen noch einmal ins dunkle Wohnzimmer zu treten und das farbenfrohe Lichterspiel auf dem schwarz glänzenden Parkett zu bewundern.
Gut gelaunt trat er ins Haus ein und drückte auf den Fahrstuhlknopf. Oben angekommen, schloss er die Tür zu seiner Dachgeschosswohnung auf und stutzte. Die Wohnung war still und finster. Wo war seine Frau? Doch dann fiel ihm ein, dass seine Tochter mit ihrem Mann verreist war. Und wie immer war seine Frau nur allzu gerne als Babysitter für ihre Enkelkinder eingesprungen. Er würde sie also erst übermorgen wiedersehen.
Er sah auf die Uhr. Es war erst kurz nach sechs. Was tun mit dem angefangenen Abend? Hunger hatte er auch.
Leicht gereizt öffnete Ugo Meriani den Kühlschrank, und seine Stimmung besserte sich schlagartig. Seine Frau hatte vorgesorgt und das Abendessen bereits auf einem Teller angerichtet: im Ofen gebackener Stockfisch mit Petersilienkartoffeln. Er wärmte ihn sich in der Mikrowelle, stellte ihn auf ein Tablett und ging Richtung Wohnzimmer. Wenn seine Frau zu Hause war, war Fernsehen beim Essen tabu, und er musste sich eingestehen, dass er den beiden freien Abenden als Strohwitwer mit Vergnügen entgegensah. Später würde es sogar einen Film geben, den er vor einem Jahr im Kino verpasst hatte. Seine Laune wurde immer besser.
Im Flur jedoch stutzte er erneut. Auf der Ablage stand ein Strauß aus hohem, weiß-violett blühendem Akanthus, den er beim Betreten der Wohnung übersehen haben musste. Seltsam. Ob seine Frau in seiner Abwesenheit Besuch gehabt hatte?
Ugo Meriani beugte sich vor, um die zierlichen Blüten näher zu betrachten, und verzog angewidert das Gesicht. Fast alle Stängel waren schwarz vor Läusen. Einfach ekelhaft. Was einem heutzutage alles von den Floristen verkauft wurde! Verärgert stellte er das Tablett ab und trug die Vase in die Küche. Wenigstens über Nacht waren die Blumen auf dem kleinen Küchenbalkon besser aufgehoben. Morgen würde er weitersehen.
*
Es war schon sieben, als Patrizia nach der Sitzung aus ihrem Büro in den Flur trat, um die Questura zu verlassen.
Natürlich war es gekommen, wie es kommen musste. Da auch die letzten Recherchen der beiden Kriminalassistentinnen nichts Neues geliefert hatten, war die Soko zum Fall Spinosa aufgelöst worden.
Patrizia lief den langen verwaisten Flur hinunter. Es war still im Gebäude, alle anderen schienen bereits gegangen zu sein. Doch als sie an Di Levas Bürotür vorbeikam, öffnete sich diese, und die große kräftige Gestalt ihres Chefs erschien im gelben Rechteck des Türrahmens. Er winkte Patrizia herein, ließ sich in seinem Schreibtischsessel nieder und bedeutete ihr, sich ebenfalls zu setzen.
Einen Augenblick lang herrschte Schweigen, aber das waren sie hier in der Questura gewohnt. Der Chef war dafür bekannt, dass er oft lange Zeit gar nichts sagte, nur um dann umso energischer loszupoltern. Jetzt wirkten seine sonst so humorvoll blitzenden dunklen Augen allerdings eher nachdenklich, und er strich sich bedächtig mit der Hand über die Enden seines braunen Schnurrbarts.
»Mia cara Commissaria!«
Er räusperte sich, und Patrizia hatte den Eindruck, dass er nach den richtigen Worten suchte.
»Bene, bene«, sagte er schließlich. »Ich wollte nur sicherstellen, dass es Ihnen hier bei uns in Salerno auch gut geht.« Er sah sie prüfend an.
Patrizia versuchte ein Lächeln. Stand ihr die Enttäuschung so deutlich ins Gesicht geschrieben? Sie war erstaunt. Sie hatte mit so ziemlich allem gerechnet, nur nicht mit einer Frage nach ihrem Wohlbefinden. Sie zuckte mit den Schultern.
»So gut es in solch einer Situation eben gehen kann«, war alles, was sie als Antwort herausbrachte.
Di Leva lehnte sich in seinem Stuhl zurück und nickte. Er hatte offenbar nichts anderes erwartet.
»Sie sind ehrgeizig«, sagte er. »Das ist gut. Aber was wäre der schönste Erfolg ohne eine gelegentliche Niederlage? Glauben Sie bloß nicht, ich hätte früher zu meiner Zeit als Ermittler keine Schlappen einstecken müssen! Pazienza, Geduld. Das ist alles, wozu ich Ihnen raten kann. Ich weiß, dass das für ungeduldige Norditaliener«, er zwinkerte schelmisch mit den Augen, »eine Herausforderung ist. Trotzdem. Nehmen Sie es einfach nicht zu persönlich.«
Dabei zeigte er auf die hellblaue Flagge des S. S. C. Napoli, die hinter ihm an der Wand neben dem gerahmten Bild von Präsident Giorgio Napolitano hing.
Patrizia wollte sich noch erkundigen, was ihr Fall mit Fußball zu tun hatte, aber da war das Gespräch auch schon beendet.
Di Leva erhob sich zu voller Größe, und Patrizia fragte sich einmal mehr, warum Di Levas Frau einem solchen Hünen von Mann ausgerechnet den Spitznamen Mimmo gegeben hatte.
Sie nickten einander kurz zu, dann fiel die Tür hinter Patrizia ins Schloss.
Kurze Zeit später streifte Patrizia ziellos durch die Gassen der Altstadt. Cristinas Einladung zum Abendessen hatte sie ausgeschlagen. Heute Abend wollte sie allein sein und sich wie ein Häufchen Elend fühlen. Daran hatten auch Di Levas gut gemeinte Worte nichts geändert. Was hatte er gesagt? Sie sollte es nicht »zu persönlich nehmen«?
Sie blieb unvermittelt stehen. Nahm sie es denn persönlich? Sah man ihr den Ehrgeiz so sehr an? Und was wollte sie eigentlich? Schnell eine neue Leiche? Musste erst wieder jemand sterben, damit sie sich beweisen und ihr angeknackstes Ego aufpolieren konnte?
Sie dachte wieder an Cristina. Ihre Kokommissarin nahm die Sache gelassener, das war offensichtlich. Sie hatte zwei kleine Töchter und abends folglich Besseres zu tun, als zu den Akten gelegte Fälle »persönlich zu nehmen«. Natürlich hatte Cristina Patrizias Ausrede, sich mal wieder ums Haus kümmern zu müssen, durchschaut. Überhaupt schien Cristina sie manchmal besser zu kennen, als ihr lieb war. In ihrem Blick hatte ein stiller Vorwurf gelegen, aber auch Sorge.
Und wenn Patrizia ehrlich war, musste sie zugeben, dass die Entscheidung, den Abend allein zu verbringen, eigentlich falsch gewesen war. Na wunderbar, dann habe ich ja jetzt noch einen Grund mehr, mich schlecht zu fühlen, dachte sie mit einem Anflug von Selbstironie, während eine feuchte Windböe sie frösteln ließ.
*
Er musste wohl eine ganze Weile auf dem Sofa geschlafen haben, doch irgendetwas hatte Ugo Meriani geweckt. Im Fernsehen liefen die Spätnachrichten. Er schenkte ihnen keine Beachtung, sondern sah auf die Uhr: kurz vor Mitternacht.
Er setzte sich aufrecht hin.
Was war das für ein Geräusch gewesen, das ihn geweckt hatte? Etwas im Fernsehen? Oder das Telefon? Er schaltete den Fernseher aus und horchte in die Stille. Nichts. Erneut überkam ihn die Müdigkeit, und er beschloss, ins Bett zu gehen. Zu dumm, dass er den Film nun schon zum zweiten Mal verpasst hatte. Etwas schwerfällig erhob er sich vom Sofa. Der leere Teller stand noch auf dem Kaffeetischchen. Er sollte ihn in die Küche bringen, damit er nicht aus Versehen bis übermorgen im Wohnzimmer blieb und seiner Frau Grund gab, sich über seine Pascha-Allüren aufzuregen.
Seufzend nahm er das Tablett und setzte sich in Bewegung.
Das Erste, was ihm beim Betreten der Küche auffiel, war die Vase mit dem Akanthusstrauß neben der Spüle. Aber … das konnte doch nicht sein! Hatte er sich etwa nur eingebildet, die verlauste Schönheit auf den Balkon gestellt zu haben?
Unwirsch ging Meriani einen Schritt auf die Spüle zu, als er es wieder hörte. Das Geräusch. Dasselbe, das ihn geweckt hatte. Es war nicht laut und auch nicht schnell, aber rhythmisch. So als würde man eine halbvolle Flasche schütteln.
Swusch.
Swusch.
Swusch.
Jetzt war es hinter ihm. Ganz nah. Er wusste, dass er sich längst hätte umdrehen müssen. Stattdessen stand er reglos da, wie gebannt, den Blick starr auf den Blumenstrauß gerichtet. Ein eigentümlicher Schauer überkam ihn, wie ein Frösteln. Seine Kopfhaut prickelte. Für den Bruchteil einer Sekunde kam ihm der absurde Gedanke, dass er seinen Körper lange nicht mehr so intensiv gespürt hatte.
Dann drehte er sich langsam um.
*
Es war schon nach elf, und Patrizia wusste, dass sie am nächsten Morgen alles andere als fit sein würde, wenn sie nicht endlich nach Hause ging. Trotzdem blieb sie noch sitzen.
Zuvor war sie noch eine ganze Weile ziellos durch die Innenstadt gelaufen und hatte sich gewundert, wie viele Menschen an einem gewöhnlichen Wochentag abends unterwegs waren. Sie hatte in die fröhlichen Gesichter der Passanten geblickt, die fast alle in kleinen Gruppen unterwegs waren, und mit einem Mal hatte sie sich sehr einsam gefühlt.
Was machten die anderen aus ihrem Team wohl jetzt gerade? Was dachten sie über sie? Wurde sie persönlich für das Versagen verantwortlich gemacht? Nein. Natürlich wusste sie, dass das Unsinn war. Niemand machte sie für irgendetwas verantwortlich, nicht einmal Pietro Di Leva, ihr Vorgesetzter.
Um sich abzulenken, hatte sie sich auf die Auslagen der Geschäfte konzentriert und die bereits montierten, aber noch dunklen Lichterdekorationen betrachtet. Als die Läden schlossen und es auf der Straße ruhiger wurde, war sie in ein Lokal im Vicolo Giudaica geflüchtet, das ihr wegen seines ungewöhnlichen Namens schon öfter aufgefallen war: Dedicato a Mio Padre, meinem Vater gewidmet. Der Wirt hatte seinem Vater ganz offenbar einiges zu verdanken. Patrizia fand, dass der Name des Lokals zu einem Abend wie diesem auf zynische Weise passte, denn zu ihrem eigenen Vater hatte sie schon seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr.
Der Innenraum des Restaurants war klein und rustikal, mit nur wenigen quadratischen Tischchen und weißen Tischdecken. Auf einem breiten, den gesamten Raum überspannenden Brett standen dicht an dicht mehrere hundert Weinflaschen.
Das geräuschvolle Treiben in dem Lokal hatte Patrizias Stimmung anfänglich etwas gehoben. Sie hatte gegrillten Thunfisch und eine Flasche weißen Hauswein bestellt. Der Fisch stellte sich als hervorragend heraus, und der Wein tat ihr gut, auch wenn sie mit Unbehagen daran dachte, dass sie anschließend noch mit dem Auto nach Hause fahren musste.
Nach dem zweiten Glas allerdings war sie wieder schwermütig geworden. Wenn sie ehrlich war, vermisste sie Meran und die Südtiroler Berge. Dort kannte man sie als Mensch, nicht nur als Kollegin oder Chefin oder Kundin in irgendeinem Geschäft. Und all das hatte sie zurückgelassen.
Patrizia setzte ihr Glas ab. Was für ein sentimentales Gejammer! Sie musste einfach nur ins Bett. Letztlich war es doch nur ihrem allgemeinen Frust und der Müdigkeit zuzuschreiben, dass all diese düsteren Gedanken mit einem Mal von ihr Besitz ergriffen. Die Flasche war noch mehr als halb voll, aber das war wahrscheinlich auch besser so. Sie winkte dem kleinen, glatzköpfigen und recht beleibten Besitzer des Lokals und zahlte. Doch als sie eben aufstehen wollte, kam ihr spontan noch ein Gedanke.
»Oh, scusi, Signore, nur eine Frage. Fällt Ihnen zum Stichwort Pech und S. S. C. Napoli etwas ein?«
Sie wusste nicht, was sie eigentlich erwartet hatte, aber sicher nicht das strahlende Gesicht des Restaurantbesitzers.
»Naturalmente! Haben Sie das Spiel nicht gesehen? Vorgestern Abend gegen Juventus? Wir haben verloren. Santa Madonna! Zum ersten Mal nach fünf Siegen in Serie. Eine rote Karte. Völlig ungerechtfertigt natürlich, per l’amor di Dio! Und danach … Ach, Sie wissen ja, wie das geht. Ein Spieler weniger, und das war’s dann. Pech eben.«
Patrizia nickte. Ja, Pech eben, nicht zu persönlich nehmen. Zu ihrer Überraschung fühlte sie sich auf einmal wieder besser. Sie bedankte sich, verließ das Lokal und hastete durch den Regen zu ihrer roten Klara auf dem Parkplatz vor der Questura.
Eine halbe Stunde später betrat sie ihre dunkle Wohnung im abgelegenen Stadtteil Ogliara, zog sich die feuchten Kleider aus und ging ins Bett.
*
Sein Bewusstsein war ganz plötzlich zurückgekehrt, und seitdem war keine Minute vergangen, in der er diesen Augenblick nicht verflucht und sich nicht gewünscht hatte, wieder einzutauchen in das erlösende schwarze Nichts. Er wusste nicht, wie lange er bewusstlos gewesen war, und selbst an die Stunden davor konnte er sich nur vage erinnern. Hatte er nicht einen ruhigen Abend zu Hause verbracht? Wann war das gewesen? Und wie war er hierhergekommen? Wo war er überhaupt?
Die Schmerzen erschwerten nicht nur die Erinnerung, sie verschleierten auch seine Wahrnehmung. Er war in einem fensterlosen kahlen Raum zu sich gekommen, der wie ein Keller oder Rohbau wirkte. Gleißendes Licht, kalter Betonboden, Betonwände, ein roter Stuhl. Ja, es war tatsächlich ein roter Stuhl! Er wusste selbst nicht, warum ihm das absurd vorkam. Und doch schien sich das ganze irrwitzige Ausmaß seiner Lage in dem roten Lack des Stuhls zu spiegeln.
Er selbst lag auf dem Boden. In seinem Mund befand sich ein zusammengeballter Stofffetzen, der so groß war, dass sein Kiefer sich von der ungewohnten Anstrengung in einer Art permanentem Krampfzustand befand. Er war nackt und von den Füßen bis zum Hals mit einem dicken, rauen Seil umwickelt. Oder vielleicht mit mehreren. Es war nicht einfach nur eine Fessel, es war ein Folterinstrument. Das Seil war so fest um seinen Körper gezurrt, dass das Blut nicht mehr richtig zirkulierte. Jeder Versuch, sich zu bewegen und dadurch dem Körper Raum zu verschaffen, war sinnlos und erhöhte nur den Druck und die Schmerzen, die wie ein greifbares Etwas waren, Farben und Formen hatten. Eine messbare Quantität. Seine Schenkel fühlten sich heiß und nass an. Es stank nach Blut und Urin. Anfangs hatte es ihn noch beunruhigt, dass er seine Arme nicht mehr spürte. Doch mittlerweile empfand er nur noch Erleichterung. Dafür nahm der unerträgliche Druck in seinem Schädel ständig zu. Er blinzelte, versuchte den Schweiß abzuwehren, der ihm in den Augen brannte. In seinem weit aufgerissenen Mund spürte er die Zunge unter dem Stofffetzen wie einen trockenen Klumpen, leblos, wie etwas, das schon nicht mehr zu ihm gehörte. Dazu kam, dass ein Zipfel des Lappens in den Kehlbereich hinabhing. Jede noch so kleine Bewegung mit dem Kopf ließ den Fetzen über das Innere seiner Kehle streichen. Dann kam der Brechreiz. Immer wieder kämpfte er gegen die Übelkeit an. Sich nicht erbrechen. Sich nur nicht erbrechen.
Der Schmerz kam in Wellen, und er stöhnte auf. Wo war die Person, die ihn hierher gebracht hatte? War es ein Mann oder eine Frau gewesen? Warum konnte er sich nicht einmal mehr daran erinnern? Er wusste nur noch, dass er auf dem roten Stuhl gesessen hatte und sich diesen ganzen Unsinn hatte anhören müssen. Dieses Gefasel von seiner Schuld. Welche Schuld? Es gab keine Schuld! Was damals geschehen war, war … Nein, es war gar nichts. Er hatte die richtige Entscheidung getroffen. Nichts von alldem war seine Schuld gewesen. Und letztlich hatte er das Recht ja auch auf seiner Seite gehabt. Es war einfach absurd. Nichts als Hirngespinste. Vor allem, dass er sterben sollte, um irgendeine Krankheit zu heilen, irgendein Gleichgewicht wiederherzustellen. Das Gebrabbel einer kranken Psyche. Wie war das noch? Er konzentrierte sich, um sich an die Worte zu erinnern, die wieder und wieder gefallen waren. Genau. Sein Tod sollte richtig und notwendig sein.
Er versuchte nicht einmal sich vorzustellen, was damit gemeint war, und wollte verächtlich schnauben, doch der Stoffball ließ nur ein dumpfes Krächzen zu. Dann raubte ihm der Schmerz erneut die Sinne.
Als er wieder klarer wurde, kam Wut in ihm auf. Wie konnte es sein, dass er noch hier war? Vermisste seine Frau ihn denn gar nicht? War sie so sehr mit den Enkelkindern beschäftigt, dass es ihr egal war, wenn er nicht ans Telefon ging? Hatte sie sich überhaupt die Zeit genommen, ihn anzurufen? Oder kam die Polizei wieder mal nicht in die Gänge? Musste man denen erst die Adresse vorbeibringen, damit sie hier auftauchten und ihn rausholten? Verdammt, so schwer konnte das doch nicht sein! War er nicht aus seiner eigenen Wohnung entführt worden? Wie konnte es sein, dass sie noch immer nicht hier waren?
Erst jetzt, mit einem Schlag, traf ihn der Gedanke, den er bisher nicht einmal angedacht hatte: Was, wenn sie nicht mehr rechtzeitig kamen? Er konnte doch unmöglich sterben. Auf diese Weise. Jetzt und hier.
Die Panik kam mit unerwarteter Heftigkeit und mit ihr eine neue Welle des Schmerzes. Er fühlte Tränen über sein Gesicht laufen. Sie vermischten sich mit dem Schweiß, liefen in seinen weit geöffneten Mund. Er erinnerte sich nicht, wann er das letzte Mal geweint hatte. Er musste noch ein Kind gewesen sein. Aber jetzt weinte er. O Dio, es musste doch noch eine Rettung geben!
Vorher auf dem roten Stuhl war er zu benommen gewesen, um selber zu sprechen. Aber jetzt wusste er, was er sagen wollte. Er musste einfach eine zweite Chance bekommen. Er wollte sich erklären, wollte alles sagen. Vor allem, warum ihn keine Schuld traf. Die anderen vielleicht. Aber nicht ihn. Er war unschuldig.
UNSCHULDIG!
Er schrie das Wort in seinem Kopf – zweimal, dreimal. Dann rief er sich zur Besinnung. Ruhig bleiben. Er musste ruhig bleiben. Nein, sein Tod war nicht richtig und auch nicht notwendig. Er würde die Krankheit nicht heilen. Das Gleichgewicht konnte nicht wiederhergestellt werden. Nicht dieses, und nicht so.
In dem Moment wurde ihm klar, dass das alles keine Rolle spielte. Er würde sterben. Einfach so. Es musste keinen Sinn ergeben.
*
Ich habe keine Eile. Trotzdem drängt die Zeit.
Die Nacht ist kurz, zu kurz vielleicht. Aber ich weiß, dass er mich verstanden hat. Er weiß jetzt, warum es sein muss. Noch ein paar Stunden, dann wird alles endgültig sein. Zeit, die verfliegt, für mich, aber nicht für ihn. Noch ein paar lange Stunden, die er braucht, um den Weg zu Ende zu gehen. Wie kam mir die Idee mit dem Seil, damals vor zwei Jahren? Ich weiß es nicht mehr. Aber es ist ein wunderbares Instrument. So einfach und doch so effektiv. Es ist ein wichtiger Schritt, für den man sich Zeit lassen muss. Das Gehirn arbeitet anders unter körperlichen Schmerzen. Das Bewusstsein erhöht sich, die Empfindungen werden stärker. Alles ist plötzlich so klar. Auch die Einsicht in die eigene Tat, in die Notwendigkeit der Sühne.
Meriani. Ich sehe dich vor mir. Du auf dem roten Stuhl, meine Lippen dicht an deinem Ohr. Ich habe dir alles erklärt, lange und ernsthaft, wie man mit einem Kind spricht, das nicht verstehen will. Anfangs hast du noch durch mich hindurchgesehen, als gäbe es mich gar nicht. Aber ich weiß, dass du mich gehört hast. Ich habe es in deinen Augen gesehen.
Natürlich hast du nicht sofort verstanden. Oder sollte ich sagen: Du wolltest mich nicht verstehen? Meine Worte sind an dir vorbeigeglitten, ohne dich anzusehen, ohne sich an dir zu brechen. Doch am Ende warst du machtlos gegen die Einsicht.
Natürlich. Du hast noch versucht, es vor mir zu verbergen. Aber ich konnte es in deinen Augen lesen, als du anfingst, der Stimme zuzuhören. Wirklich zuzuhören. Als die schemenhaften Gestalten, die Worte waren, anhielten, und du ihre Gesichter erkanntest. Und dann hast du aufgegeben, bist eingetaucht in das Wissen. Das Wissen, dass du sterben wirst.
Und auch warum.
Ich frage mich, warum mir das so wichtig ist. Ihr Verständnis. Ihre Einsicht in die Notwendigkeit der Sühne. Ist es nicht mehr, als sie ihm damals zugestanden haben? Damals gab es keine Notwendigkeit. Nichts gab es. Keine Zeit zu verstehen. Nichts, was man hätte verstehen können. Nur ein sinnloses Auslöschen. Aber ich bin nicht wie sie. Es ist mir wichtig, dass sie wissen, was sie getan haben. Auch wenn es schon so lange her ist. So lange, dass manchmal alles unscharf wird. Dann muss ich mich konzentrieren auf das, was ich noch weiß: die Schuld. Ihre Schuld, die nie gesühnt wurde. Und dass es an der Zeit ist, sie zu tilgen. Deshalb müssen sie leiden. Leiden und sterben. Es ist der einzige Weg. Vielleicht werden wir dadurch frei. Wir alle, die Opfer und die Täter. Auch ich. Die Krankheit, an der wir leiden, wird geheilt, der Makel ausgelöscht. Das Gleichgewicht wird wiederhergestellt.
Der Regen, der unaufhörlich gegen das Fenster schlägt. Er spricht zu mir, begleitet mich durch diese Nacht wie ein Freund. Meine Kleider sind nass. Ich kann es sehen, aber ich spüre es nicht. Wie sagt man doch gleich? Der Himmel weint. Ist das nicht treffend? Aber es sind Freudentränen. Und diesmal sollen alle daran teilhaben. Alle sollen wissen, dass der Augenblick gekommen ist, in dem Schuld zu Unschuld wird. Vielleicht habe ich zu lange gewartet. Sie hatten viel Zeit. Viel Lebenszeit. Viel zu viel. Aber es ist nicht wichtig. Jetzt nicht mehr. Es ist so weit.
3
Dienstag, 1. November 2011
Als Patrizia am frühen Morgen in der Questura ankam, war sie hundemüde. Entgegen ihrer Gewohnheit holte sie sich einen Kaffee aus dem Automaten. Er schmeckte scheußlich, aber sie brauchte jetzt einfach einen Schuss Koffein pur. Sie fragte sich, warum sie überhaupt so früh gekommen war, jetzt, wo doch nichts Wichtiges mehr anstand.
Auf ihrem Schreibtisch lag schon seit zwei Wochen ein Fall von Körperverletzung. Ein Streit zwischen Hausbewohnern war während einer Eigentümerversammlung aus dem Ruder gelaufen, und aus dem Handgemenge war eine Schlägerei geworden. Patrizia gähnte. Sie beschloss, den Vormittag mit dem Schreiben von Abschlussberichten zu dem eben ad acta gelegten Fall zuzubringen. Am Nachmittag konnte sie dann die Streithähne befragen.
Sie fuhr ihren Computer hoch, als mit einem Ruck die Tür aufgerissen wurde.
Patrizia zuckte zusammen.
»Mensch, Cristina! Kannst du nicht …« Doch sie beendete den Satz nicht.
»Scusa, Bella, ich hatte es einfach so eilig, dich zu sehen.«
Patrizias Kokommissarin warf ihr eine Kusshand zu und ließ sich in den Besuchersessel fallen. Doch dann wurde sie ernst und sah ihre Kollegin prüfend an.
»Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ein übernächtigtes Häufchen Elend, aber pflichtbewusst wie immer. Was sind das eigentlich für andere Sachen, denen wir uns jetzt angeblich widmen sollen? Ich bin gar nicht mehr auf dem Laufenden.«
»Der Streit unter Hauseigentümern, du weißt schon.«
»O mio Dio, der hat mir gerade noch gefehlt! Worum ging’s da noch gleich?«
»Um die Kosten für einen neuen Fahrstuhl im Gebäude. Soweit ich mich erinnere, wurde der Auftrag an den Cousin eines Wohnungseigentümers vergeben, ohne Kostenvoranschläge von anderen Firmen einzuholen. Das Übliche.«
»Oje, das kann ja heiter werden. Ich fürchte, wir werden uns noch nach unserem Mordfall zurücksehnen.«
»Na, jetzt übertreib mal nicht.«
»Übertreiben? Du wirst schon sehen! In puncto Hausgemeinschaften bin ich nämlich Spezialistin. Du da oben in deinem abgelegenen Domizil hast ja keine Ahnung, was sich hier unten in den Mehrfamilienhäusern für menschliche Abgründe auftun. Alle Aussagen werden rein parteiisch sein, je nachdem, wer mit wem im Haus befreundet oder verfeindet ist. Hat der Hund von X schon mal an mein Auto gepinkelt? Hat Y mich neulich nicht gegrüßt? Dazu kommen laute Besucher, falsch geparkte Autos und Hundehäufchen auf dem Gemeinschaftsrasen … Du brauchst gar nicht so zu lachen. Das sind alles Vergehen, die das Verhältnis zwischen Hausbewohnern völlig zerrütten können.«
»Hm-hm, kann ja sein. Aber irgendwie werden wir den Hauptverantwortlichen schon finden, und dann wird er wohl mit einer gesalzenen Geldstrafe und einem Eintrag ins Strafregister rechnen müssen.«
Cristina grinste breit. »Ja, zusätzlich zu den anteiligen Kosten für den neuen Fahrstuhl. Was meinst du, sollen wir uns das sofort antun oder …«
»Ich wollte eigentlich erst mal die Abschlussberichte schreiben und dachte, dass du vielleicht schon mal anfangen könntest, weil du dich doch auf dem Gebiet so gut auskennst.« Patrizia lächelte zuckersüß.
»Na toll.« Cristina verdrehte die Augen. »Andererseits sind mir Berichte sogar noch mehr zuwider. Also dann, bis später mal.« Sie erhob sich schwerfällig aus dem Besuchersessel, winkte noch einmal kurz und verließ das Büro.
Es war fast Mittag, als Patrizia den letzten Bericht ausdruckte und in die Mappe legte. Sie hatte Hunger.
Auf dem Weg nach unten schaute sie kurz in Cristinas Büro vorbei, doch die war offenbar noch ausgeflogen. Schade. Ein paar Anekdoten aus dem Leben gestresster Wohnungseigentümer hätten die Mittagspause sicher enorm belebt.
Sie verließ das Gebäude und überquerte die Straße. In den Morgenstunden hatte es zu regnen aufgehört. Allerdings war der Himmel noch immer dunkelgrau, und ein nasskalter Wind fegte übers Meer. In der Bar Umberto suchte sie sich einen freien Platz an der Theke und aß ein Tramezzino.
Schon um halb eins saß sie wieder an ihrem Schreibtisch.
Das Telefon läutete. Luca aus der Anmeldung. Er fragte sie, ob er ihr eine Dame vorbeischicken könne, die unbedingt ihren Ehemann vermisst melden wollte. Die eigentlich dafür zuständigen Kollegen waren noch in der Mittagspause, aber die Frau hatte angeblich nur wenig Zeit, da sie ihre Enkel von der Schule abholen musste.
Patrizia seufzte. Sollte das ab jetzt ihr Los sein? Tollwütige Mieter und abtrünnige Ehemänner?
Kurz darauf saß die Dame auf ihrem Besucherstuhl. Um die 60, schwarz gefärbtes, perfekt gelegtes Haar, gepflegte Erscheinung, adrett gekleidet, aber offensichtlich nervös und aufgebracht. Sie wartete nicht darauf, angesprochen zu werden, sondern legte sofort los, was Patrizia auf eine wohlhabende gebürtige Salernitanerin schließen ließ.
»Buongiorno, Commissaria, mein Name ist Meriani, Barbara Meriani. Mein Mann ist Ugo Meriani, Sie wissen schon, der Ingenieur.«
Patrizia wusste nicht und hob erstaunt die Augenbrauen, ging jedoch nicht weiter darauf ein, sondern fragte stattdessen:
»Man sagte mir, Sie vermissen ihn? Seit wann denn?«
»Oh, das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich aber seit gestern Abend.«
Patrizia unterdrückte einen Seufzer. Ein Ehemann, der erst seit ein paar Stunden vermisst wurde. Wahrscheinlich hatte er eine Geliebte oder war einfach nur mal allein aus dem Haus gegangen, ohne seine Frau um Erlaubnis zu fragen. Aber was hatte sie im Augenblick schon Besseres zu tun? Sie zwang sich, freundlich zu klingen.
»Wann haben Sie Ihren Mann denn zuletzt gesehen?«
»Gestern Morgen. Wissen Sie, meine Tochter ist mit meinem Schwiegersohn für zwei Tage geschäftlich in Mailand, und ich passe in der Zeit auf meine beiden Enkel auf. Gestern Morgen bin ich nach Pontecagnano gefahren, wo meine Tochter lebt. Um zwei Uhr habe ich die beiden von der Schule abgeholt und bin dann über Nacht dort geblieben. Eigentlich hatte ich gar nicht vor, heute Morgen in unsere Wohnung nach Salerno zurückzufahren, aber ich hatte meine Fernsehbrille vergessen, und ohne die, na ja, Sie wissen schon … Ich muss auch gleich wieder zurück. Die Schule ist ja bald aus.«
Patrizia nickte zerstreut.
»Warum glauben Sie, dass Ihr Mann verschwunden ist? Wann haben Sie ihn denn zum letzten Mal gesprochen?«
»Ich habe gestern Abend spät, so gegen elf, bei ihm angerufen. Ugo geht nie vor Mitternacht ins Bett. Ich wollte wissen, ob er sich das Essen aufgewärmt hat.« Sie hielt kurz inne, bevor sie fortfuhr. »Er ging aber nicht ans Telefon. Wahrscheinlich war er wie immer vor dem Fernseher eingeschlafen. Also habe ich mir auch weiter keine Sorgen gemacht. Aber als ich dann heute Morgen nach Hause kam, um die Brille zu holen, ist es mir sofort aufgefallen.«
Sie machte eine Pause und sah Patrizia mit einem vielsagenden Blick an.
»Ja?«
»Ja. Das Bett, das gemachte Bett. Mein Mann kann gar kein Bett machen, jedenfalls nicht richtig. Nicht so, wie es sich gehört. Das Bett war aber gemacht. Und zwar so, wie ich es immer mache. Das heißt, dass er über Nacht gar nicht zu Hause war!«
»Könnte er nicht auf dem Sofa geschlafen haben? Oder bei einem Freund oder Bekannten? Schließlich war er allein.«
»Aber er hat doch zu Hause gegessen. Und er hasst es, nach dem Abendessen noch mal rauszugehen. Wohin auch? Er trifft sich abends eigentlich nie mit jemandem. Und auf dem Sofa schlafen? Nein, das tut er nicht. Dazu ist es viel zu unbequem.«
»Haben Sie denn schon bei seinen Kollegen und Bekannten nachgefragt, ob er sich nicht vielleicht doch bei einem von ihnen aufhält?«
»Im Büro ist er nicht, da habe ich schon angerufen. Aber bei seinen Bekannten? Nein, mio Dio, das ist mir peinlich. Was sollen die von uns denken? Aber er ist bestimmt nicht bei einem Bekannten, da bin ich mir ganz sicher. Außerdem waren da ja noch die Fußabdrücke in der Wohnung.«
»Fußabdrücke?«
»Ja. Irgendwer muss mit klatschnassen Schuhen durch die ganze Wohnung gegangen sein. In allen Zimmern waren diese Schmutzspuren. Dabei haben wir eine Fußmatte vor der Eingangstür. Eine Rücksichtslosigkeit sondergleichen. Aber Ugo war das nicht, der ist da sehr penibel. Er zieht sich immer sofort die Schuhe aus. Mein Mann ist ja Ingenieur, wissen Sie, einer der bekanntesten Ingenieure der Stadt, ach, was sag ich, einer der besten Ingenieure der Region. Er ist außerordentlich präzise. Das gehört zu seinem Beruf. Deshalb ist er auch so auf Sauberkeit bedacht. Er würde niemals einen solchen Schmutz hinterlassen.«
»Sie meinen, er hatte Besuch? Könnte er dann nicht mit diesem Besuch noch einmal weggegangen sein?«
Frau Meriani sah Patrizia beinahe gekränkt an.
»Ugo hat nicht bei jemandem übernachtet, der unsere Wohnung so verdreckt, wenn ich es Ihnen doch sage. Und seine Zahnbürste ist ja auch noch da.«
Patrizia verkniff sich ein Lächeln. Das mit der Zahnbürste hatte Signora Meriani also nachgeprüft. Einen leisen Zweifel hatte sie demnach doch gehegt.
»Haben Sie die Schmutzspuren denn schon weggewischt?«
Die Frage war Patrizia routinemäßig herausgerutscht.
Signora Meriani wirkte betreten, wie auf frischer Tat ertappt.
»Ich wollte ja, aber ich hatte doch keine Zeit. Um zwei kommen die Kinder aus der Schule, und vorher musste ich doch noch hierher.« In ihrer Stimme lag eine Mischung aus Vorwurf und Rechtfertigung.
»Gut, also ich möchte Sie bitten, an Ihrer Wohnung auch weiterhin nichts zu verändern. Lassen Sie alles, wie es ist. Auch die Fußspuren. Sie sind ja jetzt sowieso erst mal wieder in der Wohnung Ihrer Tochter. Und ich möchte Sie bitten, alle Bekannten Ihres Mannes anzurufen. Wirklich alle. Bedenken Sie, dass wir keine Ermittlungen aufnehmen können, bevor wir nicht ausgeschlossen haben, dass sich Ihr Mann einfach nur bei einem Freund oder Kollegen aufhält. In den meisten Fällen gibt es eine ganz plausible Erklärung dafür, warum jemand ausnahmsweise mal nicht zu Hause übernachtet hat oder nicht ans Telefon geht. Ich bin sicher, dass Ihr Mann innerhalb der nächsten Stunden wieder auftaucht. Rufen Sie ihn weiterhin auf dem Handy an. Falls er morgen früh immer noch nicht wieder da ist und auch seine Bekannten und Kollegen nichts von ihm gehört haben, werden wir uns einschalten.«
Signora Meriani schien über das Ergebnis ihres Besuchs eher unglücklich zu sein. Sie erhob sich beinahe trotzig und ging zur Tür. Doch bevor sie sie öffnete, drehte sie sich noch einmal um und zog ein Foto aus ihrer Handtasche.
»Dieses Bild habe ich Ihnen mitgebracht. Das ist mein Ugo. Sie werden schon sehen, dass er verschwunden ist.«
Patrizia nahm das Bild und bedankte sich. Sie musste zugeben, dass Signora Meriani ziemlich hartnäckig war.
Den Nachmittag verbrachten Patrizia und Cristina wie geplant damit, gemeinsam weitere Beteiligte an dem Streit unter Wohnungseigentümern zu befragen. Es war langweilig und ermüdend, aber wenigstens konnten sie heute mal früher Feierabend machen.
Kurz bevor Patrizia die Questura verließ, erhielt sie einen Anruf von Signora Meriani, die ihr versicherte, alle Bekannten und Kollegen ihres Mannes angerufen zu haben. Ohne Erfolg, wie sie mit Genugtuung verkündete. Im Büro war er den ganzen Tag nicht gewesen, und auch auf dem Handy hatte sie ihn nicht erreicht. Seit dem Nachmittag war es dann ausgeschaltet gewesen. Vielleicht war auch der Akku leer. Ugo selbst hatte sich nicht bei ihr gemeldet.
Obwohl Patrizia die Statistiken kannte, die dafür sprachen, dass die Sache Meriani letztlich gut ausgehen würde, wurde sie eine gewisse innere Unruhe nicht los. Nicht einmal, als sie auf dem Weg nach Hause an ihrer Lieblingspizzeria anhielt und sich eine Pizza Diavola mit scharfer Salami und Zwiebeln kaufte. Hätte sie sich der Sache gleich widmen sollen? Aber dafür hatte es am Mittag keinen Anlass gegeben. Sie kannte die Prozedur. Ach was, es würde schon nichts sein. Sie musste jetzt wirklich mal abschalten, anstatt immer und überall nur Gespenster zu sehen.
Zu Hause setzte sie sich vor den Fernseher und aß ihre Pizza.
Wenn Ugo Meriani bis morgen nicht wieder auftauchte, würden sie nach ihm suchen lassen.
Es war noch nicht einmal zehn, als sie ins Bett ging.
*
Patrizia hatte bereits tief und fest geschlafen, als ihr Handy sie weckte. Cristina! Um diese Uhrzeit? Sie stöhnte.
Wie in fast allen Familien hier in Süditalien gingen auch Cristinas kleine Mädchen sehr spät ins Bett, so dass ihre Kollegin sie oft erst nachts anrief, wenn es noch etwas zu besprechen gab. Aber was konnte es an einem ereignislosen Tag wie diesem um Mitternacht noch zu besprechen geben?
Sie nahm das Gespräch an.
»Scusa, aber mein Tag als Ermittlerin ohne Ermittlung war so aufreibend, dass ich einfach mal früher ins Bett musste.«
Eine kurze Stille am anderen Ende, dann hörte Patrizia Cristinas ironische, wenn auch müde Stimme.
»Scusa meinerseits, aber wenn du Angst vor Langeweile hast, kann ich dich beruhigen. Es gibt Arbeit.«
Wieder eine Pause.
»Wir haben einen Toten, oder besser gesagt, einen Kopf.«
Der ironische Unterton in Cristinas Stimme war verschwunden.
Wenige Minuten später saß Patrizia im Auto. Der Regen war im Laufe des Abends wieder stärker geworden. Dieser Tatsache sowie der späten Stunde war es wohl zuzuschreiben, dass selbst auf den Straßen im Innenstadtbereich kaum Verkehr herrschte. Und das, obwohl Salerno heute Abend zum ersten Mal wieder in seinem alljährlichen Weihnachtsglanz erstrahlt war, was an einem trockenen Abend sicher unzählige Menschen in die Stadt und damit in die Bars und Lokale gelockt hätte.
Patrizia parkte die rote Klara direkt vor dem klassizistischen Säulenportal des Teatro Verdi, Salernos Opernhaus. Vom Theaterplatz aus waren es nur noch ein paar Schritte bis zum Largo Campo, zu dem Cristina sie bestellt hatte.
Eigentlich hieß das hübsche kleine Plätzchen Largo Sedile del Campo. Doch selbst auf dem Straßenschild war der Name zu der trügerischen Kurzform Largo Campo – großer breiter Platz – zusammengeschnurrt, was unter Besuchern regelmäßig für Verwirrung sorgte, da es in der ganzen Stadt keinen engeren Platz gab als diesen.
Patrizia warf einen Blick auf die Uhr, als sie die Piazza erreichte. Es war kurz vor eins.
Das Gelände vor dem vierstöckigen spätbarocken Palazzo Genovese war abgesperrt. Die Kriminaltechniker hatten bereits ein paar starke Scheinwerfer aufgebaut, die das Gebäude in ein gleißend weißes, fast irreal anmutendes Licht tauchten. Trotz der relativ späten Stunde drängten sich zwei Dutzend Schaulustige vor dem gelben Plastikband. Die meisten von ihnen telefonierten oder filmten die Hauswand mit ihren Smartphones.
Patrizia folgte dem Beispiel der Menge. Mit zusammengekniffenen Augen ließ sie ihren Blick an der Hauswand hinaufgleiten. Die weihnachtliche Lichterdekoration des Palazzos bestand aus der Projektion großer, langsam an der Wand herunterrieselnder Schneeflocken, die allerdings durch das gleißende Licht der Scheinwerfer nur an den im Schatten liegenden Rändern zu sehen waren.
Durch die Helligkeit konnte Patrizia zunächst nicht viel erkennen, doch plötzlich erschrak sie. Kein Zweifel, da war er. Er baumelte im Zentrum des weißen Scheinwerferlichts. Ein großer, fahler Klumpen, der mit dem weißen Hintergrund zu verschmelzen schien. Erst bei näherem Hinsehen gab sich das Etwas als das zu erkennen, was es war: ein beinahe unecht wirkender bleicher Kopf mit unnatürlich aufgerissenen Augen und schwarzer, offener Mundhöhle, die wirkte, als hätte der Mann im Augenblick seines Todes aus Leibeskräften geschrien. Auf seiner Stirn erkannte Patrizia einen dunklen Fleck. Doch ob es sich dabei um ein Einschussloch handelte, war aus dieser Entfernung nicht zu erkennen. Neben dem Kopf klafften zwei hohe scheibenlose Fensteröffnungen.
Der Palazzo Genovese war einer der wenigen im Zentrum, an dem die Restaurierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen waren. Doch auch in unfertigem Zustand konnte man das Gebäude nur als aristokratisch bezeichnen, auch wenn das zarte Gelb seiner Fassade und die weißen Barockrahmen der Fenster im hellen Licht kaum zu erkennen waren.
Plötzlich hörte Patrizia Bob Kingfishers grantige Stimme.
»Wie wär’s, wenn die Wespe mal hier hochfliegen würde?«
Sie kniff erneut die Augen zusammen und sah den Kriminaltechniker, der hinter einem der hohläugigen Fenster stand und ihr gestikulierte, nach oben zu kommen. Patrizia betrat den Palazzo und ging hinauf.
»Endlich!«
Cristina eilte auf Patrizia zu und schnitt eine Grimasse.
»Weißt du eigentlich, wie oft ich dich angerufen habe, bevor du aus deinem Schönheitsschlaf erwacht bist?«
»Ich schlafe mit Ohrenstöpseln.«