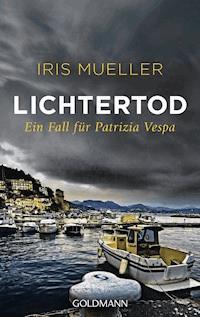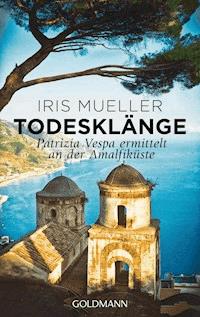
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Patrizia-Vespa-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der Sommer hält Einzug an der Amalfiküste, und auch die malerische Hafenstadt Salerno erwacht zu neuem Leben. Die Lidos haben geöffnet, Urlaubsstimmung liegt in der Luft. Wie jedes Jahr im Juni wird das nahegelegene Ravello zum pittoresken Schauplatz eines internationalen Musikfestivals. Doch dann fällt ein jäher Schatten über das frohe Treiben, als nach einem Konzert im Castello di Arechi eine bekannte Musikkritikerin erstochen aufgefunden wird. Die Stiche wurden gezielt gesetzt und mit unglaublicher Wucht ausgeführt. Ein tödliches Muster, das sich schon bald wiederholt und die sympathische Kommissarin Patrizia Vespa vor ein blutiges Rätsel stellt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Der Sommer hält Einzug an der Amalfiküste, und auch die malerische Hafenstadt Salerno erwacht zu neuem Leben. Die Lidos haben geöffnet, Urlaubsstimmung liegt in der Luft. Wie jedes Jahr im Juni wird das nahegelegene Ravello zum pittoresken Schauplatz eines internationalen Musikfestivals. Doch dann fällt ein jäher Schatten über das frohe Treiben, als nach einem Konzert im Castello di Arechi eine bekannte Musikkritikerin erstochen aufgefunden wird. Die Stiche, mit unglaublicher Wucht ausgeführt, bilden ein tödliches Muster. Ein Muster, das sich schon bald wiederholt und die sympathische Kommissarin Patrizia Vespa vor ein blutiges Rätsel stellt …
Autorin
Iris Claere Mueller, geboren 1971 in Mannheim, wuchs in Bad Wimpfen bei Heilbronn auf. Nach ihrem Studium der Germanistik, Philosophie und Politikwissenschaft an der Universität Heidelberg zog sie in die USA, wo sie an der renommierten Yale University im Fachbereich Medieval Studies promovierte. Seit 2005 lebt sie mit ihrem Lebensgefährten und den beiden Schäferhündinnen Leah und Nüsschen im süditalienischen Salerno. Im nahegelegenen Neapel arbeitet sie an der Internationalen Schule und lehrt mittelalterliche Geschichte an der University of Maryland Europe.
Iris Mueller im Goldmann Verlag:
Lichtertod. Ein Fall für Patrizia Vespa
(auch als E-Book erhältlich)
Todesklänge. Patrizia Vespa ermittelt an der Amalfiküste
(auch als E-Book erhältlich)
Iris Mueller
Todesklänge
Patrizia Vespa
ermittelt an der
Amalfiküste
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Originalausgabe März 2018
Copyright © 2018 by Iris Mueller
Copyright © dieser Ausgabe 2018
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: gettyimages/Brzozowska
Redaktion: Ele Zigldrum
An · Herstellung: kw
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-21710-5V002
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für meinen Vater
Kapitel 1
Montag, 25. Juni 2012
Die Dunkelheit wurde immer dichter. Vielleicht hätte sie sich doch zu ihrem Auto fahren lassen sollen. Nein. Nicht nach diesen Vorwürfen. Ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich zu arbeiten habe!
Ihr Fuß stieß an etwas Hartes, und sie sah zu Boden. Eine Reihe größerer Steine quer über der Straße. Etwa fünf oder sechs, wenn auch nicht alle auf einer geraden Linie.
Zufall?
Seltsam, dass ihr das vorhin auf dem Weg zum Lokal nicht aufgefallen war.
Die Straße führte jetzt steil bergan, und sie atmete schwer. Der Wein und das gute Essen machten sich bemerkbar. Vor zwei Stunden, am Ende des Konzerts auf der Burg, war es noch hell gewesen. Paolo war mit seinem Wagen zum Restaurant etwas weiter unterhalb gefahren, aber sie hatte ihr Auto stehenlassen und den kurzen Spaziergang zum Lokal genossen. Jetzt bereute sie ihre Entscheidung. Nicht einmal Straßenlaternen gab es auf diesem Abschnitt. In einiger Höhe über ihr leuchtete die Burg im Licht ihrer Scheinwerfer, doch die darunter liegende Straße war in tiefe Nacht getaucht.
Sie blieb stehen und kramte in ihrer Tasche nach dem Smartphone. Kurz darauf fiel der weiße Kegel der Lampe vor ihr auf den Weg. Doch es war kaltes Licht, und dort, wo es endete, lauerte das Nichts, schwarz und undurchdringlich. Keine Konturen. So, als ob es hinter dem schmalen Korridor aus Licht keine Welt mehr gäbe. Energisch lief sie weiter. Es konnten jetzt nicht mehr als 200 Meter bis zu ihrem Wagen sein. Sie hatte ihn am Straßenrand direkt unterhalb des Castello di Arechi geparkt.
Die Straße machte eine Biegung, und diesmal sah sie sie sofort. Ihr helles Grau leuchtete im starken Licht der Taschenlampe. Eine holprige Reihe aus Steinen.
Die zweite!
Sie blieb stehen und zählte. Es waren fünf. Groß wie Boccia-Kugeln. Wie beim ersten Mal lagen sie auf einer unregelmäßigen Linie quer über der Straße. Sie sah sich um, doch da war niemand. Kein Geräusch drang aus der tief unter ihr liegenden Stadt nach oben. Jetzt war sie sicher. Diese Steine waren vor wenigen Stunden noch nicht da gewesen. Jemand hatte sie seitdem auf die Straße gelegt. Warum?
Sie ging weiter, langsamer als zuvor, bedächtiger. Mit einem Schauer wurde ihr bewusst, dass die Taschenlampe sie für ihre Umgebung sichtbar machte, während sie selbst für die Welt außerhalb des Lichtkegels völlig blind war. Einen Augenblick lang erwog sie, die Lampe auszuschalten, aber die Angst vor der Dunkelheit war stärker.
Dann fiel ihr Blick auf die dritte Linie aus Steinen, doch diesmal blieb sie nicht stehen. Sie wusste nicht, warum ihr diese Steine solche Angst machten. Instinktiv wurde sie schneller, joggte beinahe, die Tasche an die Hüfte gepresst. Ihre Schritte hallten auf der Straße. Das Licht der Lampe hüpfte hektisch im Takt ihrer Bewegungen.
Als die vierte Linie vor ihr auftauchte, begann sie zu rennen. Wo zum Teufel bleibt das Auto? Ihr Atem kam stoßweise, und ihre Seite schmerzte. Sie zwang sich vorwärts – und kam abrupt zum Stehen.
Ihr Körper hatte reagiert, noch bevor die Wahrnehmung ins Bewusstsein vordringen konnte. Am Ende des Korridors aus Licht, an der Grenze zwischen hellem Raum und völligem Schwarz, stand ein Mensch. Er musste wohl schon vorher da gewesen sein, aber erst in dem Moment, als ihre Lampe ihn erfasste, war er wie aus dem Nichts aufgetaucht. Keine drei Meter von ihr entfernt. Es dauerte einige Sekunden, bis sie einordnen konnte, was sie sah. Ein Schrei entfuhr ihrer Kehle, und sie wollte rennen, doch die Beine versagten den Dienst. Wie gebannt starrte sie auf die regungslose Gestalt im schwarzen, enganliegenden Taucheranzug, der nur das fahle Gesicht im gleißenden Licht der Lampe freigab. Farblos, ausdruckslos. Jetzt öffneten sich die Lippen. Der Taucher begann leise zu singen. Zart, kaum hörbar. Dann lauter, deutlicher. Eine Melodie. Jetzt erst bemerkte sie die Linie zu seinen Füßen, und während sie dem stetig lauter werdenden Gesang lauschte, begann sie die Steinzeichen zu lesen. Eines nach dem anderen, bis es nicht mehr Steine waren, die sie vor sich sah, sondern die Melodie. Sie hatte sie erst gestern zum letzten Mal gehört, und wie von selbst formten sich die Worte in ihrem Kopf. Schöne, alte Worte, die von Schmerz und Tod sangen.
Ihrem Schmerz.
Ihrem Tod.
*
Normalerweise schlief Massimo Maiori gut, wenn er am Abend getrunken hatte, aber heute hatte ihn etwas geweckt. Wahrscheinlich die Paarungsschreie der verdammten Katzen. Jedenfalls lag er seitdem wach. Ein Blick auf die Uhr. Nicht einmal Mitternacht.
Er stand auf, ging in die Küche und füllte sich ein Wasserglas mit Rotwein aus der grünen 5-Liter-Flasche. Dann lehnte er sich an die Anrichte, nahm einen kräftigen Schluck und betrachtete missmutig das schmutzige Geschirr in der Spüle. Von außen sah das Haus schon seit Jahren heruntergekommen aus. Seit seine Frau nicht mehr lebte, hatte sich die Verwahrlosung auch im Inneren breitgemacht. Er gab sich einen Ruck und verließ die Küche. Einen Augenblick lang erwog er, den Wein mit ins Schlafzimmer zu nehmen und im Bett weiterzutrinken, doch dann entschied er sich anders.
Die Holztür war nicht abgeschlossen. Er war der Einzige, der noch hier oben am Hang unterhalb des Castellos lebte. Nur ein ungepflegter Schotterweg führte von der asphaltierten Straße zu seinem Haus. Diebe würden sich nicht zu ihm verirren. Abgesehen davon, dass es nichts zu holen gab. Vor vielen Jahren hatte seine Frau ihn eine Zeit lang bedrängt zu verkaufen, und vielleicht wäre es damals auch noch möglich gewesen. Heute war das Haus zu baufällig. Keine Infrastruktur. Weitab von allem. Massimo Maiori wusste, dass der Zug abgefahren war.
Er ließ sich am Holztisch auf dem Hof nieder, streckte die Beine unter dem Tisch aus und sah an sich herunter. Er war barfuß und im Schlafanzug nach draußen gekommen, doch die Nächte waren so warm, dass es keinen Unterschied machte. Er trank einen Schluck Wein. Unter ihm lagen die funkelnden Lichter der Stadt und der erleuchtete Hafen. Dahinter breitete sich der Golf aus. Der Mond warf einen breiten Streifen weißen Lichts auf die leicht gekräuselte Wasseroberfläche, und der Himmel war wolkenlos, ein durchsichtiges Dunkelblau. Einige Minuten saß Massimo regungslos. Dann fühlte er eine Brise im Haar und auf der Haut. Sie wehte vom Berg her Richtung Meer, und mit ihr drangen Töne an sein Ohr.
Klavierspiel.
Oben auf der Burg zog sich das Konzert offenbar in die Länge. Er selbst war nie auf einer Veranstaltung im Castello gewesen. Wozu auch? Er hörte sie von hier unten, leise und verschwommen. Aber selbst das war mehr, als er brauchte. Die Töne verklangen, kamen wieder, und er lauschte. Das Spiel klang vage, seltsam unbestimmt, als müsste sich der Pianist erst noch an das Stück herantasten. Aber traurig war es. Eine Klage.
Minuten vergingen. Die Klänge wurden lauter, heftiger, verloren sich aufs Neue. Massimo Maiori wurde sich bewusst, dass er selten so aufmerksam einer Melodie gelauscht hatte. Falls man das, was da herüberwehte, als Melodie bezeichnen konnte. Es wirkte bruchstückhaft, zerbrechlich. Und war doch auf flüchtige Art und Weise schön.
Dann war es zu Ende.
Er trank den letzten Schluck Wein und erhob sich. Als er sich der Tür zuwandte, glitt sein Blick den Berghang hinauf. Das von Scheinwerfern angestrahlte Castello di Arechi war der einzige helle Punkt vor dem in tiefer Dunkelheit liegenden Berg. Er sah den Sternenhimmel, und einen Augenblick lang meinte er, die Klänge noch einmal zu hören, aber der Wind hatte sich gelegt, und er war sich nicht sicher. Erst als er nach der Tür griff, fuhr ihm ganz unerwartet eine neue Brise ins Gesicht. Stärker diesmal. Und plötzlich war sie zurück. Die Melodie. Fließender jetzt, beinahe drängend. Doch sie hatte nichts Trauriges mehr.
Sie war grausam.
*
Bedrohlich. Gewalttätig. Oder waren es die Schmerzen, die die Töne verzerrten? Jeder Klang, jeder Anschlag vibrierte im Inneren ihres Schädels, pulsierte wie ihre Wunden, aus denen das Blut strömte. Wie lange, bis man verblutet?
Sie war auf der Straße unterhalb des Castellos gewesen, um ihr Auto zu holen. Dann er …
Der Taucher!
Hatte er sie in die Burg zurückgebracht? Sie erinnerte sich nicht. Auch nicht daran, wie oft er zugestochen hatte. Jetzt lag sie auf der Bühne. Am Rand ihres Blickfelds standen die Stühle der Musiker und ein Flügel.
War er es, der da spielte?
Der Druck hinter ihren Lidern nahm zu. Warmes Blut rann an ihrem Körper herab. Trotzdem fühlte sich ihre durchnässte Bluse kalt an. So wie der Schweiß, der ihr in den Augen brannte. Sie versuchte, den Kopf abzuwenden, um das gleißende Licht des Scheinwerfers auszublenden, aber es gelang ihr nicht. Nur die Lider gehorchten noch. Sie presste sie fest zu und empfand eine vage Erleichterung. Dann war plötzlich etwas anders.
Stille.
Oder doch nicht? Sie konzentrierte sich.
Tick.
Tack.
Tick.
Tack.
Leise und regelmäßig. Doch es hatte nichts Beruhigendes. Ganz im Gegenteil. Je länger sie dem Ticken lauschte, desto lauter schien es zu werden. Panisch riss sie die Augen auf, starrte bewusst in das weiße Scheinwerferlicht, bis es sie ganz ausfüllte. Nur nicht mehr hören müssen! Ihr flacher Atem kam stoßweise. Dann veränderte sich der Rhythmus, geriet aus dem Takt. Nein, das war es nicht. Er vermischte sich mit etwas anderem.
Schritte.
Sie kamen näher. Eine schwarze Gestalt schob sich vor das gleißende Licht. Der Taucher. Er beugte sich zu ihr hinunter. Seine Züge lagen im Schatten, und sie konnte sie nur undeutlich erkennen. Dennoch spürte sie den Blick auf sich und suchte nach seinen Augen, aber die waren auf einen Punkt weiter unten gerichtet. Ihre Bluse wurde angehoben, und sie erschauerte, als sich der Stoff von den Wunden löste.
Dann plötzlich eine Bewegung. Schmerz, unerwartet und heftig, als er ihren reglosen Körper mit einem Ruck auf die Seite wendete. Der Laut aus ihrer Kehle klang fremd und wild, das Blut floss jetzt schneller. Wie viel Zeit bleibt mir noch?
Tick.
Tack.
Tick.
Tack.
Das Geräusch wurde leiser, schien sich zu entfernen. Eine Schwere überkam sie. Wie in Trance nahm sie wahr, dass er noch immer neben ihr kauerte, doch sein Interesse galt nicht mehr ihrem Körper. Auch die Laute aus ihrem Mund klangen jetzt anders, wurden höher, schneller, gingen ineinander über. Als die Gestalt an den Flügel zurückkehrte, hörte sie nur noch das leise Ticken, vor ihren Augen tiefes Schwarz, das von nichts durchdrungen wurde. Und als er erneut die Tasten anschlug, erreichten die Klänge sie wie aus weiter Ferne. Sie lauschte. Versuchte, sich an den Tönen festzuhalten, als könnten die allein sie vor dem Weggleiten bewahren. Minuten vergingen. Eine chromatische Reihe löste die andere ab. Stark und schön. Immer wieder, immer leiser. Das Letzte, was sie hörte, war ein musikalisches Aufstöhnen. Ein Tetrachord in Moll. Unendlich weit weg.
Dann wurde es still.
*
Zu still.
Er blickte auf seine Hände hinunter. Sie zitterten, wie so oft in letzter Zeit. Doch nicht vor Angst. Es war das Adrenalin, der Rausch, die Kraft, die Großes schuf. Er konnte das Blut in seinen Adern fühlen, die Leichtigkeit im Kopf.
Er kniete sich neben sie und sah in die leeren Augen, die aufgehört hatten zu sehen, noch bevor sie gestorben war.
Bedauerlich, dass sie nicht lange genug gelebt hatte, um den Triumph ihres eigenen Todes zu hören.
Das Warum.
Das Wofür.
Die meisten Menschen starben ohne jeden Sinn. Nicht sie! Nur schade, dass sie gestorben war, ohne zu hören. Ohne zu wissen, dass sich ihr Opfer gelohnt hatte. Aber vielleicht war das Teil ihrer Strafe?
Er sah auf die Uhr. Es war schwer sich zu trennen in einem solchen Augenblick. Aber es musste sein. Er musste sich beruhigen und tun, was zu tun war.
Er reckte die Hand nach dem kleinen braunen Gerät auf dem Flügel, berührte den Zeiger und setzte es noch einmal in Gang. Diesmal tickte das Metronom nur für ihn, so wie er es am liebsten hatte. Er fühlte, wie sein Atem langsamer wurde, sein Kopf sich leerte. Die Nacht wurde wieder zu dem, was sie sein sollte. Ein Ruhepunkt. Schweigendes Versprechen. Er nahm das Gerät in die Hand. Zärtlich strich er mit dem Zeigefinger über seine hölzerne Haut.
Ruhe. Das ist es, was du gibst. Ruhe nach dem Chaos, dem Aufruhr. Und heute Nacht sollen alle daran teilhaben.
Bedächtig stieg er die Treppe zum Wehrgang des Castellos hoch und stellte das Metronom auf die Burgmauer. Unter ihm lag die sanft leuchtende Stadt.
»Tick, tack«, flüsterte er. »Pass gut auf sie auf.«
Kapitel 2
Dienstag, 26. Juni 2012
Patrizia Vespa nahm die Füße vom Tisch, als es an ihre Bürotür klopfte, und setzte sich gerade hin. Das musste ihr Chef sein.
»Pronto!«
Die Tür ging auf, und eine dampfende Tasse erschien, gefolgt von der braunen Mähne ihrer Co-Kommissarin Cristina D’Avossa.
»Du? Seit wann klopfst du an? Machst du das extra, um mich in die Irre zu führen? Ich dachte wirklich, es wäre Di Leva!«
Cristina schmunzelte. »Ich wollte nur meine Theorie testen.«
»Theorie?«
»Na ja, du ärgerst dich doch immer, dass außer unserem Chef nie jemand anklopft. Aber ich hatte den Verdacht, dass es dir andersrum auch nicht recht sein würde. Und das hast du eben unter Beweis gestellt … O Dio, jetzt schau mich nicht so vorwurfsvoll an. Hier, ich hab dir aus der Bar den einzigen Kaffee mitgebracht, den du trinkst.«
Patrizia nahm die Tasse und lächelte. »Einen Cappuccino. Danke, den kann ich gut gebrauchen. Leider hat mich mein Tee heute Morgen nicht wach bekommen. Bevor du reinkamst, wären mir fast nochmal die Augen zugefallen.« Sie nahm einen Schluck und lehnte sich in ihrem schwarzen Bürostuhl zurück. Dann sah sie ihre Kollegin prüfend an.
»Irgendwie siehst du heute anders aus …«
Cristina lachte. »Sonnenbräune. Ich war gestern nach der Arbeit noch eine Runde im Meer schwimmen.«
»Du warst nach der Arbeit noch schwimmen?«
»Klar, warum nicht? Von meiner Haustür zum Strand sind es keine zwei Minuten. Komm doch einfach mal mit.«
»Hm, mal sehen.«
»Mal sehen? Sei bloß nicht zu enthusiastisch.«
Patrizia schnitt eine Grimasse. Dann sah sie auf die Uhr. »Unsere Frühbesprechung geht gleich los.« Sie fuhr sich mit den Händen durch die kurzen schwarzen Haare, trank den letzten Schluck Cappuccino und erhob sich. Cristina folgte ihrem Beispiel.
Auf dem Flur vor dem Sitzungszimmer trafen sie Pietro Di Leva. Gemeinsam mit dem Polizeichef betraten sie den Raum. Patrizia war erstaunt, die Mannschaft schon vollständig versammelt zu sehen. Neben ihrem Kollegen Davide Favetta waren auch die Kriminalassistentinnen Antonia und Lydia anwesend. Dazu Bob Kingfisher, ihr amerikanischer Kriminaltechniker, der bereits seit Jahrzehnten in Salerno lebte und arbeitete. Zwar hörte man ihn in regelmäßigen Abständen fluchen, dass er jetzt endgültig genug habe von den italienischen Unsitten, doch der Ärger währte nie lange genug, als dass er sich tatsächlich ein Ticket zurück nach Oklahoma gekauft hätte. Neben Bob saß Gabriella Molinari, die Rechtsmedizinerin, die häufig an ihren Sitzungen teilnahm. Doch heute hatte Patrizia nicht mit ihr gerechnet.
»Ciao, Gabriella. Hattest du nicht gesagt, du müsstest heute deinen neuen Kollegen einarbeiten?«
Gabriella lächelte. »Ja, so war’s geplant. Aber jetzt fängt er doch erst morgen an. Er ist mit seinem Umzug noch nicht fertig. Na ja, was soll’s. Nachdem wir jetzt Monate warten mussten, bis unser Antrag auf die Stelle endlich durch war und er hier anfangen konnte, kommt es auf den einen Tag auch nicht mehr an.«
Patrizia nickte und sah in die Runde.
»Gut, dann wollen wir mal. Unsere Kollegen vom Raubdezernat haben unsere Hilfe angefordert, da wir im Augenblick ausnahmsweise mal Kapazitäten frei haben. Es geht um die beiden Überfälle mit Körperverletzung. Habt ihr alle den vorläufigen Bericht erhalten?« Allgemeines Nicken. »Gut, dann fasse ich die Fakten nochmal kurz zusammen. Ein Überfall letzte Woche, der andere vor vier Wochen. In beiden Fällen wurden die Opfer niedergestochen und ihrer Wertsachen beraubt. Beide Männer leben. Laut Gutachten der jeweils behandelnden Ärzte war die Tatwaffe ein Messer, und zwar höchstwahrscheinlich in beiden Fällen dasselbe. Wir können also davon ausgehen, dass es sich um denselben Täter handelt, und zwar nicht nur hier in Salerno. Gestern Abend bekam ich einen Anruf von Roberto aus dem Raubdezernat. Sie stehen in Kontakt mit den Kollegen in Neapel, und dort ist offenbar vor sechs Wochen ein ganz ähnlicher Überfall passiert. Ein Vergleich der medizinischen Gutachten legt nahe, dass auch dort mit demselben Messer zugestochen wurde.«
»Hast du diese Gutachten?«, fragte Gabriella Molinari.
»Nein, aber ich habe die Kollegen gebeten, sie dir zu faxen.«
Gabriella wollte etwas antworten, doch Pietro Di Leva kam ihr zuvor.
»Was wissen wir über den Ablauf bei diesem Überfall in Neapel?«, fragte er gereizt. Patrizia unterdrückte ein Grinsen. Sie wusste, dass seine Missstimmung weniger dem dritten Opfer galt als vielmehr der Aussicht auf eine Zusammenarbeit mit den neapolitanischen Kollegen. Doch sie ließ sich nichts anmerken.
»Tatzeit ähnlich wie in Salerno. Allerdings gab es in Neapel einen Zeugen. Das Opfer, Luca Pavone, hatte seinen zehnjährigen Sohn dabei, der alles gesehen hat. Außerdem war noch ein Mann in der Nähe, der aber nicht eingriff. Der Junge konnte nur sagen, dass er noch da stand, als der Täter schon abgehauen war. Dann war er plötzlich auch weg. Unsere Kollegen können nichts zur Identität dieses Mannes sagen. Es ist nicht auszuschließen, dass er mit dem anderen unter einer Decke steckt. Vielleicht sollte er Schmiere stehen. Der Täter trug übrigens eine Strumpfmaske, der Komplize höchstwahrscheinlich nicht. Wie er aussah, konnten Vater und Sohn in der Dunkelheit und bei der Entfernung nicht erkennen. Der Junge behauptet außerdem, der Täter hätte das Messer bei der Flucht weggeworfen, aber ob das stimmt, ist zweifelhaft, denn es wurde nicht gefunden. Na ja, der Kleine stand unter Schock. Immerhin lag sein Vater verletzt am Boden. Überall war Blut.«
»Was ist mit den Wertsachen?«, fragte Davide.
»Die wurden gestohlen. Das Opfer weigerte sich anfangs, Geld und Handy rauszurücken. Daraufhin stach der Täter zu, bediente sich und verschwand.«
»Also ähnlich wie bei uns«, meinte Cristina. Sie sah auf ihre Kopie des Berichtes und fasste zusammen: »Unser erstes Opfer heißt Nicola Ruggiero, 29 Jahre. Er wurde auf dem Weg vom Kino nach Hause überfallen, und zwar kurz nach Mitternacht. Er gibt an, dass der Täter seine Wertsachen forderte und auch erhielt. Trotzdem wurde er anschließend niedergestochen. Ein einziger Messerstich, aber heftig. Ruggiero ging zu Boden und blutete stark. Dasselbe gilt für Michele Landi, 34. Der war am letzten Mittwoch auf dem Weg nach Hause von einem Besuch bei Freunden. Auch bei ihm ein einzelner Messerstich. Hm, ich nehme mal an, der Täter stach seine Opfer nieder, um ungehindert flüchten zu können.«
Davide nickte. »Wahrscheinlich. Allerdings steht im Bericht auch, dass der Angreifer nach der Tat noch kurz bei seinen Opfern verharrte. Erst nach ein, zwei Minuten entfernte er sich.« Er schüttelte den Kopf. »Seltsam, oder nicht?«
»Vielleicht der Schock über die eigene Tat«, schlug Patrizia vor. »Dafür spricht auch, dass er es bei Michele Landi danach umso eiliger hatte. Er lief los, ohne die Wertsachen an sich zu nehmen. Nach ein paar Metern fiel es ihm auf, er kam nochmal zurück und schnappte sich den Geldbeutel.«
»Alles schön und gut, aber haben wir oder die Kollegen in Neapel irgendwelche konkreten Spuren?«, brummte Di Leva.
»Leider nein.« Patrizia zuckte mit den Schultern. »Hier in Salerno trug der Täter wohl so eine Art schwarze Motorradhaube und Handschuhe. Ein schlanker Mann. Der Stimme nach zwischen 30 und 50. Italiener, kein Dialekt. Das ist alles, was uns die Opfer sagen konnten. Der Junge in Neapel wusste auch nicht mehr. Weitere Zeugen, eine Tatwaffe oder Fingerabdrücke haben wir keine. Kein Wunder, dass unsere Kollegen in der Sache nicht vorankommen.«
Einen Augenblick herrschte Stille im Raum. Keiner wusste, wie es weitergehen sollte. Schließlich meinte der Polizeichef: »Wunderbar! Genau das, was wir brauchen. Einen Idioten, der wahllos Leute niedersticht und ihnen das Geld abnimmt. Erst in Neapel und jetzt offenbar hier bei uns. Und das ausgerechnet in der Touristensaison. Am vergangenen Wochenende hat in Ravello das Internationale Musikfestival begonnen. Ich war selber dort und …«
»Ich auch«, unterbrach ihn Gabriella Molinari enthusiastisch. »Am Sonntag hat Eleonora Salazar mit ihrer Gruppe Kontrapunkt ausgewählte Madrigale von Carlo Gesualdo, Monteverdi und anderen gesungen. Wunderschön! Überhaupt ist das Programm großartig. Klassik, Jazz, ganz große Namen …« Weiter kam sie nicht, da der überrumpelte Pietro Di Leva ihr das Wort abschnitt.
»Ja, ja … Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass haufenweise Besucher in der Stadt sind. Vor allem aus dem Ausland und Norditalien. Wenn es einen von denen trifft, wissen wir ja, was die Zeitungen wieder schreiben werden über die Zustände hier im Süden.«
»Stimmt«, meinte Patrizia, und der ironische Unterton in ihrer Stimme war nicht zu überhören. »Wir sollten auf jeden Fall sicherstellen, dass das nächste Opfer wieder ein Süditaliener wird, am besten aus Salerno. Halt! Am besten aus irgendeiner unbedeutenden Kleinstadt um Salerno herum.«
Di Leva wirkte beleidigt. »Als ob ich es so gemeint hätte …«
»Na ja«, warf Cristina ein. »Vielleicht haben wir ja auch Glück und es kommt zu keinen weiteren Zwischenfällen.«
»Unwahrscheinlich«, warf Davide ein. »Bisher ist es doch für den Täter optimal gelaufen. Er hat bekommen, was er wollte, und wir haben keinerlei Anhaltspunkte.«
Einen Augenblick sagte niemand etwas, und Patrizia überlegte gerade, in welche Richtung sie die Sitzung lenken sollte, als es an der Tür klopfte. Ein Uniformierter trat ein und sah von Patrizia zu Cristina und dann zu Pietro Di Leva. Offenbar war er unschlüssig, an wen in dieser Hierarchie er sich wenden sollte. Schließlich fiel seine Wahl auf den Polizeichef.
»Questore, bitte entschuldigen Sie die Störung, aber wir haben soeben einen Anruf erhalten.« Er warf einen schnellen Blick zu den Kommissarinnen hinüber. »Ein Angelo Nardi meldet eine Leiche im Castello di Arechi. Er ist dort Hausmeister und hat sie eben gefunden. Es handelt sich um eine Frau. Sie wurde erstochen.«
*
Eine halbe Stunde später stand Patrizia im Innenhof des Castello di Arechi. Dort, wo er im Schatten lag, sprachen Davide und Cristina mit einem jungen Mann. Es war der Hausmeister Angelo Nardi. Bobs Team von Kriminaltechnikern arbeitete an verschiedenen Stellen der Burg.
Auf einer hölzernen Bühne in unmittelbarer Nähe eines Flügels kniete Gabriella Molinari neben der Leiche. Patrizia steuerte auf sie zu. Doch vor den Stufen, die auf die Bühne führten, blieb sie noch einmal stehen. Von hier aus war die Tote gut zu sehen. Sie lag seitlich mit weit aufgerissenen Augen in ihrem Blut.
Wie schon oft in solchen Momenten berührte Patrizia der Kontrast zwischen der Einsamkeit des Opfers in den letzten Minuten seines Lebens und der Vielzahl an Spezialisten, die sich in den Stunden danach um die Leiche scharten.
Wir sind die Nachhut des Todes. Patrizia beobachtete die geübten Handgriffe der Rechtsmedizinerin. Wir sind die, die den Ort des Aufruhrs und des Auslöschens mit professioneller Routine für die Lebenden zurückerobern.
Patrizia stieg die wenigen Stufen hinauf und stellte sich neben Gabriella Molinari.
»Ungefährer Todeszeitpunkt zwischen 22 und 1 Uhr gestern Nacht«, sagte diese unaufgefordert. »Insgesamt fünf Stichwunden, alle im Bauchraum, und zwar mit einer recht schmalen Klinge, sonst wären die Abstände zwischen den Einstichen geringer. Allerdings hat der Täter nicht sauber zugestochen. Hier, schau mal …« Sie zeigte auf die blutverkrusteten Wunden. »Die menschliche Haut ist sehr elastisch, und normalerweise ziehen sich die Wundränder nach dem Herausziehen des Messers wieder zusammen. Hier aber sind die Wundöffnungen unscharf begrenzt, fast schon ausgefranst. Das könnte bedeuten, dass der Täter das Messer beim Herausziehen gedreht hat. Eine echte Schweinerei … zumal es gut möglich ist, dass die Frau nicht sofort tot war. Verdammt üble Art zu sterben.« Die Rechtsmedizinerin fuhr sich mit dem Ärmel über die Stirn und schüttelte den Kopf. Ihr Gesicht war gerötet, und Patrizia konnte sehen, dass sie aufgebracht war. Zu fluchen war sonst nicht Gabriellas Art. Patrizia ging neben ihr in die Hocke und betrachtete die Leiche.
»Seitenlage …« Sie runzelte die Stirn. »Kann sie tatsächlich so gefallen sein?«
Gabriella schüttelte den Kopf. »Nein. Kein Mensch fällt auf die Seite und bleibt dann so liegen. Außerdem haben wir diese hier …« Sie zeigte auf den blutigen Holzboden hinter der Leiche, auf dem feine Kerben zu erkennen waren. Patrizia beugte sich nach vorn.
»Können die wirklich von dem Messer herrühren?«
»Ich wette darauf. So wie ich das sehe, lag sie auf dem Rücken, als der Täter zustach.«
»Seltsam. Wenn sie ursprünglich auf dem Rücken lag, heißt das, dass der Mörder sie auf die Seite gedreht hat. Aber warum? Was zum Teufel wollte er damit bezwecken?« Sie sah Gabriella an, doch die hatte ihre Frage nicht gehört.
»Patrizia!« Cristina war unbemerkt neben sie getreten. »Erste Neuigkeiten?«
»Ich frage mich nur gerade, warum der Mörder sein Opfer in Seitenlage gebracht hat. Es erscheint mir so sinnlos.«
»Ist die Bühne der eigentliche Tatort?«
Es dauerte einige Sekunden, bis die Frage bei Gabriella ankam, dann antwortete sie: »Wenn ich mir die Menge an Blut und die Kerben im Holz so anschaue, gehe ich mal davon aus. Außerdem habe ich bislang nirgendwo anders Blutspuren gesehen, aber da wird die KTU uns sicher weiterhelfen.« Sie wandte sich erneut ihrer Arbeit zu. In der Stille, die folgte, wurde Patrizia auf ein Geräusch aufmerksam, das schon vorher da gewesen war, dem sie aber bislang keine Beachtung geschenkt hatte. Ein Ticken. Regelmäßig. Eintönig.
»Cristina, leise. Hörst du das auch?«
Cristina lauschte. »Ah, dieses seltsame Ticken. Das ist mir vorhin schon aufgefallen. Ich dachte, es käme von einem der Geräte unserer Techniker. Aber wenn nicht, was ist es dann? Eine Uhr?«
»Keine Ahnung.«
Patrizia stand auf und ließ ihren Blick über den Hof schweifen, konnte aber nichts Verdächtiges entdecken. Zusammen mit Cristina ging sie zur Burgmauer. Das Ticken wurde langsam lauter.
Patrizia ging auf die Stufen zu, die zum Wehrgang hinaufführten.
»Komm, lass uns da oben nachsehen.«
Wortlos stiegen sie die schmale Treppe hinauf und liefen einige Meter an den Zinnen entlang. Die Lautstärke des Tickens nahm stetig zu. Plötzlich standen sie vor einem kleinen Gerät.
»Ein Metronom. Che diavolo …!«
Patrizia sah Cristina an, doch die schüttelte nur den Kopf. Das Metronom stand auf der Burgmauer. Sein filigraner Zeiger schwang gleichmäßig hin und her.
Tick.
Tack.
Tick.
Tack.
Mehrere Sekunden standen sie regungslos und betrachteten das Gerät, das unbeirrt forttickte. Ein kleines lebendiges Wesen, seine Vorderseite dem Golf zugewandt, der nervöse Fühler energisch ausschlagend wie ein stetiges, unermüdliches Lebenszeichen.
Schließlich zog Patrizia ihr Telefon aus der Tasche.
»Ich rufe Bob an.«
Aus dem Innenhof drang Bobs Klingelton zu ihnen. Kurz darauf stand er selbst auf dem Wehrgang, machte Fotos und ein Video. Als er fertig war, sah er noch einen Augenblick auf das Gerät herunter, dann streckte er die Hand aus. Der Zeiger schlug gegen seinen Finger … und blieb stehen.
Stille.
Patrizia empfand eine unbestimmte Erleichterung.
»Ich wollte mich mal im Vorhof umsehen«, meinte Cristina. »Kommst du mit?«
Patrizia nickte. Sie stiegen die schmale Treppe hinab, überquerten den Innenhof und tauchten in den langen Gang ein, der zum Vorplatz führte. Er war düster und trotz der Juniwärme kühl. Als sie aus der Dunkelheit heraustraten, atmete Patrizia unwillkürlich auf.
Der vordere Teil des Castellos lag in der Sonne, seine sandfarbenen Mauern leuchteten weiß im Morgenlicht. Nur die Wachtürme zu beiden Seiten der Mauer, hinter der der Berg schroff zur Stadt hin abfiel, warfen scharfe, schlanke Schatten auf den Vorplatz. Patrizia und Cristina gingen den Hof ab, untersuchten die tiefen, porticoartigen Rundbogen auf der Hinterseite ebenso wie die Türme, fanden jedoch nichts Interessantes. Da hörten sie eine Stimme von unten, und der Aufzug setzte sich in Bewegung. Als sich seine Türen öffneten, trat einer der Kriminaltechniker heraus, der im unteren Eingangsbereich der Burg gearbeitet hatte. Er überreichte ihnen eine Handtasche aus grauem Leder.
Behutsam setzte Cristina sie auf der Mauer ab, die den Hof einfasste. Dann förderte sie nacheinander ihren Inhalt zutage und legte ihn in die Plastiktüten, die Patrizia ihr aufhielt. Einen Kamm, Taschentücher, einen Kugelschreiber, ein Notizbuch. Patrizia nahm das Büchlein und schlug es auf, las, blätterte, las wieder.
»Na? Und?« Cristina sah sie ungeduldig an.
»Alles Notizen zu irgendwelchen Aufführungen. Konzerte, wie es scheint. Mit dem jeweiligen Datum, Ort und Musikernamen. Kritik, aber auch Positives. Hm. Nicht sehr hilfreich. Gibt es in der Tasche keinen Geldbeutel?« Sie ließ das Buch in einem Plastikbeutel verschwinden, während Cristina den Reißverschluss einer Seitentasche öffnete.
»Bingo! Zweimal Schlüssel und das Portemonnaie.«
Patrizia griff sich die Geldbörse und zog eine EC-Karte heraus. »Alessandra Amedeo.« Sie durchsuchte das Fach mit den Geldscheinen und wurde fündig.
»Hier! Der Personalausweis. Alessandra Amedeo, 54, geboren in Siena, wohnhaft in der Via Matteo della Porta in Salerno.«
»Das ist in der Altstadt oberhalb des Doms.« Cristina tippte auf ihr Smartphone ein. »Ich hab’s! Die Frau ist freischaffende Kulturjournalistin. Spezialisiert auf klassische Musik.«
»Das erklärt das Notizbuch.« Patrizia steckte den Ausweis zurück und tütete den Geldbeutel ein. »Wir sollten zu ihrer Wohnung fahren und uns umsehen.« Cristina durchsuchte noch einmal die Tasche. »Komisch, kein Handy. Und Gabriella hat bei der Leiche auch keins gefunden.«
Patrizia nickte. »Ja, das ist seltsam. Vielleicht hat sie es verloren, als sie auf ihren Mörder traf. Wenn wir nur wüssten, wo das war.«
»Oder der Täter hat es mitgenommen.« Cristina schloss die Tasche.
Einen Augenblick standen beide der spiegelnden Fläche des Meeres zugewandt. Im Hafen lag ein Kreuzfahrtschiff. Die Autos auf dem Lungomare wirkten aus dieser Höhe klein wie Spielzeug. Um das Castello herum leuchteten die Hänge in sommerlichem Grün, und zu ihrer Rechten lag die gezackte Bergkette der Amalfiküste in leichtem Dunst.
»Schau mal!«, rief Cristina plötzlich. Sie deutete auf ein baufälliges Haus, das sich etwas unterhalb an den Hang schmiegte. Patrizia beugte sich über die Mauer.
»Na so was! Es sah verlassen aus. Ich dachte, da wohnt keiner mehr.« Sie beobachteten die beiden Ziegen, die aus einer Art Stall auf den Hof vor dem Haus getreten waren und dort an einem Busch zupften.
»Wir sagen Davide Bescheid«, meinte Patrizia. »Er soll herausfinden, ob hier noch mehr solcher Einsiedler wohnen. Außerdem muss er mit den Leuten aus dem Restaurant weiter unten an der Straße sprechen. Wir selbst statten dem Besitzer dieser beiden Ziegen einen Besuch ab.«
*
Als Patrizia und Cristina am frühen Nachmittag in der Via Matteo della Porta ankamen, stand bereits ein Wagen der Spurensicherung vor Alessandra Amedeos Haus. Im Innern des Gebäudes war es düster und angenehm kühl. Typisch für die Häuser der Altstadt mit ihrem dicken Mauerwerk. Patrizia nahm ihre Sonnenbrille ab und sah sich im Treppenhaus um. Alessandra Amedeos Wohnung lag im Dachgeschoss. Einen Aufzug gab es nicht.
Oben angekommen zogen sie sich ihre Einmalanzüge an und traten ein. Die Wohnungstür führte direkt in ein großes Wohnzimmer, an das sich linker Hand eine moderne, vom Wohnraum nur durch eine Kochinsel abgetrennte Küche anschloss. Sie sah neu aus. Die Wohnung war aufgeräumt. Patrizia nickte den Technikern zu und ging in den Küchenbereich, während Cristina sich im Wohnraum umsah. Sie versuchte, die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Schräge Decken, hell gekachelte Fußböden, keine Teppiche. Die Küche war blau gestrichen, der Wohnraum grün. Ohne zu wissen warum, öffnete Patrizia den Kühlschrank. Eine Menge Joghurts, Ziegenmilch, Peccorino, eingelegte Sardinen und Räucherlachs, dazu Auberginen und Broccoli. Offenbar war Alessandra Amedeo eine Liebhaberin der leichten Küche gewesen. Der Kühlschrank war peinlich sauber. Patrizia schüttelte unwillkürlich den Kopf. Wie man so was hinbekam, war ihr schleierhaft.
Noch ein kurzer Blick zur Anrichte, auf der Tontöpfe mit Zitronen und Knoblauch standen, dann ging sie zu Cristina hinüber. Auch der Wohnbereich war modern eingerichtet. Der Raum wurde von einem dunkelgrauen Ecksofa dominiert. Der Flachbildfernseher hatte gut und gern 60 Zoll, und die ebenfalls graue Leseliege vor der Fensterfront sah bequem aus. An der Rückseite des Raumes stand ein Glastisch mit hohen Stühlen, dahinter ein helles Bücherregal. Patrizia winkte Cristina, und zusammen gingen sie ins Schlafzimmer. Rote Wände, ein schwarzes Bett, rote Bettwäsche. Alessandra Amedeo hatte offenbar auch bei Nacht Wert auf ein stilvolles Ambiente gelegt. Patrizia gefiel es, aber Cristina schüttelte den Kopf.
»Zu modern«, erklärte sie. »Nicht mal Teppiche, und ein rotes Schlafzimmer? Damit könntest du mich jagen. Bei unserem Beruf sehe ich auch so schon oft genug Rot, da muss ich nicht abends noch mit der Farbe ins Bett gehen. He, sieh mal …« Sie hatte die Tür von Alessandra Amedeos Nachtschränkchen geöffnet.
Patrizia beugte sich nach vorn. »Ein Fläschchen Cognac, zwei Gläser und eine Packung Kondome? Alle Achtung. Da war jemand perfekt auf den Ernstfall vorbereitet.«
Cristina grinste. »Vorbereitet schon, allerdings scheint der Ernstfall noch nicht eingetreten zu sein. Die Flasche ist schon offen, nicht aber die Packung. Also, halten wir fest. Verheiratet war sie nicht, aber zumindest potenziell kein Kind von Traurigkeit.«
Patrizia nickte, stand auf und betrachtete das einzige Foto im Zimmer. Ganz offenbar Alessandra Amedeos Eltern bei der Hochzeit. Es war großformatig und schwarz-weiß.
Dann ließ sie Cristina im Schlafraum zurück und ging ins Arbeitszimmer. Hier gab es eine Menge Aufnahmen an den Wänden. Auf fast allen sah man Alessandra Amedeo mit verschiedenen Künstlern, meist auf irgendeiner Bühne, feine Abendgarderobe, im Hintergrund Flügel oder Notenständer. Patrizia betrachtete eines nach dem anderen. Die Kulturjournalistin war eine schöne Frau gewesen. Groß und schlank, lange gewellte Haare, ein strahlendes, wenn auch unnahbares Lächeln. Patrizia kannte keinen der Künstler und beschloss, sich den Schreibtisch vorzunehmen. Im Gegensatz zum Rest der Wohnung war er unaufgeräumt. Sie flippte durch Zeitungen, Magazine, Programmankündigungen und einzelne ausgeschnittene Zeitungsartikel, die sich an den Rändern stapelten. In der Mitte stand ein Laptop. Sie schaltete ihn ein, obwohl sie sich keine Hoffnungen machte. Sicher war er passwortgeschützt. Während der Computer hochfuhr, überflog sie verschiedene Artikel. Eines hatten sie alle gemeinsam: Sie drehten sich um Musik, Konzerte und Künstler. Patrizia las die Überschriften. Offenbar hatte es erst vor einer Woche Standing Ovations für eine Pianistin im Teatro Verdi in Salerno gegeben. Der Bericht war nicht von Alessandra Amedeo. Dafür aber ein anderer, der die Kraftlosigkeit eines Streichquartetts bei einer Aufführung in Neapel beklagte.
Patrizias Blick fiel auf die zuoberst liegende Zeitung. Es war der »Corriere della Sera« und trug das Datum vom Vortag. Sie schlug sie auf und blätterte sich zum Kulturteil durch. Gleich auf der ersten Seite prangte ein Bild. Drei Sänger und zwei Sängerinnen in feiner Garderobe. Sie standen im Halbkreis vor Notenständern. Dahinter die Kulisse der Costiera Amalfitana. Der Artikel trug die Überschrift: »Das traurige Comeback der Eleonora Salazar beim Internationalen Musikfestival in Ravello.«
Patrizia suchte den Namen und fand ihn. Der Artikel war von Alessandra Amedeo. Im selben Augenblick trat Cristina neben sie.
»Kein Glück mit dem Computer, was?« Sie zeigte auf das blinkende Passwortfeld. Patrizia zuckte mit den Schultern. »Den bringen wir zu Tommaso. Soll der sich die Zähne daran ausbeißen. Was hast du da? Wo waren die?«
»Im Wohnzimmer auf dem Regal.« Cristina reichte ihr zwei gerahmte Fotos. Auf einem sah man eine wesentlich jüngere Alessandra Amedeo, die offenbar ihr Universitätsdiplom entgegennahm. Auf dem anderen lachten die Journalistin, eine weitere Frau und ein Mann in die Kamera. Sie hielten volle Prosecco-Gläser in der Hand. Das Foto war auf einer Jacht aufgenommen.
»Vielleicht ist der Mann ihr Liebhaber«, schlug Cristina vor. »Wir müssen herausfinden, wer die beiden sind.«
Patrizia nickte. »Allerdings sah sie da noch jünger aus. Der Ausflug muss schon ein paar Jahre her sein. Übrigens, warst du schon auf der Dachterrasse?«
Cristina schüttelte den Kopf. Gemeinsam verließen sie das Arbeitszimmer und durchschritten den großen Wohnraum. Patrizia öffnete die Glastür, die Teil einer breiten Fensterfront war, und sie traten ins Freie.
»Wow! Was ist das denn?«, entfuhr es Cristina.
Von der Straße aus war das Gebäude hauptsächlich durch seine großen geschwungenen Portico-Bogen aufgefallen. Dass das mehrstöckige Wohnhaus sich direkt an die Mauer einer Kirche anschmiegte, hatte man nicht erkennen können. Jetzt standen sie auf Alessandra Amedeos langgestreckter Dachterrasse und blickten auf eine Reihe von Kirchenfenstern. Der obere Teil des Längsschiffes bildete die Rückwand der Terrasse. Etwas weiter oberhalb begann das rotgeziegelte Kirchendach. Patrizia und Cristina schritten die Terrasse ab und blickten zurück. Von hier aus sah man die runde Kuppel über dem Chor, die grünlich in der Sonne glänzte.
Cristina zeigte auf eine von Zitronenbäumchen umgebene Rattan-Sitzgruppe im Zentrum. »Ich nehme alles zurück. So schlecht war ihr Geschmack nun auch wieder nicht.« Dann fiel ihr Blick auf Patrizia. »Sag mal, was hältst du da eigentlich die ganze Zeit in der Hand?«
»Ach ja! Das ist der ›Corriere della Sera‹ von gestern. Lies mal.«
Sie reichte Cristina die Zeitung mit Alessandra Amedeos vernichtender Kritik. Cristina überflog die Zeilen und zog die Augenbrauen hoch.
»Hm. Zuerst fängt es ja noch ganz gut an, aber hör mal hier: ›Dass die Gruppe ausgerechnet bei jenem Komponisten versagt, den sich die international bekannte Sängerin Eleonora Salazar seit Jahren auf die Fahnen geschrieben hat, ist unverständlich. Die Gruppe setzte die vier schönsten Madrigale Carlo Gesualdos mit solcher Kraftlosigkeit um, dass sich ihr Komponist im Grab herumgedreht haben dürfte.‹ Autsch, das tut weh. Und dann auch noch in einer überregionalen Tageszeitung. Apropos, den Namen Eleonora Salazar kennen wir doch. Erinnerst du dich? Gabriella Molinari hat heute Morgen von ihr erzählt. Ich glaube, sie war genau auf diesem Konzert.«
»Stimmt. Allerdings fand sie es toll. Schon komisch, dass die Ansichten so auseinandergehen.«
»Hm. Zumal unsere Gabriella ja keine unerfahrene Kunstbanausin ist. Ich kriege immer Schuldgefühle, wenn sie mir erzählt, wo sie schon wieder war.«
Sie blätterte eine Seite weiter und las erneut. »He, schau mal …«
Patrizia stellte sich neben sie. »Das ist das Programm von dem Konzert gestern Abend im Castello di Arechi.«
Sie überflogen die Abfolge der dargebotenen Musikstücke. Bach, Händel, Brahms.
»Streichkonzerte, so wie der Hausmeister sagte«, meinte Cristina.
Patrizia nickte. »Ja, aber zwei Dinge sind doch komisch, siehst du es auch?« Cristina dachte nach, dann meinte sie: »Es ist wirklich alles nur für Streicher, kein einziges Klavierstück dabei!«
»Genau! Unser Ziegenbesitzer, dieser Massimo Maiori, sprach aber davon, Klavierspiel gehört zu haben.«
»Na ja, vielleicht war das Klavier ja auch nur eine ungeplante Zugabe von einem der Musiker. Etwas, was nicht im Programm stand.«
»Möglich. Trotzdem ist noch etwas anderes seltsam. Achte doch mal auf die Zeit. Das Konzert fing um 19 Uhr an, dieser Maiori hat das Klavierspiel aber erst kurz vor Mitternacht gehört. Glaubst du wirklich, dass die da oben geschlagene fünf Stunden gespielt haben? Das wäre doch eher ungewöhnlich, oder nicht?«
»Schon«, gab Cristina zu. »Auch wenn es in Ausnahmefällen sicher mal vorkommt. Auf jeden Fall lässt es sich leicht nachprüfen.« Sie holte ihr Handy aus der Tasche und tippte.
In dem Augenblick klingelte Patrizias Telefon. Es war Davide. Er sprach schnell und aufgeregt. Offenbar hatte er eine wichtige Neuigkeit. Cristina legte wieder auf und versuchte mitzuhören, doch sie verstand nichts.
»Na sag schon!«, drängte sie, als das Gespräch beendet war.
»Den Anruf bei Angelo Nardi kannst du dir fürs Erste sparen«, antwortete Patrizia. »Weitere Anwohner auf dem Berg gibt es zwar nicht, aber Davide hat mit den Besitzern des Restaurants gesprochen, das ein Stück unterhalb der Burg an der Straße liegt. Das ›Il Castellano‹. Die haben bestätigt, dass Alessandra Amedeo gestern Abend nach dem Konzert bei ihnen gegessen hat. Sie kannten sie persönlich, weil sie nach jeder Veranstaltung auf der Burg dort einkehrte. Sie war übrigens in Begleitung. Den Mann kannten sie nur vom Sehen, nicht namentlich. Allerdings haben sie ausgesagt, dass die beiden sich gestritten haben, und zwar fast die ganze Zeit …«
»Nämlich …?«
»Von circa halb zehn bis etwa elf Uhr.«
*
Einige Stunden später saß Patrizia am Gartentisch ihres Hauses in Ogliara, einem hoch über der Stadt am Berg gelegenen Vorort von Salerno. Noch war es hell, doch unter der mit Blauregen überwachsenen Veranda hielt schon die Abendstimmung Einzug. Einen Blick auf den Golf hatte Patrizia von ihrer Terrasse aus nicht. Eine Häuserreihe weiter unten versperrte ihr die Aussicht. Aus einer der Wohnungen erklangen Stimmen. Offenbar eine zum Abendessen versammelte Familie.
Patrizia wiegte das Rotweinglas in der Hand, und ihr Blick fiel auf die Mauer des Nachbarhauses, die ihren Garten zur Linken begrenzte. Die Wohnung im Erdgeschoss war dunkel. Das war ungewohnt. Patrizia wurde sich bewusst, wie sehr ihr die erleuchteten Fenster ihres Nachbarn Gianni Petta fehlten. Auch wenn sie sich nicht ständig sahen, war es beruhigend, ihn in unmittelbarer Nähe zu wissen. Aber im Augenblick war er auf einer veterinärmedizinischen Konferenz in Meran, und bis zu seiner Rückkehr würden noch mehrere Tage vergehen.
Patrizia verdrängte den Gedanken und griff sich die Zeitung auf dem Tisch. Es war die gestrige Ausgabe der lokalen Tageszeitung »La Città«. Sie studierte den Kulturteil. Doch eine Rezension über das umstrittene Konzert Eleonora Salazars war nicht dabei. Offenbar hatte Alessandra Amedeo ihre Kritik nur an die überregionale Zeitung verkauft.
Patrizia dachte nach. Sie mussten unbedingt herausfinden, mit wem das Opfer am Vorabend im Restaurant gestritten hatte. Es war offenbar ein Bekannter, denn sie hatten miteinander gegessen. Leider war in der Wohnung der Toten kein Terminkalender aufgetaucht. Konnte es sein, dass Alessandra Amedeo keinen besaß? Eigentlich ausgeschlossen.
Wahrscheinlich hatte sie die Kalenderfunktion ihres bislang verschwundenen Handys benutzt. Cristina war an der Sache dran, hatte sich aber noch nicht gemeldet. In einem Anflug von Ungeduld griff Patrizia zum Telefon und wählte die Nummer ihrer Kollegin. Als abgenommen wurde, ging sie sofort zum Angriff über.
»Ciao, Cristina, immer noch keine Neuigkeiten zum Handy?«
Einen Augenblick blieb es still in der Leitung, dann erklang eine fröhliche Stimme: »Ciao, Patrizia, bist du das? Hier ist Chicca! Mama hat gerade die Milch überkochen lassen, und Chiara schreit, weil sie nicht ins Bett will.«
Chicca? Natürlich! Manchmal vergaß Patrizia glatt, dass ihre Kollegin eine Familie mit zwei kleinen Töchtern hatte. In dem Augenblick wurde Chicca der Hörer aus der Hand genommen. Cristinas Stimme klang atemlos, als hätte sie gerade einen Workout hinter sich. Sie kam sofort zur Sache.
»Pronto, Patrizia, ich hätte dich auch gleich angerufen. Mit guten und schlechten Neuigkeiten. Welche willst du zuerst hören?«
»Die gute.«
»Die gute ist, dass es natürlich kein Problem war, Alessandra Amedeos Handynummer rauszufinden, und offenbar ist das Ding auch eingeschaltet. Wir haben es also orten lassen.«
»Na super! Was kann es da noch für schlechte Neuigkeiten geben?«
»Na ja, das Problem ist, dass keine exakte GPS-Ortung möglich ist. Wahrscheinlich hat die Amedeo diese Funktion ausgeschaltet. Mach ich ja auch, wenn ich sie nicht brauche, um den Akku zu schonen.«
»Hm, und die Ortung via Sendemasten?«, fragte Patrizia.
»Haben wir gemacht, aber da ist das Ergebnis eben nicht ganz so präzise. Das Handy ist tatsächlich bei dem Sendemast eingeloggt, der den Bereich um das Castello abdeckt, aber wo genau sie es verloren hat, können wir nicht feststellen. Bisher hat die Spurensicherung es jedenfalls noch nicht gefunden.«
»Verdammt!«, entfuhr es Patrizia. »Vielleicht wurde es ihr auch abgenommen und weggeworfen, dann kann es überall dort oben in der Pampa liegen. Und wenn demnächst der Akku leer ist, suchen wir die Nadel im Heuhaufen.«
Cristina am anderen Ende der Leitung seufzte. »Da hast du leider recht. Ich habe ihre Nummer übrigens in regelmäßigen Abständen angerufen und gehofft, dass jemand von der Spurensicherung es hört und rangeht, aber Fehlanzeige.«
»Wer weiß, ob es überhaupt klingelt«, warf Patrizia ein. »Alessandra Amedeo kam gerade aus einem Konzert. Kann gut sein, dass der Klingelton noch ausgeschaltet war. Aber gib mir mal die Nummer, ich rufe weiter an. Du hast heute Abend offenbar andere Probleme.« Cristina diktierte ihr die Nummer, da ertönte im Hintergrund ein langgezogenes Heulen, gefolgt von der entnervten Stimme Maurizios, Cristinas Mann.
»Chiara will nicht ins Bett?«, fragte Patrizia vorsichtig.
»Der ganz normale Abendwahnsinn«, meinte Cristina trocken. »Manchmal wünsche ich mir fast, ich wäre schon wieder in meinem ruhigen Büro auf der Suche nach einem Mörder.«
Patrizia lachte.
Nachdem sie das Gespräch beendet hatten, saß sie einige Minuten regungslos da. Die Stimmen aus der Wohnung unterhalb ihres Gartens waren verstummt. Es war sehr still. Kein Lüftchen wehte, und dem in voller Blüte stehenden Blauregen entströmte ein betörender Duft.
Das ist der Grund, warum ich hier oben auf dem Berg wohne. Sie trank einen Schluck Rotwein. Es ist der einzige Ort, an dem ich diesem Sog da unten entrückt bin und mich wenigstens etwas entspannen kann. Ein Ort, an dem ich Zitronenbäume und Blauregen sehe und die Bilder der Toten in den Hintergrund treten.
Die Bilder von Alessandra Amedeo …
Sie seufzte. Noch gelang es ihr, nicht ständig an den geschundenen Körper der Journalistin zu denken. Aber sie wusste auch, dass diese Fähigkeit im Laufe der Ermittlung abnehmen würde. Dann, wenn der Druck und die Erschöpfung überhandnahmen und man dünnhäutig wurde. Wie lange würde sie ihre Terrasse bei Sonnenuntergang noch genießen können, bevor auch die jüngsten Bilder sie bis hierher verfolgen und ihr den Schlaf rauben würden? Sie versuchte, den Gedanken abzuschütteln, und griff zum Telefon.
*
Bob Kingfisher erreichte den Parkplatz unterhalb der Burg und stieg in sein Auto. Trotz der langen Junitage konnte man die Dämmerung vorausahnen, und hier oben im Schatten der Burg war es schon fast düster. Wie viele Stunden er im Castello verbracht hatte, wollte er gar nicht wissen. Jetzt war er einfach nur hundemüde. Morgen würde es weitergehen. Bei einem so großflächigen Gebäude konnte die Arbeit dauern. Dazu kam, dass er Leute von der Burg hatte abziehen müssen, um Spuren zwischen dem Restaurant und dem Castello zu sichern. Seine Kollegen hatten am Nachmittag in der Nähe des Lokals begonnen, doch soviel er wusste, waren sie noch nicht weit gekommen. Und auch Alessandra Amedeos Alfa Romeo, den sie unterhalb des Parkplatzes sichergestellt und abgeschleppt hatten, wartete noch auf seine Untersuchung.
Bob Kingfisher startete den Wagen und bog auf die kurvige Straße, die in die Stadt hinunterführte. Mit einer Hand legte er eine CD ein, und Emmylou Harris sang »Goodbye«. Bob lehnte sich in seinem Sitz zurück. Die traurig-intensive Stimme der Sängerin passte zur Abendstimmung, und er begann sich zu entspannen.
Doch mit einem Mal krachte es, und er spürte einen Schlag gegen die Unterseite des Autos. Fluchend hielt er an. Hoffentlich ist nichts kaputt. Er stieg aus, umrundete den Wagen und fluchte noch einmal. Diese verdammten Steine! Er erinnerte sich vage daran, dass er schon am Morgen um sie herumgefahren war, aber da hatte man sie wenigstens besser sehen können.
Bob bückte sich und untersuchte den Wagen, doch es war alles in Ordnung.
Langsam fuhr er weiter und spähte dabei vor sich in die Dämmerung.
Da! Noch mehr Steine! Wieder fünf oder sechs in einer Reihe quer über den Fahrweg! Ob da einer versuchte, den Autofahrern einen üblen Streich zu spielen? Aber wieso auf dieser Nebenstraße, die ohnehin nur von Konzertbesuchern benutzt wurde? Bob schüttelte missbilligend den Kopf.
Keine Minute später sah er die dritte Reihe. Diesmal parkte er den Wagen am Straßenrand und stieg aus. Die Sache fing an, ihn zu interessieren. Am Morgen hatte er es bei seiner Ankunft so eilig gehabt, dass er dem schlechten Zustand der Straße keine Beachtung geschenkt hatte. Man war schließlich nicht in der Schweiz! Er war um die Brocken herumgefahren und hatte sie auf der Stelle wieder vergessen.
Aber etwas stimmte hier nicht. Das sagte ihm sein Gefühl. Er kniete sich hin und betrachtete die Steine genauer. Sie waren ganz offenbar aus der Gegend, denn sie sahen aus wie alle anderen auf dem Berg. Grau und unscheinbar. Seltsam war nur, dass sie alle die gleiche Größe hatten. Etwa die einer Boccia-Kugel. Wie die ersten beiden Reihen formten sie eine holprige Linie von einer Straßenseite zur anderen. Nur zwei der Steine lagen etwas weiter unterhalb. Möglicherweise waren sie von einem Auto aus der Reihe gestoßen worden, vielleicht sogar von einem Polizeifahrzeug, denn seit ihrer Ankunft am Morgen war die Straße für die Öffentlichkeit gesperrt.
Bob Kingfisher stand auf und ging zu Fuß bergab. Dabei zählte er seine Schritte. Nach etwa sechzig, siebzig Metern traf er auf eine neue Reihe. Er untersuchte sie und machte Fotos. Dann ging er weiter. Sechzig Meter, achtzig, hundert.
Nichts.
Er suchte den Straßenverlauf mit den Augen ab. Etwa fünfhundert Meter unterhalb konnte er das Restaurant ausmachen, in dem das Opfer nach dem Konzert gegessen hatte. Er seufzte und setzte sich erneut in Bewegung, fand jedoch keine weiteren Steine.
Am Lokal angekommen wechselte er ein paar Worte mit den Uniformierten, die die Absperrung bewachten. Dann drehte er um und ging zurück. Die Straße war steil. Er schwitzte und kam sich lächerlich vor. Was zum Teufel mache ich hier? Steine fotografieren? Er schüttelte den Kopf und stapfte weiter. Endlich erreichte er aufs Neue die erste Reihe, dann die zweite, dritte und vierte. Zwischen jeder von ihnen lagen circa sechzig bis siebzig Meter. Alle sahen sie ähnlich, aber nicht gleich aus.
Bei der vierten und letzten Reihe blieb er stehen und trommelte sich mit den Fingern auf die Glatze, wie immer, wenn er scharf nachdachte. War er ein Idiot, weil er immer noch hier oben stand, statt mit Emmylou Harris »Goodbye« zu sagen und sich in seiner Wohnung etwas zu essen zu machen? Nein, irgendetwas war faul an der Sache. Die regelmäßigen Abstände, die gleichmäßige Größe der Brocken.
Wie schon bei den ersten drei Reihen sah Bob Kingfisher sich auch bei der letzten am Straßenrand um und suchte vorsichtig das Buschwerk ab. Tief unter ihm lag der Golf. Die untergehende Sonne tauchte den Horizont und das Meer in intensives Orange, und zu seiner Rechten bildeten die in tiefem Schatten liegenden Berge der Amalfiküste eine einzige schwarze Masse. Nur die Bergzacken hoben sich scharf gegen den helleren Himmel ab. Einen Augenblick lang genoss Bob die Abendstimmung und atmete die würzige Luft ein. Wilder Rosmarin und Thymian. Es tat gut. Dann riss er den Blick von der Aussicht los und konzentrierte sich wieder auf den Boden zwischen den Sträuchern. In seinem Augenwinkel blitzte etwas auf. Eine Glasscherbe? Er trat näher und wollte schon die Hand ausstrecken, da erkannte er den Gegenstand und hielt abrupt inne. Es war ein Smartphone!
Er zog die Einweghandschuhe über, nahm das Handy vorsichtig in die Hand und strich über den Bildschirm. Der Akku war schwach, aber noch nicht leer. Ohne nachzudenken, öffnete er den Kalender und rief den Vortag auf.
19 Uhr Konzert mit Paolo.
Wenn das nicht Alessandra Amedeos Handy war! Er tippte auf die Kontaktliste.
Bbrrrrrr.
Die Vibration kam so unerwartet, dass Bob das Telefon beinahe fallen gelassen hätte. Erst als der Schreckmoment vorüber war, wurde ihm klar, dass ein Anruf einging. Das Handy kannte die Nummer nicht, er dafür umso besser.
Er tippte auf Grün.
»Buonasera, Signora Commissaria! So spät noch bei der Arbeit? Kein Privatleben? Nichts Besseres zu tun?«
»Zieh bloß keine voreiligen Schlüsse von dir auf andere! Santo cielo, Bob, heißt das, du hast das Handy der Amedeo gefunden? Wo zum Teufel war es?«
»In den Büschen neben einer sehr interessanten Reihe aus Steinen auf der Straße unterhalb des Castellos. Von diesen Steinreihen gibt es übrigens mehrere. Vier, um genau zu sein.«
»Interessante Steinreihen? Was redest du da? Meinst du die nervigen Brocken, die da überall auf der Straße rumlagen?«
»Nervige Brocken?«, rief Bob aus, und Patrizia wusste, dass sein glattrasierter Kopf sich bei dieser Tonlage rot verfärbte. »Beleidige bloß unsere Indizien nicht, sonst beschließen sie am Ende noch, ihr Geheimnis für sich zu behalten.«
»Du sprichst in Rätseln. Geht’s auch etwas klarer?«
»Was die Steine angeht, leider noch nicht. Aber ich habe etwas anderes für dich. Ich habe mir den Handykalender unserer Journalistin angesehen, und es gibt einen Eintrag für den gestrigen Abend.« Er brach ab.
Patrizia stöhnte, sagte aber nichts. Bob war dafür bekannt, seine Neuigkeiten häppchenweise zu präsentieren, bis man vor Ungeduld fast platzte.
Dann war die Kunstpause zu Ende. »19 Uhr Konzert mit Paolo. Sagt dir der Name was?«
»Paolo? Kein Nachname, keine Telefonnummer? Hast du schon in die Kontaktliste geschaut?«
»Good Lord! Du kriegst den Hals auch nie voll. Zur Kontaktliste bin ich noch nicht gekommen, weil du ja …«
Das Gespräch war weg. Entnervt wählte Patrizia die Nummer erneut, doch diesmal erhielt sie eine automatische Mitteilung. Das Gerät war ausgeschaltet. Der Akku war leer.
Patrizia lehnte sich zurück und atmete tief durch.
Paolo also. Alessandra Amedeo war mit einem Paolo im Konzert gewesen, und höchstwahrscheinlich war er es auch, mit dem sie anschließend im Restaurant »Il Castellano« gegessen hatte.
Gegessen … und gestritten.
Sobald Bob das Handy wieder aufgeladen hatte, würden sie sicher schnell herausfinden, wer dieser Mann war.
Patrizia trank den letzten Schluck Wein und stand auf. Auf der Veranda war es düster geworden. Doch als sie die Zeitung zuschlagen wollte, fiel ihr Blick auf das Impressum des Kulturteils und blieb an einer Zeile hängen:
Redattore Editoriale stand da. Und ein Name. Sie beugte sich vor, um ihn im schwindenden Licht besser lesen zu können.
Redattore Editoriale: Paolo Pacifico.
Kapitel 3
Mittwoch, 27. Juni 2012
Sie hatten früher gehen können. Stromausfall. Genau zur richtigen Zeit. Ein Hoch auf das Elektrizitätswerk. Gerade heute passte ihm das besonders gut, denn Eleonora hatte Geburtstag. Auf dem Weg nach Hause hatte er noch einen Abstecher zu dem Musikgeschäft gemacht, in dem er schon vor Wochen das gesehen hatte, was er ihr schenken wollte. Er fühlte das Päckchen in der Hand. Von außen konnte man nicht erkennen, was es war.
Ein Metronom.
Und nicht irgendeins. Es war ein Wittner 811M, Mahagonigehäuse. Er hatte es nicht einpacken lassen. Zu Hause würde er es aus der Schachtel nehmen, anstoßen und über Eleonoras Gesicht lachen, wenn sie das sanfte, regelmäßige Ticken hörte, noch bevor sie es sehen konnte.
Kurz darauf öffnete er die Wohnungstür. Vorsichtig. Er wollte sie überraschen. Lautlos drehte sich der Schlüssel im Schloss, und er trat ein, lauschte. Nichts. Konnte es sein, dass sie nicht da war? Leise ging er zu ihrem Arbeitszimmer. Die Tür stand offen. Es war leer. Ebenso wie das Wohnzimmer und die Küche. Enttäuschung stieg in ihm auf. Er setzte sich an den Esstisch, stellte das Päckchen ab und überlegte. Wahrscheinlich machte sie noch kurz eine Besorgung. Immerhin war er zwei Stunden zu früh dran.
Er nahm das Päckchen und entfernte das Papier. Dann stellte er das Metronom behutsam vor sich hin. Im schräg einfallenden Licht konnte man die Fingerabdrücke der Verkäuferin auf dem Mahagonigehäuse sehen. Er ging in die Küche, holte ein Tuch und begann, das warm leuchtende Holz zu polieren, bis es glänzte. Dann streckte er langsam die Hand aus und berührte den Zeiger. Es bedurfte nicht viel. Nur ein zartes Antippen mit der Fingerspitze, und das dünne Metallstäbchen setzte sich in Bewegung.
Tick.
Tack.
Langsam und gemächlich.
Er war sicher, dass Eleonora sich freuen würde. Seit Wochen beklagte sie sich, kein Metronom mehr zu haben, seit das alte heruntergefallen war. Kein großer Verlust. Das Ding war nicht mehr viel wert gewesen. Nur dass Eleonora sich natürlich selber nie die Zeit nahm, ein neues zu kaufen.
Er sah auf. Ein Geräusch? Tatsächlich. Es kam aus dem Schlafzimmer. Eleonora musste sich hingelegt haben und war wieder aufgewacht. Behutsam nahm er das Metronom und setzte es auf die linke Handfläche. Er wollte keine neuen Fingerabdrücke hinterlassen. Der Zeiger schwang unbeirrt fort.
Tick.
Tack.
Als er am Schlafzimmer ankam, war es wieder still. Vorsichtig drückte er die Klinke herunter. Nur für den Fall, dass Eleonora wieder eingeschlafen war. Die Tür schwang auf, und er blickte zum Bett. Der Rücken eines Mannes. Sein Körper bewegte sich kraftvoll auf und ab.
Und dann sah er sie.
Eleonora.
Fast hätte er sie nicht erkannt. Ihre Züge waren verzerrt, und aus ihrem Mund kamen seltsame Laute. Ihre linke Hand umschlang den Hals des Mannes. Endlose Sekunden vergingen, ohne dass er begriff, was vor ihm geschah. Sein Gehirn weigerte sich, die Informationen zu verarbeiten.
Tick.
Tack.
Das Metronom tickte die Sekunden herunter. Eleonoras Mund bewegte sich, als ob er Laute ausstieße, doch er hörte nichts mehr. Nichts außer dem Ticken, das immer lauter wurde, ihm in den Ohren dröhnte.
Jetzt hatte es auch Eleonora gehört. Sie wandte den Kopf, ihre Augen waren auf ihn gerichtet. Dann bäumte ihr Oberkörper sich auf. Und während der Orgasmus in Wellen über sie hinwegging, schrie sie auf. Schrie ihre Lust, ihre Wut heraus. Schrie ihn an. Ja, der Schrei galt ihm, doch er hörte ihn nicht. Er nahm die Bewegung wahr wie in einem Stummfilm. Nur das Ticken füllte seinen Kopf. Langsam und gleichmäßig. Einem Rhythmus folgend, der nicht zu dem passte, was er vor sich sah.
Jetzt wandte ihm auch der Mann das Gesicht zu. Unwillkürlich trat er einen Schritt zurück.
Der andere wirkte überrascht, erst betroffen, dann belustigt. Und während er sich von Eleonora löste, hob und senkte sich sein Brustkorb, seine Augen wurden schmal. Er lachte, lachte ihn an. Nein – er lachte ihn aus.
Das Ticken in seinen Ohren schwoll zu einem ohrenbetäubenden Lärm an. Er wollte, dass es aufhörte. Wollte das Metronom nach dem Kerl werfen, ihn am Kopf treffen oder es wenigstens fallen lassen. Doch seine Hand krampfte sich um das Gerät, unfähig es loszulassen.
Er wandte sich ab und ging auf den Flur, als wäre sein Körper eine Marionette, die von einem unsichtbaren Puppenspieler bewegt wurde. Die Wohnungstür öffnete sich wie von selbst, und er trat hinaus auf den Treppenabsatz. Als er sich noch einmal umdrehte, sah er den Mann im Flur stehen. Ohne nachzudenken, packte er die Tür und knallte sie zu. Und diesen Knall hörte er. Sein Echo hallte im Treppenhaus, bevor es nach und nach in einen lauten Alarmton überging.
Biep, biep, biep.
Er riss die Augen auf. Einen Augenblick lang war er desorientiert, wusste nicht, wo er war. Dann kehrte er in die Realität zurück. Im Zimmer war es hell. Sonne schien durch die Vorhänge. Doch die Stimmung hatte nichts Friedliches. Der Alarm schrillte in seinen Ohren, und er richtete sich stöhnend auf. 7 Uhr. Er versetzte dem Wecker einen Schlag. Endlich Stille. Schwer ließ er sich aufs Kissen zurücksinken und dachte an den Traum.
Es war unfassbar, dass er ihn immer noch hatte. Diesen … und den anderen. Immer noch und immer wieder. Dazu jedes Mal mit der gleichen Intensität. Einen Moment lang blieb er regungslos liegen, schloss die Augen und versuchte, ruhig zu atmen, den Raum um sich zu spüren, den Traum abzuschütteln. Dann gab er sich einen Ruck und setzte sich auf. Heute konnte er unmöglich zu spät kommen.
*
Patrizia trommelte mit dem Bleistift auf ihr Notizbuch, und auch Pietro Di Leva schaute verdrossen drein, wenngleich er bisher nichts gesagt hatte. Noch nicht.
Endlich hörte man Stimmen. Die Tür ging auf, und die beiden Kriminalassistentinnen Antonia und Lydia kamen herein, gefolgt von ihren uniformierten Kollegen Marco und Leo, die Di Leva für die neu gegründete SOKO