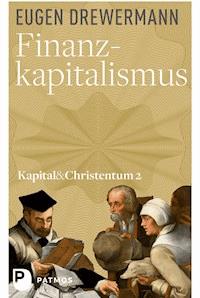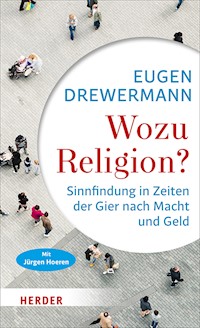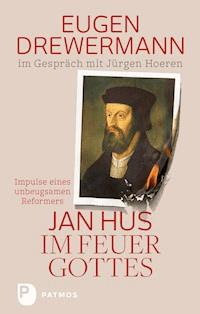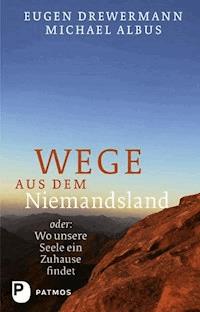Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Man findet sie in jeder gut sortierten Bibliothek: die Sagen des klassischen Altertums. Sie gehören zur Mitte europäischen Kulturguts. Wem fallen nicht ein paar Brocken zur Schlacht um Troja, zu den Irrfahrten des Odysseus oder zum Liebesdrama von Orpheus und Eurydike ein? Aber worum geht es in den Sagen und Mythen eigentlich? Eugen Drewermann führt uns in diesem Buch mit tiefenpsychologisch geschärftem Blick sicher durch die Enge zwischen Skylla und Charybdis. Er erschließt, warum Liebe, Leid und Tod - drei Konstanten menschlichen Daseins - die beherrschenden Themen in vielen antiken Mythen sind und wie ein tieferes und richtiges Verständnis dieser alten Texte uns heute das Leben besser verstehen lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1461
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Über den Autor
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Eugen Drewermann
Liebe, Leid und Tod
Daseinsdeutung in antiken Mythen
Patmos Verlag
Inhalt
Einstimmung
I. Geschichten von Liebe und Leid
A) Liebe als Dualunion oder: Der Wunsch nach Einssein
1) Pygmalion oder: Von der Kunstliebe zur Liebeskunst
2) Narkissos und Echo oder: Die Flucht zu sich selbst und die Flucht vor sich selbst
3) Hermaphroditos und Salmakis oder: Die Verschmelzung der Gegensätze
B) Tabus oder: Zerrissene Zäune
1) Byblis und Kaunos oder: Zwischen Gottesrecht und Menschensatzung
2) Myrrha und Kinyras oder: Zwischen Sünde und Sehnsucht – die Suche nach dem dritten Weg
3) Phädra und Hippolytos oder: Verlorene Jugend
C) Unterschiede, die Unterschiede machen, oder: Ungleichheiten und Ungleichzeitigkeiten
1) Eos und Tithonos oder: Das Scheitern am Altern
2) Polyphem und Galateia oder: Tödliches Verstoßensein
3) Atalante und Hippomenes oder: Liebe als Wettkampf
D) Mißtrauen, Eifersucht und Untreue oder: Selbstzerstörung in verängsteter Liebe
1) Kephalos und Prokris oder: Von der tödlichen Macht des Mißtrauens
2) Skylla und Kirke, Aglauros und Herse, Semele und Hera oder: Von der zerstörerischen Macht der Eifersucht
3) Medeia und Iason oder: Die Rache einer betrogenen Fremden
E) Verbotene Liebe oder: An den Grenzen der Gesellschaft
1) Hero und Leander oder: Eine Liebe im verborgenen
2) Pyramus und Thisbe oder: Die Flucht in den Tod
3) Laodameia und Protesilaos oder: Der lieblose, leidige Krieg
F) Abschied oder: Von Trennung und Tod
1) Kalypso und Odysseus oder: Die Einsamkeit der Gebenden
2) Dido und Aeneas oder: Eine Frau zwischen zwei Männern
3) Andromache und Hektor oder: Kriegers Abschied
II. Geschichten von Tod und Unsterblichkeit
A) Erfahrungen
1) Niobe und Aktaion oder: Zwei Weisen der Bewußtwerdung zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit
2) Alkyone und Keÿx oder: Liebe, die den Tod besiegt
3) Deianeira und Herakles oder: Erhebung über Schuld und Schmerz
B) Bilder
1) Phaethon, Helios und Klymene oder: Das Bild des Bernsteins
2) Selene und Endymion oder: Das Bild des Mondes
3) Aphrodite und Adonis oder: Das Bild der Blume
C) Mysterien
1) Demeter und Persephone oder: Ein Kind zweier Welten
2) Alkestis und Admetos oder: Tod, wo ist dein Stachel?
3) Orpheus und Eurydike oder: Wir werden uns wiedersehen
Nachklang: Paulus in Athen oder: Man kann nur richtig leben im Unendlichen
ANHANG
Mythische Stammbäume
Karten
Bildnachweis
Bibliographie
Anmerkungen
«Der Kern, das Zentrum der Poesie
ist in der Mythologie zu finden
und in den Mysterien der Alten.
Sättigt das Gefühl des Lebens
mit der Idee des Unendlichen,
und ihr werdet die Alten verstehen
und die Poesie.»
Friedrich Schlegel: Ideen, 85, in: Werke, I 273
«Ite procul, Musae, si non prodestis amanti: non ego vos, ut sint / bella canenda, colo.» «Bleibt, ihr Musen, mir weit, wenn nicht ihr dem Liebenden beisteht. Nein, ich ehre euch nicht / Kriegspropaganda zulieb.»
Tibull: Liebeselegien, II 4,15–16
Für Jörg-Dieter Kogel
Einstimmung
Warum antike Mythen?
Tafel 1a: Apollontempel in Delphi
Weil sie, am Anfang abendländischer Kultur, all die Aspekte unseres Daseins abbilden, ausagieren und ausformulieren, die wesentlich dazu gehören, daß wir Menschen sind. Man hat sie einst erzählt, um Rituale zu begründen, um Herrscher einzusetzen oder um Helden zu verehren, auch um Gegebenheiten der Natur – bestimmte Bäume, Blumen, Flüsse, Felsen, Steine, Tiere – in ihrer Herkunft zu «erklären»; doch nur zwei Themen sind derart bedeutend, daß sie zu allen Zeiten Deutungen verlangen: die Liebe und der Tod – und was dazwischen liegt: das Glück und insbesondere das Leid. Deuten ist nicht erklären noch verklären, wohl aber aufzeigen, verdeutlichen, bewußtmachen, zur Stellungnahme nötigen. «Erkenne dich selbst» – es war Apoll, der Gott von Delphi1, der an dem Ort, da er die Riesenschlange Python tötete, diese Verpflichtung jedem auferlegte, der seinen Tempel zu betreten dachte; denn seine Pfeile wirkten beides: Licht, Helligkeit und Wärme, aber auch Krankheit, Schmerz und jähen Tod. Von den Extremen unseres Daseins her gilt es mithin, den Ort zu finden, da das Leben seine Mitte hat. Zeus selbst, so wird erzählt, sandte von den äußersten Rändern der Welt im Osten und Westen zwei Adler aus, und sie trafen sich eben dort, am «Nabel» der Erde. (Vgl. Tafel 1a.) Solch eine Pilgerreise des Geistes zum Zentrum, da die Gegensätze sich einen, sollte unser Leben sein. Was also ist es mit uns zwischen Liebe und Tod?
Gäbe es nur den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang des Phoibos Apollon, so fiele die Antwort noch relativ leicht; doch es gibt auch Oben und Unten, Himmel und Hades, Jubel und Jammer, Aufstieg und Abschied, Ekstase und Neubeginn, – es gibt auch Dionysos, den Gott der rauschhaften Beseligung und des tragischen Erwachens, auch er gehört zu Delphi, wo er während der Wintermonate regiert; und so gilt es, sie beide: Denken und Fühlen, Kultur und Natur, Sollen und Wollen im eigenen Leben zur Einheit zu führen. Es gilt, doch läßt sich befehlen, daß es gelingt?
Notwendig sind die antiken Mythen von Liebe und Tod schon deshalb, weil sie den Menschen weitaus hilfloser zeigen, als ihn Moral und Justiz gerne sähen. Was wird aus der sonnenhellen Klarheit sittlicher Selbstbestimmung, wenn selbst der Gott, der sie verkörpert, Apoll, getroffen von einem der Pfeile des Eros, der Flußnymphe Daphne in unglückseliger Sehnsucht nachstreben muß, ohne sie je zu erreichen? Die Halbgöttin wird, um dem Gott zu entgehen, ihren begehrenswerten Körper abstreifen und sich in einen Lorbeerbaum verwandeln, hat doch Aphrodites Sohn mit einem anderen Pfeil ihr Herz zu Flucht und zu Abwehr verwundet. Man sieht: nicht einmal die Götter und Menschen gehören sich selbst, wenn sie lieben; – Aphrodite nicht, wenn sie nach dem Willen der Unterweltgöttin Persephone in Verlangen erglüht nach Adonis, Eros nicht, wenn er Psyche begehrt (Apuleius – um 125–um 180 – hat daraus eine philosophische Allegorese geformt)2, Zeus nicht, wenn er in immer neuen Verstellungen mit Göttinnen, Nymphen und all den sterblichen Frauen und Männern sich paart. Wie könnten da Menschen in Freiheit verfügen, wohin Liebe sie drängt? Göttliche Kräfte, unendlich stärker als sie, ergreifen von ihnen Besitz. Und wer, wenn es so steht, wollte sie richten? Doch räumt man das ein, ändert sich das ganze Menschenbild. Es ist nicht wahr, daß Menschen «gut» sein könnten, einfach weil sie wollten. Wie aber hilft man ihnen, aus den Widersprüchen ihrer Psyche durch Selbsterkenntnis ihre Einheit zu gewinnen? Das ist die erste wesentliche Frage bei der Lektüre der antiken Mythen.
Ethisch betrachtet, gewiß, dürfte alles das gar nicht sich aufführen, – daß eine Tochter (Myrrha) ihren Vater (Kinyras) liebt, eine Schwester (Byblis) ihren Bruder (Kaunos), eine Ehefrau (wie Phädra) einen weit Jüngeren (Hippolytos) …, und doch, wer all diese Schicksale vor sich sieht, versteht: unwichtig sind vergleichsweise die einzelnen Namen der Göttinnen und der Götter, Nymphen, Heroinen und Heroen, wichtig sind die Gestaltungen und Gestalten der Seele selbst, die in ihnen vor Augen treten. Wohl, derlei sollte nicht sein, doch wenn es geschieht? Gegen den eigenen Willen, im Widerspruch zu sich selbst, in Überwältigung scheinbar unbeherrschbarer Leiden und Leidenschaften? Wenn’s als Ereignis erzählt wird, kann es sich wieder ereignen, und es hilft dagegen nicht der Appell von Verbot und Androhung von Strafe. Selbstverfügung und Autonomie – wie sollten sie möglich sein, solange die Seele des Menschen erscheint als die Szenerie eines göttlichen Bühnenspiels, in dem die Akteure nichts sind als die Schauspielermasken von Kräften, die sie, unbegreifbar den Tragöden selber, durchtönen wie das Evoë des bakchantischen Taumels in den Schluchten des Kithairon?
Auch das zählt zu den Grunderfahrungen der antiken Mythologie: es ist nicht nur unmöglich, es ist lebensgefährlich, die archaischen Antriebe der menschlichen Seele mit den Mitteln eines nur moralisch disziplinierten Willens niederzuhalten. Pentheus, der König von Theben, hat es versucht: er widersetzte sich den dionysischen Ausschweifungen in seiner Stadt, die ihm als weingeborener Wahnsinn, als schamloses Treiben sogar von altersergrauten Greisen und als maßloses Gieren unzüchtiger Jünglinge vorkam, als ein selbstgeschaffenes Delir aus Trance und Tanz und Taumel. Doch läßt der Zeus-Sohn Dionysos sich einkerkern und fesseln? In blinder Raserei zerriß die eigene Mutter (Agaue) den Gegner des Gottes, – sein Widerstand staute nur auf, was er aufhalten wollte, und dann durchbrach es die Dämme … Dionysos als Gott …!
Friedrich Nietzsche (1844–1900) hat dieses «Jenseits von Gut von Böse» beschworen3, dieses tragische Zurückfluten des Willens nach Lust und Lebenssteigerung und Leidenschaft im Übermaß in allem, was wirklich lebendig ist, und er hielt voller Zorn dem Kirchenchristentum entgegen, daß es zugunsten priesterlichen Machtstrebens das Leben selber in Sünde und Schuld verbogen und verlogen habe, – eine «Moral» der Unehrlichkeit und des Ressentiments, des Nicht-sehen-Wollens und Nicht-sehen-Dürfens von allem, was sichtbar wird, sobald man die unheimliche Wahrheit hinter den scheinbar so beruhigenden Formationen der Oberfläche des menschlichen Ich zu ergründen sucht. Indes, «Dionysos» ist gerade nicht schon die Mitte der Welt, er ist das konträre Extrem zu «Apoll»; das «Erkenne dich selbst» aber umfaßt notwendig beide in ihrer Wechselwirkung, in ihrer Bedingtheit und ihrer Ergänzbarkeit. Der arabische Myrrhenbaum – wenn eine Frau schließlich so aussieht, die als Mädchen verliebt war in ihren Vater; die Wasser, in welchen Byblis zu einem Strom aus Tränen zerfließt ob ihrer verbotenen Zuneigung zu ihrem Bruder; der verzweifelte Selbstmord, mit dem die unglückselige Phädra, wo nicht ihr Glück und ihr Leben, so wenigstens doch ihre Ehre zu wahren sucht – und verliert, indem sie fälschlich Hippolyt der Verführung beschuldigt –: verlangen nicht all diese dramatischen Darstellungen menschlichen Unheils in dem mächtigsten und anscheinend nur manchmal glückseligsten aller Gefühle: der Liebe, nach einem Verständnis, das nicht verwirft, und einem Verstehen, das nicht verurteilt? Flehentlich Rufende sind sie alle, diese ungehörigen, unerhört Liebenden; und wie zeitlos gewordene Schatten der Unterwelt warten sie sehnlichst darauf, sich in begreifbaren Worten mitteilen zu dürfen.
Die «Erkenntnis» des Menschlichen, auf die alles ankommt, kann deshalb nur erfolgen als eine Erlösung von den Widersprüchen der Daseinsmächte der Seele, die in der launischen Willkür der olympischen Götter mythisch sich ausspricht. Und das eigentlich ist die Aufgabe, vor welche die Mythen stellen: die Tragik des Lebens nicht länger zu leugnen, doch sie auch nicht in Nachfolge Nietzsches heroisch zu überhöhen ins Übermenschliche, ins Unmenschliche, vielmehr sie im Durcharbeiten ihrer Dynamik aus dem Zwang des Schicksalhaften herauszuführen, die «Person» hinter dem Spiel der Masken und Maskeraden in ihrer Eigenheit wahrzunehmen und ihr zu ihrer Wahrheit zu verhelfen4.
Die großen Gestalten verlorener und sich verlierender Liebe in den Mythen der Antike verlangen bereits durch das Unglück, das sie mit sich führen, nach einer Aufklärung ihres Zustandekommens, sonst bleiben sie – trotz der Erschütterung, die sie in jedem Fühlenden auslösen – im Untergrund der Psyche als Gefahr, als Antrieb, als Verhaltensmöglichkeit weiter präsent. Was da erzählt wird, kann zum Verhängnis eines jeden werden, der nicht zur rechten Zeit jener verdrängten, unheimlichen Seiten seiner Seele sich bewußt wird, die auch und gerade das selbst als ungeheuerlich Empfundene zu motivieren pflegen. Moralische Kontrolle langt nicht aus, und die Gigantenschlacht5 der Götter ist von vornherein verloren, wenn nicht die Gegensätzlichkeiten selber sich versöhnen lassen. Die «Selbsterkenntnis», die der Gott von Delphi fordert, ist einzig möglich im Raum einer Liebe, die das Unglück all der vergeblich und verderblich Liebesuchenden aufsucht, begleitet und zurückgeleitet zu dem Ursprungsbedürfnis eines jeden Menschen: vorbehaltlos und bedingungslos bejaht zu sein.
Nicht als individuelle Biographien sind die großen Liebesgeschichten der griechischen Mythen deshalb zu lesen, sondern als Grundmuster möglichen Suchens und möglicher Versuchung, als Konfigurationen der Hauptkonflikte auf dem Weg zur Liebe, als psychotherapeutische Agenda beim Passieren all der Klippen und der Riffe, an denen, oben im Gebirge wie weit draußen auf dem Meer, die Gratwanderung zum eigenen Ich, die Nachtmeerfahrt der Seele zu stürzen und zu scheitern droht. Das überzeitlich Gültige, das Typische des seelischen Erlebens, das die Mythen schildern, gilt es, zum Heilmittel all der Erkrankungen zu destillieren, zu synthetisieren, welche im Leben und Erleben Einzelner die Liebe immer wieder bis hin zu Wahn, Zerstörung und Verbrechen heraufzuführen fähig sind. So viel steht fest: der Reichtum, den an Gift wie Arznei die Mythen zu dem Thema Liebe in sich bergen, ist unerschöpflich an Hinweisen, Vorstellungshilfen, Warnungen, Erkenntnissen, Empfehlungen …, die allesamt zu lesen sind in Richtung auf sich selber. Einen philosophischen Traktat aufzunehmen mag den Intellekt erweitern, Mythen zu deuten ist nicht anders möglich, als den Blick auf die eigene Persönlichkeit zu vertiefen und zu verwandeln. Nichts Fremdes ist da zu ermitteln, vielmehr vermittelt sich das Eigene zum Ort des Austrags eben dessen, was sich im Mythos als Begebenheit in Wort und Bild darbietet. Was sind, in Freundschaft, Liebe, Ehe, die Schwierigkeiten, die am häufigsten auftreten und mit der Wucht ihrer Gefühle am meisten schädlich wirken können? Woher stammt ihre Energie, und welche Grundgefüge von Beziehung setzen sich in ihnen durch? Gerade auf diese überaus wichtigen Fragen antworten die Mythen der Antike mit ergreifenden Erzählungen, denen, in näherer Betrachtung, der Wert von Archetypen zukommt, deren Themen sich in einer Handvoll klassischer Konflikte konzentrieren.
Ein Urwunsch aller Liebe gilt der Wiederherstellung vollkommener Verschmelzung.
Da geht die Kunde von dem zyprischen Bildhauer Pygmalion: unsterblich verliebte er sich in die Elfenbeinstatue einer wunderschönen Frau, die er selber nach den Vorstellungen seiner Sehnsucht angefertigt hatte; Aphrodite sogar bekam Mitleid mit dem Künstler und erweckte sein Bildnis zum Leben, – so die Geschichte. Worum in der «Wirklichkeit» aber handelt es sich, wenn jemand in seiner Geliebten die Erfüllung all seiner Träume erblickt? Wie viele Projektionen mögen einer solchen Beziehung zugrunde liegen, und woher stammen sie? – Oder der klassische Mythos von dem Jüngling Narkissos, der in einem Teich sich in sein eigenes Spiegelbild verliebte – zur Strafe dafür, daß er die Nymphe Echo abgewiesen hatte, die einem jeden nachzureden pflegte, was er ihr vorgesagt! Optisch wie akustisch verkörpern diese beiden die reine Reflexion – Narkissos auf sich selbst, Echo auf die Stimme anderer, doch was sind das für Menschen, die so total fixiert sind auf das eigene Ich beziehungsweise auf das Ich des anderen? Wieviel an Angst steckt in ihrem Verhalten, und was ist es mit ihrem schier bedingungslosen Wunsch nach Einheit? – So liebte einst die Quellnymphe Salmakis das Kind des Hermes und der Aphrodite – Hermaphroditos geheißen, und um von ihm niemals mehr abgewiesen zu werden, erbat sie von den Göttern sich die Gunst, auf immer mit seinem Körper vereint zu sein. Kann Liebe in dem Bannkreis solch einer Dualunion – ursprünglich von Mutter und Kind – jemals gelingen? – Ein paar Motive aus antiken Mythen langen aus, Menschen und menschliche Beziehungen in ihrem Glück genauso wie in ihrem Unglück besser zu verstehen.
Psychoanalytisch scheint es erwiesen, daß Liebende Gefühle miteinander tauschen, die «eigentlich» den eigenen Eltern gelten, schwere Tabuvorschriften aber richten sich genau dagegen. Wie die Bestätigung durch ein uraltes Wissen wirkt es deshalb, wenn nicht wenige mythische «Inzestgeschichten» Schicksale erzählen wie eben die von Byblis oder Myrrha, die sich in ihren Bruder oder Vater verliebt, oder – wie zur Rechtfertigung – von dem Sonnengott Helios, der die persische Prinzessin Leukothoë umwarb: – es war ihr Vater, der die Tochter bei lebendigem Leibe begraben ließ, so daß Helios nur noch übrig blieb, ihren Leib in eine Wolke wohlduftender Kräuter zu verwandeln. Oder eben von Phädra und ihrem Stiefsohn Hippolytos, die in den eifersüchtigen Wettstreit zwischen Aphrodite, der Göttin der Liebe, und der Jagdgöttin Artemis mit dem Ideal ihrer Keuschheit gerieten. – Sie alle scheitern an den psychischen Mechanismen ihres Unbewußten, die stärker sind als die moralischen Kontrollversuche des Bewußtseins. Wie führt man Menschen dahin, daß sie mit sich soweit identisch werden, um wirklich tun zu können, was sie tuen wollen? – Die Psychoanalyse hat vor über 100 Jahren bereits ganz richtig eine derartige therapeutische Aufgabenstellung formuliert, doch gilt es, sie anhand des überaus reichhaltigen Materials der griechischen Mythen entsprechend aufzugreifen und durchzuarbeiten – zugunsten eines verständnisvolleren Umgangs miteinander sowie zur Gewinnung einer Reihe von Grundmustern therapeutischer Problemstellungen, in denen immer wieder die Tragödien des Daseins ihren Ausdruck finden.
Wie viele Liebesbeziehungen zum Beispiel scheitern an der Ungemäßheit der Partner! Die eine ist zu jung, der andere zu alt, wie die zeitlos schöne Eos, die Göttin der Morgenröte, und ihr zusehends dahinsiechender Gemahl Tithonos. Die eine ist von verführerischer Ausstrahlung, wie die schöne Galateia, doch außerstande, die großzügigen Angebote des ungeschlachten Kyklopen Polyphem positiv zu erwidern. Die Schöne und der Unhold, la Belle et la Bête – endlos wird dieses Motiv variiert in den unglückseligen Liebesgeschichten der Opfer schicksalhafter Fehlbeziehungen. Wieder andere verwandeln, was Liebe sein könnte, in einen Wettkampf auf Leben und Tod, wie Atalante, die als Kind bereits gelernt hat, vor Männern sich in Acht zu nehmen, und Hippomenes, der sie unter allen Umständen für sich gewinnen will.
Wie zerstörerisch vor allem kann Mißtrauen und Eifersucht oder erwiesene Untreue in menschlichen Beziehungen sich auswirken, weil man kaum weiß, mit wem man es in seiner eigenen Person und der des anderen zu tun hat! Mit seinem ständigen Mißtrauen, sie könnte einem anderen Liebhaber nachgehen, ruiniert etwa Kephalos seine Liebe zu Prokris: er selber stellt ihre Treue auf die Probe, bis diese schließlich empört in die Einsamkeit flieht; als sie selber dann sehnsuchtsvoll wieder zu ihm zurückkehrt, ist sie es, die ihm mißtraut: wähnend, sein wohliges Bitten um Kühle während der Mittagsglut gelte einer geheimen Geliebten, umschleicht sie sein Lager im Walde und wird aus Versehen von seinem Jagdspeer getroffen.
Anderen Liebenden stehen die eifersüchtigen Gefühle anderer im Wege. – Bekannt ist als schauervolles Seeungeheuer die ursprünglich schöne Skylla, die in ein Monstrum erst von der Zauberin Kirke verwandelt wurde; diese nämlich hatte der Meergott Glaukos um einen Zaubertrank gebeten, mit dem er die Zuneigung der widerstrebenden Nymphe zu gewinnen hoffte, doch weil Kirke selber Gefühle für ihren Auftraggeber hegte, verunstaltete sie ihre Konkurrentin auf ewig und trieb damit gegen den eigenen Willen auch Glaukos selbst in die Flucht. – Was Eifersucht aus Menschen machen kann, zeigt sich geradezu kraß an Aglauros, der Tochter des Kekrops, die von der Göttin des Neides, von Eris, mit Gift erfüllt ward, so daß sie beim Anblick des Glücks ihrer Schwester Herse, die der Gott Hermes besuchte, in eine blutlose Bildsäule verwandelt wurde. – Das berühmteste Beziehungsdrama der antiken Mythologie stellt zweifellos die Geschichte von Kirkes Nichte Medeia dar, die als Prinzessin von Kolchis dem Griechen Iason mit dem Goldenen Vlies nach Korinth folgte; doch als sie erleben mußte, wie dieser sich in die Königstochter Glauke (oder Krëusa) verliebte, tötete sie ihre eigenen Kinder und floh zu König Aigeus nach Athen. Wie soll es gelingen, derartig schwere Verletzungen enttäuschter Liebe zu heilen? – Doch der Katalog möglicher Katastrophen ist noch nicht am Ende.
Wenn ein einzelner schon scheitern kann an der Lieblosigkeit seines Partners, so sind es oft die Widersprüche der Umgebung und die Normen der Gesellschaft, die den Liebenden den Weg zu einem gemeinsamen Glück versperren. Hero, die Aphrodite-Priesterin in Sestos, darf nicht die Liebe des Leander aus der gegenüberliegenden Stadt Abydos erwidern; Pyramus und die schöne Thisbe lieben einander schon seit Kindertagen, doch trennt sie beide die Wand ihres Wohnhauses sowie der Wille der Eltern, – so zeitlos sind die menschlichen Tragödien, die sich aus derlei Gegensätzen für die Liebenden ergeben, daß William Shakespeare (1564–1616) noch im Jahre 1597 sein wohl berühmtestes Stück «Romeo undJulia» danach gestaltet hat. – Am ärgsten liebesfeindlich aber ist der Krieg; welch eine Chance hätten Liebende, ihm zu entgehen? Ganz offensichtlich keine! So muß Laodameia ihren Gatten Protesilaos nach Troja ziehen lassen, obwohl er nach dem Schicksalsspruch der Götter – entsprechend seinem Namen! – der «Erste des (Kriegs)Volkes» sein wird, der gleich nach der Landung der griechischen Flotte durch einen Pfeilschuß umkommen wird. Das Bild vom Schnitter Tod, der unerbittlich mit seiner Sense ohne Unterschied alles, Gräser wie Blumen, dahinmäht, tritt in dieser blinden Grausamkeit des menschlichen Geschicks vor Augen.
Ein wichtiges Motiv der Mythen, die von Liebenden erzählen, ist der Abschied selbst. Rührend und anmutig erscheint er, wenn die Nymphe Kalypso auf der Insel Ogygia nach sieben Jahren des Zusammenseins dem heimwehkranken Odysseus zum Bau und zur Ausrüstung eines Floßes verhilft, – sie muß sich fügen in den Willen des Zeus. – In gewissem Sinne tut das auch Aeneas, der Sohn der Aphrodite und des Anchises, der nach seiner Flucht aus Troja nach Nordafrika verschlagen ward und sich dort in die karthagische Königin Dido verliebt; gleichwohl folgt er seinem Schicksal, das ihn zum Gründer Roms bestimmt hat; des Nachts, unbemerkt, sticht er in See, Dido aber nimmt sich das Leben, als sie sich allein zurückgelassen sieht; ihre Selbsttötung zählt zu den ergreifendsten Erzählungen der antiken Literatur, unmöglich also, die Psychologie dieser Szene nicht entsprechend zu würdigen.
Zu erschütternden Begebenheiten kommt es im wirklichen Leben nicht anders als in den Mythen, wenn Liebende zum letzten Mal voneinander Abschied zu nehmen haben in dem Wissen, daß der andere wohl in den Tod geht: Andromache zum Beispiel, die Gemahlin des trojanischen Königssohns Hektor, muß ihren Mann zurück in die Schlacht ziehen lassen, auch wenn er dabei umkommen könnte und durch das mörderische Rasen Achills dann auch tatsächlich umkommt.
Doch all das ist nur erst ein Spiel von Möglichkeiten. Wie aber, wenn kein Abschied voller Ungewißheit zum Tod führen könnte, sondern der Tod selbst unvermeidlich zum Abschied zwingt, wie es in zahlreichen der bisher schon genannten Fälle geschah? Es ist das zweite Hauptthema, vor welches die Mythen stellen: die Überwindung des Todes, die Suche nach Unsterblichkeit.
Für alle, die lieben, führt der Tod eine fundamentale Infragestellung herauf. Es war die ganz richtige Entdeckung des Buddha, daß, wer nichts Liebes, auch nichts Leides habe6. Doch so denken nicht die antiken Mythen, und so fühlen nicht die Götter und die Menschen, die sie schildern. Würden sie nicht lieben, so bedeutete ihnen der Tod des anderen wenig, – er hätte in seinem Leben nicht diesen unersetzlichen Stellenwert des Einmaligen und Einzigartigen angenommen, den nur die Liebe einer Person zu verleihen oder, richtiger, in ihr wahrzunehmen vermag. So aber tritt der Tod auf als ein Alleszermalmer und Alleszerstörer, der in seinem zynischen Nihilismus nichts hinterläßt als Trauer und Klage. Und wie darauf antworten? Unter gewissen Umständen stellt es bereits einen wichtigen Trost dar, den Kummer verlorener Liebe überhaupt zulassen zu dürfen und darin durch all die Gefährtinnen und Geschwister des gleichen Schmerzes begleitet zu werden, von deren Schicksal die Mythen berichten. Auf den marmornen Sarkophagen der Antike bildete man daher bevorzugt gerade die besonders tragischen und dramatischen Todesfälle der mythischen Überlieferung ab, wie um das Sterben des Einzelnen, der hier beigesetzt wurde, rückzuverbinden mit dem gleichen Leid oder auch mit dem gleichen Hoffen, das in jenen Heroen und Heroinen der Vorzeit Gestalt gewonnen hatte.
Da findet sich beispielsweise die untröstliche Niobe, die Tochter des Zeus-Sohnes Tantalos, die mit dem Thebanerkönig Amphion sieben Töchtern und sieben Söhnen das Leben geschenkt hatte; stolz darüber, lehnte sie es ab, daß man in Theben die Titanin Leto verehrte, nur weil diese – unter großen Schwierigkeiten – auf Delos die Zeus-Kinder Artemis und Apoll zur Welt gebracht hatte; Leto aber, beleidigt, sann auf Rache: Apoll, der fernhin treffende, tötete Niobes sieben Söhne, – ihr Vater Amphion nahm sich daraufhin das Leben, doch die Königin rühmte sich trotz ihrer Trauer noch immer des Besitzes ihrer sieben Töchter, bis die Jagdgöttin Artemis auch diese mit ihren Pfeilen niederstreckte; der Schmerz darüber versteinerte Niobe … Wer immer gerade diese Geschichte in die Seitenwände seines Steinsarges meißeln ließ, der mochte seine eigene Trauer offenbar relativieren an solchem Übermaß an Leid, – er fühlte sich weniger allein mit seinem Schmerz.
Unvermeidbar führt der Schmerz der Niobe indessen auch zu einer wichtigen Erkenntnis: ein Mensch kann und darf nicht sein Leben gründen auf den Besitz seiner Kinder. All seine Liebe geht im letzten ins Unendliche, das in dem Gegenüber seiner Liebe zwar erscheint, doch mit ihm nicht identisch ist.
Drum ist es zu dem gleichen Thema hilfreich, sich jene Szene vor Augen zu führen, die ebenfalls erstaunlich oft auf (römischen) Sarkophagen sich dargestellt findet: den Tod des Aktaion. Dieser Enkel des Kadmos, des Bruders der Europa und des Gründers von Theben, hatte bei dem Kentauren Chiron eine hervorragende Ausbildung als Jäger erhalten, doch erregte er damit den Unwillen der Jagdgöttin Artemis, und diese strafte ihn furchtbar. Eines Tages überraschte er die männerabweisende Göttin im Kreis ihrer Nymphen beim Baden, und damit er das Geschaute nicht ins Gerede zöge, verwandelte diese ihn in einen Hirschen; über den jedoch fielen sogleich die eigenen Jagdhunde her und rissen ihn in Stücke. – Kein Geringerer als der bedeutende Renaissance-Philosoph Giordano Bruno (1548–1600) erblickte in dieser Erzählung ein Sinnbild für den unauflöslichen und unaufhörlichen Zusammenhang von Liebe und Erkenntnis, von Begehren und Begreifen, von Schauen und Scheitern7: Wirklich verstehen, so Bruno, wolle und könne man nur einen Menschen, den man von Herzen liebe, – ihn möchte man immer vertrauter sich machen, und je mehr das geschehe, desto stärker der Drang, ihn immer inniger kennenzulernen – eine wechselseitige Steigerung des «Dionysischen» und des «Apollinischen» in Nietzsches Diktion –, und sie könne nur ins Unendliche gehen, so wie die Seele des Menschen selber unendlich ist, so wie der Kosmos unendlich ist, so wie Gott selber unendlich ist, der die Welt als unendliche schuf, damit sie seiner Unendlichkeit würdig zu sein vermöge. Niemals vollendbar ist deshalb der Wunsch, zu erkennen, was man liebt, und zu lieben, was man erkennt; freilich erhält dieser Kreislauf sich nur durch immer neue Stadien des Strebens, des Sterbens und des Wiederauferstehens.
Gleichwohl sucht die Liebe immer wieder von neuem sich zu wappnen gegen die absurde Willkür, mit welcher der Tod zuschlägt. Voll dunkler Vorahnungen zum Beispiel begleitet Alkyone, die Tochter des Windgottes Aiolos, den Entschluß ihres Gatten Keÿx, des Königs von Trachis, ein kleinasiatisches Orakel aufzusuchen und zu diesem Zweck eine gefahrvolle Seereise zu riskieren; nur unter Tränen, als sei er lebendig schon tot, nimmt sie Abschied von ihm, und tatsächlich entlädt sich bald nach der Ausfahrt bereits ein schweres Unwetter über dem Schiff und reißt es trotz aller seemännischen Tüchtigkeit der Matrosen an Bord in die Tiefe. Mit dem Namen seiner geliebten Alkyone auf den Lippen versinkt auch Keÿx in den Fluten. Um so mehr rührt es die Göttin Hera, die Bittgebete der ahnungslosen Alkyone um das Wohlergehen ihres Gatten entgegenzunehmen; um sie auf die traurige Nachricht vom Tod ihres Gemahls vorzubereiten, schickt sie die Regenbogengöttin Iris zu dem Gott der Träume, zu Morpheus, daß er sich der schlafenden Alkyone in der Gestalt des verstorbenen Keÿx erzeige und ihr den Tod des Geliebten mitteile. Und wirklich sieht Alkyone am Morgen des nächsten Tages, wie der Leib des Ertrunkenen an den Strand gespült wird, doch in ihrem Leid verwandelt sie sich in einen Vogel und Keÿx gleichermaßen; «ihre Liebe blieb», schreibt Ovid, «und ihren Ehebund löste auch die Verwandlung in Vögel nicht auf. Sie paaren sich, werden Eltern, und an sieben windstillen Tagen zur Winterszeit brütet Alkyone in ihrem Nest über der Flut. Dann liegt das Meer ganz still, denn über die Winde wacht Aiolos, läßt sie nicht fort und schafft seinen Enkeln ruhige See.»8
Die Verwandlung Verstorbener in Vögel ist bereits in der altägyptischen Religion als ein erstes Bild des Ausschwingens der Seele über die Grenzen von Raum und Zeit trostvoll gewesen9; in der Geschichte von Alkyone und Keÿx aber dient sie der Versicherung, daß nicht nur die Sterbenden unsterblich sind, sondern daß die Liebe selbst sich erhebt über die Enge des irdischen Daseins; die Verwandelten werden nie mehr einander verlieren, vielmehr in den «halkyonischen Tagen», im Januar, wenn das Meer überraschend ruhig daliegt und der Himmel in heiterer Klarheit erstrahlt, sind es die Eisvögel Alkyone und Keÿx, die von der Unvergänglichkeit der Liebe und des Lebens angesichts des Todes Zeugnis geben.
Ein anderes uraltes Bild zu einer tröstlichen Deutung des Todes ist die Verwandlung und Erhebung in Feuer, das etwa Herakles zum Himmel aufsteigen läßt: Seine Gemahlin Deianeira, aus Sorge, sie könnte seine Liebe an die schöne Kriegsgefangene Iole aus Trachis verlieren, hatte ihm ein Gewand zugesandt, das mit dem Blut des Kentauren Nessos durchtränkt war; der hatte ihr heimtückischerweise versprochen, sie könnte damit eines Tages, wenn nötig, die schwindende Zuneigung ihres Gatten zurückgewinnen; das Gewand fraß sich mit unerträglichen Schmerzen in dem Körper des Herakles fest, so daß dieser bat, auf einem Holzstoß verbrannt zu werden. Im Feuer fuhr er zum Himmel empor und erscheint dort seither als Sternbild; sein Vater Zeus aber versetzte ihn unter die olympischen Götter. Feuer als ein Mittel zum Ausschmelzen der Ewigkeit …
Ein anderer Mythos schildert den Aufgang und Untergang der Sonne als ein Sinnbild von Leben und Tod. Helios selber mußte erleben, wie sein Sohn Phaethon, als er den Sonnenwagen des Vaters nicht auf der rechten Bahn zu lenken vermochte, von Zeus getötet wurde, um die Welt nicht in Flammen aufgehen zu lassen; daraufhin habe der Sonnengott einen Tag lang sich geweigert, die Erde zu bescheinen, und Klymene, Phaethons Mutter, sei, wie von Sinnen vor Schmerz, über die Erde geirrt, um die Gebeine ihres Kindes zu suchen; die Tochter des Sonnengottes indes, Phaethusa, sei zu einem Baum geworden, aus dessen Rinde die Tränen als Bernstein hervortraten.
Ein weiteres Bild für den Tod ist seit jeher der Schlaf und, verbunden mit ihm, das Aufwachen und Verschwinden des Mondes am Himmel. Ein Motiv, das seiner quasi lyrischen Implikationen wegen auf (römischen) Sarkophagen gern abgebildet wurde, ist deshalb die Geschichte von Endymion, dem König von Elis, in den die Mondgöttin Selene sich verliebt hatte; aus Sorge, er könnte altern und sterben, schloß sie ihn in einer Höhle in Karien ein und umgab ihn mit ewigem Schlaf. Nacht für Nacht besucht die Mondgöttin seither ihren Geliebten, dieser aber erlebt ihre Nähe wohl nur wie einen glückseligen Traum. Freilich, ist das RIP (requiescat in pace – er ruhe in Frieden) auf den Grabsteinen unserer Friedhöfe wirklich so sehr verschieden von diesem Bild? Von alters her galten Hypnos und Thanatos, Schlaf und Tod, als Geschwister, – in solchen Vorstellungen allerdings sind sie (beinahe) eins; und der Gedanke ist überaus tröstlich, der Tote sei gar nicht tot, er schlafe nur, er werde wieder gesund, ja, er regeneriere soeben von der Krankheit, die wir das irdische Dasein nennen; und wie die Mondgöttin selber am Himmel immer wieder aus dem Nichtsein der Neumondnächte erneut und erneuert zu voller Schönheit erwacht, so möchte es doch auch sich verhalten mit der Sterblichkeit der Menschen.
Ein ähnliches Bild des Vertrauens erscheint in dem Wiedererstehen der Schönheit blühender Blumen im Frühling. – Ein Mythos, der davon berichtet, ist die Geschichte von Aphrodite und Adonis: Dieses Kind des Inzests der Myrrha mit ihrem Vater wurde seiner Schönheit wegen von Aphrodite in einem Kästchen bei der Unterweltherrscherin Persephone versteckt, die aber verliebte sich selbst in das Knäblein und wollte es bei sich behalten; Zeus mußte zwischen beiden entscheiden: Adonis solle vier Monate lang in der Unterwelt, vier Monate auf der Erde und vier Monate, wo er wolle, verbringen. Doch die Art seines Todes und die Art seiner Rückkehr aus dem Totenreich zur Erde erzählt eine andere Fassung der Geschichte: Danach war Aphrodite, deren Brust eine Pfeilspitze des Eros verwundet hatte, unsterblich verliebt in den Sterblichen; inständig warnte sie deshalb Adonis davor, auf die Jagd nach Großwild zu gehen, doch vergeblich – er tat’s und wurde von einem Wildschwein zerrissen, in das, wie manche überliefern, sich auf Weisung Persephones der Kriegsgott – und Aphrodites Geliebter – Ares selbst verwandelt hatte. Die trauernde Göttin versuchte sich über den jähen Verlust des Geliebten damit zu trösten, daß sie die Blutstropfen aus seinen Wunden in die Blüten der Anemone verwandelte.
Nach einer anderen Art von Trost für eine Mutter, deren Tochter von dem Gott des Todes, Hades, in die Unterwelt entführt ward, hält die zentrale griechische Mythe von der Unsterblichkeit des Lebens in Gestalt der Göttin des Ackerbaus, Demeter, Ausschau, indem sie symbolisch von dem Kommen und Gehen im Raum der Vegetation erzählt und darin ein Sinnbild zur Deutung auch des menschlichen Daseins erblickt: Beim Blumenpflücken hatte Hades die Demeter-Tochter Persephone als seine Braut entführt, und nur der allessehende Sonnengott Helios konnte der suchend umherirrenden Mutter bedeuten, wo ihre Tochter sich fand; Zeus schließlich, um seine Schwester Demeter, aber auch um seinen Bruder Hades zu versöhnen, entschied, Persephone dürfe von Herbst bis Sommeranfang, also in der Zeit von Aussaat und Getreideernte, oberhalb der Erde verweilen, doch müsse sie während des Rests des Jahres, wenn die Erde in der Sommerglut wie verdorrt daliegt, in die Unterwelt wieder zurückkehren. In den Mysterien von Eleusis wurde dieser Mythos vom Verlieren und Wiederfinden des verstorbenen Kindes durch seine Mutter kultisch begangen, doch die Frage stellt sich gerade hier generell: können Bilder der Natur den Schmerz der Liebe lindern, gleich, ob ein Kind, ein Gatte, eine Gattin durch den Tod hinweggerissen wird?
Alle Naturmythen werfen dieses Problem auf: Was haben sie uns Heutigen noch zu sagen? Nichts offenbar, wenn wir sie lediglich «naturhaft» deuten als bloße «Ätiologien» vom Kommen und Gehen der Gestirne oder von der Aussaat und Ernte des Getreides, doch alles, wenn wir, wie in einer christlichen Eucharistiefeier etwa, in einer geschnittenen Ähre ein Bild erkennen für das «Brot des Lebens», in welchem eine verstorbene Gottheit ins Leben zurückkehrt. Nicht das Korn ist das Leben der Menschen, wohl aber die Liebe eines Einzelnen zu einem Einzelnen. Dann aber müßte es gelten, daß der Tod nicht imstande ist, endgültig die Liebenden voneinander zu trennen.
Von einem solchen Sieg der Liebe über den Tod kündet in den griechischen Mythen verborgen, doch um so bedeutsamer, vor allem das Schicksal von Admetos und Alkestis. Anfänglich kreist es um jene «ödipale» Eifersucht eines Vaters, mit welcher der thessalische König Pelias die schöne Alkestis nur demjenigen in die Ehe zu geben gewillt ist, der vor seinen Hochzeitswagen einen Löwen und einen Eber zu spannen vermag; allein der König von Pherai, Admetos, war dazu imstande, und auch das nur, weil Apoll ihm hilfreich zur Seite stand. Doch als er es dann unterließ, der Artemis das schuldige Hochzeitsopfer darzubringen, sandte die Jagdgöttin ihm Schlangen ins Brautgemach, zum Zeichen, daß er bald sterben werde. Zum Glück war es ihr Bruder Apoll, der die Schicksalsgöttin überredete, Admetos leben zu lassen, wofern sich ein anderer fände, der statt seiner zu sterben bereit sei; wer aber geht schon für einen anderen in den Tod außer ein Liebender? Einzig Alkestis wollte lieber sterben als lieblos leben, und ihr Opfer rührte Persephone derart, daß sie Admetos die Rückkehr in die Oberwelt gestattete. Euripides schildert den entscheidenden Vorgang freilich noch weitaus dramatischer: danach war es Herakles, der den Totengott Hades im Zweikampf überwand und ihn zur Freigabe des Admetos nötigte. Dazu muß man wissen, daß die Keule des Herakles das Material ist, aus welchem der Bogen des Eros geschnitzt ward: – nicht die physische Kraft, nur seelische Stärke verheißt und bewirkt den Sieg der Liebe über den Tod …
Konsequent zu Ende gedacht ist diese Hoffnung in der berühmten Mythe von Orpheus und Eurydike, die gleichermaßen auf den Sarkophagen der Antike eine weite Verbreitung gefunden hat: Der thrakische Sänger Orpheus war ein Sohn des leierspielenden Apoll und der Muse Kalliope, der «mit der schönen Stimme», der Hüterin der erzählenden Dichtung. Seine Liebe galt der Nymphe Eurydike, die seine Zuneigung von Herzen erwiderte; doch bei der Hochzeit biß eine Schlange die Braut in die Ferse und tötete sie. Glücklicherweise gelang es Orpheus, die Unterweltgöttin Persephone mit seinen Liedern gnädig zu stimmen, so daß Hades ihm gestattete, die Geliebte zurückzuholen, wofern er sich nur nicht nach ihr umschaue; gerade das aber tat er, ob aus Sehnsucht oder Sorge, stehe dahin, und sogleich sank Eurydike zurück in das Schattenreich; alle weiteren Versuche des Orpheus, die Geliebte ins Leben zurückzuholen, scheiterten schon daran, daß der Fährmann des Hades, Charon, sich weigerte, den Sänger über den Unterweltstrom Styx zu setzen. Traurig und resigniert entsagte Orpheus fortan der Liebe zu Frauen und wandte sich lieber jungen Männern zu; dabei besang er in vielen Liedern, welch ein Verhängnis die Liebe zwischen Mann und Frau über die Menschen zu bringen vermag; schließlich jedoch zerrissen die Mänaden des Dionysos den Sänger, so daß nur sein Kopf in dem Fluß Hebros zum Meer schwamm und seine Leier als Sternbild an den Himmel versetzt ward. Entscheidend indessen war, daß er, als Verstorbener, in der Unterwelt die Geliebte wiederfand, denn nun waren sie wirklich untrennbar vereint.
Wenn das so ist, hat dann nicht Heraklit (um 500 v. Chr.) recht, als er sagte: «Unsterbliche: Sterbliche, Sterbliche: Unsterbliche»10? Womöglich bestand der Irrtum des Orpheus eben darin, daß er die Gemeinsamkeit der Liebe auf Erden für die eigentliche Wirklichkeit hielt und den Tod als Trennung ansah, während es sich anscheinend gerade umgekehrt verhält: das Leben ist der Tod und der Tod das Leben …
Doch ist es nicht die Liebe allein, die an Unsterblichkeit glauben läßt. Neben dem Wissen der Liebe und dem liebenden Wissen besteht zugleich ein starkes Verlangen nach Gerechtigkeit oder, richtiger, nach einem rechten Leben vor Gott, und auch dieser Zug menschlicher Sehnsucht hat in den Mythen der Antike seinen Ausdruck gefunden, nirgends tiefer freilich als in der Gestalt der Antigone, der Tochter des Ödipus: Als deren Vater aus Theben verbannt wurde, gerieten ihre Brüder Eteokles und Polyneikes in Krieg gegeneinander zur Entscheidung der Frage, wem die Macht in der Stadt gehören sollte; wechselseitig brachten beide sich um, doch Kreon, der Oheim des Ödipus und dessen Nachfolger auf dem Thron, hielt es mit Eteokles, den er in Ehren beisetzen ließ, Polyneikes (der «viel Zankende», wie schon sein Name sagt) sollte von niemandem bestattet werden, – unter Todesstrafe verbot es der König. Antigone aber wagte es, dem Befehl Kreons zuwiderzuhandeln: sie hielt das Gebot der Götter zur Pietät für wichtiger als die Weisung eines Menschen, – sie ging in den Tod. Doch nun: Kann ein Mensch so handeln, ohne eine Perspektive über die irdische Gerechtigkeit hinaus? Und was war es mit Sokrates (um 470–399), der, im Vertrauen, seinen wahren Richtern im Jenseits zu begegnen, gefaßt den Schierlingsbecher trank?
Solchen Fragen wird im folgenden nachzugehen sein. Von dem Apostel Paulus erzählt die Apostelgeschichte (Kap. 17), er sei auf dem Areopag von Athen mit stoischen und epikureischen Philosophen ins Gespräch gekommen. Dieses Gespräch gilt es fortzuführen und zu vertiefen. Wie nämlich wäre es gewesen, der Apostel hätte zu ihnen gesprochen nicht an der Gerichtsstätte des Areshügels, sondern im Dionysostheater und auf dem antiken Stadtfriedhof, dem Kerameikós? Entgegen der Lehre der Stoá können Menschen nicht gut sein, nur weil sie wollen; alle Tragödien der großen attischen Dichter sind ein Schrei nach Erlösung durch eine Güte, die nicht verurteilt. Und entgegen der Lehre der Epikureer können Menschen richtig nur leben mit der Hoffnung der Ewigkeit in ihrem Dasein.
Eine Betrachtung zu Liebe und Tod in antiken Mythen und auf (römischen) Sarkophagen ähnelt in gewisser Weise deshalb dem Besuch des Odysseus im Hades, woselbst er – auf den Rat der Zauberin Kirke hin – den Seher Teiresias nach den Aussichten seiner Heimreise zu befragen suchte; als er dem Phäakenkönig Alkinoos darüber Bericht erstattet, hält er selbst, nachdem er von Phädra und Prokris und Ariadne und manch anderen erzählt hat, die er im Totenreich traf, mit den Worten inne:
Aber ich werde nicht alles erzählen oder berichten,
Welche Frauen ich sah und Töchter der Helden; denn eher
Schwände dahin die unsterbliche Nacht; auch ist es die Stunde,
Schlafen zu gehen auf schnellem Schiff bei meinen Gefährten
Oder auch hier; das Geleit liege euch und den Göttern am Herzen.
Ganz so sollten wir’s halten an dieser Stelle: um, in übertragenem Sinne, «nach Hause» zu kommen, sollten wir den Zug der Schatten nicht weiter vergrößern, sondern mit den Genannten in Zwiesprache treten – schweigend und sinnend, horchend und hoffend, erinnernd und voller Erwartung, hat doch in ganz anderer Weise, als es selber vermeinte, das Buch des Predigers recht, wenn es sagt: «Was war, das wird sein … Und es gibt nichts Neues unter der Sonne.» (Pred 1,9) Es gilt, an dem Alten zu lernen, was es heißt, sich selbst zu erneuern. Die Mythen der Antike vermögen es, die Rechtfertigungslehre des Paulus ebenso wie seinen Glauben an Auferstehung in einer Weise als buchstäblich «nötig» erscheinen zu lassen, die den «metaphysischen» Argumentationen der tradierten Theologie über Natur und Gnade und über Körper und Seele weitgehend fehlt.
Abb. 1: Götter und Titanen
Um mit den Namen der griechischen Götter sich vorweg ein wenig vertraut zu machen, mag ein «Stammbaum» dienen (Abb. 1)11, der zeigt, wie Erde (Gaia) und Himmel (Uranos) die Titanen gebaren, und wie aus zweien von ihnen,KronosundRhea, die olympischen Götter entstanden: sechs von ihnen sind Geschwister (Hestia,Hera,Zeus,Demeter,HadesundPoseidon), fünf andere sind Kinder desZeus:Areswird ihm vonHerageboren,ApollonundArtemisvon der TitaninLeto,Athenevon der TitaninMetis,HermesvonMaia, der Tochter des TitanenAtlas, der ein Sohn desIapetosund der OkeanideKlymenewar (vgl. mythische Stammbäume);Aphroditewurde ihm einer Überlieferung zufolge von der ErdgöttinDionegeboren (einer weiblichen Form zuZeus); einer anderen Überlieferung nach aber entstand sie, als der TitanKronosseinen VaterUranosentmannte und sein abgeschnittenes Glied auf dem Meer trieb; an der Küste vor Paphos auf Zypern stieg die Göttin als «Schaumgeborene» an Land; das Blut aber, das aus der Wunde desUranosauf die ErdgöttinGaiaherabfiel, ließ die schlangenfüßigenGigantenentstehen. Der zwölfte der Götter, der Gott der Schmiede,Hephaistos, wurde vonHeraohne Geschlechtspartner geboren; andere aber meinen, auch er sei vonZeusgezeugt worden. NurDionysosist eigentlich keine olympische Gottheit; er gilt als das Kind desZeusund derKadmos-TochterSemele, die vor seiner Geburt starb, alsZeussich ihr auf Betreiben der immer eifersüchtigenHerain seiner ganzen Herrlichkeit zeigte;Zeusselber versteckte ihn in seinem Schenkel und brachte ihn so zur Welt.
Abb. 2: Ostgiebel des Parthenon
Eine berühmte Darstellung, wie die Götter sich zueinander verhalten, bietet der Ostgiebel des Parthenon auf der Akropolis in Athen. (Abb. 2)12 Die Szene gibt wieder, wie Zeus seine Tochter Athene gegen ihren Konkurrenten Poseidon zur Stadtgöttin von Athen einsetzt, – auf der Brust trägt die kriegerische Göttin die Aigis, den Schild des Zeus, mit dem Bild der Meduse Gorgo, deren Anblick jeden, der sie anschaut, versteinert. Soeben setzt die Siegesgöttin Nike, die, geflügelt, auch hinter dem thronenden Göttervater steht, der Göttin den Kranz aufs Haupt. Athene wurde geboren aus dem Haupte des Zeus, das Hephaistos mit seiner Axt spalten mußte, um den Vorgang zu ermöglichen; deshalb steht er mit erhobener Axt gleich hinter Athene. Hinter ihm sitzt Poseidon, der Meergott, mit seinem Dreizack; ihm entspricht auf der linken Seite die thronende Schwester des Zeus und Gattin Hera. Hinter dieser steht Aphrodite mit dem Eros-Knaben; eigentlich ist sie des Hephaistos Gemahlin, doch näher steht ihr buchstäblich Ares, der Gott des Krieges, mit dem sie ein intensives Verhältnis pflegt; auf der rechten Seite ist – parallel dazu – der Gott Apoll mit seiner Leier und dessen Schwester Artemis mit ihrem Bogen abgebildet; dahinter sieht man Hermes mit seinem Stab, der mit Blick auf die neben ihm sitzende Herdgöttin Hestia mit beiden Händen auf die Krönung Athenes hinweist. Auf der linken Seite entspricht dem männlichen Götterboten Hermes die weibliche Botin der Hera: die Regenbogengöttin Iris. Hinter dieser sieht man als eine weibliche Doppelgruppe die Erdgöttin Demeter und ihre Tochter Persephone; auf der rechten Seite entspricht dem die Darstellung der Dione, in deren Arme sich ihre Tochter Aphrodite zurücklehnt. Ohne Entsprechung ist auf der linken Seite der Weingott Dionysos, der mit einem Becher in der Hand sich sinnvollerweise in der Nähe der Demeter aufhält. Von links her schickt sich soeben Helios an, mit seinen Pferden über den Himmel zu fahren, während rechts außen Selene, die Göttin des Mondes, den Himmel verläßt.
Tafel 1b : Nicolaes Wieling: Götter im Olymp, 17. Jh.
Um zu sehen, wie man sich in der Renaissance den Aufenthalt der Götter auf dem Olymp vorgestellt hat, lohnt es sich, einmal das Residenzmuseum in Celle zu besuchen, wo sich ein Gemälde von Nicolaes Wieling aus der Zeit um 1670 befindet, das den Titel trägt: «Götter im Olymp». (Vgl. Tafel 1b.)13 In gewissem Sinne ist dieses Bild eine Hommage an den Adel der Zeit mit seiner Verklärung von Lebenskunst und genußvollem Leben, und die Götter Griechenlands gelten nur noch als Projektionsgestalten eines wiedergekehrten Goldenen Zeitalters, in dem Leid und Schmerz unbekannt, dafür Schwelgen und Prangen geradezu pflichtgemäß sind. Vor allem die halbnackten Körper der olympischen Protagonisten verstärken den Eindruck uneingeschränkter Gesundheit, Schönheit und erotischer Sinneslust. So also feiern die Fürsten …
Die unstreitige Königin der ganzen Szene ist die nur mit einem Tuch über dem Schoß verhüllte Aphrodite, die ganz in Vorderansicht zu betrachten ist und bereits durch die Helligkeit ihrer Haut hervorsticht. Vor ihr steht nackt mit langen Locken der kleine Eros-Knabe, der mit ausgestreckten Armen auf ihr Knie gehoben werden möchte. Links von ihr am Kopf der Tafel sitzt, gelehnt auf einen Adler, Zeus, der in der Linken eine Muschel hält, – das Zeichen der Geburt der «Schaumgeborenen». Seine Gemahlin Hera, die mit kokettem Blick den Göttervater anschaut, verweist auf ihre Art mit der rechten Hand auf Aphrodite, als wollte sie gerade den Vorwurf erheben, nicht so viel an Beachtung von ihrem Gatten geschenkt zu bekommen, wie der Pfau, ihr Symboltier, durch Selbstdarstellung beansprucht. Der Kriegsgott Ares neben ihr, der seine Rüstung nur in Liebesdingen – für Aphrodite – ablegt, ist gerade im Gespräch mit Herakles, den Hera sein Leben lang verfolgt, weil Zeus in einem Seitensprung mit Alkmene, der Gattin des Amphitryon, ihn zeugte; dafür steht er unter dem Schutz der Athene, die mit Helm und Lanze hinter Ares ihren Auftritt hat. Sie ist die eigentliche Konkurrentin des Kriegesgottes, verkörpert sie doch eher die listenreiche Intelligenz des Kriegshandwerks als, wie Ares, die brutale Grausamkeit des Kriegsgeschehens. Herakles sitzt, mit dem Rücken zum Betrachter gewandt, auf einem Löwenfell, dem Attribut seiner ersten Heldentat, als er den Löwen zu Nemea bezwang; seine Waffe, die Keule, steht schräg hinter ihm, – ein Festmahl auf dem Olymp ist offensichtlich nicht die rechte Zeit für neue Kraftbeweise. Um so deutlicher wird – zwischen Vorder- und Rückseitenansicht – der Kontrast zwischen weiblicher Schönheit und männlicher Stärke, die sich in Aphrodite und Herakles verkörpern: da hebt sich das Elfenbeinweiß der Göttin deutlich ab von der sonnengebräunten Haut des Heros, die weichen Rundungen der Idealfigur der Frau von dem muskulösen Körper des Mannes, die einladende offene Zugewandtheit der Liebesgöttin von der eher abweisenden, in sich ruhenden Haltung des hilfreichen Helden Herakles. Der Blick Aphrodites gilt indessen einem Putto, der ein Blasinstrument mit der rechten Hand an den Mund hält, das er pausbäckig soeben bespielt, während er mit der linken sein Hemd emporhebt, um ungehindert (nach Art der Brunnenfigur des Männeken-Piß, im Echo wohl entsprechender römischer Herakles-Darstellungen) sein Wasser lassen zu können; das Horn ist ohne Zweifel eine phallische Chiffre für Potenz und Fruchtbarkeit so wie der Urinstrahl Lebenskraft und Zeugungsfähigkeit bezeichnet; beides schenkt die Göttin der Liebe, beides beachtet sie. Und über allem streut im Hintergrund Flora, die Göttin des Frühlings, in rotem Gewande Blumen über die Tafelnden. Mit von der Partie ist auch Artemis, die, trotz ihrer strengen männerabweisenden Keuschheit in verführerischer Nacktheit dem Betrachter zugewandt an Herakles vorbei ins Bild drängt. Am Boden rechts unten scheint Demeter, die Erdgöttin, zu sitzen; das Kind auf ihrem Schoß müßte dann Persephone sein. Alle Götter sind glücklich, besagt dieses Bild. – Allerdings fehlt es bei so viel Prunk und Genuß und Freude am Leben in vollen Zügen auch nicht an warnenden Hinweisen, das rechte Maß zu bewahren. So deutet Hermes, der Götterbote mit dem Flügelhelm (oder den Flügelschuhen), auf den noch jungen Dionysos, der sich derart betrunken hat, daß er zu Fuß gar nicht mehr weiterkommt und selbst auf seinem Esel sich nur in Begleitung seiner Gefolgsleute halten kann. Repräsentiert diese Szene die Gefahr des Bewußtseinsverlustes im Rausch von Weinseligkeit und sinnlichem Verzücken, so deutet am linken unteren Bildrand die Gestalt des Narkissos, der sich gerade an sein eigenes Spiegelbild verliert, die Möglichkeit an, in Bewußtseinshelle nur noch um sich selber zu kreisen und die Wirklichkeit aus den Augen zu verlieren. Die Forderung, auf welche der blondgelockte Apoll darüber mit dem ausgestreckten Zeigefinger der linken Hand verweist, führt aus dem bloßen Genußleben hinaus – sie lautet bekanntlich: «Erkenne dich selbst».14
Ein Wort noch zur Lektüre: Es empfiehlt sich, die im folgenden aufgeführten Gesänge sich laut vorzulesen, um ihren rhythmischen Wohlklang besser erfassen zu können:
Aber ich bebe, sooft mir der traurige Krieg in den Sinn kommt;
Tränen rinnen wie Schnee, / der von der Sonne zerschmilzt.
So läßt Ovid in den «Briefen der Sagenfrauen» (XIII 3, V. 51–52; S. 107) die unglückselige Laodameia an ihren Gemahl schreiben, der unterwegs ist in den Krieg vor Troja. Der erste Vers ist ein Hexameter (Sechstakter), der zweite ein Pentameter (Fünftakter) – eigentlich ein Sechstakter mit einer Pause in der Mitte; beide Verse bilden einen Zweizeiler (ein Distichon), wie er in Epigrammen und Elegien überaus beliebt war. Wie sehr dieses Versmaß sich eignet, Gefühlen den lyrischsten Ausdruck zu leihen, wird man selber erleben durch die Ergriffenheit bei möglichst dramatischem Vortrag.
I. Geschichten von Liebe und Leid
Rein «naturwissenschaftlich» zeigt sich das Dasein unbezweifelbar so: Wir kommen aus dem Nichts, und wir gehen ins Nichts, und was dazwischen liegt, unser Leben, dient einzig dem Zweck, Leben weiterzugeben. Das Nichts, das wir sind, gibt sich den Anschein, etwas zu sein. Das ist alles. Es ist gar nichts, – der mutwillige Versuch einer Selbsttäuschung. Doch was ist es dann mit der Religion? Ist auch sie nur ein Versuch, sich etwas vorzumachen? Oder verweist sie auf eine Wahrheit, die nötig ist, um «richtig» zu leben? Eine «Wahrheit», die man braucht, um «richtig» zu leben, steht von vornherein in Verdacht, bloßem Wunschdenken zu entstammen. Doch vielleicht verhält es sich gerade umgekehrt, und die Menschlichkeit, die der Glaube gebiert, «beweist», daß die Religion wahr ist, wenn sie das Leben in einer Liebe birgt, die den Tod besiegt. Naturwissenschaftliches Denken kann Tatbestände erklären, doch was wir tun sollen, sagt es uns nicht, und noch weniger sagt es, wer wir selbst sind. Das vermag uns nur jemand anzuvertrauen, der uns sehr liebt.
Doch wem ist Liebe zu glauben? Und was alles nennt sich nicht Liebe?
In Ingmar Bergmans (1918–2007) Film «Wie in einem Spiegel» sagt David am Ende zu seinem Sohn: «Es steht geschrieben, daß Gott die Liebe ist … Ich will dir nur meine eigene Hoffnung andeuten … Es ist das Wissen, daß Liebe als etwas Wirkliches in der Welt der Menschen existiert.» David meint ausdrücklich nicht «eine besondere Art Liebe»; er meint: «Jede Art von Liebe …! Die höchste und die niedrigste, die armseligste und die reichste, die lächerlichste und die schönste. Die besessene oder krasse. Jede Art von Liebe … Sehnsucht und Verleugnung, Mißtrauen und Vertrauen.»15 Einzig die Liebe ist diesen Worten nach imstande, die Verstellungen zu öffnen und die Verformungen zu überreifen, an denen sie selbst leidet, und es ist dieser Glaube an die Macht der Liebe, der sich in allen Religionen ausspricht und sich, trotz allen Unglücks, allen Unheils, alles Ungemäßen, in allen Mythen der Antike darstellt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!