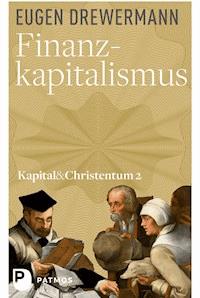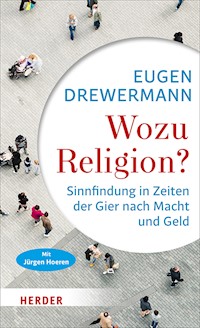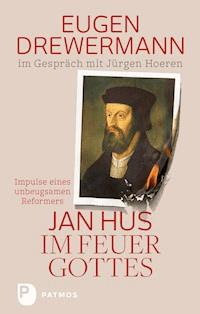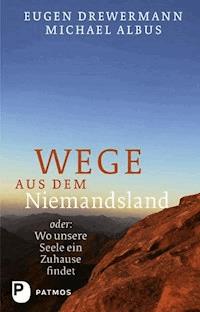Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Eugen Drewermann stellt in seinem neuen Buch die Theologie vom Kopf wieder auf die Füße und führt sie zurück zu dem, was Jesus von Nazareth wollte und was das Christentum eigentlich besagt. Er kritisiert in aller Deutlichkeit die in der Kirchengeschichte wirkmächtige Überzeugung, dass objektiv festgelegt werden könne, wie wir Gott zu verstehen haben und was Erlösung durch Christus bedeutet. Dagegen verweist er auf den mythischen Charakter all unserer religiösen Vorstellungen. In Drewermanns revolutionärem Neuansatz bekommen Begriffe wie Erlösung, Schöpfung, Auferstehung wieder einen Sinn. Ein unverzichtbares Buch für alle, die den Glauben neu und besser verstehen möchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1105
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Über den Autor
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Eugen Drewermann
Wendepunkte
oder Was eigentlich besagt das Christentum?
Patmos Verlag
Ihr seid das Salz der Erde.
Wenn aber das Salz stumpf wird,
was soll man damit salzen?
Zu nichts taugt es mehr,
sondern es wird nach draußen geworfen
und zertreten von den Menschen.
Ihr seid das Licht der Welt …
Eine Leuchte zündet man nicht an
und stellt sie (dann) unter den Scheffel,
sondern auf den Leuchter:
dann strahlt sie allen im Hause.
Mt 5,13–16
Inhalt
Vorwurf und Entwurf oder: Die Umkehrpredigt des Propheten Jeremia
I) Kosmologie oder: Schöpfungsglaube versus Evolutionslehre
1) Von Gottes Güte, Macht und Weisheit oder: Vom Widerspruch der Welt
2) Von den Bedingungen menschlicher Existenz oder: Was Glauben an Gott als den Schöpfer meint
II) Soteriologie (Erlösungslehre) oder: Woher das Böse?
1) Die «Sünde» am «Anfang» oder: Der Teufel zum Beispiel
2) Der Ausweg oder: Vertrauen gegen Angst
III) Christologie oder: Die Lehre vom Erlöser
1) Dogmatische Verdinglichung oder: Die «hypostatische Union»
2) «Kommt, seht selbst» (Joh 1,39) oder: Vom Saum seines Gewandes
IV) Ekklesiologie (Die Lehre von der Kirche) oder: Einheit in Freiheit
1) Die verordnete Erlösung oder: Die verweigerte Aufgabe
2) Vom Ich zum Wir oder: «Löscht den Geist nicht aus» (1 Thess 5,19)
V) Eschatologie (Die Lehre von den letzten Dingen) oder: Was darf ich hoffen?
1) Die Ambivalenz eines Symbols oder: Von Heulen und Zähneknirschen (Mt 8,12)
2) «Gesehen habe ich den Herrn.» (Joh 20,18)
VI) Gotteslehre (Theologie im eigentlichen Sinne) oder: Von Glaubensformeln und von Glaubensformen
1) «Gott ist dreifaltig einer» oder: Syllogistische Sophistereien statt einer synkretistischen Synthese
2) Vermittelte Unmittelbarkeit oder: Glauben an der Seite Jesu
Farbtafeln
Bibliographie
Vorwurf und Entwurf oder: Die Umkehrpredigt des Propheten Jeremia
Was geschieht,
das ist längst schon gewesen,
und was sein wird,
ward allzumal;
und wieder holt Gott hervor,
was vergangen.
Pred 3,15
Wie nötig wäre Religion! Wer, wenn nicht sie, könnte den Menschen sagen, daß sie mehr sind als Übergangsgebilde im Stoffwechselhaushalt der Natur, daß sie zu schade sind, um sich als Konsumenten und als Produzenten im Wirtschaftskreislauf dubioser Kapitalverwerter zu verschleißen, daß sie es nicht verdienen, ihren Wert als Leistungsträger bei der Sicherung des Industriestandorts der BRD oder irgendeines anderen Landes im globalen Konkurrenzvergleich bestimmt zu finden?
Auf daß Menschen eine absolute Geltung haben, bedarf es eines absoluten Gegenübers ihrer Anerkennung. Ein solches Gegenüber kann und darf nicht die Natur, nicht die Gesellschaft, nicht ein Zweckverband aus Industrie und Militär und Banken sein. Wie aber glauben an ein Absolutes, auf daß Menschen nicht länger mehr als Mittel für die Zielsetzungen anderer versklavbar sind?
Es müßte einen jeden die Religion begleiten auf dem Weg zu seiner Freiheit. Sie müßte die verinnerlichten Zwänge seiner Seele durcharbeiten, in denen andere mit scheinbar göttlicher Autorität vor ihn hintraten und ihn nach ihrem Bild zu formen suchten, – vom eigenen Vater in den Kindertagen über den Lehrer in der Schule, den Pastor in der Kirche, den Spieß auf dem Kasernenhof, den Herrn Professor auf dem Universitätsgelände bis hin zum Chef der belle etage des Glashochhauses eines systemrelevanten Großkonzerns … Sie alle sind nicht Gott, sie sind nur lächerlich, wenn sie versuchen, so zu tun.
Doch das zu spüren macht auch Angst. Leichter, als seine Freiheit zu riskieren, ist es in jedem Falle, einzutauchen in die Fremdbestimmung anderer; statt selbst zu sein erscheint es einfacher zu tun, was alle sind und machen; Normalität statt Individualität – nach dem Konzept besorgt, versorgt man stets ein nur uneigentliches Dasein, das nie zum Leben kommt, weil es im Kampf ums Überleben sich und alle Welt in die Begräbnisstätte seiner selbst verwandelt.
Nötig wäre die Religion! Doch so, wie nötig, ist sie nicht.
Denn selber tritt sie auf als göttliche Autorität, verbreitet Angst vor Gott, um selber Macht zu haben über Menschen, und augenscheinlich hält sie es zum Selbsterhalt konstant mit dem, was Geld und Geltung bringt.
In seiner institutionalisierten Form hat religiöser Glaube seine Glaubwürdigkeit endgültig eingebüßt. Gewissen Medien mag es noch wichtig scheinen, wie jemand in der Rolle eines Papstes agiert, regiert oder reagiert, und Papst Franziskus glaubt man gerne, daß er es ehrlich meint mit der Reform der Kirche Roms1 ; in religiösem Sinn hingegen kann nicht etwas wahr sein, nur weil es kirchlicherseits «amtlich» angeordnet wird. Ja, wie verängstigt ist, wer ernsthaft meint, es brauche eines Gottesstellvertreters hier auf Erden, um sich des Himmels zu versichern?
Geschichtlich ist der Vorwurf schwer zu widerlegen, Religion betreibe lediglich die Ruhigstellung der sozial Entrechteten durch weltjenseitige Vertröstungen, sie rede von Gott wesentlich, um Herrschaftsansprüche von Kaisern, Kardinälen, Fürsten und Blaublütigen den Untertanen als gehorsamsschuldig hinzustellen; sie rechtfertige, ja, segne notfalls sogar Krieg, Gewalt und Diktatur als etwas Heiliges und Gottgewolltes, nur um sich selbst den Machthabern als unersetzlich anzudienen. Denn in der Tat: Kein Kolonialreich, das nicht von Soldaten militärisch und von Patres missionarisch aufgerichtet worden wäre: die einen plünderten, die anderen predigten, die einen stahlen den Besitz der Unterworfenen, die anderen zerstörten ihre Seele, – Religion als Legitimation des Ungeheuerlichen in der menschlichen Geschichte … Wie soll, wenn es so steht, man Glauben noch von Aberglauben unterscheiden? Wohl, wer von Gott spricht, sollte Freiheit meinen, doch wenn sogar bis in den inneren Bereich der Psyche die religiöse Unterweisung zur bloßen Indoktrination erstarrt? Wenn die zentralen Dogmen einer Religion der menschlichen Vernunft und ihre Vorstellungen über Ethik dem menschlichen Gefühl in Form und Inhalt geradewegs entgegenstehen? Wenn sie nicht sowohl Geistigkeit und Güte, als vielmehr Fanatismus fördern oder, reaktiv, Gleichgültigkeit? Solange Religion im Status seelischer Entfremdung Menschen in Ängsten, Repressionen, Schuldgefühlen und absonderlichen Lehren hindert, zu sich selbst zu finden, führt sie nicht zu Gott; wenn sie, was innen ist, veräußerlicht, ist sie gemeingefährlich, eine ansteckende Krankheit. Marx sah das so, Freud sah das so, und die Zahl derer wächst, die es genau so sehen, weil es ihnen anders niemals vorgelebt und vorgetragen wurde.
Lernen’s die Kinder nicht inzwischen, wo nicht im Schulfach «Religion», dann in «Geschichte», wie das Christentum im «Abendland» im 4. Jh. n. Chr. zur Reichsreligion des römischen Imperiums aufstieg? Für Konstantin den Großen war nach dem Sieg über seinen Thronrivalen Maxentius an der Milvischen Brücke im Jahre 312 der Glaube der Jesus-Bewegung gerade das rechte Mittel zur Vereinheitlichung des Bewußtseins aller Bürger: Christus selber triumphierte fortan auf dem Schlachtfeld, er manifestierte seinen Willen in dem Kaiser, und alle Gläubigen, Bischöfe und Kirchenlehrer konnten’s offenbar nicht besser treffen, als diese völlige Verkehrung der ursprünglichen Botschaft Jesu als gottgewollte Wahrheit zu akzeptieren, zu instruieren und zu indoktrinieren2 . Wie spricht man seither «richtig» über Christus? Ist er von Gott geschaffen, ist er selber Gott, ist er Gott und Geschöpf zugleich? Um der Reichseinheit willen wurde es im Jahre 325 im Konzil von Nicaea zur Pflicht, als Bürger Roms die Gottessohnschaft Jesu als der zweiten Person der dreifaltigen Gottheit zu bekennen; doch dieses Bekenntnis war keines des Lebens mehr, es war die Wiederholung einer Lehrformel, deren Berechtigung sich durchsetzte im Ausschluß ganzer Völkerschaften – etwa der Goten, denen der «Irrlehrer» Arius soeben erst das Markus-Evangelium erschlossen hatte … Das Christendogma als ein Herrschaftsinstrument! Der «Christus» als Allherrscher durch Gewalt und mit Gewalt! In Wahrheit ist er unter dieser Zerrgestalt nicht länger auffindbar, und jene Religion, die ihn im Schilde führt, sagt nicht, was nötig ist, sie nötigt vielmehr zu Unsäglichem. – Manche Vertreter der Kirchen beklagen offen den gegenwärtig zu beobachtenden Machtverlust der religiösen Institutionen in der modernen Gesellschaft, und sie vermeinen, darin einen Rückgang des Glaubens selber wahrzunehmen, – die Familienstrukturen brechen weg, in denen einst bereits die Kinder kirchlich zu «sozialisieren» waren. Doch der Verlust, der damit droht, scheint nicht so groß, als wie die Chance ist, die sich draus ergibt: endlich könnte die Religion zurückkehren in ihre Freiheit. Nicht länger hält man sie unter den Augen der Aufsichts- und Verwaltungsbeamten von Thron und Altar zu ihrer eigenen Schande als willfährige Gefangene!
Der Wechsel ist in unseren Tagen unvermeidbar.
Seit langem schon können Eltern in der Sprache der Dogmen und Konzilien ihren eigenen Kindern nicht mehr sagen, was sie trägt in Augenblicken, in denen es darauf ankommt, Lehrer in den Schulen stehen vor der unlösbaren Aufgabe, an ihre Jungen und Mädchen Glaubensformeln weiterzugeben, deren verbale Korrektheit beim Nachsprechen allenfalls der Erlangung guter Prüfungsnoten, doch nicht der Formung von Erfahrungen und Überzeugungen zugute kommt, Pfarrer auf den Kanzeln predigen sich trotz guten Bemühens und sorgfältiger Vorbereitung ihre Kirchen leer oder getrösten sich mit Bildungsangeboten und mit Bach-Chorälen.
Das Paradox ist nur ein scheinbares: je intensiver die religiöse Indoktrination unter Staats- und Kirchenaufsicht, desto stärker der Widerstand des Denkens, des Fühlens, des Empfindens. Nichts wirkt so unglaubwürdig, wie ein Glaubensinhalt, der in sich selbst unglaublich ist. Den Älteren erscheint die Religion inzwischen ähnlich einem Marmormonument, an dem das Leben ungerührt vorüberfließt, den Jüngeren wie ein Museum, das allenfalls noch aus besonderem Anlaß (ein Papst-Event, ein Kirchentag, ein Festival) eines Besuches wert ist. Wie läßt ein solches Vakuum sich wieder füllen?
In konservativen Kreisen pflegt man wohl immer noch die Meinung von der «Unverzichtbarkeit» der Religion. Woran gerade diese dabei freilich denken, ist weder Gott noch Mensch noch gar die Not all derer, die als an den Rand Gedrängte: als Asylsuchende, als Hoffnungslose, als Arbeitslose, als Immigranten oder als Invaliden, nicht mehr weiterwissen; was ihnen vorschwebt, ist «Religion» als Ordnungsfaktor, ist der Zusammenhalt des Staates, ist die Stabilisierung der Eigentumsverhältnisse und eine gewisse Planungssicherheit bei wirtschaftlichen und politischen Aktionen. In dieser Hinsicht ist es anscheinend recht nützlich, wenn das Volk die Regeln und Verordnungen des Rechts als gottgegeben hinnimmt. Was sonst als bloßes Machtdiktat der gerade Herrschenden sich offen darböte, empfängt in Kerzenschein und Weihrauchwolken die Aura heiliger Integrität und Unantastbarkeit.
«Christlichen» Theologen obliegt unter diesen Umständen von alters her die Pflicht, die bürgerlichen Werte des Zusammenlebens metaphysisch oder biblisch aus dem Sein beziehungsweise aus dem Wollen Gottes selber abzuleiten. Und ganz entsprechend wird die Religion jetzt wahrgenommen: sie ist noch nützlich, um die Kinder zu moralisch unbedenklichem Verhalten anzuleiten; sie dient auch wohl dazu, die imponierende Gestalt des Vaters, wie sie dem Kind erscheinen konnte, für die Erwachsenen ins Ewige und ins Unendliche zu überhöhen und damit das Gefühl der Ohnmacht, mithin die Neigung zu Gehorsam und zu Unterwürfigkeit, ins Maximum zu steigern; heiliger Geist, göttlicher Geist erweist sich als das beste Mittel, um den Geist kritischen Widerspruchs und Widerstands in all den Fragen, die nur allzumenschlich sind, zu dämpfen. Jedoch: Wer solchermaßen glaubt, läuft leicht vor jedem Karren … Das kann nicht wirklich Religion sein.
Im Grunde erntet man derzeit die Früchte des Zusammenspiels von Staat und Kirche zu Fragen der Moral und Rechtsprechung in den Jahrhunderten der Christenheit.
Siegreich im Wettbewerb von Politik und Religion, von Staat und Kirche, Papst und Kaiser um den Erhalt von maximalem Machtbesitz wurde, je länger, desto mehr, die weltliche Verwaltung. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Der Staat, die Politik bleiben nur handlungsfähig, wenn sie ihre Gesetze von Fall zu Fall an die Veränderungen der Gesellschaft anpassen; wer in Gesetzen aber Gott am Werke sieht, kann solchen Wankelmut nicht dulden, er muß auf Festigkeit und Unnachgiebigkeit beharren. Die Religion taugt so am besten zur Restauration, als Retardiv des Fortschritts. Frauenrechte, Ehescheidung, künstliche Empfängnisverhütung, Abtreibung, Homosexualität, Sterbehilfe, – in all diesen Fragen versteht insbesondere die katholische Kirche sich immer noch als Hüterin der gottgewollten Schöpfungsordnung von Ehe und Familie, und wo immer sie die Macht hat (in Irland, Polen, Spanien, den Philippinen, in Lateinamerika), versucht sie, die Legislative in ihrem Sinn auf Kurs zu halten. Religion als Reaktion, – das freilich ist das Gegenteil der geistigen Revolte, die mit Religion gemeint sein sollte, das ist der Abgesang auf jede Form lebendiger Gottesbeziehung. Wer Gott im Munde führt und nur das ewig Gestrige verteidigt, diskreditiert den Glauben; er macht ihn obsolet, er leistet letztlich dem Zynismus Vorschub.
Vor 50 Jahren noch schien das erheblich anders: Die Menschenrechtsbewegung zur Gleichstellung von Schwarz und Weiß in den Südstaaten der USA formulierte ihr Anliegen bewußt mit religiösem Pathos, desgleichen die Friedensbewegung in ihrem Widerstand gegen den Krieg der Amerikaner in Vietnam sowie gegen das atomare Wettrüsten zwischen Ost und West im Kampf um Weltherrschaft; nicht minder fand das Eintreten für faire Austauschrelationen auf dem Weltmarkt im Handel zwischen Nord und Süd, die Forderung des Ausgleichs zwischen Arm und Reich, das Engagement zur Unterstützung der Entwicklungsländer einen starken religiösen Widerhall, und nicht zuletzt erblickte die Ökologiebewegung in dem Erhalt der Umwelt und in dem Schutz der Tiere ein evidentes Postulat des Schöpfungsglaubens: wenn Gott die Vielfalt der Natur ermöglicht und gewollt hat, dann kann er nicht die Durchsetzung nur einer Spezies (des Menschen) gegen den Rest der Welt gutheißen3 . Doch wie weit ist das alles her!
Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks brach sich das kapitalistische Wirtschaftssystem in ungehemmter Weise Bahn: es ökonomisierte, privatisierte und deregulierte alle Bereich des öffentlichen Lebens bis hin zu Altenbetreuung, Krankenpflege, Schulausbildung, Strafvollzug und Energieversorgung, es konzentrierte unvorstellbare Geldsummen in den Händen weniger zum Schaden von zwei Dritteln der Bevölkerung der Erde, es lehrte, mit dem Hunger von Milliarden an der Nahrungsmittelbörse in Chicago auf Gewinn zu spekulieren, es militarisierte die Außenpolitik der Industrienationen und globalisierte den Krieg als ständige Einrichtung zur Wahrung der Interessen der Besitzenden4 . Die quasi religiöse Hoffnung, es möchte möglich sein, auf dieser Erde endlich miteinander in Frieden und Gerechtigkeit zu leben, wurde aufs bitterste enttäuscht. Gekommen ist nicht eine «bessere» Welt, gekommen sind die Realisten, die Pragmatiker, die Utilitaristen, die Opportunisten, und sie reden von Verantwortung, von Sachzwängen, von Wirtschaftswachstum unter allen Umständen und buchstäblich um jeden Preis; als unverantwortlich erscheint es jetzt, an Idealen, Utopien und Prinzipien noch länger festzuhalten. Die Zeit der Träume ist vorbei; die Kinder schon kann man nicht früh genug heranführen an die Härte der Lebenswirklichkeit. Man muß sie ausbilden, um fit zu sein für den weltweiten Konkurrenzkampf der Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft.
Die Erwartung, die Welt lasse sich nach religiösen Idealen umgestalten, hat sich scheinbar als trügerisch erwiesen; die Religion in der tradierten Form ist nichtssagend und leer geworden. Doch sonderbar: Gerade damit wird erst wirklich klar, was Religion zu sagen hätte. Erst jetzt wird vollends offenbar, daß es von Grund auf falsch war, Religion mit Ethik gleichgesetzt zu haben. Die Religion, speziell die christliche, hat mehr, unendlich mehr und tieferes zu lehren als: «Du mußt», «Du sollst» und: «Du darfst nicht». Sie bietet in gewissem Sinne allererst die Grundlage dafür, daß Menschen hinreichend mit sich identisch sind, um tun zu können, was sie moralisch wollen und was sie ethisch sollen. Die Religion kommt erst zu ihrer Wahrheit, wenn sie abläßt davon, nichts weiter sein zu mögen als eine Ideologie des Staatserhalts. Die Menschen brauchen anderes …
Die allerdings, verstreut über die Berge, gehen unterdessen selber auf die Suche. Das All, das Universum, die Natur tritt für sie an die Stelle Gottes; das Einssein mit dem Kosmos gilt ihnen als Gebet; das Einverständnis, daß doch alles kommt, wie’s muß, und daß es gut ist, wie es ist, ersetzt ihnen den Gottesglauben; und sich im Gang des Ganzen aufzulösen, kompensiert für sie die Hoffnung auf Unsterblichkeit. Fast wird es eine Lust, die Personalität des Menschen als ein scheinbar zu Begrenztes zu negieren und eine Frömmigkeit im Jenseits eines personalen Gottes zu erträumen; man gibt sich das Versprechen, auf diese Weise eine Weisheit zu besitzen, in der die Unterschiede zwischen Gott und Welt, Mensch und Natur, Seele und Leib, die Differenzen auch zwischen den Religionen selbst in mystischer Alleinheit wie von selbst verschwänden, – eine Toleranz der Indifferenz zur Überwindung der Intoleranz und Divergenz vor allem der monotheistischen Offenbarungsreligionen. Bei den Nachdenklichen erübrigt sich die Metaphysik der abendländischen Theologie nunmehr durch eine physikalisch argumentierende Naturphilosophie, bei der gewisse überraschende Aussagen der Quantentheorie, nicht selten in Kombination mit esoterischen Anschauungen und Praktiken, wie ein Beweis dafür genommen werden, daß die Natur schon selber jene Transzendenz des Wissens, des Bewußtseins, des nur Materiellen, des Endlichen, des Definierbaren aufweist, die vordem sich mit der Idee von Gott verband. Kein Plan, kein Wille mehr gestaltet sonach diese Welt, dafür ein Es, ein Ist, ein Muß, – etwas Unendliches, das alles in sich schließt, indem es, was da ist, aus sich hervorbringt und in sich zurücknimmt. – Die Anziehungskraft solcher Lehren ergibt sich nicht aus ihrer Wohldurchdachtheit – das Denken selbst erscheint hier als ein geistig zu Beschränktes –, sie gründet vornehmlich in all den offenbaren Fehlantworten, die in der Tradition der Dogmen als Glaubensgut des Christentums von Kirchentheologen letztverbindlich vorgetragen wurden und noch werden. Wenn es so, wie gesagt, nicht sein kann, dann muß es anders sein; – das stimmt! Doch: dieses «anders» muß sich nicht ergeben aus dem Widerspruch zum Christlichen; weit näher liegt es, was das Christentum zu sagen hat, vom anderen Ende aufzunehmen. Und eben das soll hier geschehen.
Alles beginnt damit, das Alte anders auszudrücken, – statt Dogmen Dichtung, statt der Sprache des Dozierens eine Form des Existierens, statt des Kultdienstes der Priester eine Kultur von priesterlichen Menschen, statt einer Hierarchie von Klerikern und Staatsbeamten die unbeschwerte Weise Jesu, durch die Welt zu gehen. Allein schon dieser Wechsel hat enorme Konsequenzen.
Läßt man tradiertermaßen Theologen an die Quellenschriften einer Religion heran, so wird in ihren Händen aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, aus dem Koran ein Kriegsbuch, indem sie sich beweisen, daß just ihre Religion als die von Gott geoffenbarte einzig und allein die Wahrheit ist und in sich trägt, und wer nicht gleich in gleichem Sinne glaubt, der muß bekehrt werden und hat sich zu bekehren. Anders, wenn man die gleichen Texte als das liest, was sie in Wahrheit sind: als Bilder, als Symbole mit einer eigenen Poesie. Während Dogmen trennen, laden Bilder ein. Was Dichter schreiben und gestalten, weckt in der Seele aller, die es lesen, ähnliche Gefühle und Gedanken. Sie sind mit sich nicht mehr so ganz allein, sie fühlen sich verstanden und begleitet, und insbesondere die Ausgegrenzten, die Gescheiterten, die tragisch ins Unglück Geratenen erregen durch ihr exemplarisch dargestelltes Schicksal Mitleid: so kann es einem selbst ergehen! Der menschliche Zusammenhalt stellt sich, verstärkt sogar, neu wieder her und überwindet den Graben der moralisch selbstgewissen Aburteilungen. Man kann, läßt man allein die Theologen «Offenbarungen» auslegen, wie oft genug geschehen, mit Mose Kriege führen gegen «Kanaan», mit Christus gegen Mose und Mohammed und mit Mohammed gegen Mose oder Christus. Mit Shakespeare kann man Goethe nicht bekämpfen, mit Goethe nicht Gogol und Dostojewski, mit keinem Dichter einen anderen Dichter. In allen Religionen redet Gott in Bildern, die er in der Seele aller Menschen angelegt hat. In Bildern reden heißt, die Grenzen aufzuheben, die zwischen den Kulturen und den Sprachfamilien bestehen; es heißt, aus dem zu existieren, woraus alle Menschen leben. Auf dieser Ebene ist Religion universell wie alle Kunst – wie die Musik, die Malerei –, nur daß es ihr nicht um Ästhetik, um die Kunst des freien Spielens, sondern um die Kunst des Lebens selber geht. Der Glaubende setzt ganz und gar sich selbst aufs Spiel. In dieser Weise sich symbolisch zu verstehen, steht den verfaßten Religionsformen im ganzen noch bevor, doch es ist unabdingbar, und es führt nicht, wie man mitunter meint, zu unverbindlicher Beliebigkeit, sondern im Gegenteil: zum eigentlichen Ernst des Religiösen. Es will gelebt und angeeignet werden in der eigenen Existenz. Verbindlicheres gibt es nicht.
Dann aber, wesentlich, ist es darum zu tun, die ganze Perspektive umzukehren. In Theologensicht weiß man, wer Gott ist, was er plant und was er tut, weil er sich selbst geoffenbart hat; folglich ist christliche Verkündigung als Wiedergabe dieser Offenbarung ein Sprechen stets von Gott her auf die Menschen hin: die ganze Welt erklärt sich aus den Absichten des Höchsten, und man schaut über Gottes Schulter auf den Lauf der menschlichen Geschichte, – versteht ihn, kennt ihn, wertet ihn. Und immer weiß man schon, was sonst gar nicht zu wissen wäre. Die Wahrheit ist: wir sehen nicht mit Gottes Augen! Wenn Gott sich offenbart, dann ist es, weil er uns die Augen öffnet, daß sein Licht in unsere Seele fällt. Dann heben wir das Haupt zum Himmel gleich den Blumen, die den Blütenkranz zur Sonne wenden. Die Blumen wissen nicht die Sonne, sie wachsen nur in ihr. Auch wir als Menschen wissen Gott nicht, wenn er sich uns mitteilt; dafür empfangen wir die Kraft, die Wahrheit, die in uns liegt, zu entfalten, dem Glanz entgegen, der von allen Seiten uns umgibt. Wir können nur von uns her auf Gott hin Leben gewinnen, und nur auf Gott hin, menschlich redend über Menschen, vermögen wir zu sagen, wer Gott für uns ist. Denn alles ist und schenkt er uns. Das Christentum der Lehramtsdogmen ist wie ein Teleskop, das all die Zeit falschrum gehalten wurde: statt von der Erde her damit die Sterne zu betrachten, nahm man das Objektiv als Okular und wähnte sich damit an Gottes Statt. Man sah die Erde von den Sternen aus. Man sah nicht Gott, man sah nur alle Menschen – ins Winzige verkleinert!
Theologie vom Menschen her – das heißt zu integrieren, was man heut über den Menschen weiß: – seine Gefühle, die den Hunderten von Millionen Jahren sich verdanken, in denen er sich aus der Tierreihe entwickelte; die Antriebe, Sehnsüchte, Bilder seiner Psyche, die tief im Unbewußten liegen; die Ohnmacht des Bewußtseins gegenüber dem bewußten Wollen; die abgründige Ausgeliefertheit im Getto seiner Ängste, Aggressionen, Zwänge und Kompensationsversuche; – das Warten auf Erlösung durch eine Gnade, die es inmitten der gesamten Welt nicht gibt. Davon im wesentlichen hat das Christentum zu sprechen, darin liegt seine Offenbarung, dadurch allein vertieft sich sein Blick auf die Menschen im Untergrund der oberflächlichen Bewertungen nach Gut und Böse auf der Ebene von Ethik und Jurisprudenz. Um zu verstehen, wie die Sonne sich in Blumen offenbart, muß man begreifen, was Photosynthese ist: wie physikalische Energie sich wandelt in biochemische Energie; um zu verstehen, wie Gott sich offenbart in Menschen, muß man begreifen, was Verzweiflung ist – und wie sie sich von Gott her wandelt in Vertrauen.
Ein solcher Perspektivewechsel ist total; er ändert nicht den Inhalt, doch die Richtung der gesamten Religion. Sie dient nicht mehr der Auszehrung des Menschlichen zur projektiven Aufblähung des Göttlichen, sie dient der Heilung jener Krankheit, die das Dasein ohne Gott, im Feld der radikalen Gnadenlosigkeit der Welt, sein muß. Ein solcher Umsturz ist notwendig, und er ist unaufschiebbar, doch eben deshalb tritt er ein mit der Sprengwirkung einer Explosion; er ist gefährlich, denn er fordert alles.
Einst, in der Bibel, waren es Propheten, die in den Schicksalsaugenblicken Israels es wagten, in den Zusammenbruch hineinzugehen, um auszusprechen, was sich zeigt, wenn aller Halt im Äußeren zerbirst. Keiner von ihnen freilich ist dafür so exemplarisch und zugleich so aktuell wie Jeremia; seine Geschichte ist in unseren Tagen beides: Vorbild sowohl als auch Verpflichtung, denn in gewissem Sinne wiederholt sie sich oder vielmehr, im Blick auf Jesu Botschaft, sie verwirklicht sich erst jetzt in ihrer ganzen Tragweite, sie setzt sich durch in ihrer damals nurmehr wie von fern geahnten Wahrheit, sie lehrt uns, Jesu Hauptanliegen zu verstehen, den Gott der Väter heilend, nicht mehr strafend, den Menschen nahzubringen.
Wer Jeremia war? Und warum man ihn kennen muß? –
Im Jahre 609 v. Chr. – soeben ist Josia in der Schlacht bei Megiddo gefallen und sein Nachfolger Joahas von den Ägyptern abgesetzt worden; ihr Vasall Jojakim tritt gerade sein Amt an5 , – da stellt sich, beim herbstlichen Bundesfest in Jerusalem dieser Priestersohn aus Anatot an das Tempeltor (zwischen dem äußeren und dem inneren Vorhof; vgl. Jer 26,2) und schleudert der Gottesdienstgemeinde, die eines tröstlichen Wortes nach all dem Desaster dringend bedürfte, Sätze wie diese entgegen: «Setzt euer Vertrauen nicht auf die Trugworte: ‹Der Tempel Jahwes, der Tempel Jahwes, der Tempel Jahwes ist dies!›» (Jer 7,4) «Ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, in euren Augen eine Räuberhöhle geworden? Wahrlich, auch ich sehe es so an – ist Jahwes Spruch. – So geht doch zu meiner (heiligen) Stätte in Silo, wo ich zu Anfang meinen Namen wohnen ließ, und seht, was ich ihr getan habe.» (Jer 7,11.12)6
Silo – das war einmal das zentrale Heiligtum des Zwölf-Stämme-Verbandes gewesen (vgl. 1 Sam 1–3), doch schon im 11. Jh. war es von den Philistern dem Erdboden gleichgemacht worden (vgl. Ps 78,60)7 ; Silo das war das Vorbild und der Vorgänger auch für den Tempel, der – gegen prophetischen Widerstand (2 Sam 7,5–7) – von dem David-Sohn Salomo um 935 v. Chr. errichtet worden war (1 Kön 6,1–10); warum also soll, was jenem geschah, nicht auch diesem geschehen?
Gleiche Fehler zeitigen gleiche Folgen, und was Jeremia an Fehlern den Gläubigen seines Volkes vorwirft, ist nicht mehr und nicht weniger als die Perversion des gesamten Gottesverhältnisses in ein liederliches, widerliches Menschenmachwerk. Man glaubt sich sicher am Orte, da der «Herr» wohnt, wie man es in den Tagen des Jesaja im Jahre 701 v. Chr. erlebt hatte (vgl. Jes 10,24–27; 29,1–8); damals hatte der Assyrerkönig Sanherib vergeblich versucht, Jerusalem einzunehmen (2 Kön 19,35–37), und der Prophet hatte seine Zuflucht genommen zu einer Haltung des Vertrauens jenseits des politischen Machtkalküls aus Bündnissuche und militärischem Hasardspiel8 . Wie durch ein Wunder war man gerettet worden. Was aber folgt daraus für die Gegenwart? Etwa ein Anspruchsrecht, daß Gott sein Heiligtum auch künftighin in dieser Weise schützen wird? Wohl, von alters her bot der Tempel Gottes Zuflucht allen Verfolgten und Schutzsuchenden, selbst den Schuldiggewordenen, selbst gegenüber dem Zugriff des Bluträchers (vgl. 1 Kön 1,50–52). Doch läßt daraus sich eine Ritualmagie göttlicher Beistandszusage ableiten? Gottes Urteil ist nicht Menschen-Urteil! Das allerdings ist wahr. Dann aber auch: Gott braucht den Tempel nicht! Er braucht die Opfer nicht, die Priester ihm in endlosen Kulthandlungen auf den Altären darbringen (Jer 7,21–28). Der ganzen Religion bedarf er nicht mit all ihren Verkomplizierungen, Verrechtlichungen und Instanzenzügen. Was er gewollt hat, als er Israel berief, und was er nach wie vor im Sinn trägt, das ist ein Bündnis mit dem Menschen, den er schuf (Jer 7,23)9 . Ein Bündnispartner in Verläßlichkeit für Menschen, die verläßlich sind, – das war, das ist der Gott vom Sinai in Jeremias Augen.
Wenn aber Menschen nicht verläßlich sind? Wenn sie, statt Gottes freier Partnerschaft zu trauen, sich selber zutrauen, den Gott der Offenbarung hinreichend zu kennen, um ihn den eigenen Bedürfnissen nach Sicherheit und Macht gefügig einzupassen?
Dann wird aus dem Gott Israels der Typ von Gottheit, den ganz offensichtlich alle Religionen der Tendenz nach in sich bergen: Da walten Priester über das Mysterium des Daseins, handhaben es mit fixen Formeln, traktieren es in Traditionsroutine, schreiben es fest im Regelwerk von Rechtsbestimmungen, Tabus und Unterwerfungsforderungen. Gehorsam, Außenlenkung und: Angst, die Unterschlupf im Kollektiv zu finden hofft, sind das Ergebnis einer solchen Einstellung. Man braucht die anderen, um nicht allein zu sein, man ist dabei, um nicht beiseite stehen zu müssen, man fühlt sich zugehörig durch den Zufall der Geburt und Gruppenbindung; man ist, und ist nie wirklich, das Eigene zerrinnt uneigentlich, die Wahrheit, die man glaubt, ist nie dazu bestimmt, persönlich wahr zu werden. Dabei käme es nur darauf an. Was trägt, zeigt sich, wenn alles Äußere zerbirst.
Die Stunde des Propheten Jeremia kam am 10. August des Jahres 587. Man hatte ihn als Lästerer, Verräter, Defätisten und notorischen Schwarzseher zu beseitigen gesucht (Jer 37,15–16; 38,1–13), weil er Nebukadnezar, den König von Babylon10 , als Hammer in den Händen Gottes ansah, mit dem er «seine» Stadt Jerusalem zur Strafe für ihr Fehlverhalten niederschmettern werde; ja, er verlangte von König Zedekja, selber seinen «Nacken unter das Joch des Königs von Babel» zu beugen und ihm untertan zu sein, nur so werde man leben (Jer 27,12)11 . Doch Volk und König weigerten sich, zu kapitulieren, und so ließ sich die Katastrophe nicht mehr aufhalten. Um jeden Widerstand in Zukunft unmöglich zu machen, deportierten die Babylonier die unterworfene Bevölkerung als Kriegsgefangene, als Sklaven ins Exil in das Zweistromland12 . Als Heiligtumsort seines Gottes hatte Jerusalem aufgehört zu existieren. Der gesamte nationaltheologische Stolz der Hofpropheten und der Tempelpriester war am Ende. Schon schien es, als sei Gott, der Jahwe Israels, selber am Ende, – Marduk, der Gott der Babylonier, war offensichtlich stärker, er hatte ihn besiegt … Nur Jeremia glaubte seinem Gott; er zog die Konsequenz aus dem Zusammenbruch, den er die ganze Zeit schon hatte kommen sehen.
Und dies vor allem waren die Feststellungen, die er treffen mußte: Die wie selbstverständlich geglaubte Einheit von Gottesmacht und Menschenmacht hatte sich jäh und grell als eine grandiose Lüge offenbart. Keinesfalls gründete Gottes Macht auf militärischer und wirtschaftlicher Größe, – dies ganze Denken war von Grund auf falsch. Überhaupt: Alles, was Gott ins Äußere zu stellen suchte, war verkehrt. «Gott wohnt im Tempel», – es gab keinen Tempel mehr. «Gott wird im Gottesdienst der Gläubigen und im Gebet der Priester gegenwärtig», – es gab keinen Gottesdienst und keine Priester mehr. «Gott zeigt seine Größe in der Machtfülle des Herrschers», – jetzt gab es keine Größe irgendeines Herrschers mehr in Israel. Der Grundfehler war stets derselbe: Alles, was da versucht, im Sichtbaren Gott vorweisbar zu machen, muß in die Irre gehen. Der ganze Pomp des Religionsbetriebes war nicht nur überflüssig, er war schädlich, er war ein Mißverständnis oder gar ein Selbstbetrug, in jedem Falle selber eine Form von Götzendienst. Der ganze Außenhalt der Religion in dem Zusammenhalt des Volkes als eines Staatswesens von nationaler Größe, die Rückbindung an das Althergebrachte aus Tradition, Institution und Konfession, die Vergewisserung, durch göttliche Erwählung allein schon durch die Abstammung von Abraham etwas Besonderes zu sein, – all das war endgültig dahin, und Gott sei Dank! Gerade dafür: Gott sei Dank!
Denn weiter! Was galt in Israel als Allerheiligstes, wenn nicht die zwei Gesetzestafeln in der Bundeslade? Auf ihnen hatte Mose die Gebote Gottes eingemeißelt, und gewiß: in ihnen ehrte man das Wort des Herrn vom Sinai. Was aber nutzt Geschriebenes auf Stein, wenn’s nicht ins Herz des Menschen dringt? Und kann es je des Menschen Innerstes erreichen, solange man von außen her es anerziehen und aufzwingen muß? Die Schriftausleger, die Autoritäten, wenn es galt, Gott «richtig» zu verstehen, – sie alle hatten sich als Irrlehrer erwiesen, und das zentral, in dem Hauptpunkt: Gott schreibt, was er dem Menschen sagen will, nicht äußerlich auf Steintafeln, er redet in ihr Herz hinein, – wie er mit Jeremia selber redete in Worten, die ihm sagten, was sein Auftrag sei, sowie in Bildern, die als Wahrnehmungen Gottes Handeln vorbedeuteten. Gott wirkt auf Menschen nicht von außen, er redet innerlich in dem, was sie selbst fühlen, denken, wissen, spüren … Das macht es unabweisbar, hebt es zur Gewißheit, nötigt es, sich mitzuteilen.
Jedwede Form von Fremdbestimmung mußte religiös verkehrt sein, – schon deshalb war die Gleichsetzung von Herrschermacht und Gottesmacht absurd. Alles, was Könige befehlen, will Gehorsam, verlangt Unterwerfung; was hingegen Gott mitteilt, läßt leben, richtet auf, weitet das Herz. Der Gegensatz könnte nicht größer sein. Darum braucht Gott all die liturgischen Staffagen nicht, die Formeln, die ihn festlegen, die Schlachtaltäre für die Tieropfer, die die gerechte Strafe für begangene Schuld von Menschen nehmen sollen … Es ist die ungeheuere Vision des Jeremia, daß Gott den alten Bund mit seinem Volk ersetzen wird durch einen neuen Bundesschluß, in dem alles, was außen war, ins Innere gezogen wird. «Siehe», schreibt er, «es werden Tage kommen, … da schließe ich mit dem Haus Israel … einen neuen Bund, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Lande Ägypten herauszuführen … das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließe nach jenen Tagen …: Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und schreibe es ihnen ins Herz. Und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und nicht mehr braucht einer den anderen und niemand seinen Bruder zu belehren mit der Mahnung: ‹Erkenne Jahwe!›, sondern sie alle werden mich erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten … Denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken.» (Jer 31,31–34)13
Wenn es nach der Tragödie des Untergangs Jerusalems noch weitergehen soll, dann also einzig unter diesen zwei Bedingungen:
1) daß man Gott reinweg innerlich versteht. Das ganze Lehrsystem von Wissenden in Sachen Gottes, die andere, Unwissende, belehren, schafft nichts als jene Fremdbestimmung, Unselbständigkeit und Außenlenkung, die nur das Gegenteil von Freiheit, Mündigkeit und eigener Verantwortung vor Gott darstellt. Vor allem: man kann Gott nie in der Art wissen, daß man aus ihm ein Objekt zum Dozieren modellieren könnte. Gott redet jetzt, von Augenblick zu Augenblick, persönlich, unvermittelt und unmittelbar, – alles Gelehrte, Dünkelhafte, Wichtigtuerische ist da fehl am Platze14 . Umgekehrt: man sollte wieder die Bescheidenheit gewinnen, von Gott zu lernen aus dem Mund der Magd in der Küche und aus den spielenden Händen des Kindes im Hof. Aus allem redet Gott, und die eigentliche religiöse Erziehung müßte darin bestehen, die Ohren für das «verschwebende Schweigen» zu öffnen, in welchem Gott schon zu Elija redete (1 Kön 19,12)15 .
Oder zu Mose selber.
Als dieser am brennenden Dornbusch ihn nach seinem «Namen» fragte, antwortete Gott mit den ebenso verhüllenden wie verheißenden Worten: «Ich bin da, als der ich dasein werde.» (Ex 3,14)16 – «Mein Wesen, Mose», sollte das heißen, «wirst du nie wissen und brauchst du nicht zu wissen. Das einzige, was du wissen mußt, ist eine Tatsache, die du immer neu erfahren kannst: Es wird in deinem Leben kein Augenblick sein, da ich nicht bei dir bin. Wie du mich jeweils antriffst, entscheidet sich von Fall zu Fall: Mal werd’ ich dir entgegentreten als Widerstand und Widerspruch, wenn du dabei bist, in die Irre zu gehen; dann wieder werd’ ich dir begegnen als Trost und Halt, wenn du am Boden liegst und nicht mehr weiterweißt; dann wieder wirst du mich erleben wie einen Wind, der deiner Seele sanft unter die Flügel greift. Je nachdem, wie du selber dich verhältst und in welch einer Lage du dich findest, werd ich ganz unterschiedlich dir erscheinen. Niemals aber wird eine Situation eintreten, in der ich nicht da wäre. Denn das bin ich dir wesentlich: jemand, der da ist als dein Beistand.»
Nicht durch Dozieren mithin, nur durch Existieren läßt sich Gott erfahren. Diese Erkenntnis bereits ändert alles. Doch dann ist da noch etwas anderes, ja, in gewissem Sinne noch weit Wichtigeres, das ist
2) die Zusage bedingungsloser Vergebung. Sie ist der Kern des Neuen Bundes, den Jeremia kommen sieht. Im Alten Bunde mußte gelten, daß Gott das Gute lohnt, das Böse straft. Gut und Böse, die gesamte Ethik, die Rechtsprechung, die Vorstellung von Recht und Unrecht, von Gerechtigkeit, – all das lag in den Händen eines Gottes, der zu Gericht saß über alle Menschen. Die Menschen – das war die Grundvoraussetzung dieser Verbundenheit von Gott und Mensch – sind von sich her imstande, zu tun, was Gott von ihnen fordert; sie tragen selber die Verantwortung, wenn sie es nicht tun. Nur deshalb hatte Gott in der Geschichte Israels von Mal zu Mal sein Volk gezüchtigt, wenn es fremden Göttern nachgehurt oder sittlich sich verfehlt hatte. Doch wann wäre das nicht der Fall gewesen? Der stete Kreislauf von Vergehen und Strafe, Strafe und Vergehen zeigte nur eines ganz gewiß: daß kein Mensch «besser» wird, wenn man ihn straft und züchtigt. Die Strafepädagogik insgesamt war mit dem Untergang Jerusalems am Ende. Furchtbarer konnte Gott nicht dreinschlagen, als es im Jahre 587 geschehen war; was aber war damit erreicht? Gott selber, das Konzept vom Bundesschluß am Sinai als ganzes, war gescheitert. Es brauchte eine neue Grundlage, und es war unschwer, zu verstehen, wie diese auszusehen hatte.
Solange Menschen Angst haben vor Gott, sind sie im Inneren zerrissen. Selbst wenn sie Gutes tun, geschieht es nicht in Einheit mit sich selbst, sondern aus Furcht vor Strafe, und immer bleibt im Untergrund die Neigung zu Protest und Auflehnung bestehen. Das, was die Ethik böse nennt, läßt sich nicht wegverbieten (durch Verschärfung der Gesetze) oder wegdressieren (durch Verhängung noch strengerer Strafen), man kann es überwinden nur durch ein Vertrauen, das die Angst vertreibt. Statt all das Böse abzustrafen, gilt es daher, den Gründen nachzugehen, die einen Menschen dahin bringen, das Gegenteil von dem zu tun, was er im Grunde mal gewollt hat, und das setzt gerad das Gegenteil von äußeren Bewertungen und Strafentscheidungen voraus. Offen dem anderen gegenübertreten kann man nur in einer Haltung des Vertrauens auf Vergebung, nicht in der Furcht vor Züchtigung; ehrlich sich selber gegenüber wird man nur im Gegenüber eines solchen Anderen, von dem man glauben darf, daß er nicht aburteilen, sondern helfen will. Die Innerlichkeit in dem Neuen Bündnis zwischen Gott und Mensch basiert allein auf dem Vertrauen in Vergebung17 .
Und das genau ist jetzt der Inhalt der gesamten Botschaft Jesu. Es ist die Lebensmitte dessen, was als Neuer Bund, als Neues «Testament», den Kern des Christentums ausmacht. Die Art, wie Jesus auftrat und mit Menschen umging, ist überhaupt nur zu verstehen als Erfüllung der Vision des Jeremia: «Richtet nicht, damit ihr nicht (von Gott) gerichtet werdet», sagte er (Mt 7,1), und: «Wenn euere (Vorstellung von) Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich gelangen.» (Mt 5,20)18 Die «bessere» (die fundamental andere) «Gerechtigkeit», die Jesus vorschwebte, besteht nicht länger darin, in Selbstgerechtigkeit über einander zu Gericht zu sitzen, sondern der Not des anderen «gerecht» zu werden. Einzig in dieser Haltung kommt das Wesen Gottes selbst zum Tragen. Gott ist nicht der Gesetzgeber und Richter, als der er von den «Schriftgelehrten» und den «Pharisäern» hingestellt wird, er ist als erstes der Ort eines Innehaltens, um zu sich zurückzufinden. Die ganze Botschaft Jesu diente der Freiwerdung des Menschen aus den Brechungen und Zwängen seiner Seele. Von außen her «gerechte» «Strafen» zu verhängen erübrigt sich dabei von selbst; die Pein, im Fortschritt eigener Erkenntnis nach und nach zu sehen, wie weit man sich vom Eigenen entfernt und welchen Schaden man bei anderen dadurch angerichtet hat, wiegt schwerer als jede fremd verhängte Schmerzzufügung.
Das Christentum, mit einem Wort, darf gerade keine Ethik sein, es ist in strengem Sinne eine Religion der Erlösung. Es treibt nicht zur Erfüllung von moralischen Geboten an, es ist bestrebt, der Menschen Leben bis dahin zu ordnen, daß sie von innen her die Fähigkeit gewinnen, so zu werden, wie Gott sie gemeint hat. Nicht um das Tun der Menschen, um die Art des Menschseins selber geht es ihm, und eben darin greift es – ganz entsprechend der Idee des Neuen Bundes – zentral die Weissagung des Jeremia auf.
Von diesem Zentrum her gilt es deshalb, die Jeremia-Stunde des Zusammenbruchs der Religion in unseren Tagen zu bestehen. Es sind die beiden Grundgedanken des Propheten: Innerlichkeit und Vergebung, die als einzige nach Wegfall aller Spannseile und Stützpfeiler des Christlichen im Äußeren für einen Neuanfang geeignet sind. Nicht eigentlich der Inhalt steht in Frage, doch um so mehr die Art, ihn zu vermitteln.
Die religiöse Sprache selber ist erkennbar leergeredet, – an den zentralen Stellen bezeichnet sie inzwischen das genaue Gegenteil des ursprünglich Gemeinten. «Gnade» etwa – ein Wort, in welchem das gesamte Verhältnis Gottes zum Menschen zum Ausdruck kommt19 , ist im alltäglichen Gebrauch so gut wie völlig ausgestorben, und wenn man es denn doch einmal verwendet, so denkt man an das Gottesgnadentum, mit welchem geistliche und weltliche Regenten ihre Herrschaft zu begründen suchten, – das träufelt von den Thronen huldvoll, wie zur Ironie, herab aufs Haupt der Untertanen; in diesem Kontext dient das Wort Gnade nicht dazu, dem Dasein jedes Einzelnen die absolut notwendige Berechtigung zu schenken, es hat nur noch den Zweck, den Gottesglauben mit Gehorsam gleichzusetzen. – Oder das wichtige Wort «Sünde»: In biblischer Bedeutung steht es für ein Leben im Zustand radikaler Gottesferne20 , doch dieser Sinn ist wie verloren; es umspielt allenfalls den ethischen Begriff moralischer Verfehlungen noch mit dem Hauch einer sakralen Aufwertung21 . Auch das Wort «Sünde» hat den Sinn verloren. – Inzwischen lassen «Gnade» ebenso wie «Sünde» sich recht erfolgreich in der Werbeindustrie gebrauchen: Da ist der Held eines Wildwestfilms «gnadenlos», da ist der Geschmack von Pralinen «sündhaft» gut, – die Worte wirken in völliger Verdrehung des einmal Gemeinten. – Oder wohl am schlimmsten: das Sprechen von der Person Jesu selbst. Es hat sich, entsprechend dem Bewußtseinszustand der Gesellschaft, aufgespalten in eine quasi sektenhafte Formelverwendung nach dem Motto des Autoaufklebers «Jesus liebt dich» und eine quasi kabarettistische Form des Ulks, mit der man all das Unechte, Verlogene und Phrasenhafte der Verkündigungssprache der Kirchen freizulegen sucht. Im Bundestag von Jesus zu reden bedeutete heutigentags schlicht eine undemokratische Provokation. Dieselbe Politik, die noch das Aufhängen von Kreuzen in Gerichtssälen und Schulen schützt und selbst den Fahneneid deutscher Rekruten bei der Bundeswehr im Beisein kirchlicher Amtsträger abnimmt, versteht sich selbst als religiös neutral. Daß Religion im Sinn des Jeremia oder gerad des Jesus eine Haltung ist, die das gesamte Dasein gründet in «Gnade», tritt vollkommen zurück hinter der Vorstellung, die Konfessionsinteressen von «Evangelischen» und «Katholiken» nach dem Gesellschaftsproporz aufteilen zu müssen. Selber zu glauben braucht man dafür nicht.
Die Botschaft Jesu, wie dringend erfordert, innerlich zur Sprache zu bringen, setzt deshalb die Entrümpelung der gesamten Dogmensprache voraus. Sie ist entstanden beim Versuch der «Kirchenväter», den Gottes- und den Christusglauben mit den Mitteln griechischer Philosophie als in sich logisch und vernünftig zu erweisen. Ein solcher Versuch mag historisch verständlich, vielleicht vor 1800 Jahren sogar notwendig gewesen sein, – der «Erfolg» bestand darin, das Christentum zu akademisieren und zu kategorialisieren. Indem man die Glaubensinhalte in philosophischen Begriffen dogmatisierte, dogmatisierte man zugleich die philosophischen Begriffe mit. Man errichtete ein immer großartigeres Prachtgebäude aus versteinerten Gedanken, in dem nur die gehorsame Gelehrtenschaft der Kirche selbst zu Hause war; für alle anderen – «normalen» Gläubigen oder gar Andersgläubigen – wurde daraus eine gar feste Burg zur Durchsetzung der einzig wahren Lehre. Inzwischen reckt sich diese Burg zum Himmel wie das berühmte Castel del Monte des Staufenkaisers Friedrichs II.: bewundernswert, doch unbewohnbar. Zum Leben kommen kann man nur, wenn man von dort herabsteigt und bei den Fragen anknüpft, die den Menschen wirklich auf den Nägeln brennen. Nicht wer Gott an und für sich selbst ist, steht da zur Debatte, – das können wir so wenig wissen, wie es Mose wußte. Doch wie die Suche nach der Unmittelbarkeit und der Innerlichkeit Gottes hinfindet zu dem Glauben an seine unbedingte Gnade und Bereitschaft zur Vergebung, – das ist, als Grundlage des Neuen Bundes, der Ausgangspunkt der dringend notwendigen Kehrtwende im ganzen.
Betroffen sind davon der Reihe nach die sechs Hauptfächer klassischer Dogmatik:
1) die Frage nach dem Ursprung – die «Schöpfungslehre» christlicher Theologie. Man faßte sie auf wie die Frage der griechischen Naturphilosophie in ihrer Suche nach den Ursachen der Welt: Gott als die höchste und die letzte Ursache war Grund des Daseins aller Dinge. Der Gott der Bibel und das Sein der Griechen verschmolzen so zu einer Einheit in der Vorstellung von Gott dem Schöpfer. Doch ist die Welt so, daß sie sich als Selbstdarstellung eines Gottes denken läßt, dem ontologisch wesenhaft die Eigenschaften der Allgüte und Allweisheit und der Allmacht zukommen? Der Begriff Gottes paßt nicht zur Weltwirklichkeit, – an der Erfahrung scheitert prinzipiell der Schöpfungsglaube des als Ursache der Welt bewiesenen Gottes in der christlichen Dogmatik. Die Wahrheit ist, daß Menschen nach Gott fragen nicht entsprechend dem Kausalsatz; wonach sie suchen, ist ein Gegenüber ihrer Angst und Einsamkeit, nach einem Trost in ihrem Schmerz, nach einem Halt inmitten der Vergänglichkeit. Erst wenn sie im Vertrauen zu sich selber finden, wenn sie auf dieser Erde sich berechtigt fühlen, vermögen sie die ungeheuere Veranstaltung der Welt recht eigentlich als «Schöpfung» zu erkennen. Vom Menschen her auf Gott und dann von Gott zur Welt – so müßte der Gedankengang verlaufen, nicht, wie bisher, «griechisch» gedacht, vom Seienden (der Welt) zum Sein (zu Gott) und dann zum Dasein, das der Mensch ist. Was diese Umkehrung bedeutet und warum sie unerläßlich ist, wird sich sogleich schon zeigen.
2) Der zweite klassische Traktat tradierter Theologie ist die Erlösungslehre (die «Soteriologie» mit einem griechischen Fremdwort). Da wird geschildert, wie der Mensch die Schöpfungsordnung Gottes durch die «Erbsünde» zerbrochen hat und wie er durch das «Kreuzesopfer» Christi von aller Schuld(strafe) befreit wurde. Diese Lehre, wohlgemerkt, bildet den Hauptinhalt des ganzen Christentums; um so verheerender die völlige Ratlosigkeit der Theologen selbst in gerade diesem Punkte! Denn eben hier gelingt es nicht und kann es in der vorgetragenen Form auch nicht gelingen, zu sagen, was gemeint ist. Die Unverständlichkeit beginnt schon mit dem Wort «Erbsünde», – es ist noch sinnentleerter als die Vokabel Sünde. Da soll am «Anfang» jemand eine «Schuld» begangen haben, die dann auf alle seine Kinder und Kindeskinder überging. So kann’s nicht sein, so darf’s nicht sein, Schuld läßt sich nicht «vererben». Und wodurch hätte «Adam» denn «gesündigt»? Durch Ungehorsam, heißt es. Dann wäre – wieder mal – das Heilmittel ein Mehr an Unterwerfung und Gehorsam. Und die Erlösung? Sie, sagt man, bestehe in der Hinrichtung des einzig ganz gewiß Unschuldigen (des Christus) zur stellvertretenden Sühneleistung für die Schuld der anderen, auf daß die Forderung nach göttlicher «Gerechtigkeit» Erfüllung fände. So aber ist es nicht gerecht, und wiederum begreift man, daß die ganze Lehre falsch gestellt ist: man redet über Gott statt von der Not der Menschen; man mißversteht das Grundproblem des Daseins; man setzt als ein historisches Geschehen, was nur als Wesensaussage über die Existenz des Menschen Sinn macht … Eine falsche Diagnose und eine fatale Form von Therapie – mit Händen läßt sich gerad an dieser Stelle greifen, warum das Christentum selbst wirkt wie eine Krankheit. Erneut muß man das «Fernrohr» anders herum halten; – das Dogma von der «Erbsünde» des Menschen sollte der Anlaß sein, den Menschen tiefer zu verstehen, als es im Rahmen der simplen Grundannahme, Menschen handelten in Freiheit, möglich ist. Was wird aus uns inmitten einer buchstäblich gnadenlosen Welt? Das ist die Frage. Und: warum als erstes finden wir uns in gerade einer solchen Welt der Ungnade vor? Und: Wie, wenn es wesentlich derart mit uns bestellt ist, gelangen wir aus dem Gefängnis unserer selbst heraus? Und: Was heißt da «Gott», und was «Erlösung»? – Lauter Fragen, die der Antwort harren.
3) Im Mittelpunkt des Christentums, natürlich, steht die Gestalt des Christus, des «Messias», des «Gesalbten», des «Königs, wie die Worte im Griechischen und auf Hebräisch sagen. Doch allein darin liegt schon wieder ein Problem: In der Antike galten Könige als Söhne (eines) Gottes, und gerade so wird Jesus als der Christus auch verkündet; doch dies Bekenntnis ist erkennbar an die Ausdrucksform historisch bedingter mythischer Vorstellungen gebunden, die mit der demokratischen Verfassung der meisten westlichen Staaten heute unvereinbar sind; der letzte Kaiser, der noch als «Gottessohn» verehrt wurde, war Japans Tenno Hirohito, dessen Machtanspruch bei seiner Abdankung 1946/1947 auf die Rolle einer bloßen Symbolfigur der Einheit des Inselstaates reduziert wurde; seither gibt es keine «Gottessöhne» auf den Thronen mehr.
In welchem Sinn aber war Jesus «König» oder ein «Sohn Gottes»? Ganz sicher nicht nach Art der Pharaonen und der römischen Caesaren; wie aber dann?
Die Frage müßte existentiell geklärt werden; sie ist identisch mit der Frage, was Jesus mir als Einzelnem bedeutet; statt dessen suchten schon die «Kirchenväter» in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten erneut nach einer Auskunft in der Begrifflichkeit der griechischen Philosophie, indem sie die Person des Jesus Christus für göttlich erklärten, und zwar so, daß diese ihre göttliche Natur mit der menschlichen Natur sich verbunden habe. Mit dieser Übertragung eines mythischen Bildes zur Deutung der Person Jesu in die Terminologie griechischer Philosophie gewann man freilich keine höhere Rationalität, man vermeinte lediglich, sich des mythischen Hintergrundes der eigenen Glaubensvorstellung ein für allemal entledigt zu haben – zugunsten einer historisch einmaligen objektiven Tatsachenbehauptung. Was in den Mythen der Völker von Gottessöhnen überliefert wurde, galt nunmehr für (teuflische) Lüge und Unwahrheit, – allein im Christentum beaß es geschichtliche Realität. Die mythenbildenden Schichten der menschlichen Psyche wurden damit ins Verführerisch-Diabolische gerückt, und zugleich wurde die Stellung des Christusglaubens absolut polemisch gegen alle anderen Religionsformen gewendet. Gewalt in jeder Form, psychologisch wie militärisch, war die unausweichliche Folge dieser Verkehrung eines Geschichte deutenden mythischen Bildes in die Behauptung eines geschichtlichen Faktums von unendlicher Bedeutsamkeit. – Es wird mithin darauf ankommen, den Christusglauben in historischer Ehrlichkeit auf seine Bedeutung zur Interpretation der menschlichen Existenz zurückzuführen. Was aber heißt dann: «Ich glaube Jesus als den Christus»? Das gilt es zu erörtern.
4) Göttlich beauftragt mit der Weitergabe und Verkündigung des Christusglaubens ist nach dogmatischer Lehre die «Kirche» als das, «was des Herrn ist» (so im Griechischen das Grundwort kyriakē) oder als die Versammlung (griech: ekklesía). Die «Ekklesiologie», die Lehre von der Kirche, nimmt in jeder Ausbildung von Theologen dementsprechend einen breiten Raum ein. Doch das Problem stellt sich sofort: Wie kann eine Gemeinschaft fehlbarer Menschen göttliche Wahrheit tradieren? Und welche Art von Wahrheit soll das sein? Jedwede Glaubenswahrheit läßt sich im Grunde nur bezeugen im gelebten Leben, in der Existenz von Menschen, doch Menschen können irren. Sie suchen Wahrheit, doch besitzen und verfügen sie die Wahrheit Gottes nicht. Das gilt auch für die Kirche als eine Gemeinschaft gläubiger Menschen, wie die protestantische Lehre von der Kirche denn auch betont; als Gemeinschaft von Menschen können selbst Konzilien irren, ja, es kann die gesamte Geschichte der Kirche 1500 Jahre lang in die Sackgasse laufen, – in dieser Erkenntnis begann mit dem Ernst eines Jeremia im 16. Jh. die Reformation des Martin Luther22 . Dagegen aber steht das dogmatische Konzept der Kirche Roms. Wohl, Menschen können irren, das weiß auch sie, doch bewahrt Gott, der Herr, die Kirche, seine Kirche, wie sie vermeint, als Institution davor, jemals als ganze sich zu irren. Durch seine «Gnade» stattet Gott die Kirchenämter mit der Gabe aus, in Fragen der Moral sowie des rechten Glaubens «unfehlbar» zu sein. Zwar nicht als einzelne Personen, dafür jedoch als Träger ihres Amtes sind Bischöfe und Kardinäle und insbesondere, mit ihnen im Verein, der Papst von Rom in ihren Lehrentscheidungen für die Gesamtkirche unfehlbar23 . Menschen mögen «sündhaft» sein, doch «heilig» ist die Kirche. So war es immer. Niemals hat ein Konzil geirrt (auch nicht in Konstanz, als es 1415 den tschechischen Reformator Jan Hus verbrannte), und niemals im Verlauf ihrer Geschichte war die römisch-katholische Kirche als der einzige Ort der unverfälschten und ungeschmälerten Wahrheit Gottes ohne den Beistand des Heiligen Geistes, der sie davor bewahrte, eine verkehrte Richtung einzuschlagen oder an Verkehrtem festzuhalten. – Auf diese Weise wird den Gläubigen ein Maximum an Sicherheit in allen Glaubensfragen garantiert, jedoch um welchen Preis! Die «Wahrheit», von der jetzt die Rede geht, ist keine mehr des Daseins, sondern der dogmatischen Doktrin; sie ist nicht länger eine Lebensform, sie ist zu einer bloßen Lehrformel geronnen; sie ist nicht mehr der Ausdruck einer Umwandlung der personalen Existenz, sie ist der festgelegte Standard aller, die als «Gläubige» im Sinn des Lehramts zu homogenisieren und zu kontrollieren sind. Was Jesus wollte, war ganz offensichtlich anders; die Kirche Roms als «fortlebender Christus» löst mit solcher Glaubenswahrheit den Glauben nicht nur von den Menschen ab, sie trennt ihn auch von der Person, auf die sie sich formal und formelhaft bezieht: von der Person Jesu aus Nazaret. Kann aber so noch «Kirche» das sein, was des «Herrn» sein sollte? Jetzt ist sie selbst die Herrin «ihres» «Christus», den sie als lebend preist und dessen Grab sie ist.
5) Und dann die Lehre von den letzten Dingen, griechisch: den Eschata, die «Eschatologie». Gott garantiert nicht nur das Heil der Kirche; indem die ganze Menschheit «objektiv» bereits im Kreuzestode Jesu Christi zur «Erlösung» kam, ist es jetzt nur die Frage, wie die Menschen sich als einzelne oder in ganzen Völkern und Kulturen diese Wahrheit subjektiv zu eigen machen. Im ganzen, weiß man durch die «Offenbarung», endet die menschliche Geschichte mit der «Wiederkunft» «Christi» und mit der Umwandlung der gesamten materiellen Welt in die Wirklichkeit Gottes. Was immer das heißen mag, – klar ist erneut die dogmatische Absicht, eine objektive Tatsache zu behaupten. Wie bereits in der «Schöpfungslehre» Gott als Ursache am Anfang der bestehenden Welt genommen wurde, so wird er jetzt auch in der «Lehre von den letzten Dingen» als Ursache für das Ende dieser Welt gehalten. Damit jedoch wird wieder aller Sinn verkehrt in Widersinn. Aussagen, denen in der Bibel allenfalls eine mythisch-symbolische Wahrheit über die menschliche Existenz zukommt, verwandelt das Dogma in kategoriale Mitteilungen über Ursprung und Untergang des ganzen Weltalls. Gestützt auf die Bilder der Apokalyptik, sieht man sich in den Stand kosmologischen Wissens versetzt und gibt sich offenbar bereit, alle Einwände von seiten der Astrophysiker zu diesem Thema in den Wind zu schlagen.
Mehr noch: mit Hilfe der Philosophie Platons von der unsterblichen Seele läßt sich dogmatisch scheinbar auch die Infragestellung des menschlichen Daseins angesichts des Todes widerlegen: metaphysisch läßt sich die Geistseele des Menschen als unzerstörbar dartun, und am Ende der Tage, so die Lehre der Kirche Roms, wird sie bei der «Auferstehung der Toten» wieder mit ihrem Leibe vereinigt24 . Aus dem ganz und gar persönlichen Vertrauen, daß unser Dasein im Leben wie im Sterben in Gottes Händen steht, wird so eine Behauptung von dem Besitz einer unsterblichen Substanz. Erneut verformt sich damit eine Beziehungsaussage zwischen Mensch und Gott in eine Aussage über ein an und für sich bestehendes Sein der (menschlichen) Natur; die existentielle Hoffnung glaubender Sinnsuche jenseits des Todes vergegenständlicht sich auf diese Weise zu einer Wesensaussage über die Geistnatur des Menschen. Es ist klar, daß eine solche Position in große Schwierigkeiten kommen muß, sobald die Naturwissenschaften mit Hilfe von Biochemie und Neurologie «Geist» als eine Form der Gehirntätigkeit zu untersuchen beginnen. – Auch an dieser Stelle hat die protestantische Theologie, sich selber treu bleibend, mit der sogenannten Ganz-Tod-Lehre das Konzept einer unsterblichen Seelensubstanz im Sinne der griechischen Philosophie zu umgehen versucht – zugunsten der neutestamentlichen Lehre von der «Auferstehung»: der Mensch stirbt «ganz», mit Leib und Seele, Gott, der ihn schuf, erweckt ihn neu zu ewigem Sein25 .
Doch wie beschaffen ist die «Ewigkeit»? Auch Jesus hat im Neuen Testament – im Erbe altägyptischer Jenseitsvorstellungen – davon gesprochen, daß Gott im Tode «richte» über unser Leben und es bestimme entweder zur Ewigkeit des «Himmels» oder zur Unendlichkeit der «Hölle». Ganz ohne Zweifel war und ist es eben dieses Dogma von der Hölle, das nach der ungeheueren Wirksamkeit, die es im Mittelalter zu entfalten wußte, die Menschen in der Neuzeit immer mehr dem Christentum entfremdet hat. Wie kann ein Gott, der als die Liebe selbst gepredigt wird, so unversöhnlich strafen? – Das muß er tun, weil er des Menschen Freiheit ernst nimmt, lautet standardisiert die Theologenantwort. Wie aber kann man endliche Verfehlungen unendlich strafen? So ist es wieder nicht gerecht; so widerspricht es vollends der «größeren» «Gerechtigkeit», die Jesus seine Jünger lehrte, um menschlicher Gebrechlichkeit «gerecht» zu werden. Gerade die Lehren von den «letzten Dingen» machen Sinn nur, wenn man sie liest als Bilder zur Deutung des Entscheidungsernstes menschlicher Existenz.
6) Dann bleibt die «Gotteslehre», die «Theologie» in eigentlichem Sinne, und hier besonders springt der Unterschied zwischen der ursprünglichen Botschaft Jesu und dem, was sich im Kirchendogma draus entwickelt hat, geradezu grotesk ins Auge. Was Jesus uns zu bringen kam, war keine neue Gotteslehre, er wollte uns vielmehr dahin begleiten, Gott als dem Hintergrund des Daseins zu vertrauen wie Kinder ihrem Vater; im Schatten dieses Gottvertrauens wollte er uns mit uns selber und mit Gott versöhnen. Auch deshalb, weil er uns zu «Söhnen» Gottes machen wollte, vermochte man ihn – zuzüglich zum «Königs»titel – als «Sohn Gottes» zu bezeichnen. Es war ein Wort, das eine ganz und gar persönliche Beziehung zwischen Gott und Mensch ausdrückte. Doch – wieder – wurde unter dem Einfluß der griechischen Philosophie aus der Art des Personseins eine metaphysische Bestimmung des Gottseins des Christus: Nicht erst als Gottes Sohn kam er zur Welt, er war schon immer seinshaft Gottes Sohn, er ging von Ewigkeit durch «Zeugung» hervor aus dem Vater. – Die Ausdrucksweise dieses Dogmas schon erinnert an die alten Mythen, in denen Gott, der Vater, mit seiner Schwester (oder einer anderen Göttin) einen Sohn zeugt und alle drei: der Vater und die Mutter und ihr Kind, als eine Dreiheit in Erscheinung treten: die Drei sind eins, – sie bilden eine Urfamilie. Doch in die Richtung konnte sich das Christentum um keinen Preis entwickeln. Der Grund: die Bibel, nicht zuletzt auch Jeremia (Jer 44,1–23), bekämpfte kategorisch den Mythos von der Heiligen Hochzeit des Himmelsgottes mit der Himmelskönigin (oder der Erdgöttin). Gott durfte keine Partnerin an seiner Seite haben! Er zeugte autark, aus sich selber, seinen Sohn. Doch geht aus Vater und aus Sohn durch «Hauchung» (eben nicht durch Zeugung) nun auch der Heilige Geist hervor. Obwohl er selbst nicht als Person erscheint, sondern die Kraft ist, die Personen aneinander bindet, ist auch er selbst Person; die drei sind also drei Personen, doch haben sie in gleicher Weise Teil an der einen göttlichen Natur, so daß Gott einer ist in diesen drei Personen …
Diese im Verlauf von fünfhundert Jahren entwickelte Lehre von der Dreifaltigkeit ist theologisch bis heute weder den Juden noch den Muslimen zu vermitteln, – allein die Differenzierung der Begriffe von «Natur» und «Person» ist weder auf Hebräisch noch auf Arabisch auszudrücken; doch um so heftiger hat man dogmatisch gerade hier den Unterschied des Christentums vom «Heidentum» hervorgehoben. Auch innerhalb der Christenheit haben seit dem Schisma von 1054 zwischen der Kirche Roms und den orthodoxen Kirchen die Meinungen über die Dreifaltigkeit sich gegeneinander verfestigt: geht der Heilige Geist aus dem Vater durch den Sohn oder aus dem Vater und dem Sohn hervor? In den Augen der römischen Theologen ist allein das letztere der Fall; das war ein Hauptgrund für katholische Kroaten, nach 1941 unter der Besatzung der Deutschen in jugoslawischen Vernichtungslagern wie Jasenovac26 etwa 700 000 orthodoxe Serben zu ermorden … Alles, was in den Glaubenslehren nicht als Symbol verstanden, sondern als Begriff genommen wird, führt geistig und dann auch politisch oder ethnisch zu Gewalt.
Damit ist klar, wie Christentum vermittelt werden müßte. Es geht nicht länger durch Verstärkung aller möglichen innerkirchlichen Dogmenzwänge. Glauben als eine Existenzweise vor Gott läßt sich nur weitergeben von Person zu Person, und alle «Lehren» des Christentums sind dabei zu lesen als eine Art poetischer Beschreibung der Erfahrungen, die sich dann machen lassen.
Wie führt man speziell die Kinder an das Christentum heran? So fragen sich – immer noch – Eltern, die es gut meinen mit ihren Jungen und Mädchen. Es war der Däne Sören Kierkegaard, der schon um 1850 davor warnte, die christliche Glaubenslehre zu früh den Heranwachsenden beizubringen27 . «Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben. Dadurch bist du erlöst von der Erbsünde. Und an dieser Erlösung hast du teil, weil du auf den Tod und die Auferstehung des Christus getauft bist.» Wer, um Himmelswillen, hat das je verstanden und wer versteht es – noch –? Und wer, als Kind wie als Erwachsener, ist nicht – beim Anblick etwa des Isenheimer Altars von Matthias Grünewald um 1515 in Colmar28 – entsetzt zu sehen, in welcher Gräßlichkeit die Kreuzigungspraxis der Römer Menschen zu Tode folterte? Wer will auf diese Weise schon «erlöst» sein, und was muß das wohl für ein Gott sein, der solche Greuel nötig hat, um Menschen ihre «Sünden» nachzulassen?
Will man die Kinder «christlich» unterweisen, so sollte man in Form und Inhalt gerade in der Weise «lehren», wie Jesus selber es getan hat. Gleichnisse wie die vom verlorenen Schaf und von der verlorenen Drachme (Lk 15,1–10) oder von dem gütigen Vater und den beiden Söhnen (Lk 15,11–32) oder von dem barmherzigen Samariter (Lk 10,25–37) oder das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat (Mk 4,26–29) und viele andere, daneben auch Begebenheiten aus dem Leben Jesu: wie er die «Zöllner» und die «Sünder» aufnimmt (vgl. Lk 19,1–10: die Geschichte von Zachäus, und Lk 7,36–50: die Geschichte von der Sünderin) oder wie er die Kranken heilt, selbst wenn er dabei das Gebot des Sabbats bricht (vgl. Mk 3,1–6: die Heilung eines Mannes mit einer verdorrten Hand), – all diese Geschichten mögen zeigen und einüben, wie Jesus dachte und gelehrt hat; dann erst, für das erwachsene Bewußtsein, kann man die Frage einführen, wie man in einer Welt der Gnadenlosigkeit antworten wird auf eine Lehre und ein Leben reiner «Gnade»; und dann kann man und muß man weiterfragen, mit welcher Hoffnung auf die absolute Güte Gottes jemand wie Jesus in den Tod geht. Fest steht: man kann nicht annähernd auch nur versuchen, so zu leben, wie es Jesus tat, ohne wie er zu glauben.