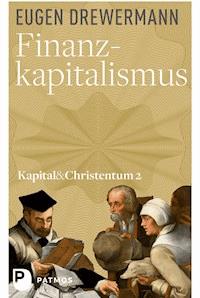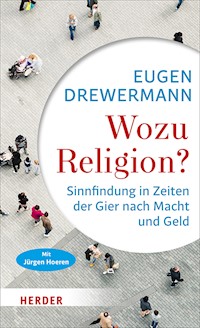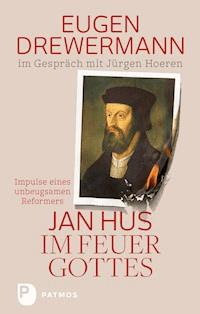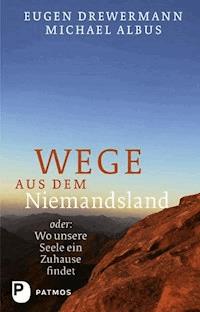I. Was bedeutet Luther?
Herr Drewermann, vor allem von katholischen Theologen wird die Frage gestellt: Was feiern wir eigentlich am 31. Oktober 2017? Feiern wir 500 Jahre Reformation? War es überhaupt eine Reformation, die am 31. Oktober 1517 in Wittenberg losgetreten wurde?
Als Kind habe ich noch gelernt, dass der Jubeltag der Protestanten der größte Trauertag der Katholiken sei, die Kirchenspaltung. Sie wurde katholischerseits als Schuld Luthers gebrandmarkt. Das war noch vor 60 Jahren der Bewusstseinsstand unter den meisten katholischen Theologen, auch in der Katechese den Gläubigen gegenüber. In diesem Sinne hat es keine Reformation gegeben, nur eine Irrlehre, indem im Westen der Kirche der Glauben an den einen Gott unheilvoll in zwei Konfessionen zerteilt wurde. In Wirklichkeit aber wurde durch Luther etwas bewusst, das innerhalb der Glaubenstradition längst Gegenwart war: Statt die Botschaft der Einheit, die Jesus in die Welt bringen wollte – zwischen Gott und Mensch, zwischen Himmel und Erde, zwischen Heiligen und Sündern, zwischen Sakralem und Profanem –, kreativ aufzugreifen und weiterzuführen, haben 1500 Jahre Kirchengeschichte in katholischer Obhut die Spannungen zementiert. Luther hat, stellvertretend für eine ganze Zeit, in seiner Gegenwart und für die Jahrhunderte danach, diese Zerspaltenheit gefühlt, durchlitten und auf seine Weise zu artikulieren und zu überwinden unternommen.
1. Prophetisch existieren in Protest und Programmatik
Das bedeutet Luther für mich: Eine Persönlichkeit, die die Gegensätze so energisch aufgreift, dass man damit nicht länger leben kann und nach Lösungen suchen muss. Es wäre historisch unfair, der Person Luther vorzuhalten, dass er am Anfang des 16. Jahrhunderts nicht auf den Neuaufbruch seiner Zeit, auf das ungeheuer Widersätzliche in seiner Zeit, mit einer geschlossenen systematischen Betrachtung antworten konnte. Er hat es von Fall zu Fall an den Stellen getan, an denen er es evident als notwendig spürte. Darum ist er in meinen Augen in seiner ganzen Biografie nicht im Jahre 1517 am größten, sondern 1521 auf dem Reichstag in Worms. Da vollendet sich der gesamte reformatorische Ansatz und bringt einen neuen Gegensatz hervor, den er nicht mehr überwinden kann und auch gar nicht überwinden darf, weil er zu der Botschaft Jesu gehört: der Gegensatz von Person und Institution, von Individuellem und Allgemeinem, von Prophet und Priester.
Aber bleiben wir noch einmal im Jahre1517 beim Thesenanschlag in Wittenberg. Wollte Luther eigentlich mit diesen Thesen so eine große Aufmerksamkeit erregen? Wollte er wirklich etwas Neues stiften, oder wollte er seiner katholischen Kirche zeigen: Da müsst ihr neu nachdenken?
Im Jahre 1517 schreibt Luther noch andere Sammlungen von Streitthesen mit den Theologen. Auch der sogenannte Thesenanschlag an der Schlosskirche zu Wittenberg wird zu verstehen sein als Teil einer breit gefächerten Auseinandersetzung. Der Zeitpunkt für das Thema ist richtig gewählt: Es geht um die Ablassfrage. Was Luther sich erhofft, ist typisch für ihn selber – der Glaube nämlich, dass es im theologischen Streit gelingen werde, die Wahrheit Christi zurückzugewinnen und einträchtig zu formulieren. Das ist eine akademisch so ehrliche, im Grunde aber auch so mönchisch naive Vorstellung, dass sie zu Luther sein ganzes Leben lang passen wird: Wenn man die Wahrheit sucht, wenn man sie vertritt, wenn man sie so kraftvoll formuliert, wie man kann, und einen Gegner hat, der geistig standhält, dann kann dabei nur etwas herauskommen, das allen Menschen gut tut und das die Sache Gottes vorantreibt. Das hat Luther Ende Oktober 1517 erwartet. Dass es dann völlig anders kam, basiert auf der groben Unterschätzung von Fragen, die er zwar selber angreift und aufgreift, die er aber nicht selber steuern kann: Geld und Macht nämlich. Der Ablass ist einer der Punkte, an denen es für Luther gilt, standzuhalten. Es hätte hundert andere Fragen gegeben – die hat er auch irgendwo alle einmal formuliert –, aber nun trifft er wirklich in das Zentrum. Die katholische Kirche hätte auf alles Mögliche an Themenstellungen sonst wahrscheinlich mit Aussitzen, mit Toleranz, mit Duldsamkeit, mit Verschweigen, mit Irrelevanz reagiert, solange es nur um Gnade oder um Freiheit oder um Gesetz oder um Bibelauslegung oder um Kirchenstruktur oder um die Frage, was ist und macht der Papst in Rom, gegangen wäre. Aber nun schreibt Luther in den Thesen: »Wenn schon der Papst in Rom den Dom zu St. Peter bauen will, warum, wo er selbst der reichste Crassus ist, nimmt er nicht zumindest sein eigen Geld statt das der armen Gläubigen?« Das klingt nach Aufruhr. Und das ist es auch, und das wird es auch bewirken. Und es ist auch so gemeint: Dem Papst soll Angst gemacht werden vor den eigenen Gläubigen in der Verantwortung Christus gegenüber.
Da sitzt in Mainz seit 1514 in der Person Albrechts von Brandenburg ein Bischof, der sich seine Pfründe mit dem geliehenen Geld der Fugger hat kaufen müssen. Diese seine Schulden muss er nachkreditieren. Dafür wird der Ablass eingesetzt. Das ist unglaublich! Man kauft sich geistliche Ämter – das nennt man Simonie; man schachert herum, man erpresst mit Seelenangst aus den Gläubigen das notwendige Geld dafür. Das ist keine Seelsorge mehr, das ist Verrat an den Menschen. Das ist Verleugnung der Botschaft Jesu. Das ist nicht zu dulden von einem Mann, der, sich stützend auf die Bibel, ernsthaft die Nachfolge Christi leben will.
Aber Herr Drewermann, das haben doch schon John Wyclif, Jan Hus 150 Jahre vor Luther getan. Sie haben den Ablass gegeißelt und sind, was Hus betrifft, auf dem Scheiterhaufen gelandet.
Richtig. Man sieht, dass das Thema »Reichtum« in der Wirklichkeit der Kirche mit der Armutsforderung Jesu im Ideal nicht zusammenkommen kann.
Bis heute.
Bis heute nicht. Aber damals, spätestens im Hochmittelalter, seit den Tagen Innozenz III., schließt sich die Kluft nicht einmal mehr durch den heiligen Franziskus. Der hat einen Armutsorden gegründet. Das haben Leute wie Waldes, Wyclif und Hus, die Sie erwähnen, nicht getan. Aber die Spannung besteht natürlich. Jan Hus hat miterlebt, wie 1410 päpstlicherseits – allerdings durch einen von drei Päpsten in seinen Tagen – ein Ablass ausgerufen wurde, um Krieg gegen Neapel zu führen. Und einen solchen Ablass soll er in Prag vertreten, und er tut es wieder nicht, weil er eine ehrliche Haut ist, die sich nicht einem Ochsen ähnlich strapazieren und zu Leder verarbeiten lässt. Auf solche Widersetzlichkeit aber steht die Todesstrafe. Das sind die wirklichen Vorwürfe, für die man Hus verbrennen wird: Er hat die Kirche bekämpft an einer Stelle, wo es ihm wirklich darauf ankam. Allein das war schon verräterisch. Nicht weit von Paderborn, in Bielefeld, hat der Systemtheoretiker Niklas Luhmann einmal gemeint: »Man kann Systeme nur verändern entlang ihren immanenten Messfühlern.« Wenn die Kirche auf einen Mann wie Hus mit Interdikt, mit Ausgrenzung, mit Hinrichtung antwortet, bloß weil es ihr um Geld geht, so offenbart sie damit klarer als in jeder theoretischen Abhandlung, wo ihre wahren neuralgischen Punkte liegen: bei Geld und Macht.
Bei Äußerlichkeiten.
Ja, bei Äußerlichkeiten. Das gerade wird ein Dauerthema Luthers 100 Jahre später. Man muss das, was da äußerlich deklariert wird, innerlich nehmen, um Christus zu verstehen, sonst ist es nicht geistig, sonst ist es nicht paulinisch, sonst ist es überhaupt nicht christlich, sonst ist es – ich sag jetzt schon lutherisch vorweg – nur »alttestamentlich«. Das ist der entscheidende Auseinandersetzungspunkt: Wie kommt man vom Alten Testament zum Neuen Testament, außer man liest es geistig, man nimmt es innerlich?
2. Vaterangst und Gottesfurcht
Herr Drewermann, kommen wir einmal – Sie sind ja Psychotherapeut – zu dem Psychogramm von Martin Luther. Können Sie es entwerfen?
Das ist nicht einfach, doch versucht hat es zum Beispiel Erik Erikson – zum Ärger vieler Theologen, doch in sich recht stimmig. Grob gezeichnet das Ergebnis: Unzweifelhaft stand Luther sehr stark unter dem Eindruck seines Vaters, den er höchst ambivalent erlebt hat. Wir haben von Lucas Cranach gezeichnet die Elternbilder: die Mutter Margarethe, die treusorgend, abgehärmt in ihren Pflichten aufgegangen, dasteht, und nicht gerade ein Gefühl von Glück und emotionaler Innigkeit ausstrahlt; und daneben das Gesicht des Vaters Hans. Wenn man sich, das sehend, psychologisch vorstellt: so hat Luther sein erstes Gottesbild in sich aufgenommen, dann begreift man eine Reihe seiner späteren Konflikte. Luthers Vater war kein einfacher Bergmann, sondern er hatte sich im Montangeschäft emporgearbeitet. Er hatte Kuxe gehalten, Aktien also im Bergwerksgewerbe, er war in Mansfeld zu Wohlstand gelangt – gerade jetzt werden archäologische Ausgrabungen am Ort durchgeführt, die zeigen, dass das Bild des Arme-Leute-Sohnes, des Bergarbeiterkindes Martin Luther, so nicht stimmt. Das Milieu seiner Eltern war mehr als gehobener Mittelstand. Und natürlich wollte der Vater, dass sein Sohn Martin in gewisser bürgerlicher Weise Karriere macht und reüssiert. Also ging Martin in Mansfeld auf die Lateinschule, die wie üblich sehr streng war. Später wird Luther sagen: »Man sollte zum Prügel einen Apfel legen.« Aber er hat diese Art von Pädagogik, die damals selbstverständlich war, durchlaufen müssen und sollte nach der Schulzeit in Eisenach entsprechend dem Willen seines Vaters durch ein Studium in Erfurt nach Ableistung der Artes Jurist werden. Genau damit hat er begonnen, als er 1505 bei Stotternheim einen Blitzeinschlag erlebt. Nur zwei Monate später tritt er in den Augustiner-Eremiten-Orden ein, nach einem heiligen Schwur, den er der Mutter Anna geleistet hat: »Ich will ein Mönch werden.«
Ich denke, Luther hat in diesem Moment den ganzen Schrecken seines Lebens kondensiert gefühlt: Gott kann strafen – wie der antike Zeus, der Blitzefreudige. Was erlebt ein Mensch, wenn er gerade einer tödlichen Gefahr, die auf ihn gezielt zu haben scheint, entkommt? Er kann kaum etwas anderes denken, als dass er nur noch einmal davongekommen ist, um etwas, das eigentlich gestraft gehört, abzubüßen. In einer solchen Vorstellung verdichtet sich das Vaterbild Luthers fast zur Naturmetaphysik, und es wird sein charakteristisches Thema bleiben: Wie gibt es eine Rechtfertigung für meine eigene oder für die menschliche Existenz insgesamt?
Das wird ein Ringen gegen den Blitze schleudernden Gott, ein Flehen um Gnade, und so liest er die Bibel an jeder Stelle, wo er sie aufschlägt, als Antwort auf diese Frage, oder er bekämpft die Stellen, an denen er eine Antwort nicht findet oder seine Angst gar verstärkt sieht. Nur folgerichtig wird er sich auch aus dem Mönchsgelübde herauslösen, weil er da wieder die Strenge des strafenden väterlichen Gottes findet in Gestalt endloser Schuldgefühle.
Es ist generell die Frage: Wie kann man die Mönchsgelübde ehrlicherweise ohne Selbstverrat, ohne Heuchelei leben? Luther wird die Orden auflösen, er wird 1525 mitten in dem Maximum des Durcheinanders, das er zum Teil selber provoziert hat – die Bauernkriege sind gerade auf ihrem Kulminationspunkt –, wie wenn es nichts Wichtigeres zu tun gäbe, heiraten. Die Polemik gegen ihn auf der Gegenseite überschlägt sich. Das alles ist vorherzusehen. Zwei Jahre später aber wird er an seinen Vater Hans Luther schreiben: »Das hast nicht Du gemacht, sondern Christus. Der Papst schafft Puppen«; doch will er sagen: Christus hat ihn gelehrt, sich selber treu zu sein als Mensch und damit die Liebe zu lernen und persönliche Freiheit zu gewinnen. Das ist ein Prozess, der eine Psychogenese und Reifung im Psychologischen verrät, die wirklich so, wie Luther immer wieder schreibt und gedacht hat, ganz und gar aus dem Glauben kommt. Eine solche Entwicklung ist nicht mehr bezogen auf seinen Vater, eigentlich auf gar keinen Menschen mehr, sicher auf keinen Ordensoberen und auf gar keinen Fall auf den Papst; vielmehr allein im absoluten Gegenüber Gottes findet Luther zu sich selber als einer Person, die sich annehmen darf in ihrer Begrenztheit, in ihrer Relativität, in ihrer Gebrochenheit. An dieser Stelle ist Luther groß und Beispiel gebend, und über die Jahrhunderte müsste sein Vorbild weiterentwickelt werden.
Aber, Herr Drewermann, Sie nochmals als Psychotherapeut gefragt: War ein Grundgefühl von Martin Luther in seiner Anfangsphase und gerade in seiner Berufungsgeschichte die Angst?
Unbedingt. Er schreibt selber, mit wie viel Angst er zum Beispiel die erste heilige Messe gelesen hat. Die katholische Messfeier, wohlgemerkt, ist der Ort, wo eigentlich das Opfer Christi – nach Luthers eigenem Verständnis und auch in Übereinstimmung mit der Lehre der katholischen Kirche – von aller Sündenschuld befreien soll. Er aber erlebte als Priester, zu dem er geweiht worden war, die Frage seiner eigenen Würdigkeit am Altar. Kann er überhaupt die heilige Messe lesen? Isst und trinkt er nicht sich selber das Gericht damit? Wenn er das Heiligste mit unheiligen Händen und mit unheiligen Lippen berührt, ist er dann nicht ein schlimmerer Verräter noch als Judas im Abendmahlssaal? Diese Gedanken quälen ihn zum Äußersten und bringen ihn dahin, am Ende den ganzen Klerikerstand innerkirchlich noch einmal neu zu definieren, auch um in gerade dieser Frage seine eigene Freiheit zu gewinnen: Es ist nicht möglich, dass man in der Messe eine liturgische Tragödie aufführt mit einer Maske vor dem Gesicht, statt selber als Person gegenwärtig zu sein. Auch diese ungeheure Kluft muss Luther schließen, um leben zu können.
Darf man das skrupulös nennen oder sehr gewissensgeprägt?
Es ist ein Gewissen, das zweifellos eine solche Schärfe im Über-Ich verrät, dass Skrupulantismus die notwendige Folge davon ist. Aber dieses Gewissen hat, anders als Millionen Menschen vor, zur Zeit und nach Luther, ihn nicht nur gequält, er hat versucht, eine Lösung für sein eigenes Problem vor Gott und dadurch gültig für alle Menschen zu finden, und eben darin ist er groß und Beispiel gebend.
3. Die Stunde der Entscheidung – Worms im Jahre 1521
Und ist es das, was Sie, Eugen Drewermann, an ihm bewundern oder wo Sie sich an ihm reiben?
Ich bewundere das Beispiel, das Luther darin gibt, wie man die Angst der eigenen Biografie, die Angst einer ganzen Zeit, die Angst einer gesamten Kirche im Abstand von 1500 Jahren zu der Botschaft Jesu in der eigenen Existenz durch das Vertrauen auf Gott zu überwinden vermag.
Insofern erscheint mir, noch einmal gesagt, Luthers größter innerer Augenblick die Stunde seiner stärksten äußeren Gefährdung zu sein. Das ist 1521 der Reichstag in Worms. Man hat ihn gewarnt: »Mönchlein, du gehst einen schweren Gang!« Doch seine Antwort darauf soll gewesen sein: »Selbst wenn in Worms der Teufel so viele wären wie Schindeln auf den Dächern, da muss ich hin!« Allein das verrät eine seltene Größe. Ein Mensch sieht die äußere tödliche Gefahr, er macht sich durchaus keine Illusionen, er geht aber nicht zurück, sondern er geht nach vorn. Die Angst vor Gott wird so zum Mut in Gott. Das hat jesuanisches Format. Das macht man nicht aus sich selber.
Er dachte, er würde auf dem Scheiterhaufen landen?
Es geht um die Treue Gottes. Es wäre möglich, als Ketzer hingerichtet zu werden. Aber: Was immer dabei herauskommt, Gott muss wissen, was daraus wird. Man selber aber hat die Aufgabe, die Verantwortung, dem nicht auszuweichen, was Gott im eigenen Leben allen anderen zu sagen hat. Dafür steht Luther gerade, und deswegen tritt er vor die kirchlichen Theologen, vor die Landesfürsten, vor den Kaiser, der über Leben und Tod zu entscheiden hat, indem er entweder die Acht über den Wittenberger Mönch ausspricht oder eben das nicht tut. Vom Worte Kaiser Karls V. wird abhängen, ob Luther Worms überlebt oder nicht. Wenn er in die Acht kommt, kann jeder ihn totschlagen wie einen tollen Hund, und er begeht dabei keinen Mord, sondern er verrichtet ein Gott wohlgefällig Werk. Das kann sein und das steht sogar zu erwarten. Dennoch ist Luther der Meinung, dass er es sich selber, dass er es Gott schuldig ist, die Wahrheit auszusprechen, so, wie er sie erkennt. Und das Ergebnis ist eine ungeheure Kluft zwischen dem katholischen Begriff des Glaubensgehorsams und dieser Christustreue im persönlichen Gewissen. Die Legende sagt, Luther habe die Gespräche mit dem Bemerken abgeschlossen: »Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir.« Das ist eine – wenn es erfunden ist – wunderbar erfundene Legende. Denn so war es innerlich gewiss. Historisch verbürgt aber, schwarz auf weiß, haben wir das Schlussbemerken von Karl V., einem damals noch ganz jungen, neu gewählten Kaiser, mit einer Riesenaufgabe, die für ihn in Europa (die Türken!) und Lateinamerika (die Eroberung eines ganzen Kontinents) kaum lösbar ist. Karl V. fasst alles, was er in Übersetzung mitbekommen hat, ohne die theologischen Äußerungen, um die es geht, auch nur entfernt würdigen zu können, auf den unter der Perspektive eines Regierenden wichtigsten Aspekt zusammen: »Es will mir nicht erscheinen, wie ein einzelner Mönch recht haben könnte gegen die ganze Christenheit.« Das ist wirklich ein zentrales Problem: Wie soll man eine Kirche zusammenhalten, wie soll man ein Reich festigen, wenn es Menschen gibt, die in dieser Form die Wahrheit zu haben beanspruchen, wie Luther es tut? Gibt es nicht so etwas wie einen Gruppenkonsens, gibt es nicht so etwas wie klare dogmatische Vorgaben? Gibt es nicht Instanzen, die kirchlich und staatlich befinden, wer überhaupt zu sagen hat, was wahr ist und was nicht wahr ist? Wie kann ein Einzelner, ein Individuum, sich hinstellen und erklären: »Ihr habt unrecht, alle habt ihr unrecht, weil ihr die Bibel nicht richtig lest. Ihr versteht Christus nicht richtig, ihr seid 1500 Jahre schon als Verräter an der Botschaft Jesu eine gefrorene Lüge.« So etwas ist ungeheuer. Das kann nicht sein, das ist unvorstellbar für die Herrscher auf den Thronen. Aber genau das ist die Haltung, mit der bereits die Propheten in der Bibel auftreten: gegen die Könige, gegen die Tempelverwalter, gegen das Volk und gegen den Pöbel. Alle diese Gotteskünder haben nichts weiter als ihre einzelne Person, die sie zum Sprachrohr Gottes machen.
4. Das Vorbild: Jan Hus
So war doch auch Jan Hus, der am 6. Juli 1415 in Konstanz verbrannt wurde, 100 Jahre zuvor.
Natürlich. So war Hus.
War Hus ein Vorbild für Luther?
So hat Luther sich stets begriffen. Hus selber bereits hat von sich schon ein Stück weit vorweggenommen, was kommen würde. Sein Name bedeutet im Deutschen »die Gans«, und so dachte Hus tatsächlich: »Sie werden eine Gans verbrennen und einen Phönix fliegen sehen.« Luther selber hat den Vorwurf formal gegen sich erleben müssen, schon 1519 in der Diskussion mit Johann Eck in Leipzig, er lehre wie Jan Hus. Seine Antwort darauf war, man habe Hus zu Unrecht verbrannt.
Nebenbei: Die ganze Vorgehensweise in dem Gespräch mit Eck war natürlich hoch politisch, sehr anders also im Grunde, als Luther selber dachte. Man wollte, dass er sich zu Jan Hus bekennt, mit der Gewissheit, dass, wenn das passiert, kein deutscher Fürst von ihm noch irgendetwas annehmen wird. Hus, die Hussitenkriege – alles das war ein Zeichen des politischen Aufruhrs im Namen Christi gewesen. Kein Fürst, der ruhig auf seinem Thron in deutschen Landen sitzen bleiben wollte, konnte neue hussitische Zustände wünschen. Wenn also Luther in die Situation gebracht wird, sich zum Anliegen und zur Person von Jan Hus positiv zu äußern, ist er selber geliefert und wird das gleiche Schicksal wie der tschechische Rebell in Prag erleben. Dahin wollte man ihn manövrieren. Und tatsächlich hat Luther diese Identifikation angenommen. »Es war ein Unrecht, Hus zu verbrennen!«
Da kam natürlich sofort die nächste Frage: Kann denn ein Konzil, das doch die Wahrheit Gottes vertritt, einen solchen Justizmord begehen, kann es irren bis zur absolut verbrecherischen, kriminellen Insinuation? Genau das bestätigt Luther: »Auch Konzilien können irren – das Konzil in Konstanz hat geirrt, Jan Hus verbrannt zu haben.«
So war Luther immer. Er wich keiner Falle aus, sondern er ging in die vermeintliche Aporie hinein und sprengte sie auf, oder er blieb darin stecken.
5. Der Reformer wird zum Protestanten gegen Rom
Hat Luther sich denn je selbst als Reformator bezeichnet? Reformation ist doch ein viel späterer Begriff.
Luther sah eine Kirche vor sich, die dringend sich selber ändern musste, und er hat erwartet, dass sie das selber tut. Dafür konnte er verbindlich die Themen vorgeben, die Perspektiven, die Stichworte, die Begründungen, die Interessenlage. Aber gemeint hat er, zunächst ganz katholisch, dass die Änderung nur durch den Papst selber kommen kann bzw., im Verein mit ihm, durch die Kardinäle. Die entscheidende Änderung musste in Rom erfolgen. Das war seine feste Meinung, und drum war die Diskussionseinladung mit dem Thesenanschlag 1517 eigentlich ein Sendschreiben nach Rom. Da erwartete er die Änderung. Der Fisch bekanntlich stinkt vom Kopf her. Der Gedanke, dass er die entscheidende Änderung an Haupt und Gliedern vollbringen könnte, war ihm völlig fremd. Deshalb hat er auch späterhin immer wieder den Versöhnungsgedanken seines Freundes und wichtigsten Mitarbeiters Philipp Melanchthon aufgegriffen, 1530 beim Augsburger Reichstag in Gestalt der Confessio Augustana zum Beispiel. Da darf er zuvor an den Verhandlungen selber schon gar nicht teilnehmen, aber er lässt Philipp Melanchthon freie Hand, immer noch in der Hoffnung, dass man doch in Rom verstehen wird, wie unausweichlich es ist, die Kirche so zu gestalten, dass sie wirklich Christus trägt, vermittelt und sichtbar macht und nicht das Widerspiel von alldem wird und bleibt. Erst als klar wird, dass der Papst es ablehnt, »Papst« zu sein, wird er in Luthers Augen zum »Antichristen« und Rom zur »Hure Babylon«, wie bereits für Hus und die Prager Refomatoren um 1400. Eine der letzten Schriften Luthers, 1545, heißt denn auch »Vom Papsttum als Werk des Teufels«. Das ist endgültig, da ist keinerlei Hoffnung mehr. Also kann es auch keine Reformation einer solchen (Un-)Kirche mehr geben. Man kann diese Kirche so, wie sie ist, wie sie ganz offensichtlich bleiben will, wie sie sich im Recht befindlich sieht, nicht nur nicht verändern, man kann sie nur zur Hölle wünschen und der Hölle übergeben. Da ist nichts mehr zu ändern. Man muss ohne sie weitermachen. Da hilft keine Reformation mehr, da ist ein Neuanfang nötig.
Ist Luther denn absichtsvoll oder eher absichtslos zum Reformator geworden? Wie sehen Sie die Entwicklungslinie theologisch und psychologisch?
Was Luther 1517 begonnen hat, klopft immer noch an die Türen von St. Peter und bittet um Einlass. Dass das bis heute nicht geschehen ist, macht aus der Reformation, die ein Angebot, ein dringliches Gesuchen hätte sein müssen, eine Vergeblichkeit im Tragischen, eine Abspaltung, die so nie hätte erfolgen sollen. Aber was bleibt jetzt im Abstand von 500 Jahren den Protestanten anderes übrig, als sich in dem, was sie für richtig gefunden haben, auch im Erbe Luthers, selber festzumachen und das so intensiv zu tun und weiterzuentwickeln, dass es in unseren Tagen verständlich wird, auch und gerade im Anspruch an Rom in all den kreativen Alternativmöglichkeiten, die in den Kirchen der Reformation entfaltet worden sind? Es ist, wie wenn ein Baum im Sturm seine Samen im Herbst weit verstreut hätte, weit außerhalb der Grenzen des Gartens, in den man ihn gepflanzt hat, und nun im darauffolgenden Jahr entdeckt man, dass er Früchte bringt weit außerhalb des Zaunes, reicher und nahrhafter als am Ursprungsort – so könnten die Protestanten heute, 500 Jahre später, mit einigem Stolz sagen: »Wir haben uns nicht entfernt von dem Baum, den Gott gepflanzt hat, aber wir wurden durch einen Sturm, den wir nicht gerufen hatten, davongerissen. Jetzt wurzeln wir in neuer Erde. Und was wir hervorbringen, lässt sich bei Gott und den Menschen sehen.«
Es wäre näher betrachtet vor allem dieser Punkt: Der Protestantismus fußt in der Evidenz, dass es keinen Glauben, christlich gesehen, geben kann ohne die Passage durch das Subjekt in all seiner Angefochtenheit, Geängstetheit, Schuldbefangenheit, Zerbrochenheit. Genau dieses Brüchige im Menschen ist das, was Gott sich erwählt, um seine Gnade zu schenken. Das ist der Kern des ganzen Protestantismus. Wenn diese Kernerfahrung der Rückgewinnung der Botschaft Jesu verweigert wird zugunsten eines Gruppendenkens, eines Zwangsgehorsams, zu dem Vorteil der institutionalisierten Sicherheit einer Sakramentenpraxis, die vorgibt, Gott buchstäblich in der Hand zu haben, dann können Protestanten mit dieser Scheinberuhigung des Unpersönlichen sich niemals anfreunden wollen oder dürfen. Die Stütze aber für die Persönlichkeit, die im Gegenüber zu Gott und im Vertrauen auf ihn sich in ihr eigenes Leben wagt, ist keine menschliche Autorität, weder in der Politik noch in der Kirche, sondern allein das Wort Gottes, so wie es in der Bibel steht. Der Glaube (das Vertrauen) und die Bibel – beides gehört zum Kern des Protestantischen, aber auch in gewissem Sinne zu dem Problem der protestantischen Tradition.
6. Protestantismus und Katholizismus
Aber, Herr Drewermann, sehen Sie nicht, dass in der katholischen Kirche sich in den letzten Jahrzehnten auch etwas protestantisch Wertvolles eingenistet hat und das katholische Denken beeinflusst? Sind sich da nicht doch beide in wesentlichenPunkten auch sehr, sehr nah? Eigentlich kann man doch heute gar nicht mehr die Trennung der beiden großen Konfessionen vermitteln.
Im Volk wird diese Trennung schon seit langem nicht mehr verstanden. Gewiss, es hat in der sogenannten ökumenischen Theologie an Versuchen in den letzten 50 Jahren – seit dem 2. Vatikanischen Konzil – nicht gefehlt, die Gemeinsamkeiten zwischen den Konfessionen auszuformulieren, doch das geschah an den Menschen und ihren Erfahrungen weit vorbei. So hat man zur Erinnerung an die Confessio Augustana von 1530 einen Hauptpunkt der scheinbaren Unterschiedlichkeit zwischen Katholiken und Protestanten durch gemeinsame, überbrückende Formeln zueinanderbringen wollen: die Rechtfertigungslehre. Paradoxerweise ist das theologische Zentralproblem der jahrhundertelangen kontroverstheologischen Streitigkeit die Gnadenlehre. Gerade da also wollte man sich so austauschen, dass zumindest dieser Kernpunkt nicht mehr in die Debatte als strittig oder trennend eingebaut werden könnte. Eine solche Zielsetzung stellt rein akademisch kein Problem dar. Man kann natürlich, wie wir noch sehen werden, auch grundverschiedene Ausrichtungen in identischen Begriffen vereinigen. Aber: Das Problem nennen Sie ganz richtig; die Leute haben davon nichts. Sie verstehen die ganze Problemstellung inzwischen schon nicht mehr. Denn bereits das WortGnade ist obsolet. UndRechtfertigung – wer spricht davon?Freiheit ist ein bürgerlicher Begriff, aber er entfernt sich sehr von dem, was Luther vor Augen hatte, wenn er von der Freiheit eines Christenmenschen sprach. »Wie finde ich einen gnädigen Gott?« Wo auf der Straße finden Sie jemanden, der diese Frage als zentrales Problem seiner Existenz zu beantworten sucht? Bezeichnend daher im Grunde das Unvermögen beider Kirchen, von ihren eigenen Anliegen so zu reden, dass es in der Öffentlichkeit jenseits der innerkirchlichen theologischen Sprachspiele wirklich noch verstanden wird.
Ein mir befreundeter protestantischer Pastor pflegte vor Jahren zu sagen, die katholische Kirche sei gar nicht so schlecht, wenn sie nur wollte lutherisch werden. Doch davon ist wenig zu spüren. Johannes Paul II. noch hat die Gefahr der Reprotestantisierung, die er drohen sah, mit aller Macht bekämpft. Ein Papst, wie er ihn sah, war unfehlbar, er hatte wirklich in Glaubens- und Sittenfragen für alle Kirchenmitglieder verbindlich zu entscheiden. Auch die Sakramente waren, wie sie sind. Insbesondere das Priestertum war, wie es ist. Und natürlich, die katholische Dogmatik gilt unzweideutig. Die Mariologie etwa ist, egal was die Protestanten und die Bibel darüber schreibt, in katholischer Tradition, also in Wahrheit, so und nicht anders zu lehren. Unter der Hand blieben unter dem Pontifikat des polnischen Papstes all die Erwartungen des 2. Vatikanischen Konzils in den Anfängen stecken. An der Oberfläche der öffentlichen Aufmerksamkeit lagern zum Beispiel die üblichen sexualmoralischen Fragen: Dürfen Priester heiraten? Dürfen Verheiratete zu Priestern geweiht werden? Dürfen geschiedene Wiederverheiratete zur Kommunion gehen?
Es zeigt sich gerade in solchen Fragen Luthers Größe darin, dass er meinte, Menschen dürften nicht dahin gebracht werden, dass sie die Entscheidung für ihr persönliches Leben abhängig machten von der Zuständigkeit irgendeiner fernen und fremden Instanz jenseits der Alpen. Entweder man lebt jetzt richtig oder man wird nie dahin kommen, frei in Christus zu werden. Das war Luthers Meinung. So wie wir eben aus seinem Brief an seinen Vater zitierten: »Der Papst macht Puppen.« Aber dies hier, seine Heirat mit Katharina Bora, das ist ein Werk Gottes – so Luther. Nun nehmen wir mal an, es möchte sein, die katholische Kirche käme wirklich zu einer Einstellung, wie der jetzige Papst Franziskus sich ausgedrückt hat, es sei die »Laetitia amoris«, die Freude (das Glück) der Liebe, als ein erlaubtes und zu erlaubendes Erlebnis für die Menschen als ein weiterer Beweis der Gnade Gottes offen zu halten; dann hätten wir den ganzen Priesterstand enttabuisiert, wir hätten ihn vermenschlicht, wir sähen ihn nicht mehr wie eine Wolke über den Gläubigen liegen, ganz wie am Berge Sinai das Heilige im Wolkennebel verhüllt bleiben musste; wir hätten normale Menschen in der Seelsorge. All das könnte der Kirche in bestimmter Weise nur gut tun; es zerbräche aber die Zweigeteiltheit von Profanem und Sakralem, und es ginge folglich sofort weiter in die Richtung, die Luther angestoßen hat.
Denn: Die Frage nach dem Papstgehorsam wäre gleich die nächste. Es ist für mündige Menschen, die ihren eigenen Gefühlen, die der Lyrik ihrer Seele Folge leisten, nicht mehr möglich, die Obödienz formaler, nachsprechbarer Formeltreue zu vereinbaren mit der Ehrlichkeit der persönlichen Überzeugung, die sich bei der Lektüre der Bibel oder beim Hineinhören in das Schicksal anderer Menschen dialogisch ergibt oder, situativ bedingt, einstellt. All die Änderungen Luthers gingen augenblicklich weiter. Will die katholische Kirche in der Moderne ankommen, hat sie 500 Jahre ihres selbstverordneten Stillstands im Eiltempo nachzuholen, entlang all den Fußpuren, in denen Luther schon gegangen ist.
Hat das 1. Vatikanum 1870 mit dem Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes ein Stück weit die Spaltung zwischen den Konfessionen vertieft?
Absolut. Eine solche (weitere) Spaltung wurde damals sogar noch einmal in Gestalt derAltkatholiken hervorgerufen. Es erscheint fast als paradox, dass eine Gruppe von Münchener Gelehrten sich unter dem Titel Altkatholizismus als Reaktion auf das Unfehlbarkeitsdogma der Kirche Roms abspaltet. Man will schon mit dem Namen »Altkatholiken« sagen: »Was jetzt passiert – 1870 –, ist der Beginn einer neuen Kirche. So hatten wir das noch nie. Wir hatten Päpste, aber doch nie solche, die unfehlbar sich dünkten. Das schafft einen religionspsychologisch vollkommen anderen Kirchentyp. Wir bleiben jetzt bei dem, was von altersher war.« − Der Titel »Altkatholiken« ist wenig attraktiv, weil er restaurativ klingt, aber man wollte tatsächlich die Perversion oder die Transformation des Papsttums in eine reine Machtbeanspruchung – in Reaktion auf die politische Entmachtung des Vatikanstaats unter dem italienischen Freiheitskämpfer Garibaldi – nicht akzeptieren. Und hatten die Altkatholiken nicht recht? Mit diesem Dogma wurde wirklich die beste Tradition sogar der eigenen Lehre im Katholizismus überschritten, aber man hatte, wie stets, in breiter Front eine theologische Gelehrtenschaft, die mit ihrem Gehorsam bereit war, mitzumarschieren. Das ist bis heute so. Die kleine Gruppe der so genannten Altkatholiken indessen war ehrlich, sie riskierte ihren Beruf, ihr schönes Gehalt, und konnte doch nur erklären: »Dies, was da verkündet wird, ist nicht mehr unser Glaube.« Dann kam 1871 noch hinzu, dass man im nächsten Schritt in die Mariologie ging und die Unbefleckte Empfängnis Mariens (ihre Freiheit von der Erbsünde) verkündete, ergänzt später dann, 1950 unter Pius XII., durch das Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel, wie sie in der Ostkirche schon lange geglaubt wurde. Durch diese neuen Glaubenssätze wurden die Protestanten noch weiter beiseitegeschoben. Und warum? Von beiden Dogmen steht in der Bibel nicht ein einziges Wort!
Und dann kam noch das Wort von Joseph Kardinal Ratzinger in dem Lehrschreiben aus dem Jahre 2000: Dominus Jesus – so etwas wie eine Provokation für die Protestanten.
Die Glaubenskongregation bescheinigte damit den Protestanten, dass sie eigentlich nur Christen sind, weil sie, ohne es zu wissen oder wissen zu wollen, Katholiken sind, denn andere Christen als Katholiken kann es gar nicht geben, recht verstanden. Jeder Christ ist im Grunde demnach ein Mitglied der katholischen, und zwar der römisch-katholischen Kirche. Aber da die Protestanten sich zur katholischen Kirche formal nach wie vor nicht bekennen und viele der katholischen Wahrheiten weggebrochen haben, sind sie Christen in einem »defizitären Modus«. So Ratzingers Worte. Auch solch eine Doktrin trägt natürlich wenig zur Versöhnung der Konfessionen bei, wie sich jeder denken kann. Von den Protestanten hätte ich damals erwartet, dass man deutlicher gesagt hätte: »Wir sind nicht defizitär, wir setzen allerdings andere Akzente. Und die setzen wir ganz bewusst, in der Erwartung, dass sie bei euch genauso energisch wahrgenommen werden. Das ist kein Defizit. Wir haben nichts gegen Maria – übrigens war Luther ein glühender Verehrer der Maria, aber nicht in dieser dogmatisierten oder mystifizierten Form. Was Jesus uns gelehrt hat, ist eine Gottunmittelbarkeit zwischen der Person, die der Mensch ist, und der Person, die Gott ist. Wir brauchen nicht erst zu Maria uns zu wenden, damit sie einen stets verärgerten und angstmachenden Vater zu unseren Gunsten versöhnt. All die Umwege können sich nicht zu recht auf Jesus berufen. Diese Glaubenshaltung ist nicht defizitär, sie ist unsere Stärke.« Eine solche Antwort habe ich sehr vermisst. Man hat sich protestantischerseits damals beleidigt gegeben, aber man hat nicht wirklich argumentiert. Eben drum ist unser Gespräch hier über Martin Luther in meinen Augen auch ein Beitrag zur Ermutigung der Protestanten zu sich selber.
Nun sind die Protestanten ja auch keine geschlossene Einheit. Papst Franziskus wird zum 31. Oktober 2017 die lutherische Kirche besuchen. Da scheint es offenbar weniger Berührungsängste zu geben, sondern eher den Willen, einen deutlichen, öffentlichen Akt der größtmöglichen Gemeinsamkeit zu setzen.
Das ist zweifellos sein Bemühen, und ich nehme auch an, es wird so verstanden werden, jedenfalls möchte ich das hoffen. Andererseits wäre es schade, wenn die wirkliche religiös-theologische Spannung darunter eingeebnet würde. Die nämlich lautet, dass auch diese Papstgeste im Grund zweideutig sein kann. Sie bedeutet womöglich: Wir, die katholische Kirche, reden wie ein Mann, mit geschlossener Stimme, denn wir haben das Lehramt, wir haben das Papsttum, wir haben die Normierung des Dogmatischen, wir vertreten das Objektive. Nun aber reden wir mit euch Protestanten leider ungefähr so, wie wenn der amerikanische Präsident mit Indianern spräche, wo jeder Stamm einen eigenen Häuptling hat: Er kann eigentlich nur Verträge schließen mit den Sioux oder mit den Cheyenne oder mit anderen, aber nie mit »den Indianern«. So ähnlich kommt der katholischen Kirche der Protestantismus vom Verwaltungsstandpunkt aus vor. Wieder müsste deshalb jetzt umgekehrt die Antwort lauten: »Der Glaube ist christlich kein Verwaltungsgegenstand. Es ist überhaupt nicht möglich, den Glauben Christi plakativ flächig zu streichen und eine Formel daraus zu machen, die man nur nachsprechen muss, um die Wahrheit zu besitzen. Das eben ist das typisch Protestantische: Die Wahrheit muss gelebt werden in der einzelnen Person. Sie ist nicht in allgemeiner Form wie eine Drucksache abzustanzen. Ihr müsst mit jedem Einzelnen reden, das ist Seelsorge, das ist Mitteilung des Glaubens.« Der dänische Religionsphilosoph Søren Kierkegaard wird sagen: »Der Glaube ist keine Lehre, sondern eine Existenzmitteilung.« Das geht nur zwischen Ich und Du.
Wenn wir eben schon sprachen von Angst und ihrer Überwindung, so ist klar: Derlei gelingt nicht mit dem Weihwasserwedel, das gelingt nur durch das Gespräch mit jedem Einzelnen in seiner Angst. So wie Jesus zu jedem einzelnen Kranken im Neuen Testament redet, so müsste man persönlich, mit jedem Einzelnen, reden, wenn denn von Glauben überhaupt die Rede sein soll. Alles andere ist ein Verrat im Prinzip.
Also müssten die Protestanten wieder sagen: »Wir sollten gemeinsam eine Sprache finden, die die Einzelnen einlädt. Das dann ist unsere Gemeinsamkeit. Im übrigen: Was wollt ihr? Die Bibel selber ist voller Widersprüche, wie jeder sehen kann. Auch da gibt es nicht diese doktrinäre Einheit, sondern da herrschen riesige Spannungen, nicht nur zwischen Paulus und Petrus oder Jakobus und Johannes. Wo haben wir denn die Bibel als ein Lehrbuch, das wir nur aufschlagen müssten, um für jede Frage des Lebens die passende Antwort zu finden? Vom Alten Testament mal ganz zu schweigen. Das trägt in sich eine Geschichte von mehr als tausend Jahren Überlieferung mit unglaublich vielen unterschiedlichen Situationen, auf die man antworten musste, im Namen Gottes, wie man dachte. Also kann es doch nur richtig sein, dass wir suchen, gemeinsam, situativ, personal, dialogisch, und nicht dogmatisch, institutionell und kollektiv, Glauben zu leben und weiterzugeben.«
Sie haben gerade, Herr Drewermann, von der Sprache Luthers gesprochen, die sich an die Menschen richtet und die das Verhältnis von Gott und dem Einzelnen betont. Liegt der Unterschied zwischen dem katholischen Denken und Reden in dem Faktum, dass die katholische Kirche sehr juristisch, formaljuristisch denkt? Das zeigt sich ja zum Beispiel an dem Begriff »sacramentum« (Tertulian). Das ist ja eigentlich ein militärischer Begriff, der so viel heißt wie »einen Eid ablegen«. Und im Gegensatz dazu spricht Martin Luther von dem »Signum«, also von dem »Zeichen«. Da liegt ja ein gravierender Unterschied schon in der Sprache, in der Bewertung, in der Interpretation.
Die römische Kirche ist tatsächlich römisch. Hans Küng hat einmal gesagt: »Die katholische Kirche kann nur katholisch werden, wenn sie aufhört römisch zu sein.« Das ist ein Bonmot, aber eines, das da ganz gut hinpasst.
Da sind jetzt mehrere Dinge, die hüben und drüben der Alpen sehr unterschiedlich sein können. Ich mache es einmal daran fest, dass dasRechtsverständnis Roms einen Weg gegangen ist, der in der Neuzeit kaum noch verständlich ist, aber in der Kirche Roms im Grunde bis heute beibehalten wird. Die römische Kirche hat in ihrer Tradition angeknüpft, anknüpfen müssen, an die Pandekten Justinians im 6. Jahrhundert. So ist sie ins Mittelalter hinein gegangen und hat ihre eigene Struktur gefunden. G. W. F. Hegel hat einmal sehr richtig beschrieben, dass das römische Rechtsverständnis größten Wert auf die Ordnung des Äußeren legt. Das Individuum ist hier von der objektiven Gesetzgebung losgelöst. Man fordert ein korrektes Verhalten, aber nicht eine innere Übereinstimmung mit dem Inhalt der Gesetze.
Es kommt noch zu anderen Merkwürdigkeiten im römischen Rechtsverständnis. Man entwickelte bereits in der Antike in Rom, schon um die Vielfalt der Provinzen verwalten zu können, so etwas wie ein allgemeines Menschenrecht; bis zu diesem Punkt denken sich die Stoiker in der Tat vor. Gleichzeitig aber versklavt das Imperium unglaubliche Massen von Menschen, rekrutiert sie fürs Militär, lässt sie in den Gladiatorenkämpfen zum Schauspiel des Mobs gegeneinander antreten. Daher bricht sich die abstrakte Humanität, die im römischen Recht gebündelt wird, notwendig an der konkreten Willkür, die in der Praxis sich austobt. Beides, das Abstrakte des Rechts und das Konkrete des Verhaltens, wird nicht vermittelt. Hegel glaubte im übrigen, dass die Person Jesu gerade deshalb kam, um diesen Widerspruch zu heilen. Der Glaube an den Sohn Gottes sei notwendig gewesen, um den römischen Widerspruch zwischen innen und außen, zwischen Humanität im Recht und Inhumanität in der gelebten Wirklichkeit zu überbrücken. Dass das Göttliche Person sei, das betrachtete Hegel als in der Gestalt Jesu repräsentiert, philosophiegeschichtlich gedeutet. Darum habe, »als die Zeit erfüllt war«, der Christus kommen müssen.
Wir sind speziell in Deutschland, wesentlich auch im Erbe Martin Luthers und der Protestanten, zu einer davon sehr unterschiedlichen Auffassung gelangt, die sich am besten bündelt in der Aufklärung, im Deutschen Idealismus. Für Immanuel Kant ist es vollkommen unmöglich, dass man Recht formuliert, ohne dass es Recht sei in der inneren Überzeugung. Nach ihm kann keine Staatsordnung bestehen, die nicht vom Gewissen ausgeht, von der autonomen Freiheit jedes Einzelnen. Dieser Ansatz ist genau umgekehrt zu der römischen Auffassung. Das römische Denken beginnt mit der Institution des Staates und bricht sich herunter auf den Einzelnen, den es äußerlich einordnen möchte. Der Ansatz der Aufklärung umgekehrt beginnt, fast lutherisch zu sagen, beim Einzelnen, dessen Leben sich in die Allgemeinheit hinein ordnen muss.
Kontroverser können die beiden Standpunkte sich eigentlich nicht aufeinander zubewegen. Und zwischen ihnen ergibt sich eine Fülle von Problemen, die schwer lösbar sind – was ist beispielsweise mit dem Sakrament der Ehe? Für einen Katholiken ist die sakramental geschlossene Ehe unauflösbar, wenn sie vor dem Pfarrer und zwei Zeugen formal gültig geschlossen wurde. Für einen Protestanten gibt es diese Art von Sakramentalität der Liebe zwischen zwei Menschen nicht. Das, was Menschen sich schenken können, wenn sie sich lieben, ist die Gnade Gottes. Und dass sie zusammenleben und miteinander auskommen, ist das Zeichen dafür, dass Gott am Werke ist. Aber das kann kein Pastor machen. Der Pfarrer mag die Liebenden und ihre Beziehung (ein)segnen, doch ihre Ehe ist protestantisch kein Sakrament. Sie muss auch nicht formal in der Kirche angesiedelt sein. Luther würde andererseits der Anschauung sehr zugestimmt haben, dass man nur lieben kann und frei zu sein vermag für die persönliche Begegnung, wenn man jenseits der Angst sich in Gott geborgen fühlt. Doch um dahin zu finden, bräuchte man eine Art Erlösung zur Liebe, basierend auf religiösen, dogmatischen Voraussetzungen, wie sie in der katholischen Kirche in ihrer psychologischen Bedeutung nie mitbedacht wurden. Luther indessen ging schon in seinen Tagen bis da hin, dass er dem Landgrafen Philipp von Hessen, nicht ohne politische Gründe, eine Wiederverheiratung erlaubte und damit Hessen auf der Seite des Protestantismus hielt. Aber es entsprach jenseits der Politik ein solcher Schritt auch seiner religiös-menschlichen Überzeugung: Es ist möglich, in der Ehe zu scheitern. Es ist nicht gewiss, ob Gott uns beisteht, es steht nicht fest, was er mit unserem Leben will. Es muss sich im Konkreten unserer Existenz selber und in der Ehrlichkeit der persönlichen Entwicklung entscheiden.
Kann man es noch einmal auf den Punkt bringen, Herr Drewermann, dass man sagt: Der Protestantismus Martin Luthers nahm den Einzelnen viel ernster und viel stärker in die Pflicht als das katholische Regelwerk?
Unbedingt. Protestantismus, um es noch einmal zu betonen, beginnt wesentlich mit der Szene beim Reichstag in Worms: Ein Einzelner gegenüber den Kardinälen, den Theologen, dem anwesenden Kaiser, dessen Meinung sachlich zur Frage, was Glauben sei, nichts beiträgt –, all denen gegenüber ein Einzelner, der für das geradesteht, was er aus der Bibel als Gotteswort erkannt hat und in seelsorglicher Verantwortung im Namen Gottes und Jesu Christi für die Menschen als Kirche erhalten sehen möchte – dahinter gibt es kein Zurück. Wenn Menschendas wagen, hat man die Kirche, die man mit Jesus verbinden kann und die Martin Luther auf seine Weise in seiner Zeit wieder zu erreichen suchte. Das freilich taten sie alle, die Vorläufer Luthers, ob Jan Hus oder Wyclif oder Waldes: Sie standen für sich selber gerade. Und unterhalb dieser prophetischen Verdichtung der Existenz in der Person des Einzelnen ist das, was Christentum heißt, überhaupt nicht zu gewinnen.
7. Gottvertrauen und persönliche Identität
Für sich selber geradestehen – das heißt auch: Sie denken für sich selber, sie gewinnen ein neues Selbstbewusstsein.
Da sind wir bei vielen zeitgenössischen Voraussetzungen, die den Protestantismus mittragen. Natürlich leben wir Anfang des 16. Jahrhunderts im Zeitalter des Humanismus. Man will nicht mehr einfach Lehrmeinungen übernehmen, bloß weil sie einem vordoziert werden. Man weist zum Beispiel gerade um 1480 nach, dass die Konstantinischen Schenkungen an Papst Silvester I. im 4. Jahrhundert eine glatte Fälschung sind. Man muss Urkunden offenbar kritisch lesen, um zu sehen, was Fälschung und was Wahrheit ist. Und genauso jetzt: Wer garantiert uns die Echtheit eines Bibeltextes? Die in Rom gültige Bibel ist die Übersetzung von Hieronymus und vor ihm die Fassung der Itala; aber was steht griechisch wirklich da? 1516 legt Erasmus zum ersten Mal eine kritische Ausgabe des griechischen Neuen Testamentes vor, vier Jahre später eine Zweitauflage, noch mal revidiert, noch gründlicher. Diese Bibeledition ist für Luther das Arbeitsmaterial für seine eigene Übersetzung. Das ist der Geist des Humanismus: selber forschen, selber die Ursprünge kritisch betrachten. Theologisch bedeutet das: 1500 Jahre Kirchengeschichte sind keine Garantie für die Wahrheit Gottes. Die Geschichte auch der Kirche kann eine einzige Geschichte des Abfalls sein. Tradition selbst also beweist überhaupt gar nichts. Was in der wirklichen Existenz jetzt gelebt wird, in der Gegenwart, das entscheidet: Da und nirgendwo sonst findet sich die Wahrheit. Und diese Wahrheit ist individuell, personell, reflexiv mit einem ungeheuren Mut, sie ist nur als Wahrhaftigkeit. Die Gründe, die man anführt, um diese Wahrheit plausibel zu machen, sind niemals vorzutragen im Status der Selbstsicherheit, sondern immer nur der Dankbarkeit. Das spricht sich am Anfang noch massiv in Luthers Vorstellungen seines Verhältnisses zu Gott aus. Freilich, das ändert sich später, da will auch er recht haben. Aber das ist dem Widerspruch der Rechthaber geschuldet, mit denen er es zu tun hat.
8. Die Bibelauslegung – Schuld und Vergebung
Speist sich Luthers reformatorischer Gedanke aus seiner Beschäftigung mit der Exegese?
Absolut. Die Frage, die ihn nach der Bekehrung 1505 umtreibt, ist wirklich die: Wie finde ich einen gnädigen Gott? Und kaum, dass er Dozent ist an der neugegründeten Universität zu Wittenberg – erst 1510 wurde sie gegründet, und sein Orden schickte mit ihm den besten Mann dorthin –, beginnt er mit der Interpretation der Psalmen; 1513 beginnt das: Er liest die Bibel und liest sie auf die persönlichste Weise: das Gebetbuch Israels, die Psalmen, als seine und seiner Hörer Gebetslehre.
Er sollte ja vor allen Dingen in Wittenberg zunächst das Alte Testament lehren.