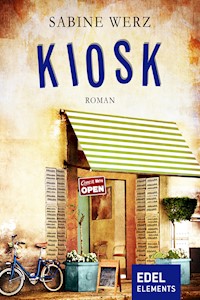Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eines Tages erhält die Kölner Reisejournalistin Charlotte Dornfelder die Nachricht, dass sie eine alte Zuckerfabrik am Rhein erbt, die im Zweiten Weltkrieg ihrem Großvater gehörte und nun auf Drängen von Kulturamt und ambitionierten Architekten zu einem Museum umgebaut werden soll. Bei der notwendigen Recherche zur Familie der Dornfelders, die Charlottes Jugendfreund Cantucci übernimmt, der inzwischen Historiker geworden ist, werden nicht nur alte Wunden wieder aufgerissen – auch die Zuckerfabrik birgt ein schreckliches Geheimnis ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sabine Werz
Liebe unter Kannibalen
Roman
Edel:eBooks
Copyright dieser Ausgabe © 2013 by Edel:eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg.
Copyright © 2004 by Sabine Werz
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-186-6
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
1.
Wenn Cantucci kommt, musst du dich totstellen«, sagt eine Stimme im Ginsterbusch. Charlie legt sich eifrig zurecht, kneift die Augen zu und gräbt ihre Hände in dünnen Ufersand. Sie bekommt einen Flusskiesel zu fassen. Fühlt sich an wie einer mit schwarzen Streifen und einem Loch drin, die mag sie gern, die heißen Hühnergötter, sagt der Vater. »Bleib so liegen, Charlie«, flüstert das Gebüsch, »egal was passiert.«
Ehrensache, auch wenn es nicht einfach ist. Ein Ast bohrt sich wie ein Vogelschnabel in Charlies linke Wade. Sie liegt neben einer Pyramide aus Feuerholz. Das haben sie vorher im Inselwäldchen gesammelt. Cantucci soll die Streichhölzer dabeihaben. Sein Vater raucht Tropenzigarren zum Schnaps, da kann Cantucci so was leicht abstauben. Sein Vater schaut nicht genau hin. Erst recht nicht nach drei, vier Samtkragen. Das ist halb klarer Schnaps, halb öliger Magenbitter, der sich als brauner Ring oben absetzt. Riecht nach Hustensaft.
Cantuccis Vater ist Postbote, und wenn er die Renten auszahlt, geben die Empfänger gern einen aus. Darum fährt Cantuccis Vater manchmal schon mittags Schlangenlinien auf seinem gelben Rad. Dabei sieht er aus wie ein Artist, findet Charlie und beneidet den kleinen Cantucci ein bisschen um ihn. Auch deshalb, weil der immer ein Malzbier kriegt, wenn er seinen Vater aus dem »Fässchen« bei der Zuckerfabrik abholen muss, manchmal mitten in der Nacht.
Da stehen die Männer im Finstern an der Theke, umwölkt von Bierdunst und Tabakqualm. Meist ist der verrückte Kaschubek dabei, der mit dem Glasauge und den Geschichten vom Krieg. Einem Krieg, der irgendwann hinter Berlin stattgefunden hat.
Das ist weit weg, so viel weiß Charlie. Und dass ihr Vater nicht gern davon spricht, weil ihm der Krieg noch im Knie sitzt, das ist ganz steif davon. Spricht keiner gern drüber, schon gar nicht mit dem alten Kaschubek. Weshalb der manchmal sein Glasauge rausnimmt und tut, als ob er es verschluckt.
Das hat ihr der kleine Cantucci erzählt. Der hat keine Angst vor Kaschubek. Der traut sich was, vielleicht weil er schon acht ist. Charlie ist erst sechs.
»Ich seh ihn kommen«, verkündet das Gebüsch, »kein Mucks, klar?«
Klar. Und kein Wort zu irgendwem darüber, dass sie hier sind.
Die Ölgangsinsel ist nämlich verboten, weil es hier sehr einsam ist und manchmal Zigeuner darauf zelten. Ungerührt summt eine Hummel, Birkenblätter flirren im Wind, der Fluss schwappt in leisen Wellen heran. Alles ist wunderbar.
»Pass auf, jetzt kommt er«, flüstert hinter ihr das Gebüsch. Charlies Körper erstarrt. Sie hört ein kurzes Aufplatschen. Das ist Cantucci, der aus seinem Kanu springt. Cantucci ist Mitglied im Ruderverein. Im Sommer glänzt sein drahtiger Körper braun wie eine Kastanie. Jetzt, wo Cantucci so braun ist, leuchten seine blauen Augen wie die letzten beiden Tassen vom hellen Sonntagsporzellan ihrer Mutter. Fast sieht Cantucci aus wie der Drachentöter in Charlies Sagenbuch, nur dass der blonde Haare hat.
Charlies Vater hat Cantucci trotzdem verboten und nennt dessen ganze Familie »asoziales Pack«, dabei wohnen die Cantuccis in dem gleichen neuen Hochhaus wie Charlies Familie. Gegenüber von der Insel, in der Nähe der Zuckerfabrik.
Aber Charlies Vater ist Arzt beim Gesundheitsamt und was Besseres, schon weil seinem Vater die Zuckerfabrik gehört.
Ein hölzernes Klappern verrät, dass Cantucci eben die Ruder in seinem Boot verstaut. Charlie atmet so lautlos wie möglich aus, auf ihren Armen bildet sich Gänsehaut. Gleich wird sie Cantuccis Zähne darauf spüren. Sie muss nur daran denken, dass es Cantucci und kein echter Menschenfresser ist, dann kann nichts passieren.
Im Gebüsch raschelt es ärgerlich, die unsichtbare Stimme hat neue Kommandos.
»Cantucci, du Idi. Na los. Tu so, als ob du sie essen willst. Mach das Feuer an.«
»Das ist blöd.«
»Das ist Robinson Crusoe.«
»Quatsch, Freitag haut ab, und Robinson tötet zwei Kannibalen, die ihn verfolgen.«
Dem Gebüsch ist das egal: »Erst machen die Kannibalen das Feuer an und schneiden einen Gefangenen auf.«
Cantucci bleibt widerspenstig. »Aber nicht den Freitag. Du hast keine Ahnung. Lass mich den Robinson machen.«
Charlie ist Freitag, weiß aber nicht, wer von beiden Recht hat. Sie will jedenfalls niemanden beißen. Schon gar nicht Cantucci.
»Ich bin vierzehn und sag, was gemacht wird«, bestimmt das Gebüsch, »du bist der Kannibale und willst Freitag fressen, dann komm ich und schieß dir ein Loch in den Bauch.«
»Pah! Du bist doch ein Mädchen, und ein Gewehr hast du auch nicht.«
»Ich hab eine Haarspraydose, was meinste, wie das Treibgas knallt, wenn ich die ins Feuer schmeiß.«
Ob Mama das recht ist?, fragt sich Charlie. Die Haarsprayflasche stammt bestimmt von der Frisierkommode. Wenn sie das rauskriegt, sagt sie es dem Vater und dann setzt’s Dresche. In letzter Zeit gibt’s häufiger Dresche.
Cantucci scheint das Zubeißen vergessen zu haben. Charlie hört, wie er direkt neben ihr ein Zündholz anreißt. »Gib her. Ich wette, du traust dich nicht.« Seine Stimme klingt lauernd. Knisternd fängt ein Reisigzweig Feuer. Charlie spürt an ihrer linken Seite einen warmen Hauch. Fühlt sich schön an, fast wie ein Streicheln.
»Und ob ich mich trau«, versichert über ihr die Stimme, die eben noch im Gebüsch saß. »Ich bin schließlich Robinson. Charlie, mach Platz.«
Und was ist mit Freitag? Ob Charlie die beiden an ihn erinnern soll? Geht nicht. Freitag spricht nur Kannibalensprache. Charlie hat sie erfunden und kann sie schon ziemlich gut. »Du bist bloß Alexandra und eine blöde Angeberin«, mault Cantucci, »du darfst nicht mal hier sein.«
»Ich geh, wohin ich will.«
»Her mit der Dose, oder ich sag’s deinem Vater ...«
Charlie wird ganz steif, so wie eine richtige Tote. »Der ist nicht mein Vater. Charlie ist sein Kalmückenkind.«
Charlie wird ganz heiß von dem Satz. Warum sagt Alexandra das in letzter Zeit immer. Und gerade jetzt. Sie spielt doch ganz brav mit.
»Dann sag ich’s eben deiner Mutter.«
»Drauf gespuckt.«
Jemand zieht Rotz hoch.
»Doppelspuck«, hält Cantucci dagegen. Zwei Rotzpfützen landen neben dem Holzhaufen.
»Meins war Atomspuck, leck weg«, behauptet eine der Stimmen. »Pass auf, gleich knallt’s, Idi. Eins, zwei ...«
Ein kollerndes Geräusch im Sand. Die beiden ringen miteinander. Hastiges Fußtrappeln, grapschende Hände, ein Sandregen geht auf Charlie nieder. Sie will aufspringen.
»Weg da, Charlie, halt dich raus«, ruft einer.
Ein sausendes Geräusch. Metall klappert gegen Holz. Auf dem Fluss tönt das Signalhorn eines Schleppschiffs. Das Tuten wird zu einer Explosion, mitten in Charlies Gesicht. Durchs linke Ohr saust ein Blitz direkt in ihren Kopf. Das tut weh, wirklich weh. Charlie reißt die Augen auf.
Sie ist nicht mehr sechs. Sie ist fast vierzig.
2.
Cantucci sitzt im ehemaligen »Fässchen« gegenüber von der Zuckerfabrik. Das »Fässchen« heißt inzwischen »Sugar Cane« und sieht aus wie ein zu groß geratenes Aquarium. Man sitzt hinter blau getönten Scheiben, eine grüne Neonpalme hängt über einer Holztheke, die mit zerspelztem Zuckerrohr verkleidet ist. Darüber rühren Flügelventilatoren die ohnehin klimatisierte Luft. Sehr cool, sehr trendy und kurz vor klinisch, findet Cantucci.
Dafür darf man nachmittags – zur Happy Hour – die Schalen der Erdnüsse, die aus Sektkübeln auf die Tische geschüttet werden, auf den Boden werfen. So viel Dreck muss sein, man lebt schließlich nicht mehr in den voll verchromten Achtzigern.
Genau das Richtige für die Büroboheme aus hektischen Werbern und nervösen Brokern, die sich im rechten Trakt der alten Zuckerfabrik langsam breit machen.
Die kommen ab neun, trinken klebrige Cocktails zur Cohiba und erzählen vom letzten Kubatrip. Kuba ist zurzeit schwer in Mode, und jeder, der da war, bemüht sich zu versichern, dass er das echte, authentische Kuba entdeckt hat – als gäbe es ein falsches. Das für Idioten.
Morgens, auf dem Weg ins Büro, süßt man sich im »Sugar Cane« den Café macchiato mit grobem Zucker, der bei Feuchtigkeit schnell Klümpchen bildet und von erdigem Braun ist. Das täuscht Natürlichkeit vor, ist aber oft nur ein Zeichen für Verunreinigungen oder einen Melassezusatz, so viel weiß Cantucci noch über die Tücken der Raffination. Schließlich ist er neben einer Zuckerfabrik groß geworden. Seine Familie war stolz darauf, sich nur den weißesten Feinzucker zu gönnen. Proletenehre.
Im Hintergrund läuft die Musik aus »Buena Vista social club« und spendet ein bisschen Wärme. Passt gar nicht hierher.
Die Bedienung, zwei biegsame Blondinen, eifern mit der Kühlleistung der Klimaanlage um die Wette. Erfolgreich. Cantucci wirft ihnen bereits den dritten auffordernden Blick zu. Eine Blondine bequemt sich, ihn aus dem Augenwinkel als Gast zu registrieren. Sie schlendert zu seinem Tisch, den Kopf immer noch der Kollegin zugewandt, mit der sie ein ausführliches Gespräch über »so einen notgeilen Naschkeks« führt.
»Musste dir mal vorstellen, singt mir um Mitternacht noch auf Knien Cole Porter vor, um mich ins Bett zu kriegen, und am Morgen isser einfach weg. Nicht mal ‘n Zettel. Sagste dazu? Dabei ist dieser Pavianarsch angeblich Werbetexter. Nur nich in eigener Sache.«
Sie wendet sich mit strafendem Blick Cantucci zu. »Bitte, was ...«, sie zögert kurz, ihre Pupillen werden weit, ihre Stimme bekommt einen gurrenden Klang: »Was kann ich Ihnen bringen? Die Frühstückskarte? Wir servieren Frühstück bis ein Uhr. American Breakfast, Cuban Eggs, Empanadas oder vielleicht Castros Spezial? Das ist eine Havanna und ein Espresso.« Sie hat den Ärger aus ihrem Gesicht gewischt und gegen ein hinreißendes Lächeln ausgetauscht. Völlig falsch.
Cantucci kennt das. Es liegt an seinen Augen, das haben ihm genug Frauen gesagt, dass sie seine sehr blauen Augen zu seinen dunklen Haaren unwiderstehlich finden. Cantucci langweilt das, genau wie das Lächeln der Bedienung, das ihr Zahnfleisch entblößt.
»Einen Kaffee.«
Der Kellnerin ist das zu wenig. »Café macchiato, Espresso, Café au lait, Caribic Coffee, das ist mit einem Schuss weißen Rum ...«
»Einfach Kaffee.«
»Kommt sofort. Bin gleich wieder da.« Sie strebt im Schlängelgang zur Theke zurück, führt ihre Biegsamkeit vor. Cantucci schaut nicht hin.
Das alte »Fässchen« war ihm lieber. Hatte einen unverwechselbaren Geruch. Die Männer würzten ihren kerligen Schweiß mit Pitralon, und die wenigen Frauen, die sich hertrauten, rochen nach Rexona und Polyesterblusen. Proletenduft eben. Über plarrende Lautsprecherboxen, Marke Universum, versicherte Udo Jürgens: »Griechischer Wein ist wie das Blut der Erde.« Bei »Komm schenk mir ein« grölten die Kerle mit, die Frauen bekamen ihr viertes Glas Pampasgras mit Grapefruitgeschmack, und ihre Augen wurden feucht, weil die Kerle im Grunde genommen doch Herz hatten.
In dieser Kneipe hat er alles gelernt, was man in Kneipen können muss, Groß-das-Maul-aufreißen, Fußballwetten, Autogespräche, Streiten, Knobeln, Trinken, Frauen anbaggern. Hier ist er erwachsen geworden. Bisschen zu früh für seinen Geschmack. Aber das wird man eben, wenn der Vater ein begnadeter Thekenheld ist.
Am Tresen war Cantucci senior zu Hause, ist er nie drüber hinausgekommen. Anders als sein Sohn. Hatte auch sein Gutes, die Welt von ganz unten her kennen zu lernen, findet der. Er wusste immer, wo’s langgeht – nach oben.
Die Bedienung vom »Sugar Cane« pflügt durchs Lokal und balanciert dabei ein Bambustablett mit Kaffeegedeck. Umständlich serviert sie und grinst, als habe sie dafür schnell noch einen Aufbaukurs absolviert.
»Wir haben auch anderen Zucker, wenn Sie möchten?«
»Danke«, entgegnet Cantucci. Gelangweilt wendet er sich seinem Kaffee zu. Die Blondine streicht widerwillig die Segel.
Solche Frauen machen es ihm und sich zu einfach, denkt Cantucci. Eine Zeit lang hat ihn das regelrecht angeekelt, und er hat Blondinen, wie diese Bedienung, im Stillen nur noch »Hühnerpopos« genannt. Jetzt sind sie ihm einfach egal, davon hat er in seinen wilden Zwanzigern genug gehabt. Genau wie von seiner Rolle als echter Kerl.
Gott sei Dank hat er früh andere Dinge dazugelernt.
Er freut sich darauf, nach so vielen Jahren wieder in der Stadt zu sein. Ein interessanter Job liegt vor ihm, und alte Bekannte kann er auch treffen. Gerade wartet er auf Anton Kellmanns. Und natürlich, Cantucci schaut auf die Uhr, lässt ihn Anton Kellmanns warten.
Nicht dass ihm an Kellmanns besonders viel liegt, aber der Architekt will wissen, was Cantucci hier macht. War ganz aufgeregt am Telefon, als Cantucci kurz die Zuckerfabrik erwähnt hat. Scheint Kellmanns Lebensthema zu sein, ist immer noch damit zugange, wenn auch nicht mehr im Bürgerzentrum »Zuckerhut«, sonst müsste er wissen, was Cantucci vorhat.
Cantucci ist Historiker. Keiner von den staubtrockenen Aktenhockern und verhärmten Quellenfreaks. Er verdient gutes Geld mit komplizierten, historischen Recherchen für Firmen und Anwälte. Hat gerade eine knifflige Sache hinter sich.
Eine Vereinigung jüdischer Emigranten in den USA hatte ihn beauftragt, nach alten Patenten und Lebensversicherungsurkunden zu forschen, die angeblich im Zuge der Kriegs- und Nachkriegswirren verschollen waren. Nicht ganz so verschollen. Cantucci hat sich durch Archive zwischen Washington und Wladiwostok navigiert. Er hat gebohrt, gebettelt, geschmeichelt, getrickst und bestochen. Sein größtes Talent – Hartnäckigkeit – hat sich ausgezahlt.
Jetzt steht ihm der Sinn nach einer leichteren Aufgabe wie dem Job in der ehemaligen Zuckerfabrik. Einer Aufgabe, die nebenbei mit seiner eigenen Vergangenheit zu tun haben wird.
Immer ältere Bilder tauchen auf. Kinderszenen. Der Fabrikhof, Glasauge Kaschubek, die fauchenden Kalköfen, sein blau bemaltes altes Postfahrrad, die Kanufahrten auf dem Fluss, die Ölgangsinsel, Robinson-Spiele. Sommerbilder, alles Sommerbilder. So war es nicht. Nicht nur.
Cantucci fährt mit der Hand in die Innentasche seiner Jacke. Seine Finger berühren knisterndes Papier. Er zieht einen oft gelesenen, lilafarbenen Brief hervor. Früher hat der mal nach Patschuli gerochen, aber sogar der Geruch von Patschuli verfliegt nach so langer Zeit. Der Brief ist fünffach geknifft, und ein ziemlich kindischer Totenkopf ist darauf gemalt, als handelte es sich um eine Geheimbotschaft. Typisch Alexandra. Immer melodramatisch und ein bisschen makaber.
Dabei war sie fast zwanzig, als sie das hier geschrieben hat. Cantucci schüttelt den Kopf, entfaltet den Brief und lächelt traurig. Der Brief beginnt mit ihrem Lieblingsgedicht:
Die Sterne rosten
Langsam oxidiert sie der Frost
Es regnet dort und überall
Der Wind wirft mit zerbrochenen Vögeln um sich
Und schreit —
Erkaltet wie ein Krater auf dem Mond
Ist mein Herz
Ich friere langsam in das All hinüber
Das stammt von Yvan Goll, wenn er sich nicht täuscht. Alexandra war ganz versessen auf surrealistischen Todeskitsch. Eine Mode damals, genau wie Dalís zerfließende Uhren oder seine Schubladen-Giraffen, die bald in jeder Pommesbude über dem Flipper hingen. Leider war das alles für Alexandra mehr als eine Mode. Als er den Brief zum ersten Mal gelesen hat, konnte er nicht wissen, dass es ihr letzter sein würde. Mit fünfzehn kann man nicht wissen, dass einer wie Alexandra auf dieser Welt nicht zu helfen war. Anfang der Siebziger haben viele die Doors gehört und in ihren einstigen Kinderzimmern die Wände und die Schleiflackmöbel schwarz gestrichen.
Alexandra war dabei eine der Ersten, wie bei allem, was Eltern ärgert und mit dem Geruch von Gefahr behaftet war. Ein Star auf ihre Art. Jedenfalls hier in der Vorstadt. Erst recht nach ihrem Ausflug in die Welt, nach London und dann immer wieder nach Amsterdam. Hatte am Ende Narrenfreiheit – vor allem bei den Eltern. Die haben sich nicht mehr zu helfen gewusst.
Cantuccis Augen überfliegen den letzten Satz des Briefes, es folgt ein Postskriptum, dann ein PPS, und noch ein PPPS, Teenie-Stil. Forever young – Alexandra hat das buchstabengetreu nachgelebt. Wenigstens der Inhalt des PPPS zeigt, dass sie kein Teenie mehr war, als sie das geschrieben hat: »Pass auf Charlie auf. Dich mag sie.«
Auf Charlie aufpassen. Leichter gesagt als getan. Cantucci greift zur Tasse. Er hat es mal versucht und ist gründlich gescheitert. An sich selbst. Oder doch an Charlie? Charlie, die Klette. So hat er sie als kleines Mädchen genannt. Mit achtzehn war sie noch immer recht anhänglich, beinahe noch ein Kind. Anders als er.
Aber das ist zwanzig Jahre her. Inzwischen ist sie eine erwachsene Frau und seit kurzem Erbin. Kein leichtes Erbe aus historischer Sicht. Und außerdem ein Erbe, das Charlie gar nicht haben sollte, sondern Alexandra. Könnte eine komplizierte Geschichte werden, hängt ganz von Charlie ab.
3.
Vom Traum ist nur eine Gänsehaut geblieben. Den Rest hat Charlie im Sekundenbruchteil des nächsten Lidschlags vergessen. Sie setzt sich im Bett auf. Der Vorhang vor dem Schlafzimmerfenster bauscht sich im Wind und fängt blendendes Licht. Charlie greift hinüber zum Nachttisch. Sie hat den Wecker nicht klingeln hören, muss wohl wieder auf dem rechten Ohr geschlafen haben.
Elf Uhr schon.
Jeden Morgen ist sie später dran und wie zerschlagen.
Die Kissen fühlen sich klamm an. Es muss am Wetter liegen, tippt sie mit Blick auf den gleißenden Vorhang. Ein verfrühter Maisommer liegt über der Stadt, lässt das Leben stocken wie Milch, verwirrt die Menschen und erschöpft einen sogar im Schlaf. Charlie wirft das Laken beiseite, vergräbt die Füße im tiefen Teppich. Fühlt sich an wie Sand. Ihr wird schwindlig, fast so als müsse sie sich übergeben. Ein hohes Pfeifen schwillt in ihrem tauben Ohr auf und wieder ab.
Unsinn.
Muss an dieser elenden Wohnung liegen, dass sie zu viel schläft und dann schlecht gelaunt aufwacht. Eine halbe Fabriketage bietet viel Platz für eine ausufernde Fantasie und herrenlose Gedanken. Vor allem, wenn die Etage Teil eines Erbstücks ist, das man nicht haben will. Charlies Erbstück ist die Dornfelder Zuckerfabrik und ihre Wohnung das ehemalige Kontor des Zuckerbarons. Hier wohnt sie seit einem Monat.
Anton Kellmanns hat alles saniert und einen sehr nackten Architektentraum daraus gemacht, für den er einen Preis bekommen hat: Freigeschlagene Ziegelmauern, Steinböden, freiliegende Versorgungsleitungen und bodentiefe, stahlgerahmte Fensterfronten zur Flussseite hin.
Zusammen ergibt das zweihundert Quadratmeter und eine sorgsam veredelte Fabrikatmosphäre, die keine eigenen Verzierungen verträgt. Ihre Mutter hat das Ganze vor zwei Jahren in Auftrag gegeben oder besser: Sie hat Kellmanns freie Hand gelassen und in einem Anflug später Gier seinem seifigen Vertretergeschwätz von »innovativen Investitionen« und einer »enormen Wertsteigerung« vertraut. Die beiden haben gigantische Pläne für den Umbau der Fabrikruine geschmiedet, bis der Tod dazwischengefunkt hat.
Der Tod der Mutter, aber auch Anselm Rottgarten, der Leiter des Bürgerzentrums, das im linken Fabriktrakt untergebracht ist. Ein undurchsichtiger Kauz, dem Charlie noch weniger traut als Kellmanns. Den treibt nur Gewinnsucht, er ist ein gewöhnlicher Kungler, der seine Finger auch in den Baufirmen zu haben scheint, die er beschäftigt. Gut möglich, dass er sich für seine Aufträge ordentlich schmieren lässt. Er ist etwas zu schnell reich geworden, nachdem er jahrelang nur für den Aufbau des »Zuckerhut« und wenig lohnende alternative Bauprojekte gekämpft hat. Charlie zuckt die Achseln. Wenigstens zahlen seine Manipulationen sich für alle Beteiligten aus.
Rottgarten hingegen ist ein spät berufener Esoteriker, der mit verschwiemelten Nachrichten aus dem Jenseits eine Seite in ihrer sterbenden Mutter zum Schwingen gebracht hat, die Charlie peinlich ist. Einen törichten Hang zu Mystik und Versöhnlichkeit. Fast so als habe sie auf den letzten Metern zum Grab noch ein sehr feiger Katholizismus gepackt, eine Reue, die sie nichts mehr kosten konnte und ihren Lebenslügen einen höheren Sinn gab. Charlie schüttelt sich bei dem Gedanken.
Dann schon lieber dieser großspurige Loft, der sich aus den amerikanischen Achtzigern hierher an den Rhein verirrt hat. Immer hatte ihre Mutter ein Händchen für die falschen Männer an ihrer Seite. Darin ist sie sich treu geblieben.
»Vorbei«, sagt Charlie laut und zuckt. Wie hohl ihre Stimme von den kahlen Wänden widerhallt. Sie hat beim Einzug nur lustlos ein paar Möbel und Reisemitbringsel in der Wohnung platziert. Sie wollte hier nicht heimisch werden.
Genau, nickt sie sich jetzt im Spiegel zu, der gegenüber an der Wand lehnt. Mein Gott sieht sie fertig aus. Leichenblass, die dunklen Haare ganz zerstrubbelt, dazu ihre schräg stehenden Augen. Die hat sie vom Vater. »Kalmückenkind«, sagt Charlie und streckt sich die Zunge raus.
Wird Zeit, dass sie weggeht. Eine ehemalige Reisereporterin gehört eben an keinen festen Ort.
Was heißt eigentlich ehemalig? Sie hat doch nur eine Pause vereinbart. Eine zu lange Pause. Ein Jahr ist einfach zu viel für eine, die gewohnt ist, von dreihundertfünfundsechzig Tagen dreihundert unterwegs zu sein. Sie braucht überhaupt keine Pause. Egal, was andere dazu sagen. Charlie schüttelt energisch den Kopf. Sollen sich alle raushalten. Und zwar ab sofort. Sie will weg. Der Gedanke macht sie munter.
Die restlichen Erbschaftsfragen können die Anwälte klären und ...
Das schnurlose Telefon klingelt, Charlie zieht es unter dem Bett hervor.
» Hallo?«
»Hallo, hier Kellmanns.«
An genau den hatte Charlie gerade gedacht, sie schaut den Hörer an, als handele es sich um ein magisches Instrument.
»Einen wunderschönen Guten, Frau Dornfelder. Herrlicher Tag, hoffe, Sie haben etwas passend Schönes vor?«
Ja, ich geh weg, denkt sie kurz, sagt aber nur: »Mal sehen, wird sich sicher was finden.«
Kellmanns wartet die Antwort kaum ab. Die Frist, die er sich für höfliches Vorgeplänkel setzt, ist gewöhnlich knapp. Mit ziellosem Gerede hat er sich in seinem Leben lang genug aufgehalten. Jetzt ist er ein Macher, preisgekrönt und voller Zuversicht. Seine Stimme erinnert an Fahrstuhlmusik – man entkommt ihr nicht.
»Ich wollte Sie bitten, morgen am Vormittag einmal bei mir vorbeizuschauen. Habe paar interessante Skizzen für Sie. Paar Ideen für den linken Fabriktrakt, die ich bereits mit Ihrer Mutter entwickelt hatte, bevor ... nun ja. Alles . ganz unverbindlich, versteht sich. Aber ich bin sicher, dass es Ihnen zusagt. Freundlich, licht, großzügig. Ein echter Gewinn.«
Charlie runzelt ärgerlich die Stirn. Unverbindlich? Elender Lügner. Den Verteilungskampf zwischen Kellmanns und Rottgarten hat sie auch geerbt. Erbschleicher alle beide.
»Der linke Flügel? Da sollten Sie zuerst mit Rottgarten und den Leuten vom Bürgerzentrum reden. Meine Mutter wollte es, glaube ich, erhalten und weiter ausbauen.« So viel Hartnäckigkeit ist sie ihr schuldig – leider.
Kellmanns’ Stimme holt mit einem Hauch müder Entrüstung aus. »Liebe Frau Dornfelder, so weit sind wir doch noch gar nicht. Es geht nicht um den Innenausbau oder die Nutzungsrechte. Es handelt sich nur um die Fassade. Da muss was passieren, wegen der Bausubstanz. Die vom Bürgerzentrum sind dem nicht gewachsen und schaden damit einem unwiederbringlichen Industriedenkmal. Die Bausubstanz interessiert einen Herrn Rottgarten leider nicht.«
»Aber den Kaschubek.« Der ist der Sohn vom alten Kaschubek, dem Glasauge, und inzwischen selber um die sechzig. Warum sie ihn ins Spiel bringt, weiß sie nicht. Kindheitserinnerungen? Ach was, die sind verschwommen und nicht eben heiter. Es ist Kellmanns schmierige Zuversicht, die Charlie rebellisch macht und den Kaschubek in Stellung bringen lässt. Dieser alte Sturkopf ist ein hart gesottener Kämpfer, dem die Zuckerfabrik tatsächlich am Herzen liegt. Familientradition, denn wie sein Vater hat Kaschubek junior sein ganzes Arbeitsleben dort verbracht.
Der Architekt räuspert sich, seine Stimme erinnert jetzt an einen geduldigen Arzt. »Der Kaschubek, ja. Der ist natürlich sehr engagiert – für einen Hausmeister. Einen ehrenamtlichen Hausmeister. Macht seine Sache prima. Aber, das Gegenteil von gut ist nun mal gut gemeint. Das ist ja das Problem mit unserem Bürgerzentrum. Ich kenn das, hab lange genug da mitgemacht. Alles Zeitverschwendung.«
Charlie wird ungeduldig. Sie will sich doch raushalten und endlich weg.
»Ich schau mir Ihre Pläne morgen schnell an«, entscheidet sie.
Kellmanns springt darauf mit der Elastizität eines Flummiballs. »Wunderbar, sagen wir um zehn? Bis dann, genießen Sie den Tag.«
Genau. Ihr ist der linke Fabrikflügel so egal wie der rechte. Eigentum ist lästig. Charlie glaubt nicht an ein Leben ohne Arbeit. Sie will ihr Geld selbst verdienen, auch wenn sie von den Mieten für die Nobelbüros, die Kellmanns bereits im rechten Fabriktrakt untergebracht hat, sorglos leben könnte – wenn die Büros alle vermietet sind.
Geld reicht nicht, um sie hier zu halten. Ihr kleiner grüner Koffer steht unter dem Bett – fertig gepackt. Das hat sie gleich nach der Beerdigung der Mutter gemacht. Sie gehört nicht auf Dauer in diese Stadt, mit der sie nur eine nichts sagende Kindheit verbindet und zuletzt die sterbende Mutter. Unterwegssein bekommt ihr besser, genau wie Sonnenbräune.
Charlie steht auf, tappt über einen langen Flur in die Küche. Hier hatte der Großvater sein Laborbüro, in dem er Rübenpreise aushandeln oder über ein neues Verfahren zur Zucht einkeimiger Rübensamen brüten konnte.
Knifflige Sache, Charlie hat die Aufzeichnungen aus seinem Nachlass kürzlich überflogen, sie lernt gern dazu.
Ein natürliches Rübenknäuel enthält drei bis vier Samen, die auf dem Feld dicht gedrängt aufgehen und sich den Platz streitig machen. Die sonst so anspruchslose Zuckerrübe braucht für ihre Entwicklung viel Platz, muss einzeln stehen. Genau wie der alte Tüftler, sagt Charlie sich mit Blick auf die Glasfront vor ihrer Küche.
Dem Alten muss der weite Blick vom Kontor auf den Fluss gefallen haben, die Einsamkeit auf dem Dach. Seine Rüben hatte er eindeutig lieber um sich als seine Verwandten. Familie war dem Zuckerbaron immer lästig, die Forschung ging vor. Kein schlechter Zug, findet Charlie, auch wenn sie den Großvater deshalb nie kennen gelernt hat. Seine Liebe zum Fluss kann sie mit ihm teilen, seine Abneigung gegen verlogene Familienidyllen auch.
Sie öffnet eine Glastür und tritt hinaus aufs Dach. Die Teerpappe knistert unter ihren nackten Füßen, sie hat die Hitze der letzten Tage gespeichert. Genießerisch betrachtet Charlie den gemächlich dahinströmenden Fluss.
Der ist sich gleich geblieben. Hat sie immer ans Reisen denken lassen. Schon als Kind ist sie gern am Ufer zwischen Basaltquadern und Flusskieseln herumgeklettert, die Abenteuer ihrer Sehnsucht vorauserlebend. Der Fluss trug allerhand Schwemmgut vorbei, das von anderen Menschen und Orten erzählte. Glücklicheren Orten, davon war sie fest überzeugt, man musste sich nur auf den Weg machen.
Bewegung statt Stillstand. Genau. Sie wird noch heute ihren Job wieder aufnehmen. Reisereportagen für »female«, da hat ihr nie einer reingequatscht. Freelance ohne Redaktionsanbindung. Feste Freie nennt man das. Eine laue Geschichte, und man ist draußen, ganz im Freien. Kein Problem für Charlie, ihre Geschichten sind unnachahmlich. Eben echt Charlie. Unterwegs sein ist die Lösung. Ist immer schon die Lösung gewesen.
Übermütig läuft sie bis zum Rand des Dachs, blickt hinab auf den Kai vor der Zuckerfabrik und den alten Schiffsanleger.
Unten geht Kaschubek. Ausgerechnet. Charlie macht einen Schritt zurück, ganz vorsichtig, da blickt er schon zu ihr hinauf, winkt, lacht, formt mit den Lippen ein »Guten Morgen Frau Dornfelder«, verbeugt sich sogar. Klar, dass er mit dieser Pantomime etwas bezweckt, der will sie für sich gewinnen und fürs Bürgerzentrum.
Charlie zögert einen Moment. Was soll’s. Sie winkt zurück, lacht auch. Klingt gezwungen, aber das kann man unten bestimmt nicht hören. Charlie kehrt in die Küche zurück. Nichts kann sie hier halten, kein Kellmanns, kein Rottgarten und kein Kaschubek.
Nein, es gibt keinen Menschen, der sie hier halten könnte. Erst recht kein Mann. Da ist sie anders als ihre Mutter. Glaubt Charlie. Entschlossen zieht sie den grünen Koffer unter dem Bett hervor. Leichtes Gepäck. Sollen die anderen sich mit der Zukunft der Vergangenheit beschäftigen. Sie will einfach leben.
4.
Der Kaschubek hat eine Schraube locker, heißt es. Aber die das behaupten, können es nicht wissen, weil sie mit dem Kaschubek gar nicht erst reden. Eindeutige Vermutungen haben sie trotzdem. Es muss in der Familie liegen. Sein Vater – Glasauge Kaschubek – war schon mit fünfzig völlig plemplem und hat lauter wirres Zeug erzählt. Das tut sein Sohn zwar nicht, dafür schlendert er jeden Morgen zum Kai vor der Zuckerfabrik, geht hinaus auf den schwimmenden Schiffsanleger und spricht mit dem Fluss.
Über seine Pläne. Was die Leute, die nicht mit ihm reden, nur noch verrückter fänden. Kaschubek plant nämlich die Zukunft der Zuckerfabrik. Dabei hat die längst keine mehr. Jedenfalls keine, die Kaschubek zu interessieren hat. Seine Tage als Werkmeister sind längst Vergangenheit, wie alles hier.
Hinter ihm schneidet ein verödeter Schienenstrang in den Kai – ummantelt von einem Pelz aus Rost. Darüber sind vor zwanzig Jahren die letzten Wagonschlangen zum Hauptbahnhof gerollt. Beladen mit Dornfelder Zucker: Rohzucker, Haushaltszucker, Hagelzucker, Streuzucker, Einmachzucker, Puderzucker, Farinzucker, Kandiszucker, Würfelzucker und die berühmten Zuckerhüte, eingeschlagen in kobaltfarbenes Papier und ganz früher noch mit Indanthren geblaut, damit sie besonders weiß leuchteten.
Der alte Dornfelder hatte da sein Spezialrezept. Eines von vielen. Fing mit einem Patent für Zuckerersatz an, in den späten Dreißigern. Damals brauchte man für alles Ersatz. Kriegswirtschaft. Hat dem Dornfelder viel Geld gebracht. So viel, dass er die Fabrik übernehmen und umbenennen konnte: Dornfelder Zucker. Das war sein ganzer Stolz. Hat er alles für gegeben und ’ner Menge Leuten Jobs verschafft. War ein begnadeter Chemiker, der letzte Zuckerbaron. Und alles in allem ein feiner Kerl. Hat sich um jeden gekümmert, der für ihn gearbeitet hat. Jeden.
Vorbei.
Zu sagen hat hier demnächst nur noch einer, heißt es. Der Architekt Anton Kellmanns. Der hat alles im Griff. So führt er sich jedenfalls auf, seit er für den Umbau des rechten Trakts einen Preis bekommen hat. Jetzt will er an den linken Flügel ran. Kellmanns glaubt, dass er den Auftrag dafür so gut wie in der Tasche hat, weil die Charlie sich nie um was gekümmert hat und immer unterwegs war.
Kaschubek sieht das anders, vor allem, weil Charlie immer so ein freundliches Lächeln für ihn hat. Wie eben. Ganz der Großvater. »Die wird dem Kellmanns schon zeigen, wo’s langgeht. Ist keine Memme wie ihr Vater oder verführbar wie die Mutter. Die Charlie hat Unternehmensgeist, genau wie der Alte«, erklärt er dem moosfarbenen Fluss, der glucksend den Anlegerponton umspült.
Manchmal überspringen die guten Gene eine Generation, so ist das eben. Charlies Vater, der Sohn vom Zuckerbaron, hatte eindeutig zu viel von seiner Mutter mitgekriegt. Ein dummes Fabrikmädel aus dem Osten, das sich für ganz schlau hielt. Dachte, wenn sie einmal die Beine breit macht beim alten Dornfelder, hat sie fürs Leben ausgesorgt.
Geschnitten, der hat sich keine Familie aufhalsen lassen wegen so’m bisschen Gefummel. Das konnte er schließlich überall haben. Mit Liebe hat das nichts zu tun gehabt. Mehr als seinen Namen hat er dem unerwünschten Sohn nie vermacht. War auch besser so. Jetzt ist jedenfalls Charlie dran.
Ein wirklich wunderbarer Tag. Die Sonne spiegelt sich im Wasser, das nach Motorenöl, Blei und Bracke riecht. So muss ein Fluss riechen, nach Industrie und Arbeit, findet Kaschubek und beginnt zu hüpfen. Auf und nieder, auf und nieder. Der Steg des Anlegers federt starr unter seinen Füßen.
An diesem Anleger haben während der Rübenernte früher täglich die Schleppkähne festgemacht. Von September bis in den November hinein. Randvoll mit schmutzigen Pyramiden aus Zuckerrüben, Erdreich und Feldgestein. War das ein Betrieb! Auf dem Kai schloss sich ein Entladesystem aus Wasserkanonen, Umlauftrommeln und Schwemmrinnen an, über die ein steter Strom aus Schmutzrüben und Wasser dem Steinfänger und Schnitzelwerk zufloss.
Alles abmontiert und weggeflext, sogar die Betonfundamente der Zuckersilos haben sie gesprengt.
Aber den schwimmenden Anleger hat Kaschubek verteidigt bis zuletzt. Der gehört nämlich ganz klar zum linken Fabrikflügel und ist tadellos in Schuss. Kaschubek hat ihn gewissenhaft gewartet. Das merkt man daran, wie alles federt. Auf und nieder, auf und nieder. Und meine Knochen sind auch noch gut geölt, denkt Kaschubek und hüpft spaßeshalber auf einem Bein weiter, dann auf dem anderen, dann immer abwechselnd.
Wirklich verrückt, denkt Frau Delius, die eben mit einer schwarzen Tasche den Kai langgeht. Bei dieser Hitze. Sie ist ja vom Gehen schon schweißgebadet. Viel zu heiß dieser Mai. Immer falsch das Wetter. Der Fluss stinkt ganz vergammelt.
Frau Delius ist auf dem Weg zur Arbeit. Heute hat sie ihren Putztag bei Charlie. Das macht sie seit einem Monat, jede Woche einen ganzen Tag. Charlies neue Wohnung ist riesig, geht übers halbe Fabrikdach. Frau Delius hat also keine Zeit, auf verrottenden Stahlstegen rumzuhopsen, aber Zeit für eine Frage hat sie. Ordnung ist ihr halbes Leben, die andere Hälfte widmet sie gewissenhaft den Angelegenheiten anderer Leute.
»Was machen Sie denn da?«
Kaschubek dreht sich langsam um und wackelt ein wenig, weil der Steg nachfedert. Er mustert die Delius scharf, so als wolle er feststellen, ob sie eine Antwort verdient hat. Hat sie. Ausnahmsweise. Die Klatschbase soll Charlie mal ruhig weitererzählen, dass er neue Pläne für die Zuckerfabrik hat.
»Ich teste den Anleger. Sehen Sie, alles im Lack. Hier können demnächst wieder Schiffe festmachen.«
»Schiffe?«
Kaschubek beginnt zum Beweis wieder zu hüpfen. Rechtes Bein, linkes Bein, immer abwechselnd. Die Delius soll sehen, wie elastisch er ist. Im Kopf und mit den Beinen.
»Genau, Frau Delius. Schiffe. Vier oder fünf am Tag.«
Schon schlimm, wenn man einen an der Mütze hat, denkt die Delius. Hat doch die Rente durch – mit gerade mal zweiundsechzig, der ist nur zehn Jahre älter als sie. Der könnte sich’s nett machen in seiner Werkswohnung, die ist frisch renoviert, und eine Abfindung hat er damals, als die Zuckerfabrik dicht gemacht wurde, auch noch gekriegt. Eine zum Neidischwerden. Stattdessen hopst er in der Gegend rum und spielt ehrenamtlich den Hausmeister im »Zuckerhut«.
»Am Wochenende kommen stündlich welche«, bastelt Kaschubek weiter an seinem Schifffahrtplan.
»Hierhin? Dass ich nicht lach«, schnaubt Frau Delius.
»Hierhin. Zum ›Zuckerhut‹«, sagt Kaschubek, legt sich bäuchlings auf den Steg und kontrolliert den Unterboden.
»Im Leben nicht.«
Früher stand im Bürgerzentrum unter dem Gestänge eines hochgewölbten Hallendachs Kaschubeks geliebte Siede- und Kesselstraße. Jetzt ist der ganze Bau nur noch eine zusammengeschusterte Angelegenheit aus der leeren Halle, endlosen Gängen, Pack- und Speicherräumen, Kellern, Kontoren und Büros, die von Grund auf renoviert gehören. Das braucht mehr als paar Eimer Farbe, handwerkliches Geschick und Kaschubeks heilige Werkzeugsammlung. Das braucht einen Kellmanns. So viel ist der Delius sonnenklar. Sie fächelt sich mit einem Spültuch aus ihrer Tasche Luft zu.
Im »Zuckerhut« treiben sich hauptsächlich Nichtstuer rum. So genannte Kleinkünstler, Sozialarbeiter, lauter Alternative und Weltverbesserer. Deren bezahltes Hobby sind Arbeitslose, Alkoholiker, Ausreißer, Sozialfälle und ein paar geschlagene Frauen. Gut, darum muss man sich kümmern, aber Frau Delius hat ihre Zweifel, ob ausgerechnet die Sozialarbeiter vom »Zuckerhut« dafür die Richtigen sind.
Bei deren Chefin handelt es sich nämlich um Sophie Kellmanns, die Exfrau vom Anton Kellmanns. Und die redet den Leuten am liebsten ein, dass sie Opfer und hilflos sind. Vor allem den Frauen. Hat sie bei ihr auch schon mal versucht. Sophie Kellmanns leitet das Frauenberatungsbüro im »Zuckerhut«. Pah.
Die dolle Kellmanns ist ja nur sauer, weil ihr Anton sie sitzen gelassen hat und jetzt mit dem Fabrikumbau Karriere macht. Der will die ganze Gegend sanieren. Ohne sie. Hat die Delius kein Mitleid mit. Früher konnte die Sophie Kellmanns sich schließlich gar nicht einkriegen über ihren tollen Mann. »Anton sagt ...« Nervtötend. Männer bewundern ist eine gefährliche Sache. Die gewöhnen sich an so was und glauben am Ende, dass sie Gottes größtes Geschenk an die Frauen sind. Und dann sind sie weg.
Jetzt lässt Sophies Mann sich jedenfalls von jüngeren Frauen zitieren, die blonder als Sophie Kellmanns sind und glatte Knie haben. Das ist der Schlag, den die Kellmanns nicht verkraftet hat. Und plötzlich isse Emanze. Selbst schuld. Was weiß die über Liebe oder Kerle, die einem das Auge blau hauen. So einen hat die Delius gehabt und ist ohne Sozialarbeiterin damit fertig geworden.
Zurück zu den Schiffen.
»Was sollen denn hier für Schiffe anlegen?«, fragt sie spitz und stellt ihre Tasche auf der verwitterten Kaimauer ab. Wird Zeit, dass der Anton Kellmanns da was dran macht. Der kann sich durchsetzen, hat ein Gesicht wie ein Beil.
»Ausflugsdampfer«, erklärt Kaschubek mit einer großartigen Armbewegung.
»Ausflugsdampfer? So ein Quatsch, was soll’s denn hier zu bewundern geben? Etwa Ihr Pack vom ›Zuckerhut‹?«
»Leben und leben lassen, Frau Delius. Jeder Mensch hat ein Schicksal. Das sind Leute wie Sie und ich. Merken Sie sich das«, sagt Kaschubek hoheitsvoll.
»Aha. Und welches schlimme Schicksal haben diese merkwürdigen Gestalten, die am Wochenende hier rumtanzen, geschminkt wie die Leichen und mit Blut in Plastikbeuteln.«
»Das ist bloß Ketchup, Frau Delius. Ganz harmlos. Das sind junge Leute, die ein bisschen Spaß haben wollen, nennen sich Grufties. Is nur ’ne Verkleidung zum feiern, tanzen, Filme gucken. Sind ganz normale Jugendliche wie Ihr Sohn.«
»So was macht der nicht, das wüsste ich. Der sitzt nur vorm Fernseher und macht Computerspiele.«
Und nennt sich seit kurzem Forkas die Killermaschine. Immer noch besser, als wenn er sich mit jungem Gesocks rumtreibt. Bringt nichts als Ärger. Sein Strafregister hat er nur seiner Gutmütigkeit zu verdanken. Hält gern den Kopf hin, um Held zu sein und dazuzugehören. Wenigstens hat er die hässlichen Hakenkreuzwimpel inzwischen von seiner Kinderzimmerwand abgenommen. Dann schon lieber Computerspiele. Aber das geht Kaschubek alles nix an.
»Mein Markus ist am liebsten für sich.«
»Dafür treibt er sich in letzter Zeit aber häufig hier rum«, sagt der. Frau Delius’ Junge hat nämlich einen Blick auf die Kleine von der Sophie Kellmanns geworfen. Kaschubek hat’s genau mitgekriegt. Ein Blick auf diese – wie heißt sie noch, irgendwas mit Sonnenschein – egal, jedenfalls läuft der Sohn von der Putzfrau seither rum wie angeschossen und lungert vorm »Zuckerhut« rum, in der Hoffnung, dass sein Mäuschen anraschelt. Und seine Mutter weiß von nix, schäle Glucke.
»Der holt mich nur ab«, behauptet sie. Blindes Huhn eben.
»Dreimal die Woche? Wegen der kleinen Kellmanns kommt er. Niedliche Motte.«
Frau Delius schaut verwirrt. Mit Verrückten diskutiert sie nicht über ihren Sohn. Ihr Markus und diese Sunnyi? Im Leben nicht. Zurück zum Thema Bekloppte: »Und was ist mit diesen Halbnackten von vorigem Samstag? Die mit den Ledertangas und den Hundehalsbändern?« Also wirklich.
Jetzt gerät Kaschubek einen Moment aus dem Konzept, schaut Rat suchend in den Fluss. Knurrend erklärt er: »Das waren die SM-Arties. Künstler. Also, Körperkünstler. Stand doch in der Zeitung. Das Ganze war eine Kulturveranstaltung.« Vorsichtshalber fügt er an: »Sagt Rottgarten.«
Der spielt den Guru mit wallender Gottvaterfrisur und sorgt gern für Aufsehen. War früher in der Werbung und ist heute Kellmanns’ ganz spezieller Feind.
Kann man verstehen, findet die Delius. Kellmanns’ Mieter sollen schließlich horrende Preise für die Büroetagen im rechten Trakt zahlen. Da muss der ganze Kuchen stimmen. Wer hat schon Lust, neben bunt bemalten Leichen und halb nackten Körperkünstlern zu arbeiten?
»Wenn das Kultur ist, bin ich Picasso«, sagt sie.
»Picasso ist ein alter Hut, Frau Delius, man muss mit der Zeit gehen. Den Leuten was Neues bieten.« Sagt ausgerechnet Kaschubek!
»Sie müssen es ja wissen. Passen Sie bloß auf, dass Sie nicht wieder die Polizei da haben. Blaulicht ist nicht die beste Reklame.«
»Das war wegen der Drogen. So was läuft nicht mehr.« Und die Technopartys leider auch nicht. Polizeilich untersagt. »Sugar-Rave« hieß das Ganze. Laut, aber lustig. Hat richtig Geld gebracht, und alle waren gut drauf. Zu ärgerlich.
»Drogen, aha. Und was nehmen die Frauen ein, die sich jeden Dienstag hechelnd vor Rottgarten auf dem Fußboden rumwälzen?« Hat sie selbst gesehen, als sie mal bei der Sophie Kellmanns im Büro war.
Rottgarten hat eine Art riesiges Turnzimmer in der zweiten Fabriketage, alles mit weißen Matten ausgelegt. Auf denen wälzen sich Frauen in ungebügelten Flattergewändern. Dazu läuft merkwürdige Musik, und es riecht schwül nach Schweiß und Duftkerzen oder weiß der Himmel was. Da müsste man dringend mal lüften und die Matten durchklopfen.
Kaschubek dreht unwirsch den Kopf weg. »Das sind Atemkurse. Heißt Rebirding oder so, hat mit Geburt zu tun.«
Weiberkram eben, was weiß denn er, was die Frauen an einem wie dem Rottgarten finden. Charlies Mutter war am Ende auch ganz jeck auf den und sein Geschwätz von Jenseits und Wiedergeburt. Die Kurse sind immerhin gut besucht, was man von anderen Veranstaltungen im »Zuckerhut« nicht behaupten kann, die meisten gibt’s nur auf dem Papier.
Frau Delius wirft triumphierend den Kopf in den Nacken: »Geburt? Diese dummen Hühner sind längst über die Wechseljahre. Ihr Herr Rottgarten ist ein aufgeblasener Heiopei. Wie der schon rumläuft mit seiner grauen Zubbelmähne und den albernen Seidentüchern um die Stirn. Ein richtiger Scharletan.«
»Das heißt Scharlatan.« Ein Punkt für Kaschubek, in Fremdwörtern ist der ihr leider über.
»Mir doch egal. Jedenfalls ist er damit im ›Zuckerhut‹ in bester Gesellschaft. Fragt sich nur, wie lange noch.« Sie steht auf und klopft sich ihr Sommerkleid ab. Sie weiß jetzt genug. Alles Bekloppte. Mit denen wird Kellmanns leicht fertig.
Und wenn die Zuckerfabrik erst mal komplett zum Büro- und Geschäftskomplex umgebaut ist, wird die Charlie kräftig daran verdienen. Die Charlie liegt Frau Delius am Herzen, weil die sich immer ihre Geschichten anhört und so verständnisvoll lächelt. Außerdem ist ihre Wohnung zwar riesig, aber es steht beim Putzen nicht viel im Weg. Leichter Job, da kann man sich schön zwischendrin unterhalten.
Die Charlie hat ein gutes Herz. Denkt immer an andere, redet nie von sich selbst, auch nicht über die Mutter, dabei ist die erst sechs Wochen tot. Armes Ding. So ganz allein. Muss man bisschen drauf aufpassen in einer Welt voller Geier und Schnorrer.
»Sie haben keine Ahnung«, sagt Kaschubek, obwohl er Frau Delius, was Rottgartens Atemkurse und seine Haartracht betrifft, am liebsten Recht gegeben hätte. Stattdessen schreitet Kaschubek den Steg majestätisch ab wie ein Kapitän die Brücke. »Jedenfalls hat der Rottgarten jetzt einen fantastischen Plan. Das hat die Welt noch nicht gesehen.«
»Da hat die Welt aber mächtig Glück gehabt.«
Dämliches Waschweib. Der Plan ist gut, der stammt nämlich von Kaschubek und hat wirklich was mit Kultur zu tun und mit der Zukunft der Zuckerfabrik. Die Sache muss nur schnell in trockene Tücher, bevor der Architekt Kellmanns was spitzkriegt und zwischenfunkt. Kaum hat der »Zuckerhut« mal Erfolgsaussichten, passiert was. Das mit der Drogenfahndung geht todsicher auf Kellmanns Kappe. So ein linker Vogel.
»Wäre schön, wenn Charlie morgen zur wöchentlichen Sitzung vom Trägerverein käme. Da wird alles besprochen. Riesensache. Ich bring gleich die Einladung hoch.«
»Wäre schade ums Briefpapier. Die Charlie kommt nicht.«
»Die kommt. Schließlich ist sie jetzt Ehrenvorsitzende vom Zuckerhut e.V.«
»Ehre würd ich das nicht gerade nennen. Wenn Charlie dem Kellmanns endlich grünes Licht für einen ordentlichen Umbau gibt, können Sie sich Ihren ›Zuckerhut‹ sonst wohin streuen.«
Kaschubek bleibt stur. »Das mit Kellmanns macht die Charlie nicht. Wenn die erst mal weiß, was wir im Zuckerhut vorhaben, kommt sie zur Sitzung.«
»Ja, mit einem von Ihren Ausflugsdampfern.«
Frau Delius macht sich taschenschwingend auf den Weg zum Treppenhaus.
Kaschubek zieht die Brauen zusammen. Was sagt man dazu? Nix. Halt. Plötzlich hat er eine Eingebung. Er formt mit den Händen einen Trichter um seinen Mund.
»Cantucci kommt. Sagen Sie Charlie, Cantucci ist wieder in der Stadt und bei der Sitzung. Hören Sie? Das ist ein alter Freund von Charlie.« Mit dem hat sie als kleines Mädchen doch immer gespielt. Drüben auf der Insel. Oder war es die Schwester? Egal, hingen irgendwie alle immer zusammen. Nette Bande.
Kaschubek starrt Frau Delius nach, die lässt die Hüften tanzen. Rotzfreches Maul, aber hübsches Gestell für ihr Alter, denkt er unwillkürlich, kein knochiger Hintern und vornerum auch sehr lecker gebaut. Hat er das etwa gerade laut gesagt? So was passiert ihm manchmal.
Die Delius schaut sich um und zuckt kokett mit den Schultern. Wortlos verschwindet sie hinter einer Eisentür.
Besser, er geht nachher selber hoch.
Wenn Charlie dem Kellmanns und seinen ganz speziellen Freunden, den Bauheinis, den linken Flügel übergibt, macht der daraus, was er will, schließt das Bürgerzentrum und haut sie am Ende nur übers Ohr.
Der hat bis jetzt alle übers Ohr gehauen. Seine so genannten Kumpel, mit denen er die Fabrik zweiundachtzig besetzt hat, die Gründer vom Bürgerzentrum, die alte Frau Dornfelder, seine eigene Frau und jetzt Charlie. Das wäre dem alten Zuckerbaron bestimmt nicht recht, auch wenn er die Zuckerfabrik der Charlie nicht direkt vermacht hat, sondern der Schwester. Wie hieß die noch gleich? Hat ein schlimmes Ende genommen. Egal, war sowieso nicht seine richtige Enkelin. Hätte er Charlie gekannt, hätte er es anders gemacht. Sofort.
Charlie kommt doch nur äußerlich auf ihren Vater, der tatsächlich ‘ne Flitzpiepe und als Sohn eine Affenschande war. Hat dem alten Dornfelder übel mitgespielt. Sehr übel. Rachsüchtiges Kind. Kaschubek weiß das von seinem Vater.
So was gibt’s leider. So einem Sohn vererbt man natürlich nichts. Aber die Charlie, die hat’s verdient, die ist ein prima Kerl. Die wird wieder Leben in die Bude bringen. Ganz so wie es früher mal war. Die ist eine echte Dornfelder. Das sieht man schon an ihrem Lachen, denn das Lachen, das hat sie vom Großvater.
5.
Charlie sitzt vor ihrem Koffer, kontrolliert den Inhalt und studiert die Visastempel in ihren alten Reisepässen. Das beruhigt sie, dabei kann sie ihre Gedanken übers Weggehen sortieren. Alles ganz einfach. Sie muss nur noch in der Redaktion anrufen, fragen, was anliegt.
»Juchhu, Charlie. Ich bin’s.«
Scheiße, die Delius. Hat sie ganz vergessen. Eine Stahltür fällt ins Schloss. Frau Delius Stimme arbeitet sich munter wie ein Kinderlied zum Schlafzimmer vor. »Nee, wat ein Wetterchen. Dreißig Grad, wolkenloser Himmel, für die Jahreszeit zu schwül, harn se gesagt. Und Herzschlaggefahr. Morgen gibt’s Gewitter. Die Fenster kann ich also leider wieder nicht machen.«
Glück gehabt, denkt Charlie, mit den Fensterfronten steht die Putzfrau auf Kriegsfuß. Sie hat es mehr mit dem Teppichsaugen, allerdings nicht unterm Bett. Da hat Charlie zusammen mit dem Koffer eben ein gutes Dutzend Staubmäuse hervorgezogen. Müsste sie eigentlich mal was zu sagen, aber so was macht sie nicht gern. Frau Delius würde nur langatmige Erklärungen abgeben, bei denen Charlie am Ende ein schlechtes Gewissen kriegt.
Die Delius erklärt sich ja jetzt schon:
»Wenn man vorm Gewitter die Scheiben putzt, gibt’s doch nur Brassel und Streifen«, tönt sie unbekümmert, »war schad drum und Sie am Ende noch unzufrieden. Mit mir. Und das wollen wir ja nicht. Hallo? Haaalllo.« Das letzte Hallo lässt sie im Dreiklang über die Tonleiter hopsen. Extra laut, damit Charlie es hören kann. Die hört ja auf einem Ohr nix, Trommelfell kaputt und unten am Ohrläppchen fehlt ein Stück. Darauf muss man Rücksicht nehmen. »HALLO!«
Charlie ist heute nicht in Stimmung für dieses Hallo, das Frau Delius einmal pro Woche anstimmt, als begegneten sie sich beide nach einer langen Trennung. Als gäbe es jede Menge Dinge zu erzählen – von früher.
Bislang hat Charlie dazu ein freundliches Gesicht gemacht. Ein Lächeln ist das beste Versteck. Als studierte Ethnologin hat sie jahrelang trainiert, Leute nicht zu unterbrechen oder nur so viel zu sagen, dass sie weitererzählen. So lernt man fremde Kulturen kennen, ohne sich einzumischen. War auch für ihre Arbeit als Journalistin von Vorteil. Die Leute erzählen gern Geschichten, wenn sie lächelt.
Frau Delius ist ganz versessen auf dieses Lächeln, erzählt darum aber leider ebenfalls viel. Nur keine Neuigkeiten. Im Gegenteil, sie hat sich im letzten Monat mit zunehmender Gründlichkeit in Charlies Vergangenheit vorgearbeitet. Charlie hat ihre Vergangenheit schon gelangweilt, als sie noch ihre Gegenwart war. Sie nimmt sich vor, ihr Lächeln heute genauer zu dosieren.
Frau Delius ist ein so lästiges Erbstück wie die Fabrik. Hat bis zu Mutters Tod für sie gearbeitet. Charlie hat Frau Delius mehr aus diffuser Dankbarkeit denn aus Notwendigkeit eingestellt.
Leider meint Frau Delius, dass man die Eltern mit Anekdoten am Leben erhalten muss. Manchmal reicht der Anblick einer Kaffeetasse oder eine Handbewegung von Charlie, um sie auf das Thema zu bringen. Die Mutter scheint noch überall drinzusitzen, sogar in einem alten Lappen, der für ihre Badewanne reserviert war.
Charlies Familie ist Frau Delius’ Lieblingsthema. Vielleicht weil sie die Toten leichter bändigen kann als ihren ziemlich missratenen Sohn, der ihr Geld für Computerspiele und Haargel verballert.
Ab und an fragt Charlie nach ihm, weil es Frau Delius freut, obwohl es wenig Erfreuliches von dem Sohn zu berichten gibt. Je hässlicher die Wahrheit, umso hübscher sind die Lügen, die Leute darüber erzählen. Kennt Charlie. Die Lügen über die Familien fremder Leute hört sie sich lieber an als die über ihre eigene.
Wenn die Putzfrau vom »Doktor Dornfelder« spricht, bekommt sie einen glasigen Blick, der an vergammelten Schellfisch erinnert.
»Uff, da bin ich. Ich hab ihnen auch wieder was Hübsches mitgebracht. Fürs Bett.« Auch das noch. Frau Delius’ Geschenke sind noch lästiger als ihre Anekdoten. Charlie vergisst immer wieder, sie aus der Abstellkammer vorzukramen, wenn die Putzfrau kommt. Braucht viel Fantasie, sich Erklärungen dafür auszudenken, warum der Flokati in Fußform oder die Stoffgeranie im altrosa Übertopf nicht an ihrem Platz sind.
»Ich mach erst mal Kaffee«, ruft Charlie schuldbewusst und flieht – noch immer barfuß – in die Küche. Sie kramt in einer Schublade hektisch nach Filtertüten, stopft eine in die Kaffeemaschine. Während die sich gurgelnd und sprotzend in Gang setzt, streift Charlies Blick den Küchentisch.