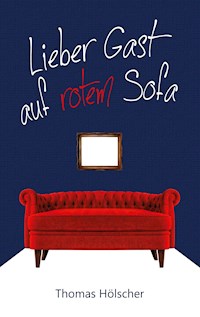
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Damit sie ihm keine bösen Szenen macht, versteckt Georges von Buderow seine kranke Ehefrau Katja in einem verwunschenen Gartenhaus. Dort malt sie ohne Unterlass Expressives, Konstruktives, Dunkles, Helles, Buntes. Oder sie backt sich einen Kerl, wie der zynische Georges gern bemerkt. Eines Tages aber komplimentiert Katja den verdutzten Tom, ihren neuen Pfleger, auf das rote Sofa, um sich von dem ein wülstiges Bild zu machen. Anstatt dass das Teil aber hinter den Rhododendren bleibt, so wie all die andere Kunst, rettet Tom es in die Welt, damit es der gehörig den Kopf verdrehen kann. Die Jagd nach dem Lieben Gast auf rotem Sofa, denn so hat Katja ihr Meisterwerk genannt, wird bald auch eine Jagd nach der Wahrheit - wider der eiskalten Lügner und wider all der Spinner und Verführten, die lieber daran glauben wollen, dass Tom nicht einfach nur Tom ist, sondern Jim Morrison oder ein Freak aus dem Andromedanebel. Ein schräger Ritt durch Berlin ist das, mit so manchem komischen Vogel am Wegesrand, und ein Fanal für die Wahrheit und die Liebe zu den Menschen, auch wenn es nicht immer leicht fällt damit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 654
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Lass uns mit den Schreckgespenstern kämpfen!“
Thomas Hölscher, geboren 1967 in Duisburg, ist gelernter Krankenpfleger und Diplom-Pflegewirt. Er war auf einer Intensivstation und in der ambulanten Pflege tätig. Nach seinem Studium hat er zwölf Jahre lang in einem Verlag mit Manuskripten gekämpft. Seit 2017 ist er Lehrer an einer Pflegeschule.
Thomas Hölscher hat drei Kinder und lebt in Berlin. „Lieber Gast auf rotem Sofa“ ist sein erster Roman.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Katheter Größe 14 (25. April, Montag)
Tom Seidel
Die Verabredung (26. April, Dienstag)
Im Gartenhaus
Tom kommt zu Besuch (12. Mai, Donnerstag)
Tom trifft Katja und wird gemalt (18. Mai, Mittwoch)
Der erste Arbeitstag (23. Mai, Montag)
Katjas Katatonie
Tom lernt Katja kennen
Sophie (4. Juli, Montag)
Die Ohrfeige
Georges und Sophie
Sophie sieht Tom als lieben Gast (5. Juli, Dienstag)
Dr. Haubach wird zum Narren gehalten (15. Juli, Freitag)
Der erste Samstag im Gartenhaus (16. Juli, Samstag)
In der Nacht
Georges bekommt den Globus
Der Tag danach (17. Juli, Sonntag)
Die kleine Ausstellung vor dem roten Sofa (20. Juli, Mittwoch)
Das Sommerfest – Prolog (13. August, Samstag)
Das Sommerfest – das Drama, erster Teil
Das Sommerfest – das Drama, zweiter Teil
Das Sommerfest – Nachschlag
In der Welt
Tom fällt um (14. August, Sonntag)
Das Sommerfest – Epilog
Maria Heimsuchung
Kehraus im Gartenhaus
Tom wird entlassen (16. August, Dienstag)
Wo ist Tom?
Alles weg, oh Schreck
Sophie und Georges
Wieder zu Hause – ein verheulter Dienstag auf der Couch
Katjas Woche danach – raus aus dem Gartenhaus! (18. August, Donnerstag)
Toms Woche danach – die Wunden lecken
Frau Stuttmann klingelt an der Tür (22. August, Montag)
Katja im Krankenhaus
Der Plan (23. August, Dienstag)
Der Liebe Gast im Fernsehen (26. August, Freitag)
Der Anruf (27. August, Samstag)
Noch ein Anruf
Ungebetener Besuch bei Tom
Der Liebe Gast wird berühmt
Im Knast
Die Dinge nehmen ihren Lauf (28. August, Sonntag)
Georges schickt einen Anwalt (29. August, Montag)
Theater um den Lazylover
Eine schicksalshafte Begegnung (30. August, Dienstag)
Editha
Der Schultz ruft an (31. August, Mittwoch)
Samstagnacht (3. September, Samstag)
Laufen lernen
Bei Erik zu Hause (4. September, Sonntag)
Joschi und Hardy
Nachrichten
Katja ist wohlauf
Tomahawk und SEK
Das große Finale – Vorspiel 1
Das große Finale – Vorspiel 2
Das große Finale – Finale
Das kleine Finale (5. September, Montag)
Epilog
Katjas großer Tag (4. März, Samstag)
Später Besuch
Kehraus (5. März, Sonntag)
PROLOG
1 Katheter Größe 14 (25. April, Montag)
Tom breitete das grüne Tuch auf dem Tisch aus. Er öffnete das Katheterset und ließ dessen Inhalt auf das Tuch fallen: Tupfer, Kompressen, Spritzen mit Gleitgel und destilliertem Wasser, Handschuhe, eine Pappschale. Dazu kam ein Katheter Größe 14, geht immer, den er steril aus seiner Verpackung gleiten ließ. Vorher hatte Tom ein grünes Schlitztuch so um den Schwanz gelegt, dass es aussah, als sprösse dieser wie ein böser Giftpilz aus einem englischen Rasen heraus. Er schüttete die braune Desinfektionssoße in die Pappschale. Dann zog er sich die Handschuhe an. Er tunkte die Tupfer in die Soße, bis diese komplett mit dem braunen Zeug vollgesogen waren. Danach umfasste er mit einer Kompresse den Schwanz und schob die Vorhaut vorsichtig zurück. Mit den Tupfern wischte er über die Schwanzspitze, bis auch diese ganz braun war. Er nahm die Kanüle mit der Gleitcreme und spritzte den Schleim direkt in den kleinen Pissschlitz.
„So rutscht es besser und betäubt auch die Schleimhaut“, murmelte er halb zu sich und halb zu dem mit dem Schwanz, der das Geschehen mit nervöser Skepsis verfolgte.
Dann nahm er den Katheter Größe 14 und schob ihn hinterher. Die Pisse kam im Schuss. Schnell stöpselte Tom das andere Ende des Schlauchs an den dafür vorgesehenen 2000-Milliliter-Plastikbeutel und befestigte diesen an der Bettkante.
„Boah, wie geil!“, seufzte der Mann mit dem Schwanz erleichtert. „Ich hab’ schon gedacht, mir kommt’s gelb aus den Ohren.“
Tom spritzte das destillierte Wasser in eine zweite, unscheinbare Seitenöffnung des Katheters und füllte damit einen kleinen Ballon in der Harnblase. Dieser sollte verhindern, dass der Schlauch wieder herausrutschen konnte. Wie immer spürte Tom bei dieser Tätigkeit ein unangenehmes Kribbeln zwischen den Beinen. Zum Schluss entsorgte er den Riesenhaufen in einem großen schwarzen Sack.
Eigentlich war alles glatt gegangen. Georges von Buderow hatte die nicht ganz leichte Darm-OP am Morgen ohne Komplikationen überstanden. Er hatte zwei Stunden im Aufwachraum gelegen und wurde dann zurück auf die chirurgische Privatstation gefahren. Keine Blutungen oder so, der Kreislauf stabil und kaum Schmerzen. Nur pissen konnte er nicht – oder „Spontanurin lassen“, wie der erste postoperative Toilettengang im medizinischen Fachsprech hieß. Da auf der Privaten nur Schwestern im Dienst waren und nur Frauen Frauen und Männer Männern beim Pissen helfen, haben sie irgendwann am Abend Tom geholt, den Pfleger von der Nachbarstation, der nach turbulenter Spätschicht fast schon auf dem Weg nach Hause war.
Und jetzt hatte Herr Seidel, den alle und sogar auch seine Patienten nur Tom nannten, Georges von Buderow den Druck genommen und damit die Angst zu platzen und vom eigenen Urin inwendig überflutet zu werden. Die ruckartige Erleichterung hatte beinahe etwas Sexuelles und Georges von Buderow genoss in vollen Zügen, dass sich jede seiner Zellen langsam entspannte. Doch damit nicht genug der Wallung und so folgte die psychische Reaktion der physischen auf dem Fuße: Ein ungewohntes Gefühl kindlicher Dankbarkeit überkam ihn, dem kalten, knallharten Macher, der sonst nix und niemandem etwas schuldete. Er fingerte aus seinem Nachtschrank einen 50-Euro-Schein und reichte ihn Tom mit einem etwas zittrig geratenen „Danke, das war knapp!“.
„Ist nicht nötig“, erwiderte Tom. „Ist mein Job und außerdem dürfen wir sowas nicht annehmen. Wenn Sie wieder auf den Beinen sind, können Sie den Schwestern was in die Kaffeekasse stecken. Morgen früh kommt dann ein Kollege und zieht das Ding wieder raus.“
Daraufhin verabschiedete er sich kurz und verschwand so elegant-unspektakulär wie er gekommen war.
Nicht wenigen schicksalhaften Begegnungen ist es eigen, dass sie sich auf ein, zwei, drei Zufällen gründen und dann Menschen zusammenführen, die sich unter anderen Umständen niemals begegnet wären. So musste der unverwundbare Georges von Buderow erst Probleme mit dem Darm und danach mit dem Spontanurin bekommen, um Tom den Erlöser zu treffen, der seinerseits fast schon zu Hause und dann auch nur bei ihm war, weil es keinen Mann auf der Privaten gab. Aber am wichtigsten war, dass Toms Performance bei Georges von Buderow, dem privatesten Privatpatienten, der je im Krankenhaus Maria Heimsuchung katheterisiert wurde, dem Medienkönig und Schwerenöter, ziemlichen Eindruck gemacht hatte. Denn so einer wie Tom war ihm, dem Strippenzieher, der sie eigentlich alle kennt, in seiner Welt noch nicht über den Weg gelaufen.
Als das Licht schon aus war, dachte der große Georges von Buderow also noch ein wenig an den zerknitterten jungen Mann in dem zeltartigen, nicht mehr ganz schneeweißen Kittel mit den vielen blauen Kugelschreiberstrichen oberhalb der Taschen. Ein so leiser, unprätentiöser Auftritt mit so großer Wirkung; ganz anders als bei vielen der aufgeblasenen Großkotze, die ihn sonst umgaben und die nach lautstarker Blähung allenfalls einem kleinen Köttel das Leben schenkten. Vielleicht, so dachte er weiter, wäre dieser Tom genau der Richtige für Katja. Die grobschlächtige Editha mit ihren Maurerpranken hatte es jedenfalls verranzt, und mit ihrer zupackenden Art, um das mal elegant zu umschreiben, auf den vermaledeiten Irrsinn glatt noch ein paar Schippen draufgelegt, die dusselige Kuh. Wie dem auch sei, Ersatz musste her, und zwar zügig. Georges von Buderow beschloss also, Tom wiederzusehen. Er würde gleich morgen fragen, wann er wieder im Dienst sei. Dann schlief er ohne Druck im Unterbauch ein.
2 Tom Seidel
Tom hatte Georges von Buderow weit weniger Aufmerksamkeit geschenkt als umgekehrt. Schließlich dämmerte ihm nicht im Geringsten, wie prominent der Schwanz war, dessen Spitze er da braun bepinselt hatte. Weil er sein Bett auf der Privaten unter falschem Namen gebucht hatte, wussten nämlich nur der Chefarzt, ein paar von dessen Kollegen und die Stationsschwester, dass Georges von Buderow Georges von Buderow war. Für Tom war der Erlöserjob also nix zum ehrfürchtigen Niederknien, sondern allenfalls ein kleines Ärgernis, weil es seinen Feierabend hinauszögerte. Und weil er Leute hasste, die sich mit 50-Euro-Scheinen bei ihm anbiederten und ihm damit gleichzeitig seine Rolle in dem Schmierentheater zuwiesen, das das Leben manchmal war. Der Private mit dem Schwanz war der King und er selbst war der Kellner, der ein Trinkgeld bekommt. Oder besser der Urinkellner, wie es in alten Witzen über seine Zunft so hieß. Oder auch der Wärter, wie ihm mal einer, der nicht mehr ganz bei sich war, eine Stunde lang hinterherkrakeelte.
An die berufsbedingten Minderwertigkeitsgefühle, die sich in solchen Situationen irgendwo hinter dem Solarplexus meldeten, hatte sich Tom in all den Jahren nur langsam gewöhnt. Gut, es gab Krankenpfleger, die wurden Krankenpfleger wie Bankkaufmänner eben Bankkaufmänner oder Elektroniker Elektroniker wurden. Es gab aber auch solche wie Tom, die Krankenpfleger wurden, weil sie vorher zweimal ein Studium verkackt hatten und ihr Scheitern nicht mit zu-viel-um-die-Häuser bei zu-wenig-Hörsaal begründeten, sondern als große Sinnkrise verkauften und dem dabei erwachten Drang, der Menschlichkeit fortan einen wahren Dienst erweisen zu wollen. Und weil er sein Herz am rechten Fleck hatte, machte er seine Sache eigentlich ganz gut; zwar waren seine Fixomull-Verbände nie ganz faltenfrei, dafür war er der Unbezahlbare mit dem lustigen Spruch, der auch mal die verzweifelte Ehefrau eines Präfinalen feste in den Arm nahm. Aber was nutzte es? Mit seinen Talenten beeindruckte er keine Sau der Welt so richtig und erst recht nicht all die Krankenschwestern, die er rumkriegen wollte, denn die waren nie auf ihn, sondern am Ende immer nur auf den Stationsarzt scharf. Was blieb war die Erkenntnis, nicht das geschafft zu haben, was möglich war und irgendwie nie das zu bekommen, was er verdiente; weder den Lohn, noch die Liebe, noch das Lob. Und da mittlerweile 32 Jahre seines Lebens vergangen waren, glaubte er auch nicht, dass sich daran noch etwas Wesentliches ändern würde.
So dachte er auf seinem Heimweg nochmal kurz und leicht missmutig über das gerade Gewesene nach. Bevor sich das leichte Unbehagen des zu Unrecht Unterversorgten aber in echten Gram wandelte, hatte er auch schon die acht Minuten Fußweg von Maria Heimsuchung zu seiner Wohnung zurückgelegt. Danach befasste er sich mit anderen Dingen.
Tom wohnte in einer typischen Zwei-Raum-Singlebehausung im Seitenflügel eines ganz nett sanierten Altbaus. Er hatte ein geräumiges Wohnzimmer mit Ausziehcouch, auf der er schlief. Das eigentliche Schlafzimmer nutzte er als Fitnessraum. Im Zentrum eine klobige Hantelbank inklusive Fußhebedings, dazu eine Lang- und zwei Kurzhanteln sowie Gewichtsscheiben in allen Größen. An diesem Abend rührte er den Kram nicht mehr an, da er sein Trainingspensum bereits am Morgen vor seinem Spätdienst absolviert hatte, ungefähr zu der Zeit als Georges von Buderow im Aufwachraum aufwachte. Stattdessen ließ er sich mit einem Bier und zwei fett mit Wurstsalat bestrichenen Broten auf der Couch nieder und las zirka 20 Seiten aus Rilkes Erzählungen. Tom gefielen diese Widersprüche. Auf der einen Seite der gut gebaute Einsneunzig-Mann mit schwarzer Coffee Racer-Lederjacke und 750er Kawasaki, auf der anderen Seite als raffinierter Kontrapunkt der Schöngeist mit der melancholischen Note, der später am Abend gerne auch mal eine Platte mit kubanischer Son-Musik auflegte, vor allem wenn Besuch da war. Mit dieser speziellen Mischung seiner Selbst hatte er durchaus kurzfristigen Erfolg: So verliebte sich mal eine Anwältin für Wirtschaftsrecht mit 1,4-Abitur in ihn, und auch eine Physiotherapeutin aus Ekuador, die auch genauso aussah, wie man sich eben so eine aus Ekuador vorstellte, ließ sich auf eine Affäre mit ihm ein. Leider alles nix für lange, denn die Frauen mochten zwar die Son-Musik und den Sex mit ihm, ein melancholischer Krankenpfleger war ihrem Freundeskreis und noch mehr ihnen selbst aber nur schwer als Mann fürs Leben zu vermitteln.
Als er mit dem Lesen fertig war, drehte er sich einen kleinen Joint und schaltete den Fernseher ein. Er war nämlich nicht nur Muskelmann und Schöngeist, sondern auch ein Hänger, dem einfach der Schneid fehlte. Wenn er breit war, dachte er sich so manche schlaue Formel aus, mit der man die Welt verbessern könnte. Und dann ärgerte er sich, dass diese unverbesserliche Welt nie ihm, dem Zaghaften, sondern immer nur den immer gleichen Schwachmaten ihr Gehör schenkte, die sämtliche Bildschirme und Lautsprecher mit ihren großen Fressen vollmachten. Wie das aber so mit denen ist, die eigentlich ganz nett, aber eben auch Hänger sind, so tat auch er nicht wirklich viel dafür, dass sich an diesem unbefriedigenden Umstand etwas änderte.
Auf Telefonieren und Rausgehen hatte er heute keine Lust mehr. Etwas später als Georges von Buderow schlief dann auch er ein.
3 Die Verabredung (26. April, Dienstag)
Georges von Buderows erste postoperative Nacht im Krankenhaus Maria Heimsuchung verlief erstaunlich ruhig. Einmal gegen zwei Uhr hatte er geklingelt und von der Nachtschwester eine Schmerzpille bekommen. Am Morgen dann hatte Toms Kollege Jochen, einziger Pfleger auf der Privaten und am Tag zuvor nicht im Dienst, wie vorhergesagt den Katheter Größe 14 ohne viel Federlesen wieder entfernt. Gemeinsam mit Jochen hatte Georges von Buderow danach das Badezimmer aufgesucht und mit mäßigem Erfolg versucht, das hellbraune Desinfektionszeug von seinem Bauch abzuwaschen. Zum Frühstück gab es Zwieback und eine dünne Plörre mit Kamillengeschmack. Kurz darauf flog der Chefarzt an der Spitze einer willfährigen Schar heran und überbrachte ihm gute Nachrichten: Sie hatten die entzündeten Dinger im Darm vollständig entfernt, und es war dazu kein riesiger Bauchschnitt nötig gewesen. Somit blieben ihm auch ein künstlicher Darmausgang und andere Abscheulichkeiten erspart. Doch damit nicht genug: In der histologischen Schnelluntersuchung waren keinerlei Hinweise auf eine bösartige Erkrankung zu erkennen. Er würde Maria Heimsuchung also in ein paar Tagen wieder verlassen können, wichtig sei nur, dass es mit dem Stuhlgang keine Probleme gäbe. „Erst das Pissen, dann das Kacken“, lächelte Georges von Buderow in sich hinein und sinnierte kurz darüber, wie ihm Pfleger Tom wohl dabei helfen könne.
Natürlich freute sich Georges von Buderow darüber, dass alles nochmal gutgegangen war. Und es schien sogar so, als sei er viel schneller wieder auf dem Damm als er dachte. Die kleine schlechte Nachricht bei all den guten war, dass er eine längere krankheitsbedingte Auszeit eigentlich dazu nutzen wollte, endlich in Ruhe über seinen ganzen Mist nachzudenken. Klar war, dass ihn weder Katja, seine dauerhaft unpässliche Ehefrau, noch Sophie, seine Tochter, im Krankenhaus besuchen würden. Mit Natascha, seiner Freundin, hatte er sich vor ein paar Tagen so gestritten, dass sie sich wohl erst nach der obligaten Schmollwoche wieder bei ihm melden würde. Wie er richtig vermutete und ihm die Stationsschwester jeweils umgehend steckte, hatte sie sich bereits gestern Nachmittag, dann nochmal am späten Abend und auch schon wieder am frühen Morgen telefonisch nach seinem Befinden erkundigt. Hätte es schlecht um ihn gestanden, hätte sie wahrscheinlich binnen Minuten an seinem Bett Platz genommen und leise klagend seine Hand gehalten. Womöglich saß sie die ganze Zeit über in der Cafeteria. Ansonsten wusste nur Johannes „Jack“ Arnold, Georges von Buderows Stellvertreter und rechte Hand bei der Bud Media Group, von dessen Unpässlichkeit mit entsprechendem Aufenthalt in Maria Heimsuchung.
Nachdem Chefarzt und Gefolge weitergezogen waren, hatte Georges von Buderow noch ein Stündchen geschlafen und dann mit besagtem Jack telefoniert, um die allerwichtigsten tagesaktuellen Fragen zu klären, die es in der Bud Media Group zu klären gab. Zügig und systematisch waren sie alle Unternehmen durchgegangen: Die frei empfangbaren Fernsehsender BRT I und II, Show and Talk, World of Sports, den Internetsender BRT online, den Bezahlsender On Demand, die Produktionsfirma Bud Productions sowie die Rechtevermarktungsfirma Movie Distribute. Da Georges von Buderow alles weitere vorher wegdelegiert hatte, benötigten sie für das Gespräch glatte 30 Minuten, und er hatte für den Rest des Tages Ruhe, es sei denn es würde etwas wirklich Schreckliches passieren. Was sie ausbaldowert hatten, würde Jack direkt im Anschluss an die acht Geschäftsführer weiterleiten, die allesamt Georges und Natascha in der Schweiz oder sonst wo, auf keinen Fall aber auf der Privaten von Maria Heimsuchung wähnten.
Nachdem Georges von Buderow mit Jack fertig war, konnte er sich endlich seinen Gedanken hingeben. Parallel dazu galt es, das eine oder andere Kännchen Plörre hinunterzukippen, um seine erste postoperative Notdurft ohne irgendjemandes Hilfe zu verrichten. Schneller als erwartet gelang ihm das bereits kurz vor dem Mittagessen gegen zwölf. Er benutzte dazu die Pissflasche, die an der Bettkante befestigt war, klingelte ohne wirklich zu müssen eine muffelige Schwester Karin oder Kerstin herbei und präsentierte dieser nicht ohne Stolz sein kleines gelbes Geschäft. Als es um drei Kaffee gab, fragte Georges von Buderow eine weniger muffelige Schwester Andrea oder Antje danach, ob dieser große Pfleger von der Nachbarstation, der mit den braunen Locken, der ihm gestern den Katheter gelegt hatte, ob der heute Nachmittag im Dienst sei und ob sie so freundlich sein könne, diesen zu fragen, ob er kurz zu ihm auf die Private kommen könne. Sie bejahte seine Frage, nicht ohne einen ganz leichten Anflug irritierter Belustigung in ihrem einfältigen Gesicht. Gleichzeitig beschloss sie, ihre blöde Neugier mit den anderen Krankenschwestern in spöttischer Weise zu teilen und eventuell Tom damit zu ärgern. Dann tat sie wie ihr geheißen, und so klopfte Tom etwa zehn Minuten später an Georges von Buderows Zimmertür.
„Hallo Herr Brandt, was kann ich für Sie tun?“, begann Tom, der immer noch nicht wusste, dass Georges von Buderow Georges von Buderow war.
Denn das war das Praktische an seiner Prominenz: Alle kannten Georges von Buderows Namen, aber kaum einer kannte seine eitle Visage, weil er niemals selbst in seinen Kacksendern mit seinen Kackshows und Kacksoaps auftrat. Und natürlich stattete er auch niemals der Konkurrenz einen Besuch ab, um dort die Fragen zu beantworten, die viele ihm so gerne gestellt hätten. Er war das Phantom, das nicht zu sehen und der Fisch, der nicht zu greifen war. Und das hatte seine Gründe, denn beliebt war Georges von Buderow nur bei wenigen. Für die Feuilletonisten und Kulturbewahrer galt er als Pionier all dessen, was alte wie neue Medien verdarb und verdummte. Ob Scripted reality, Trashtalk oder Containershow: Alle Format gewordenen Geistlosigkeiten liefen zuallererst auf den Kanälen der Bud Media Group, bevor sie, natürlich gegen viel Kohle, weitergereicht und damit zur medialen Pandemie wurden. Und für alle anderen war Georges von Buderow der, der den Menschen den Demander gebracht hatte, einen kleinen elektronischen Kasten, den keiner bestellt hatte, den man vom einen auf den anderen Tag aber kaufen und für dessen Inbetriebnahme man ein kostspieliges Abonnement abschließen musste, um auch in Zukunft bei all den wichtigen Fußballspielen und den wirklich coolen Serien dabei sein zu können. Er hatte die Rechte an den besten amerikanischen Filmen gekauft und sie damit denen für immer genommen, die sich keinen Demander mit Abo leisten konnten. Er hatte Angebote geschaffen, nach denen keiner gefragt hatte und damit jedes Preisgefüge gesprengt. Und all das Mehr an Kohle, das nunmehr qua seines diabolischen Tuns in das System floss, wanderte, so ging die Mär, nach ein paar Links- und Rechtskurven am Ende ausschließlich in seine Taschen und bescherte ihm alsbald gleichermaßen unverdienten wie sagenhaften Reichtum.
„Ich heiße nicht Brandt, sondern Georges von Buderow“, entgegnete Georges von Buderow.
„Der Fernsehmann?“
„Ja, der Fernsehmann.“
Tom wusste nicht, wie ihm geschah. In seinen bekifften Fantasien hatte er sich immer gewünscht, einmal einem dieser Arschlöcher leibhaftig gegenüberzustehen, ihm anständig die Meinung zu kartätschen oder besser noch direkt die Fresse zu polieren und ihm auf diese Weise endlich die Verachtung zuteilwerden zu lassen, die ein ebensolcher Wichser so dringend benötigte. Stattdessen aber empfand er nur ein beknacktes Gefühl leiser Dankbarkeit dem Schicksal gegenüber, das ihm einen so berühmten Mann zuführte und ihm, mehr noch, das Privileg verschaffte, diesem einen Katheter Größe 14 gelegt und damit für große Erleichterung gesorgt haben zu dürfen. Außerdem musste er sich eingestehen, dass ihn die Ausstrahlung dieses beinahe clooneyesk dreinschauenden Arschlochs beeindruckte. Smart sah Georges von Buderow aus, wie er da vor ihm lag, ganz so einer von den charmanten, schläfengrauen Checkern, die trotz Termindrucks und fast sechzig Lenzen auf dem Buckel einen Berlinmarathon in Dreifünfundvierzig hinlegten und nur durch ihr Sein das natürliche Recht besaßen, von der Privaten aus selbst die Pfleger der Nachbarstationen mal eben zur Audienz zu bitten. Seine einnehmende Wirkung auf andere konnte auf jeden Fall nicht der Grund dafür sein, dass er sich irgendwie nie in der Öffentlichkeit zeigte.
So fühlte Tom einen Moment lang hin und her und kam zum Schluss, sich seiner seltsamen und ungewollten Anwandlungen wegen in sich hineinschämen zu müssen. Das alles zusammen führte zu einer Pause der gerade begonnenen Konversation, die gefühlt dadurch noch verlängert wurde, dass sein Mund offenstand.
Georges von Buderow lächelte Toms Sprachlosigkeit elegant weg, denn er war die dussligen Gesichtsausdrücke derer gewohnt, denen er seine Identität aus der Hüfte offenbarte.
„Tom, darf ich Sie so nennen?“, begann er und fuhr fort, ohne auf eine Antwort zu warten, denn er war einer, der ohne Schmuck zum Punkt kam und keiner, der durch das Gestammel eines derangierten Gegenübers Zeit verlor:
„Ich bin auf der Suche nach jemandem wie Sie. Mir scheint, dass Sie mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Sie sind ein Menschenfreund und helfen ohne großes Theater. Sie machen kein Gewese, sondern packen an, wenn es drauf ankommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Sie mit schwierigen Leuten gut umgehen können, bei all dem, was Sie hier jeden Tag sehen. Und Sie sind unbestechlich. Stimmt mein Eindruck?“
„Hä?“, entfuhr es Tom nach einer weiteren kleinen Pause wie ein Furz mit Fragezeichen, weil ihm in diesem Hause und auch sonst wo noch nie jemand so seltsam gekommen war.
„Na? Stimmt mein Eindruck?“
„Ähh, keine Ahnung. Vielleicht …“
Nu war er plötzlich auch noch verlegen, der jäh umschmeichelte Tom, und schämte sich wieder inwendig dafür.
„Was vielleicht?“, insistierte Georges von Buderow.
Tom tat als überlegte er. So ging das nicht, auf keinen Fall, das war sein Schluss, und er ruckelte sich im Geiste, um Schiss und Scham zu verscheuchen. Gerade noch rechtzeitig konnte er den inneren Klassenkämpfer einfangen, bevor der über alle Berge war:
„Vielleicht blasen Sie mich so auf, weil Sie sonst nur Arschlöcher kennen. Mir fällt auf jeden Fall nix ein, warum Sie einen wie mich suchen sollten.“
„Genau deshalb! Weil ich sonst nur Arschlöcher kenne, aber dringend jemanden brauche, der kein Arschloch ist. Sie haben es erfasst.“
Der Zickenmist perlte an Georges von Buderow ab wie nix. Stattdessen lächelte er Tom so nett an, wie er konnte. Der wiederum brauchte schon wieder etwas Zeit mit der Retoure, denn er merkte, dass er sich weit hinauslehnen konnte mit seinen Frechheiten. Hastig rang er im Innern um eine möglichst nassforsche Draufgabe:
„Und womit kann ich Ihnen Ihrer Meinung nach dienen? Ich meine, so allein unter Arschlöchern. Soll ich Sprengstoff vorbeibringen, um Ihren Laden in die Luft zu jagen? Kein Ding.“
Tom grinste, beseelt von so viel ungewohntem Übermut.
„Nein ich weiß“, setzte er nach, „ich soll mit Ihrer Lieblingstochter durchbrennen, weil ich so ein geiler Typ bin! Keiner von den Arschlöchern, sondern ein Menschenfreund, mit beiden Beinen auf dem Boden.“
Tom, so war es also Georges von Buderow in der Nacht in den Sinn gekommen, sollte Editha nachfolgen und Katja betreuen, seine im Pleistozän einmal heißgeliebte, nunmehr anstrengend gewordene Ehefrau. Die seit 14 Jahren in ihrer Kemenate saß und diese nur verließ, um wie aus dem Nichts – bäng – auf der Bildfläche zu erscheinen und ihn mit krassen Szenen heimzusuchen, und das am liebsten dann, wenn die dicken Fische im Haus waren. Und die laut Dr. Haubach ebenso lang an einer schizoaffektiven Störung litt, was allein schon schlimm genug war, sich durch temporäre psychosomatische Dysregulationen aber noch verkomplizierte. Kurzum: Die Wahnvorstellungen hatte, die mal depressiv war und mal völlig überdreht und manchmal sogar von der Hüfte abwärts gelähmt. Und Georges von Buderow glaubte nun, dass Tom womöglich derjenige war, der Katjas abgedrehtes Temperament zügeln und ganz, ganz vielleicht seinen kleinen Teil dazu beitragen konnte, dass sie mit der Birne wieder in die Spur kam und vor allen Dingen endlich diesen Scheiß ließ.
Eine anspruchsvolle Aufgabe also, die es da zu übernehmen galt, und keine Selbstverständlichkeit, dass Tom, der renitent gewordene Erlöser, dies nach Ende der Unterredung zu tun tatsächlich gewillt war. Georges von Buderow beschloss daher, die ganze Nervensägerei nochmal anständig schönzureden, bevor er diesem Kamel, denn das war dieser Tom offensichtlich, dafür aber ein korrektes, bevor er diesem korrekten Kamel also, bevor er dem mit seinem schrägen Angebot kam, und zwar nicht auf die herablassende Art, die insbesondere Kamelen gegenüber seinem Naturell entsprach, sondern auf die fluffigseriöse:
„Noch ein Pluspunkt für Sie: Ich finde es gut, dass Sie mir Ihre Meinung direkt ins Gesicht sagen. Das tun die Arschlöcher, von denen Sie sprechen, nämlich nie. Im Ernst: Meine Ehefrau könnte Ihre Hilfe sehr gut gebrauchen. Sie ist psychisch krank und hat zu kaum jemandem Kontakt. Außerdem kann sie an manchen Tagen ihre Beine nicht richtig bewegen. Ich könnte mir vorstellen, dass kompetente Fürsorge und Pflege ihr guttun würden. Sie müssten einfach nur für sie da sein, sich mit ihr unterhalten und solche Sachen. Die Bezahlung würde natürlich auch stimmen!“
Irgendwie passte das Ganze zu Tom. Er war der gute Junge, dem niemals der böse Blick gelang. Statt großer Rede nur Ziegenmecker. Nix Revolution. Statt Wut provozierte er Wohlwollen. Und so war es auch bei diesem Fernsehmann: Weder sprang das Kapitalistenschwein ihm an den Hals, noch warf er mit der Pissflasche nach ihm. Er verlangte weder Satisfaktion noch den Chefarzt und er fiel nicht tot um beziehungsweise kippte nicht tot zur Seite weg, weil er ja im Bett lag. Nein, stattdessen machte Georges von Buderow Tom ein Jobangebot. Als Kümmerbursche für seine durchgeknallte Alte! Was fiel dem ein, dem arroganten Sack? Andererseits war die Sache natürlich ziemlich abgefahren. Und so musste Tom sich schon in diesem Moment eingestehen, dass ihn das Ganze zwar wütend, aber vor allem richtiggehend spitz machte und er lieber, natürlich nur um mal zu kucken, diesem interessanten Impuls nachgeben und seine Ideale zumindest für eine kurze Zeit mal fahren lassen wollte. Um aber sein revolutionäres Gesicht nicht zu verlieren, musste er das Theater mit ihm in der Rolle der nervigen Moralsirene noch ein wenig weiterspielen.
„Ach, Sie machen mir ein Jobangebot? Als Kammerzofe, oder was?“, fragte Tom spöttisch. „Bei dem ich den ganzen Tag Ihrer spleenigen Ehefrau das Händchen halte oder den Tee serviere, wenn sie mit dem Glöckchen bimmelt? Ich denke, da bin ich hier besser aufgehoben. Und überhaupt: Glauben Sie im Ernst, dass ich hier von heute auf morgen alles in den Sack haue, nur weil Sie mal kurz ein paar Scheine raushauen?“
„Ich zwinge Sie natürlich nicht dazu, mein Geld zu nehmen“, antwortete Georges von Buderow betont entspannt.
„Vielleicht reicht es auch, wenn Sie mich einfach nur mal besuchen, sobald ich hier raus bis. Wir können ja dann immer noch sehen.“
Dann fingerte Georges von Buderow wie am Abend zuvor in seinem Nachttisch herum, kramte aber diesmal keinen 50-Euro-Schein, sondern seine Visitenkarte hervor.
„Sie können es sich ja überlegen und mich anrufen!“
Diesmal nahm Tom das ihm Angebotene mit betonter Beiläufigkeit an. Er verabschiedete sich kurz, verließ das Zimmer und schob das Kärtchen zwischen Sparkassenkarte und Führerschein in sein Portemonnaie.
I Im Gartenhaus
1 Tom kommt zu Besuch (12. Mai, Donnerstag)
Natürlich hatte Tom Georges von Buderow angerufen. Zwei Wochen lang hatte er sich geziert und mit seiner inneren Diva gerungen, obwohl das Ergebnis eigentlich von Anfang an feststand. Er war rattenscharf darauf, sich zumindest einmal durch Georges von Buderows feiste Villa führen zu lassen, denn feist war sie zweifelsohne, wie er aus seiner Adressenrecherche schloss. Er würde einen Drink mit irgendeinem teuren Scotch Whisky und on the rocks nehmen. Dabei würde er sich das unverschämte Angebot anhören und es durch sein cooles Verhandlungsgezock noch unverschämter machen. Und sollte ihm das alles nicht gefallen, würde er wenigstens Saftiges aus dem Naseninnern in die Polster der Sofalandschaft schmieren oder irgendwelchen teuren Nippes als Beweis seiner Anwesenheit mitgehen lassen. Er hätte auf jeden Fall einiges zu erzählen.
So hatte er sich zwei Tage nach seinem Anruf und bei herrlichstem Sonnenschein also aufgemacht und war im Lederanzug mit seiner Kawasaki von Pankow aus bis nach Wannsee gecruist. Er hatte vor einem hohen schwarzen Eisentor gestanden und auf einen weißen Quader mit einer Glasfront so groß wie ein Volleyballfeld geblickt. Diese war natürlich aus so einem Zeug gefertigt, das einem erlaubte rauszuschauen, aber nicht rein. Ringsum war akkurater Rasen, an den Rändern zu den Nachbargrundstücken von Zierbäumen flankiert, deren Namen Tom, der Botanik-Banause, nicht kannte. Das ganze Grün wurde links und rechts des Weges, der schnurstracks auf die schwarze Eingangstür zuführte, von jeweils einer exakt kreisrunden Blumeninsel bunt aufgepimpt. Dabei hatten alle Blumen irgendwie die gleiche Höhe und beide Inseln waren, je nach Auge des Betrachters, das Spiegelbild ihres Gegenübers jenseits des Weges. Hier war der Gärtner auch Pedant mit Zwangsneurose. Tom resümierte, dass der Ausdruck „Neue Sachlichkeit“, obwohl anders gemeint und schon hundert Jahre alt, die Hütte und das Drumherum irgendwie am treffendsten beschrieb.
Nach einem Moment stillen Staunens hatte Tom dann die Klingel gedrückt, eine nette Frauenstimme hatte ihn durch die Gegensprechanlage nach seinem Namen gefragt und ihn hereingelassen. Er war langsam den Weg entlanggeschritten, der nur etwa 30 Meter lang war und nicht 150, wie er sich das in seinen kühnen Fantasien eigentlich ausgemalt hatte. Die Frau mit der netten Stimme hatte ihm die schwarze Tür geöffnet und über eine große Freitreppe genau in den Riesenraum geführt, der auf der anderen Seite der Glasfront lag und durch die Tom nun ganz genau den Platz vor dem Eisentor erkennen konnte, von dem aus er nur einen Augenblick zuvor noch mit großen Augen hinübergeglotzt, aber eben nix hatte erkennen können. Und obwohl er nix hatte erkennen können, war der Riesenraum trotzdem ungefähr so eingerichtet, wie er sich ihn vorgestellt hatte. Da war viel abstrakte Kunst auf großen Leinwänden und gegenüber der Glasfront war ein Tresen, der sich im Dunkeln wahrscheinlich diskret und kühl anstrahlen ließ. Die Wände waren weiß und der Boden mit braunem Parkett ausgelegt. Das Beste war ein Halbkreis aus Glas an der Decke, der sozusagen die vertikale Fortsetzung der Glasfront bildete und durch den man geradewegs in den Himmel schauen konnte. Logischerweise hatte Georges von Buderow oder sein Innenarchitekt oder wer auch immer unterhalb des Halbkreises eine Sofalandschaft mit weißen Polstern und senkrechten braunen Lehnen platziert. Beinahe wie ein extravagantes Accessoire wirkte dabei der ältere Herr, der mitten auf dem Sofa saß und sich nicht rührte als Tom den Raum betrat.
Georges von Buderow hatte im Riesenraum auf Tom gewartet. Und wahrscheinlich hatte er die ganze Zeit über und mit feinem Spott in der Fresse durch die Glasfront hindurch beobachtet, wie Tom da so blöd vor dem Eisentor rumstand. Wie erwartet trug er dieses Mal kein schlabberiges Schlafzeug, sondern einen von den todschicken Anzügen, blaugrau, aus einer Schurwolle-Seidenmischung und Slim Fit, weil er sich das leisten konnte. Ein simples schwarzes T-Shirt sowie leichtes, aber sauteures, atmungsaktives Schuhwerk ohne Socken verpassten dem Gesamtbild die Dosis Lässigkeit, die es für das Höchstmaß an gut gereiftem Sex-Appeal brauchte. Dazu kam ein offener, aufgeräumter Blick, der wie Tom meinte, zwar durchaus sympathisch war, aber nicht so richtig zu dem ernsten Thema passte, das es zu besprechen galt und noch weniger zu einem, der sich den Blicken der Öffentlichkeit entzog, weil er diese mit Überflüssigkeiten wie dem Demander chronisch über den Leisten zog.
Sie gaben sich zunächst die Hand und tauschten Belanglosigkeiten aus. Oder vielmehr war es Tom, der Belanglosigkeiten von sich gab, ohne sich dafür im Tausch Georges von Buderows Belanglosigkeiten anhören zu müssen. Denn der antwortete nicht, weil er nicht gefragt wurde, sondern fragte nur selber die belanglosen Fragen: Zum Beispiel die unvermeidliche nach dem Weg und ob Tom diesen gut gefunden, die Frage danach, mit welchem schnittigen Fahrzeug er diesen zurückgelegt habe, weil er Helm und Leder trug und die, wie es denn gerade so bei Maria Heimsuchung laufe. Tom antwortete freundlich und ausreichend ausführlich, denn er hatte schon im Vorfeld beschlossen, alles Aufrührerische beiseite zu lassen, fürs Erste zumindest. Danach erzählte Georges von Buderow doch noch etwas, und zwar, dass es ihm nach seiner Entlassung, die nun auch schon wieder zehn Tage zurückliege, täglich besser gehe und er erwarte, alsbald wieder der Alte zu sein.
So ging es dann kurz hin und her und her und hin, bis sie sich schließlich dem eigentlichen Anlass ihrer Verabredung widmeten. Dazu wendete sich Georges von Buderow dem älteren Herrn zu, der sich nach wie vor und ohne Regung im Zentrum der Sofalandschaft befand und auf sein Stichwort wartete. Sein Name war Dr. Haubach und er wurde Tom als eine Art Leibarzt vorgestellt, der sich um das gesundheitliche Wohlergehen der von Buderows im Allgemeinen und Katja von Buderows im Besonderen zu kümmern hatte. Schnell konnte Tom den hageren Mann mit den etwas zu langen, fast schon weißen Haaren und der langen Nase mit Huckel in der Mitte in die Schublade mit den Ärzten einsortieren, die eher von den alten Lorbeeren zehrten, so sie sich denn je welche erworben hatten, und die entsprechend seit Dekaden auf irgendwelche Weiterbildungen verzichteten. Die frühzeitig keinen Bock mehr darauf hatten, sich zu engagieren und deshalb Betriebsarzt wurden oder eben bei einem reichen Typen anheuerten. Und ebenso gut passte Dr. Haubach in die Schublade mit den aaligen Arschlöchern, die Unterwürfigkeit und Hochmut aufs Schamloseste miteinander verbanden und von denen auch in Maria Heimsuchung einige Prachtexemplare herumliefen. So wechselte er denn auch ohne mit der Wimper zu zucken und von einem auf den anderen Moment vom Modus der Speichelleckerei in den der nasalen Herablassung, je nachdem, ob Georges von Buderow ihm gerade das Wort erteilte oder er seinerseits dieses an Tom richtete.
Zur kleinen Vorstellungsrunde hatte sich Dr. Haubach kurz und etwas schwerfällig erhoben. Als klar war, wer wer war, ließen sich alle drei in der Sofalandschaft nieder. Die Frau mit der netten Stimme präsentierte ein für Toms Geschmack zu schmales Angebot an Getränken. Anstatt des Scotch Whiskys, der genauso wie alles andere Alkoholische nicht zur Wahl stand, nahm er den frisch gepressten Orangensaft mit Eis, weil er diesen unter den gegebenen Umständen für das Edelste, hielt, das er kriegen konnte.
Dr. Haubach referierte zunächst über das Krankheitsbild. Er tat dies mit dem üblichen Fachsprech ohne weitere Erläuterungen und wollte Tom damit wohl signalisieren, wer bei einer möglichen Zusammenarbeit der Koch zu sein hatte und wer gefälligst der Kellner. Es fielen Begriffe wie synthyme und parathyme Psychose, Ich-Störung und Katatonie. Als medikamentöse Therapie würden Phasenprophylaktika und Neuroleptika als Pillen mit so und so viel Gramm Wirkstoff und so und so oft am Tag verabreicht. Und so weiter und blabla. Bei Tom kam ungefähr die Hälfte des Gesagten an.
Mit einem einfachen „Danke, Stefan!“ unterbrach Georges von Buderow irgendwann Dr. Haubach, der gerne weiterschwadroniert hätte.
In deutlich freundlicherem Ton als sein Vorredner wandte sich Georges dann Tom zu:
„Mein lieber Tom! Wie Sie sehen, ist meine Frau schwer erkrankt. Sie leidet sehr und macht mit ihrem unkontrollierten Verhalten und ihren Ausbrüchen natürlich auch uns das Leben schwer. Sie können mir glauben, dass das für alle sehr belastend ist: für mich, für unsere Tochter, am meistens aber für Katja selbst.“
„Was meinen Sie mit Ausbrüchen und so?“, fragte Tom. „Ich meine, schmeißt sie Porzellan durch die Gegend oder redet sie wirres Zeug?“
„Die ganze Rutsche, von A bis Z. Die meiste Zeit über möchte Katja niemanden sehen und lebt ganz zurückgezogen in ihrer Fantasiewelt. Bis sie es sich plötzlich anders überlegt und ohne Vorwarnung zum Beispiel hier auftaucht. Oder ohne Pause schreit, dass das Arschloch endlich kommen soll, bis mich jemand holt. Und dann kann alles passieren: Sie wirft mir die vulgärsten Beleidigungen an den Kopf, wird handgreiflich oder brüllt, bis die Wände wackeln. Und es ist ihr scheißegal, wer gerade dabei zukuckt: meine Mitarbeiter, irgendwelche Besucher, der Kaiser von China. Scheißegal!“
Georges von Buderow, der nicht mehr so lässig war wie am Anfang, machte an dieser Stelle eine kleine Pause und platzierte einen tiefen Sorgenseufzer. Dann fuhr er fort:
„Das ist kaum auszuhalten, wissen Sie? Und reizt mich manchmal bis zum Äußersten. Na ja, und dann kann es wieder sein, dass sie stundenlang herumwimmert oder einfach nur daliegt und auf nichts reagiert. Und plötzlich wieder ganz normal redet. Katja bedient wirklich alle Klischees des Irrsinns.“
„Und die Lähmungen“, mischte sich Doktor Schlau ein, „die dissoziativen Lähmungen, ich bin nicht sicher, ob Sie schon einmal davon gehört haben, die sind ein Problem! Frau von Buderow kann manchmal die unteren Extremitäten nicht oder nicht richtig bewegen. Da wir mit dem EMG keine Schädigung des Nervensystems bzw. des Bewegungsapparates nachweisen können und auch die Muskeleigenreflexe in Ordnung sind, ist davon auszugehen, dass auch diese Symptome in Zusammenhang mit einer psychischen Grunderkrankung stehen. Uns ist dabei nicht ganz klar, ob es sich bei Frau von Buderow um einen Wahn im eigentlichen Sinne handelt oder um eine Dissoziationsstörung – also einen ungelösten psychischen Konflikt, der auf eine körperliche Ebene verschoben wird.“
„Oder ob sie uns einfach nur zum Narren hält.“ Georges von Buderow grinste zynisch-gequält. „Sie wählt auf jeden Fall immer die besten Termine aus, um mit großer Szene vor ihrer beknackten Staffelei aus den Latschen zu kippen. Zum Beispiel am Heiligabend um siebzehn Uhr. Hilfe, Hilfe, und dann geht das Theater los. Arzt, Rollstuhl, eine fette Spritze zur Beruhigung, das ganze Programm. Und nach ein paar Tagen sitzt sie am Tisch als wär’ nix und löffelt Früchtemüsli.“
So ätzte Georges von Buderow noch eine Weile weiter. Er gab die Anekdoten mit den spektakulärsten Ausrastern zum Besten, die Katja von Buderow die Würde und ihm den Druck nahmen. Es war ihm deutlich anzumerken, dass er sich umso besser fühlte, je länger er sie durch den Kakao zog. Tom wiederum fühlte ein wachsendes Unbehagen bei dem Gedanken daran, dass man ausgerechnet ihm die Aufgabe anzutragen gedachte, die furische Katja zu bewachen, zu besänftigen und wenn nötig im Ringkampf zu bezwingen. Dies umso mehr, als Georges von Buderow auf die Frage, ob sich früher schon einmal jemand anderer an der Sache versucht und vielleicht die Flinte ins Korn geworfen habe, nur kurz antwortete, dass eine Hausangestellte, Editha mit Namen, eine längere Zeit lang damit betraut gewesen sei, dass es mit ihr aber irgendwann Ärger gegeben und man sich deshalb von ihr habe trennen müssen. Die Gründe hierfür täten jetzt nichts zur Sache.
„Editha war aber nicht vom Fach wie Sie.“ Toms Skepsis war Georges von Buderow nicht verborgen geblieben. „Ich denke, dass Sie das mit der Pflege sowieso gut hinbekommen. Sie kennen sich bestimmt mit Rollstühlen und diesen Dingen gut aus und wissen auch, wie man jemanden anfassen muss, der sich nicht bewegen kann. Sie sind außerdem kräftig und nicht auf den Mund gefallen. Katja braucht nämlich manchmal eine starke Hand, wenn sie mal wieder ihre Phasen hat. Ich denke, Sie wissen, was ich meine.“
„Wie oft hat sie denn ihre Phasen? Wenn ich ehrlich bin, dann hört sich das Ganze ziemlich stressig an.“
„Keine Angst, die allermeiste Zeit passiert überhaupt nichts. Sie können dabei zukucken, wie sie ihre Bilder malt oder ihre nackten Kerle töpfert. Ansonsten hängt vieles auch von Ihnen ab. Wichtig ist, dass Sie genau darauf achten, ob sich irgendetwas verändert. Ob Katja also irgendwelche auffälligen Sachen macht, ob sie unruhig wird, irgendwas. Und dass Sie das dann umgehend mir oder Herrn Dr. Haubach melden. Der wird Ihnen dann Bescheid geben, was medizinisch notwendig ist. Ob Katja also eine Spritze braucht oder so etwas.“
„Und keine Extratouren!“, mischte sich Dr. Haubach ein. „Der Therapieplan ist meine Sache und wird von Ihnen anstandslos befolgt. Aber das kennen Sie ja sicher aus Ihrer Klinik.“
„Weiß Ihre Frau überhaupt, dass ich komme?“ Tom ignorierte die Einlassung des Doktors und wechselte das Thema. „Vielleicht lehnt sie eine Betreuung ja völlig ab.“
„Das ist schon in Ordnung. Sie weiß, dass Sie kommen und ich glaube auch, dass das mit Ihnen beiden funktioniert. Außerdem sind Sie gut gebaut.“
Georges von Buderow grinste wieder sein zynisches Grinsen von vorhin.
„Reden Sie mit ihr über Kunst. Oder den bösen Kapitalismus. Das können Sie ja, glaube ich. Am Ende ist Katja wahrscheinlich ganz froh, wenn ihr jemand mal Gesellschaft leistet. Hauptsache ist, dass ich es nicht bin.“
„Na ja, über den Kapitalismus schimpfen hört sich schon ein bisschen besser an“, scherzte Tom.
„Eins dürfen Sie bei der ganzen Sache aber niemals vergessen!“
Georges von Buderow wechselte vom zynischen in das ganz ernste Fach:
„Sie schließen Ihren Arbeitsvertrag allein mit mir ab. Und Sie bekommen mein Geld – ich spreche von, sagen wir, 4.500 Euro zu versteuerndes Brutto mit Sozialabgaben und so. Zuzüglich Geld für Überstunden oder Bereitschaftsdienst. Wie auch immer wir das nennen wollen. Das gibt es gerne auch cash ohne Abgaben. Was ich damit sagen will: Als Gegenleistung verlange ich von Ihnen absolute Diskretion und Loyalität, was immer auch passiert. Es ist möglich, dass Katja versuchen wird, Sie zu beeinflussen und auf irgendeine Weise gegen mich in Stellung zu bringen. Tun Sie dann ruhig so, als würden Sie das Spiel mitspielen. Aber nur so tun! Und mich darüber informieren! Kurzum: Vergessen Sie niemals, von wem Sie Ihr Geld bekommen und wem Sie verpflichtet sind. Nehmen Sie von niemandem sonst etwas an! Machen Sie es genauso wie damals im Krankenhaus, als Sie meinen 50-Euro-Schein abgelehnt haben.“
Georges von Buderow hatte ein bisschen was von einem Mafia-Paten, wenn er so daher sprach. Für Tom war das unangenehm, aber 4.500 Euro waren eben auch nicht schlecht. Vielleicht würde er kurz vor Vertragsabschluss noch 5.000 verlangen. denn das mit dem Geld schien für die Herrschaften hier keine große Rolle zu spielen.
Der Herr des Hauses schlug dann noch vor, das mit den Arbeitszeiten flexibel zu handhaben. Katja stehe in der Regel nicht vor elf Uhr auf, so dass Tom seinen Dienst wohl eher später am Tag antreten werde. Wenn nichts anliege und der Gemütszustand seiner Frau es zulasse, könne er sicher auch mal eher gehen, er müsse aber genauso darauf gefasst sein, spontan ein paar Stunden länger zu bleiben, sollte sie sich in irgendeiner Krise befinden. Ganz unbedingt notwendig sei seine Anwesenheit außerdem, wenn Geschäftspartner oder Freunde im Hause seien oder, wie ein- bis zweimal im Jahr der Fall, eine große Party stattfinde. Das könne auch mal ein Wochenende betreffen und sich so lange hinziehen, dass es im Falle eines solch außergewöhnlichen Ereignisses besser sei, wenn Tom in einem extra für ihn hergerichteten Gästebereich mit eigenem Bad, TV und solchen Sachen übernachte. Über die Termine hierfür werde er, Georges von Buderow, ihn aber frühzeitig in Kenntnis setzen.
So kamen sie ganz langsam zum Schluss. Tom bekundete, dass er an der Tätigkeit stark interessiert sei, bevor er seine endgültige Zusage gebe, aber Katja von Buderow gerne noch einmal persönlich kennenlernen würde. Entsprechend vereinbarten sie für die folgende Woche einen Termin. Sollte dieses Treffen positiv verlaufen, so könnten sie sich alsbald auf einen Vertragsabschluss verständigen. Georges von Buderow, der Schlawiner, riet Tom dann noch dazu, sein Arbeitsverhältnis mit Maria Heimsuchung so schnell wie möglich zu kündigen und dann krank zu machen. Auf diese Weise könne er direkt mit seiner neuen Arbeit beginnen und bekäme seinen Lohn erst einmal bar auf die Kralle, und zwar so lange, bis einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bei den von Buderows aus arbeitsrechtlicher Perspektive nichts mehr im Wege stehe.
Als alles Wichtige gesagt war, ging es auf einmal ganz schnell. Den Schlussgong bildete ein zackiges „Ich glaube, dann hätten wir es“. Noch während er diese Worte sprach, erhob sich Georges von Buderow aus der Sofalandschaft. Tom tat es ihm nach und leerte quasi in der Aufwärtsbewegung sein nunmehr drittes Glas frisch Gepressten mit Eis bis auf den letzten Tropfen. Der Doktor, der sichtbar mit seiner Hüftsteifigkeit zu kämpfen und mit den Polstern bereits eine Art Einheit gebildet hatte, folgte mit ein wenig Verzögerung.
„Danke dass Sie sich Zeit genommen haben ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit Frau Stuttmann bringt Sie zur Tür kommen Sie gut nach Hause bis Mittwoch.“ Ein fester Händedruck jeder mit jedem und ab dafür!
Dr. Haubach sank wieder in die Sofalandschaft, wahrscheinlich um dort irgendwann zu sterben, während Frau Stuttmann mit der netten Stimme Tom auf demselben Weg wieder zur Eingangstür geleitete, auf dem er gekommen war. Obwohl es in ihm auch irgendwie zweifelte, so fühlte er sich doch vor allem beseelt, und er freute sich auf seinen neuen Job wie einer, der demnächst zu einer langen Expedition in eine fremde Welt aufbrach, meinetwegen in den Kongo oder an den Amazonas. Als er die lange breite Treppe hinunterschwebte, stellte er sich noch einmal kurz die Frage, wo denn wohl Katja von Buderow jetzt in diesem Moment gerade sei und wo in diesem großen Haus sie denn wohl ihr Zimmer habe. Und wie auf Bestellung, als Frau Stuttmann gerade die Tür öffnen wollte, kam ihr eine andere Person, weiblich, von der anderen Seite, also von draußen aus, zuvor. Da es zwar noch April, aber schon ziemlich warm war, trug diese Person eines dieser körperbetonten Sommerkleider mit den großen, bunten Blumen, die kurz oberhalb der Knie enden und ihren Trägerinnen ebenso einen Touch jugendlicher Frische wie ausgewachsener Sexualität verpassen. Dazu volle Brüste ohne BH, langes blondes welliges Haar, große wache hellblaue Augen und sehr viel Energie. All die klischeehaften Erkennungsmerkmale eben, auf die man als Aufgeklärter natürlich nicht achten sollte, wenn man einer Frau zum ersten Mal begegnet, was Tom aber jetzt gerade einfach nicht gelingen wollte. Das ist sie doch nicht etwa? Nein, das kann nicht sein, allein vom Alter her und auch sonst, so eine töpfert nicht. In dieser Art schoss es ihm kurz durch den Kopf, nachdem er das doofe Glotzen des Schwanzgesteuerten gelassen hatte.
„Hallo Natascha.“
Damit sorgte Frau Stuttmann zumindest ein wenig für Aufklärung.
„Hallo Karin“, kam es laut und atemlos zurück, und schon war die Unbekannte die Treppe hinaufgerauscht.
Ich dachte schon, dachte Tom. Vielleicht war das die Tochter, dachte Tom weiter, meinte aber einen russischen Akzent gehört zu haben.
„Danke für den Orangensaft und bis demnächst dann!“, verabschiedete sich Tom von der Frau mit der netten Stimme, die also Frau Stuttmann hieß.
Noch einen Tacken beseelter schlenderte er auf dem Weg, der den akkuraten Rasen in zwei gleich große Hälften schnitt, zurück zum schwarzen Eisentor. Er zog den Helm auf, startete die Kawa und cruiste ohne besondere Eile von Wannsee nach Pankow.
2 Tom trifft Katja und wird gemalt (18. Mai, Mittwoch)
Tom hatte sich für sein erstes Stelldichein mit Katja von Buderow einen Tag frei genommen. Hoffnungsfroh wie er war, hatte er bereits ein Kündigungsschreiben für Maria Heimsuchung getippt und für den folgenden Tag einen Termin bei seinem Hausarzt gemacht. Er hatte sich im Internet über schizoaffektive Störungen informiert und all die anderen Begriffe gegoogelt, die Dr. Haubach so von sich gegeben hatte und die ihm nicht geläufig waren. Als er in Wannsee angekommen war, war er nochmal kurz um die Ecke und hatte ein kleines Tütchen sanftes Keralagras verkonsumiert und sich davon die nötige Lockerheit versprochen. Tom war also gut vorbereitet, als er nunmehr zum zweiten Mal vor dem großen schwarzen Eisentor stand und auf den dicken Knopf drückte.
Wie erwartet öffnete ihm Frau Stuttmann, geleitete ihn dann aber nicht zu irgendeinem Zimmer innerhalb des weißen Quaders, sondern durch diesen und eine Verandatür hindurch, über eine Veranda hinweg und über einen Weg, der dem vor dem Quader zum Verwechseln ähnlich war, geradewegs auf eine zweigeschossige Jugendstilvilla zu. Das Gebäude war weiß wie der Quader, aber anders als dieser mit allerlei Verspieltheiten dekoriert, mit denen es beinahe als kleines Schloss hätte durchgehen können. Es gab diese kitschigen Figuren mit den komischen Fratzen oberhalb großer doppelflügeliger Altbaufenster der schickeren Art. Es gab einen runden Erker, der wie eine Art Türmchen links über das Obergeschoss hinausragte und mit eigener kleiner Dachkonstruktion ausgestattet war. Es gab ein repräsentatives Eingangsportal mit kleiner Treppe und den typischen Verschnörkelungen drum herum. Und außerdem gab es einen blumenvollen Balkon sowie ein steiles, rot gedecktes Dach mit einer breiten Gaube und drei Schornsteinen als Krone obendrauf. Tom fühlte ein klein wenig Verachtung in sich aufsteigen, als Frau Stuttmann das Ding mit der affigen Attitüde des Pseudounderstatements, die der reichen Arschlochkaste auf unangenehme Weise eigen ist, als „das Gartenhaus“ bezeichnete.
Wer vom Äußeren aufs Innere schloss, der lag nicht falsch: Unten leicht knarzende, aber gut geölte Holzdielen, oben der unvermeidliche Stuck mit den Blümchen, dazwischen natürlich weiß Getünchtes, diesmal mit – was sonst – pastelligem Impressionismus geschmückt. Dem Eingang gegenüber ließen weit geöffnete, oben gerundete und befensterte Flügeltüren einen großzügigen Salon mit schweren Möbeln in ebenso schwerer Eiche und diese Dinge vermuten. Bevor Tom herausfinden konnte, ob dem so war, stiegen sie aber auch schon eine steile Knarzetreppe mit schwungvoll gedrechselten Stützen und rotem Handlauf hinauf ins Obergeschoss. Dort blieben sie vor einer verschlossenen, diesmal unbefensterten Flügeltür stehen.
„Frau von Buderow weiß Bescheid“, informierte ihn Frau Stuttmann. „Wenn Sie fertig sind, melden Sie sich drüben einfach wieder bei mir. Herr von Buderow erwartet Sie dann, um alles Notwendige zu klären.“
Ohne mit ihm hineinzugehen und ihn vorzustellen, machte sie kehrt und ließ Tom allein. Der stand erst einmal wieder so ein bisschen blöd rum, bevor er zart anklopfte und dann ein wenig fester, weil ihm zunächst niemand antwortete.
„Sie können hereinkommen, Tom, die Tür ist offen“, ging es dann und Tom kam vorsichtig herein.
Er betrat einen riesigen Raum mit viel Fenster und Licht und all dem Zeug, das ein klassischer, bildender Künstler in seinem Atelier, denn dazu schien der Raum gedacht, da so hat. Eine Staffelei mit weißer Leinwand ziemlich in der Mitte, in der Ecke eine weitere mit etwas Halbfertigem, dahinter, noch weiter in der Ecke, ein Brennofen. Eine Art Tapeziertisch auch mit Leinwand drauf, ein großes Regal mit kleinen Skulpturen oder sowas, dazu Dosen mit Farben, Eimer und allerlei Werk- und Pinselzeug. Der Blickfang aber war ein weinrotes plüschiges Sofa etwa einen Meter vor der breiten Wand mit der breiten Fensterfront und der Balkontür in der Mitte. Davor ein kleiner Beistelltisch und an der Seite ein antiquiertes Sesselchen mit Holzlehnen und grünem Samtbezug. Von der Decke hing irgendwie freaky eine Art Lüster mit Messingarmen herab.
Katja saß mit dem Rücken zur Tür vor der Staffelei mit dem halbfertigen Bild. Gerade in dem Moment, als Tom sie entdeckte, drehte sie sich um und zu ihm hin. Das tat sie mit Hilfe des kleinen Rollhöckerchens, auf dem sie Platz genommen hatte und mit so viel Schwung, dass der rötlich getönte Bob, den sie auf dem Kopf trug, lustig umher wippte und dadurch das erste war, das Tom an ihr auffiel. Und der ihr im Übrigen gut stand und der sie, die Tom an sich schon eine satte Dekade jünger einschätzte als ihren Ehemann, noch ein paar weitere Jahre jünger machte.
Der Bob umwölbte ein rundes, gut durchblutetes Gesicht mit vollen Lippen, die einen großen Mund umschlossen, der sicher auch feste und mit großen Zähnen lachen konnte. Katja hatte große, braune, gütige Augen, die Tom mit Wohlwollen musterten, die wahrscheinlich aber auch anders konnten, wenn sie Dinge sahen, die ihnen nicht gefielen. Und die wacher waren als Tom, der Mann vom Fach, ihn ob der Dosierung von Lithium, Tavor und wie sie alle hießen eigentlich erwartet hatte. Nix dumpfer Stierblick und überhaupt – nix Lahmarschigkeit und sowieso nix unangenehmer Speichelfluss.
Katja hatte sich nicht für Tom fein gemacht. Sie trug eine Jeans, ein gelbes Shirt und darüber eine Stoffschürze, die mal weiß gewesen und jetzt mit allerlei bunten Spuren ihres kreativen Schaffens übersät war. Die Schlabbersachen konnten freilich nicht verhindern, dass Tom einer drallen Figur mit ebensolchen Titten gewahr wurde, die sich ihm – im Gegenteil und in ihrer Wirkung verstärkt durch eine kerzengrade Körperhaltung – unvorbereitet als sexuelle Attraktion offenbarten. Also schnell woanders hinkucken. Katja trug auffälligen Schmuck – ovale goldene Ohrringe von der Größe, die alle außer ihrem Träger selbst daran denken ließen, was wohl wäre, wenn man mit den Dingern irgendwo hängenbleibt, ein Lederhalsband mit irgendeinem esoterischen Talisman dran sowie links und rechts jeweils mehr als einen metallenen Armreifen, damit das bei jeder Bewegung auch schön klimpert.
So wanderte sein Blick über Katja von Buderow, blitzschnell und mit Hirn auf Hochtouren, um das Gesehene seinen ihm vertrauten Denkmustern zuzuordnen und einer vorläufigen Deutung zuzuführen. Da war sie also: die Beschworene, die Gefürchtete. Und was sollte er sagen: Gäbe es für die Aura eines Menschen eine farbliche Entsprechung, dann wäre Georges von Buderow eher so der Blaue und Katja irgendwie rotorange. Tom war irritiert, denn er fand ein warmes Feuer vor, wo er ein irres Stroboskop angenommen hatte. Hätte man es ihm nicht anders gesagt, so hätte er in diesem Moment meinen können, dass es nicht das Schizoaffektive, sondern das Leidenschaftliche einer Leidenschaftlichen war, das sie zu ihren Gefühlsausbrüchen und also zu ihren spektakulären Taten hinreißen ließ.
„Hallo, Frau von Buderow, mein Name ist Tom Seidel.“
„Hallo Tom! So darf ich Sie doch nennen?“
Katja begrüßte Tom mit einem warmen, ruhigen Alt-Timbre, das so war wie es war, aber eben auch durch das Leben als solches und das Nikotin mitgeprägt wurde. Und ohne auf Ja-Nein zu warten:
„Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen meine Malerhand nicht geben möchte.“
Sie bat Tom darum, auf dem Sofa Platz zu nehmen und rollte mit ihrem Höckerchen hinterher, bis sie auf der anderen Seite des kleinen Beistelltisches zum Stehen kam. Zu trinken gab es erstmal nix.
„Sie sind also mein Aufpasser“, fuhr sie fort. „Auf den ersten Blick muss ich sagen, dass ich es durchaus hätte schlimmer treffen können! Wissen Sie, es fühlt sich einfach angenehmer an, wenn einem derjenige sympathisch ist, der einem die Arme festhält und an das Bett bindet. Oder der einem gegen seinen Willen eine Spritze verpasst.“
Katjas Offenheit traf Tom ungefähr so wie der Faustschlag eines Zehnjährigen – nicht schmerzhaft, aber spürbar und aus heiterem Himmel. Er rang ein bisschen nach Worten. Nach einer kurzen Pause dann:
„Ähm, ich habe nicht vor, Sie ans Bett zu binden. Eigentlich dachte ich, dass ich Ihnen vor allem Gesellschaft leiste, ein paar kleine Dinge für Sie erledige. Solche Sachen. Und dass ich für Sie da bin, wenn Sie Probleme mit dem Laufen haben.“
„Warten wir ab, wie es läuft.“ Katja lächelte vielsagend. „Heute ist auf jeden Fall alles gut. Ein guter Tag, um einander kennenzulernen. Also los, machen Sie den Anfang! Erzählen Sie ein wenig von sich! Was machen Sie so? Wer sind Sie so? Und vor allem: Wo um alles in der Welt hat Georges Sie aufgegabelt?“
Und so erzählte Tom von sich, von seinem zugegebenermaßen nur mittelcoolen Leben. Davon, dass er mal studiert hatte, ihm das mit der Krankenpflege aber besser gefiele, auch dass ihn die Literatur interessiere, auch die Musik, aber auch der Sport und seine Kawasaki, und nein, dass er die Richtige noch nicht gefunden habe und blabla. Und auch wenn das alles nicht so toll war, so hörte Katja ihm doch gut zu oder schaute ihm zumindest so tief in die Augen als täte sie es. Ihre Zuwendung gefiel ihm, und als es schließlich um die Frage ging, wie er denn nun Georges von Buderow und so, da erzählte er Katja die ganze Geschichte von Anfang an, inklusive Katheter Größe 14 und dem 50-Euro-Schein. Sie lachte laut und hämisch und lustig und Tom lachte mit, irgendwie genauso.
Als sie mit Toms Leben fertig waren, verzichtete er seinerseits darauf, sie nach dem ihren zu fragen. Wie konnte er zu diesem Zeitpunkt auch schon wissen, welche wunden Punkte da zum Vorschein kämen bei ihrer schwachen psychischen Konstitution? Tom zog es also vor, zu den vielen interessanten Dingen überzuleiten, die es in dem großen Raum so zu sehen gab. Und so zeigte sie ihm ihre Kunst, was diese so darstellte und wie sie sie schuf. Erst zeigte sie ihm ihre Plastiken, denn das waren sie und keine Skulpturen, weil sie diese mit Gips und Drahtgestellen modelliert und nicht aus einem Stein gehauen hatte. Tom dachte unwillkürlich an die nackten Kerle, von denen Georges von Buderow gesprochen hatte, und konnte tatsächlich ein paar von diesen ausmachen, aber nicht so viele, um alle Plastiken zusammen so und vor allem so abfällig zu bezeichnen. Ihm gefiel das, was er sah, sehr gut und er konnte auch mit ein paar gescheiten Bemerkungen punkten.
Danach kamen die Bilder an die Reihe. Katja malte klassisch in Öl auf Leinwand, wobei sie sich an allen möglichen Stilrichtungen versuchte. Es gab Figuratives, Expressives, Konstruktives zu sehen, Dunkles, Helles, Buntes und Graues. Tom meinte, das könne mit ihren unterschiedlichen Seelenzuständen zu tun haben, behielt diesen Gedanken aber für sich.
Katja präsentierte ihre Werke mit Hingabe, wohl auch deswegen, weil es hier nie irgendwelches Publikum gab und natürlich ebenso wenig Applaus. Sie freute sich sichtlich über Toms ehrlich beeindrucktes wie unbeholfenes Dauerlob, denn es ging die ganze Zeit nur „toll“, „krass“, „geil“. Sie redete viel schneller als zu Beginn und ihre Wangen hatten irgendwie ein lustiges Rot bekommen.
Als sie auch mit den Bildern fertig waren, sank Tom ein wenig erschöpft auf das Sofa. Katja musste sich nicht hinsetzen, denn sie war selbst nie aufgestanden, sondern immer nur mit dem Höckerchen von Kunst zu Kunst gerollt. Sie sprachen zunächst kein Wort, was aber nicht weiter störte, denn sie fühlten sich wohl miteinander.
„Darf ich Sie malen?“ Katja beendete das Schweigen mit einem weiteren kleinen Faustschlag.
„Wie, malen?“ Tom stammelte und stellte diese blöden Einwortfragen: „Mich?“ Und noch eine: „Jetzt?“ Und noch eine: Hier?“
„Ja, warum nicht?“ Katja tat so, also sei ihr Anliegen ein so normales wie meinetwegen die Bitte eines Gärtners um Regen oder die eines Rauchers um Feuer.
„Nur falls Sie Zeit haben. Sie können es sich auf dem Sofa so bequem machen, wie Sie wollen. Nehmen Sie ruhig die Beine hoch, legen Sie sich hin – ganz wie Sie möchten. Ich drehe die Heizung auf und wir können direkt anfangen.“
„Na ja, wir können es ja mal versuchen.“
Tom fühlte sich so überrumpelt, dass er erstmal machte ohne weiter nachzudenken. Er zog sich langsam die Schuhe aus und legte seine Füße auf die Polster. Dann drehte er sich mit dem Kopf auf der Armlehne leicht zur Seite. Das untere Bein war leicht angewinkelt mit dem Knie nach vorn, das obere zeigte mit dem Knie nach oben. Er schaute Katja an, die ihm gegenübersaß.
„So?“, fragte er eine weitere blöde Einwortfrage.
„Möchtest Du Dich nicht ausziehen?“
Tom erschrak doppelt: Erst sehr über das unvermittelte Du, dann noch mehr sehr über den Rest der Frage.
„Mich ausziehen? Ganz? Auch die Unterhose?“
„Wenn Du nicht magst, kannst Du die Unterhose anlassen.“
Katja antwortete beinahe beiläufig, ohne vom Du zu lassen. Sie war bereits in Richtung Heizung unterwegs und suchte in Gedanken ihr Malzeug zusammen.
„Aber dann darfst Du auch nicht enttäuscht sein, wenn Dein gutes Stück nicht so getroffen ist, wie Du Dir das vorstellst“, schob sie lachend hinterher und brachte noch ein Gerät mit klassischer Musik in Gang.
Tom zog sich umständlich aus und legte sich genauso hin wie vorher, diesmal aber nur mit Schlüpper. Er beobachtete Katja dabei, wie sie die Staffelei mit der weißen Leinwand in die richtige Position schob, ein Rolltischchen schräg davor parkte und darauf Palette, flache, runde und sonst welche Pinsel, Tuben, Terpentin, Lappen ablegte. Sie bewegte sich schnell und professionell, ohne sich je vom Rollhöckerchen zu erheben. Als offenbar alles bereit war, drehte sie sich plötzlich zu Tom um. Sie musterte ihn von oben bis unten, wie er da so lag. Tom fragte sich, ob das nun der Blick der Künstlerin auf ihr Objekt oder der der Frau auf den Mann sei. Er spürte ein leichtes Kribbeln zwischen den Beinen.
„Okay, wenn Du bequem liegst, können wir anfangen. Es kann eine Weile dauern. Ich hoffe, das ist in Ordnung? Du kannst Dich ruhig auch mal anders hinlegen, wichtig ist nur, dass Du immer mal wieder diese Ausgangsstellung einnimmst.“
„Und was ist, wenn jemand reinkommt?“





























