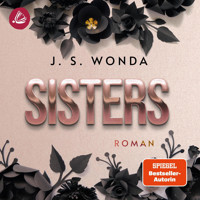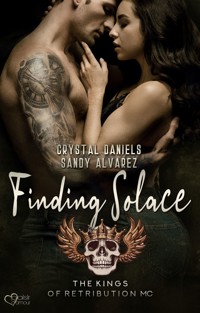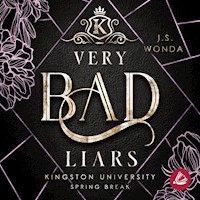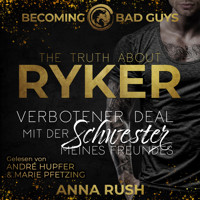3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Im Mittelpunkt dieses »Liebeskarussells« steht Loulou Biche, die Dame »mit den göttlichen Schenkeln«, um die sich alles dreht in jener scheinheiligen Welt, in der totgeschwiegen wird, was nach landläufigen Begriffen nicht anständig und nicht angenehm ist. Gabriel Chevallier, ein Meister des derb-drastischen Humors, verzaubert diesmal seine Heimatstadt Lyon in ein überdimensionales Dorf und schildert Sitten und Unsitten. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 548
Ähnliche
Gabriel Chevallier
Liebeskarussell
Roman
Aus dem Französischen von Brigitte Weitbrecht
FISCHER Digital
Inhalt
Erster Teil Loulou Biche
Tugend ist, Glück zu mehren; Laster mehrt Unglück. Alles übrige ist nur Heuchelei oder bürgerliche Beschränktheit.
Stendhal, Correspondance
Eine Gesellschaft an sich ist weder tugendsam noch lasterhaft, weder weise noch töricht; sie ist.
Gobineau
Für »Wohlmeinende« ist die Heuchelei die erste Stufe der feinen Lebensart.
Baron Ruffieu
I In einer Winternacht
Lyon, 7. Januar 1930. Es war fast Mitternacht. Tief schlummerte die Stadt in ihren Schlafzimmern und Alkoven und erholte sich von den nicht lange zurückliegenden Weihnachts- und Neujahrfestivitäten. Die schwammige Nacht bedeckte die große Stadt mit erstickendem, dichtem Nebel und verbannte sie auf den Grund der aus ihren Flüssen aufsteigenden Feuchtigkeit. Der verspätete Fußgänger suchte sich seinen Weg von einer der wenigen Straßenlaternen zur andern. Sie glichen kleinen, bleichen, an Pfähle gehängten Gestirnen, tauchten plötzlich auf und erloschen nach ein paar Metern. Er fühlte sich einsam, verloren in den Abgründen einer unwirklichen Welt, die in Nebelschwaden schwankte. Alles schien sich in ungreifbarer, nässetriefender Watte aufzulösen, die die Geräusche erstickte und die Bronchien angriff. Er hielt sich das Taschentuch vor den Mund, um die eisige Luft zu filtern, die in seine Lungen stach und ihm die Nase triefen ließ. Vom Emphysem bedroht schneuzte er sich krampfhaft und spuckte eine hartnäckige Bronchitis aus, ein klimabedingtes Leiden. Grabesstille lag über der unsichtbaren Stadt.
Eine Bö fegte auf einige hundert Meter den Nebel vom rechten Saône-Ufer weg, was den wenigen späten Autofahrern trügerische Zuversicht einflößte. Seit einer oder zwei Stunden hatten heimtückische, umspringende Winde die Straßen mit dünnem Glatteis überzogen, das um so gefährlicher war, als man es nicht sah. Bei diesen Wetterverhältnissen fuhr Notar Chabreloche ohne böse Vorahnungen in die rechtwinklige Kurve zur Palais-de-Justice-Brücke, um die Richtung ins Stadtzentrum einzuschlagen.
Notar Chabreloche kehrte eben von einem wohlgelungenen Ausflug in die Umgebung zurück und befand sich in Begleitung einer jungen Dame von lockeren Sitten, deren Anblick ihm das Blut zu Kopf getrieben hatte. Der überreichliche Genuß von Burgunder und Cognac hatte ihm zwar Wallungen verursacht, die er zur Krönung des Abends noch auszunützen gedachte, doch hatte er sein Reaktionsvermögen als Mensch mit sitzender Lebensweise nicht gerade verbessert. Schlecht in die Kurve gesteuert, kam der Wagen ins Rutschen, stieß an den rechten Bordstein, prallte ab und wurde gegen den linken Gehweg geworfen. Dann glitt er schräg über die Straße und versperrte die schmale Brückenfahrbahn vollständig.
Im gleichen Augenblick kam aus der entgegengesetzten Richtungeine große Limousine, ein herrschaftliches Auto, dessen Chauffeur im allerletzten Moment das Hindernisbemerkteundnurnochhartauf die Bremse treten konnte. Die Bremse blockierte die Räder, und die Limousine rutschte jetzt auf Notar Chabreloches Wagen zu. Frontal stießen die beiden Fahrzeuge mit den Motorhauben aufeinander, Blech kreischte, Glas klirrte. Zwei Scheinwerfer zersprangen beim Zusammenprall, verbogene Kotflügel und Stoßstangen verhedderten sich ineinander. Die schwere Limousine stieß den andern Wagen mehrere Meter zurück. Notar Chabreloche bekam das grauenhafte Gefühl, ohne Steuerungsmöglichkeit rückwärts geschleudert zu werden. Da der Druck schräg wirkte, fürchtete er, über die Brücke hinunterzustürzen. Tatsächlich fuhr sein Wagen rückwärts auf den Gehweg und prallte aufs Geländer. Dieses hielt glücklicherweisestand und rettete damit den beiden Insassen das Leben.
Überraschte Stille folgte dem Unfall. Als erster rührte sich der Chauffeur der Limousine. Er sprang von seinem Sitz und beschimpfte den unfähigen Verkehrsteilnehmer mit der Unverschämtheit eines Herrschaftsdieners, der einen reichen, mächtigen Herrn hinter sich weiß.
»Verdammt noch mal!« schrie er. »Der Hornochse kann nicht mal fahren!«
Notar Chabreloche saß noch ganz benommen am Steuer, und seine Begleiterin, die nach vorn geworfen war, klagte über Verletzungen am Knie und am Schenkel. Bei dem Ausdruck Hornochse kehrte das Bewußtsein seiner Wichtigkeit wieder zurück; er konnte nicht dulden, von einem Domestiken derart beleidigt zu werden. Seine Lage war insofern verzwickt, als die auffällige junge Frau neben ihm unter keinen Umständen in den Unfall verwickelt werden durfte. Seine Klienten hätten kein Verständnis dafür, daß der erste und als der vertrauenswürdigste gerühmte Notar von Lyon nächtlicherweile eine Halbweltdame, mit der er unzweifelhaft den Abend verbracht hatte, nach Hause fuhr und dabei einen Zusammenstoß verursachte. Einem Wüstling vertraut man seine Interessen nicht an. Die Anwesenheit der »flotten Biene« blieb jedoch dem ungehobelten Chauffeur nicht lange verborgen; er meinte, das Paar passe schlecht zusammen.
»Sie waren wohl gerade am Knutschen, Sie alter Dickwanst!« Notar Chabreloche war dicklich und klein von Gestalt. An seinem wunden Punkt getroffen, geriet er in Zorn.
»Seien Sie wenigstens höflich, Lakai!«
»Höflich zu einem Hanswurst? Das könnte ich mir nie verzeihen«, entgegnete der Chauffeur.
Das war mehr, als ein hoher Beamter, selbst auf Abwegen, ertragen konnte. Er stieg aus, um dem Unverschämten die Meinung zu sagen.
»Wir werden die Sache unter gebildeten Menschen erledigen. Ich wünsche mit Ihrem Herrn zu sprechen.«
Eben hatte er nämlich bemerkt, daß jemand in der Limousine saß.
»Erst mal den Schaden besehen«, knurrte der Chauffeur. »Sie haben Herrn Edgar Crebbs’ Wagen verbeult. Das müssen Sie teuer bezahlen.«
Bei diesem Namen zuckte der Notar zusammen. Herr Crebbs, Multimillionär (heute würde man Milliardär sagen), Direktor der Banque de France, war der reichste Mann der Stadt, eine Art Lyoner Rothschild. Es lag in seiner Macht, jemanden an die Spitze zu bringen oder zugrunde zu richten, je nach dem, was er von ihm hielt. Sein Urteil hing von Augenblickslaunen ab, denn er konnte seinen Mitmenschen wenig Zeit widmen. Es war bekannt, daß man sich ihm nicht in den Weg stellen durfte, weder bei seinen geschäftlichen Unternehmungen noch bei seinem Vergnügen, ebensowenig wie bei seinen Liebesabenteuern. Gerade an jenem Abend neigte Herr Crebbs keineswegs zur Geduld.
Er kam gerade von seiner Mätresse, der Großen Yvonne, mit der er allabendlich eine oder zwei Stunden verbrachte, wenn es seine gesellschaftlichen und familiären Verpflichtungen zuließen. Eine luxuriös ausgehaltene Mätresse von gewaltiger körperlicher Erscheinung entsprach seinem Rang in der Gesellschaft. Die öffentliche Meinung hätte nicht begriffen, wenn ein so bedeutender Mann sich nicht außerhalb seines Hauses eine schöne, wollüstige Kreatur gehalten hätte. Wozu war Geld sonst gut? Die ganze Stadt kannte und achtete die Große Yvonne, deren Laufbahn durch ihre königliche Haltung und ihren berühmten Busen sehr gefördert worden war. Körperlich glich sie den breithüftigen, wohlgerundeten Najaden, die auf der Place des Jacobins einen Fisch zwischen ihre steinernen Brüste quetschen, so daß aus dem Tiermaul ein Wasserstrahl ins Brunnenbecken fällt. Ihre amouröse Bindung an Herrn Crebbs hob sie in den Stand einer Königin der Lyoner Galanterie und trug ihr Ehrerbietung ein. Sie war sozusagen Herrn Crebbs’ morganatische Gattin. Hervorzuheben ist, daß die Große Yvonne ihren Platz sehr würdig ausfüllte. Obwohl sie von Beruf »Freudenmädchen« war, hätten viele auf ihre Legitimität pochende Bürgerfrauen hinsichtlich feiner Lebensart und guten Benehmens von ihr lernen können. Ihre Sittenfreiheit erlaubte ihr, sich ohne anderes Ziel als die eigene Vervollkommnung zu bilden. Sie las und unterhielt sich gern, es fehlte ihr nicht an Geist, sie empfing Künstler, sie befaßte sich mit Malerei und sang recht hübsch. Vor allem: In ihrer Gesellschaft langweilte sich keiner. Sie glich den Hetären des Altertums, deren Heim ein Hort der Bildung war und bei denen die damaligen Patrizier, dem häuslichen Einerlei entfliehend, gehobene Vergnügungen genossen. In dieser Hinsicht hatte sie keine Konkurrenz in Lyon und konnte von oben herab auf die Dämchen sehen, die vom Handel mit ihren Reizen lebten und sich von irgendeinem hohen Tier in Industrie und Handel unauffällig aushalten ließen. Ihre übrigen Talente konnten nicht gering sein, da Herr Edgar Crebbs, der sich alles leisten konnte, sie ausgewählt und ihr damit das höchste Befähigungszeugnis verliehen hatte.
Herr Crebbs also hatte eben das anheimelnd warme Interieur seiner Mätresse hinter sich gelassen und seinen anfälligen Hals dem giftigen Nebel ausgesetzt. Jetzt wünschte er nichts anderes, als so rasch wie möglich sein prächtiges Heim auf den Anhöhen Lyons zu erreichen, ein mehrere Hektar großes, ummauertes Anwesen, uneinnehmbar wie eine Festung. Durch die Schuld eines Idioten auf einer Brücke anhalten und den gesundheitsschädlichen, stickigen Lyoner Nebel einatmen zu müssen, war ihm unerträglich. Überdies war sein Tageslauf so genau eingeteilt, daß jeder Augenblick einem bestimmten Programmpunkt entsprach. Er kurbelte ein Rückfenster herunter und befahl schneidend:
»Erledigen Sie diese lächerliche Geschichte, Alphonse, und fahren Sie sofort nach Hause!«
Als Chabreloche diese Anweisung, die ihn dem unverschämten Chauffeur auslieferte, vernahm, sah er seinen guten Ruf dahinschwinden. Um so mehr als der mit Alphonse Gerufene unter dem Vorwand, den Schaden genau zu betrachten, an die Wagentür getreten war und die hübsche Insassin mit taktloser Vertraulichkeit anstarrte. Er war jung und gut gebaut und hatte jenes Halunkenaussehen, das oft anspruchslose Frauen verwirrt. Der auf die Menschengeschicke so mächtig einwirkende Zufall jedoch führte den von der Vorsehung ausgesandten Retter herbei in der Person von Herrn Hector Foitrasson, einem der geachtetsten Lyoner Seidenfabrikanten. Er hatte im Palais de Bondy ein Konzert besucht und sich beim anschließenden Gespräch mit einigen glühenden Musikliebhabern über die vergleichsweisen Vorzüge von Mozart, Bach und Schumann etwas verspätet. Zu Fuß und leicht fröstelnd befand er sich auf dem Wege zu seiner großen Wohnung am Quai Tilsitt, als er den Zusammenstoß hörte. Er ging auf die Palais-Brücke zu, die er sonst nicht benützte, aber die Neugier siegte über seine Gewohnheiten. Dort erkannte er den Notar, mit dem er wegen einer Erbschaftsangelegenheit in der Familie seiner Frau schon zu tun gehabt hatte.
»Was ist passiert, Herr Notar?«
»Das Glatteis«, rief Notar Chabreloche, »dieses heimtückische Glatteis …«
»In dieser Jahreszeit kann man nicht genug achtgeben. Bei solchem Wetter lasse ich meinen Wagen in der Garage. Ein Fußmarsch ist sehr gut für die Gesundheit.«
Plötzlich kam Herrn Chabreloche der rettende Einfall.
»Mein lieber Freund«, tönte er, »würden Sie mir wohl einen Dienst erweisen?«
Herr Foitrasson wurde mißtrauisch; man kann nie wissen, wozu ein Dienst verpflichtet, und Schlag Mitternacht …
»Darüber ließe sich reden. Wir besprechen es dieser Tage mal.«
»Es geht um einen sofortigen Dienst, lieber Freund.«
»Jetzt gleich? Wissen Sie, wieviel Uhr es ist? Ich werde zu Hause erwartet.«
»Es handelt sich um einen Dienst, der Sie kaum aufhalten und keinen Pfennig kosten wird. Ich möchte gleich bemerken, daß nichts Unangenehmes damit verbunden ist, ganz im Gegenteil. Ich biete Ihnen meinen Platz an der Seite einer hübschen Frau an, nicht mehr und nicht weniger. Sie dürfen mir glauben, daß es schweren Herzens geschieht.«
»Das müssen Sie mir erklären«, entgegnete Herr Foitrasson noch zurückhaltend.
»Die Sache ist die: Heute abend habe ich eine junge, hübsche Klientin ausgeführt, mit der ich eine umfangreiche geschäftliche Angelegenheit zu besprechen hatte. Sie sitzt in meinem Wagen und ist leicht verletzt. Ich möchte Sie bitten, sie nach Hause zu begleiten, sie wohnt nicht weit von hier. Leisten Sie ihr Erste Hilfe und rufen Sie nötigenfalls einen Arzt.«
Gerade streckte die Beifahrerin ihr anmutiges Gesichtchen zum Fenster heraus.
»Bleiben wir noch lange hier stehen?« fragte sie leicht gereizt. »Liebe Freundin«, säuselte Notar Chabreloche, »darf ich Ihnen Herrn Foitrasson vorstellen? Er wird so gut sein, Sie in Ihre Wohnung zu geleiten, denn ich fürchte, ich werde hier noch länger beansprucht als mir lieb ist. Herr Foitrasson gehört zur besten Gesellschaft. Ich bin überglücklich, daß ich Sie ihm anvertrauen kann. Mein lieber Freund«, wandte er sich an Foitrasson, »darf ich Ihnen Frau Loulou Biche-Weiler, meine Klientin, vorstellen? Ich empfehle sie Ihrer Fürsorge.«
Die Dame wand sich aus dem Auto, nicht ohne ihre Beine bis zu den Oberschenkeln zu zeigen, aber es war ja unmöglich, mit den kurzen Röcken und bei den niedrigen Wagensitzen anders auszusteigen. Das Blitzschauspiel machte Herrn Foitrasson geneigt, die Rolle des Beschützers der eleganten Person zu übernehmen, auch auf die Gefahr hin, sich leicht zu kompromitieren, obwohl bei solchem Wetter eine peinliche Begegnung höchst unwahrscheinlich war. Eine geschickte Frage des listigen Notars überwand die letzten Hemmungen des Seidenfabrikanten.
»Sind Sie in letzter Zeit einmal wieder bei der guten Marthe gewesen?«
Frau Marthe hielt ein gastfreies Haus in einer verschwiegenen Gasse im zweiten Stock eines bürgerlich wirkenden Gebäudes. Dort sorgten junge Frauen, die nachmittags, abends und zuweilen auch nachts über freie Zeit verfügten, für die Unterhaltung einer ausgewählten männlichen Gästeschaft, die gut zahlte und nie Skandale verursachte. Als erfahrene Geschäftsfrau ließ sie nur ältere Herren zu, die es zu etwas gebracht hatten und gewisse Mittel ihr eigen nannten. Sie ließ ihnen die Wahl unter den Schönheiten, die hinsichtlich Hautfarbe, Formen und Techniken eine wunderbare Vielfalt darstellten. Manche Stammgäste äußerten insgeheim besondere Wünsche; ihnen stellte sie spezialisierte Damen zur Verfügung, die sie »meine Attraktionen« nannte. Eine schöne Kongolesin mit kalebassenartigen Brüsten und eine anschmiegsame Japanerin vervollständigten das Personal des Etablissements. Frau Marthe organisierte auch telefonische Verabredungen und belieferte reisende Geschäftsleute mit Pseudosekretärinnen. Sie brüstete sich sogar damit, für wichtige Reisen »Damen von Welt« vermitteln zu können, die sich zu unterhalten verstanden und vornehme Manieren sowie entsprechende Kleider mitbrachten. Niemand wußte, wo sie diese »Damen von Welt« anwarb, aber mit manchen konnte man sich durchaus sehen lassen (gelegentlich besser als mit den »regulären« Frauen). Wie dem auch sei – Notar Chabreloche war jedenfalls bekannt, daß Herr Foitrasson jenes Haus besuchte, in dem er früher ebenfalls häufig zu Gast gewesen war.
»Also gut«, schnitt der Seidenfabrikant alle weiteren Erklärungen ab, »ich begleite die Dame nach Hause. Gute Nacht!«
So kam es, daß die lebensprühende Loulou Biche an Herrn Hector Foitrassons Arm leicht hinkend in den Nebel hineinschritt. Die Kirchturmuhren ließen ihr Mitternachtsgeläute über die Stadt perlen. Man hörte sie kaum.
Notar Chabreloche war sehr erleichtert, als Loulou Biche gegangen war. Der Abend entsprach seinem wöchentlichen Diner der Notarskammer, einem festen Brauch, den Frau Chabreloche ohne Argwohn hinnahm. Er wäre nicht gern bei der Lüge ertappt worden und wollte keinesfalls seinen Kollegen Schwierigkeiten bereiten, nützten sie doch gleich ihm das berühmte Diner aus, um galanten Abenteuern nachzugehen mit der Begründung: »An diesem bestimmten Tag muß ich zur Notarskammer.« Das Geheimnis dieser unter den Herren Notaren getroffenen Vereinbarung durfte nicht in Gattinnenkreise durchsickern. Vor ein paar Jahren hatte Arthur Chuffurin, ein minderwertiger, charakterschwacher Kerl, seiner Frau auf ihr Drängen alles gestanden. Sie war zum Präsidenten gelaufen und hatte fürchterlich Krach geschlagen, aber der Präsident ließ sich von einer solchen Furie nicht beeindrucken. Er erklärte schroff, man könne nicht dulden, daß ein Lump seine Laster mit einer Ausrede bemäntele, die seine Kollegen mit ihrem geregelten Lebenswandel und ihren untadeligen Sitten bloßstelle. Danach berief er eine Vollversammlung ein und erklärte: »Wir dulden kein räudiges Schaf in unserer Mitte! Wir werden Chuffurin, diesen Verräter, absägen.« Sie machten ihm das Leben zur Hölle, und er mußte seine Kanzlei verkaufen und aufs Land ziehen. Das Diner der Notarskammer wurde wieder die über jeden Verdacht erhabene Institution, die im übrigen für alle Teile günstig war. Am Tag nach ihren kleinen Eskapaden waren die Notare zu Hause reizender Laune, die bis zur Freigebigkeit gehen konnte, da ja die in die Anwaltspraxis investierte Mitgift der teuren Gattin Zinsen brachte. Manche schenkten ihrer Gemahlin den gleichen Pelz wie ihrer Mätresse. Das ergab Mengenrabatt beim Pelzhändler.
Es dauerte eine gute halbe Stunde, bis die beiden Autos rückwärts fahrend voneinander losgekommen und wieder startbereit waren. Chabreloches Wagen als der schwächere hatte mehr gelitten. Die Steuerung war leicht verbogen, ein eingedellter Kotflügel drückte auf das linke Vorderrad. Herrn Crebbs’ Chauffeur beulte ihn mit ein paar kräftigen Hammerschlägen aus, nicht etwa um dem Notar behilflich zu sein, sondern um endlich die Straße freizubekommen. Nach dem Austausch der Visitenkarten und der Adressen ihrer Versicherungen schieden die Beteiligten mürrisch voneinander. Sie hielten es für unnötig, die Polizei zu bemühen; wo hätten sie auch in dieser gespenstischen Kulissenwelt einen Polizisten auftreiben sollen? Ohne Notar Chabreloche eines Blickes oder eines Wortes zu würdigen, fuhr Herr Crebbs in seiner dicken Limousine weg. Er war vollkaskoversichert, und in seiner Privatgarage standen noch mehrere Autos, deshalb war der Unfall für ihn ein unbedeutendes Mißgeschick. Er war jedoch ärgerlich, weil er aufgehalten worden war und weil er sich wahrscheinlich in dem beim Stillstand ausgekühlten Wagen erkältet hatte. Vor allem war er aufgebracht, weil sein ungeheurer Reichtum nicht alles sofort zu regeln vermochte und weil der geringste Dahergelaufene seinen Zeitplan störte, in dem jeder Augenblick mit erheblichen Summen beziffert werden konnte. Dann überlegte er aber, daß an verschiedenen Orten auf der Welt dreißigtausend Arbeiter in seinen Fabriken beschäftigt waren und daß ihm der von jedem einzelnen einbehaltene Gewinnanteil die sinnlos vergeudete Stunde ersetzen würde. So faßte er den »Tarifvertrag« auf. Leider wurde die Stellung als Arbeitgeber immer schwieriger, da sich der Druck des Proletariats überall bemerkbar machte. So war es erforderlich, das Kapital auf Wanderschaft zu schicken und die Fabriken ins Ausland zu verlegen. Die auf den Gewinn der kleinen Minderheit (einer Elite unternehmungsfreudiger, wagemutiger Männer) gegründete kapitalistische Gesellschaft hatte die moderne Welt geschaffen und das Vorbild großer Fabrikanlagen und umfangreicher Produktionsmittel gegeben. Bei Ford war die »Fließbandarbeit« erfunden worden. Sollten die schöpferischen Menschen, die das alles ins Werk gesetzt hatten, jetzt im Namen nebelhafter »humanitärer« Theorien enteignet werden? Für den Marxismus hatte Herr Crebbs nicht das geringste übrig. Konnte irgend jemand ernsthaft glauben, Karl Marx werde dort Erfolg haben, wo Jesus Christus (an den er sich hielt) mit seinen Ermahnungen zur Brüderlichkeit und Nächstenliebe gescheitert war? Der Himmel auf Erden und der Staat als Arbeitgeber, der ihn an die Menschen verteilt? Das war unhaltbar. Er kam stets zu dem gleichen Schluß: »Das Streben nach Gewinn wird hienieden immer die große Antriebskraft bleiben.« Solange dies zutraf, würde sich das Geschlecht der Crebbs auf diese oder jene Art, mit Trusts und Holdings, durchsetzen. »Wir geben dem Arbeiter Verdienstmöglichkeiten; er sollte uns dafür dankbar sein.« Die Drohung eines Umsturzes, der seine Unternehmungen vernichten würde, lag in weiter Ferne, denn das Volk war ruhig. Gelassenheit durchströmte Herrn Crebbs von neuem, als er an seiner Havanna zog, die er angezündet hatte, solange sein Chauffeur die Durchfahrt freiräumte.
»Wer war das eigentlich, der da auf uns auffuhr?«
»Ein Notar, gnädiger Herr.«
»Sagen Sie mir später den Namen dieses Unglücksvogels! Dem würde ich meine Belange nicht anvertrauen!«
»Es tut mir außerordentlich leid, daß ich Ihnen solche Unannehmlichkeiten bereite.«
Zum Glück begann Loulou Biche mit der Unterhaltung; der etwas schwerfällige Seidenfabrikant hätte keinen Anfang für ein Gespräch mit der jungen Frau gewußt. Sie stützte sich auf ihn, ihr biegsamer und wohlgerundeter, warmer, duftender Körper unter dem Pelzmantel streifte ihn. Vorsichtig schritt sie auf der glatten Straße, eine federnde Brust drückte leicht an seinen Arm. Herr Foitrasson hatte seit langer Zeit keine derartigen Gefühle mehr empfunden, eigentlich seit seinen Studentenjahren an der Handelshochschule nicht mehr. Damals hatte er eine Freundin, die auf den Namen Marinette hörte; munter und schwatzhaft, quicklebendig und fröhlich wie eine Libelle oder eine Grasmücke war sie gewesen. Das kleine Lehrmädchen war stolz auf die Liebkosung des Studenten und blickte nicht weiter in die Zukunft als bis zur Spitze ihrer niedlichen Himmelfahrtsnase. Mit bewundernder, dankbarer Glut heftete sich der Blick ihrer haselnußbraunen Augen auf den jungen Hector. Zwei Jahre nach der Abschlußprüfung hatte er sie um einer wichtigen Angelegenheit willen überstürzt verlassen – wegen seiner Heirat. Seine Ehe sollte ihm Zugang zu den »großen Familien« der Stadt verschaffen und ihn zum Schwiegersohn einer angesehenen Firma machen, deren Leitung er eines Tages übernehmen würde. Damit begann sein Aufstieg. Was war wohl aus seiner Jugendliebe, der kleinen Marinette, geworden, die Loulou Biche so unerwartet heraufbeschwor? Er sah sich wieder, wie er mit seiner einstigen Geliebten, durch dichten Nebel wie heute abend vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten, über eine Rhône-Brücke schlenderte (es war der Pont de l’Université, und er begleitete sie zu ihrer Behausung an der Guillotière). Wenn sie ihm die Lippen bot, glich ihr Atem in der kalten Luft einem weißen Dampfwölkchen genau wie Loulou Biches Atem jetzt. Diese höchst ungewöhnlichen sentimentalen Reminiszenzen versetzten Herrn Foitrasson um vierunddreißig Jahre in die Vergangenheit zurück und verwirrten ihn auf seltsame Weise. Er vergaß darüber seine zweiundfünfzig Jahre, seine Achtbarkeit, sein Ansehen in der Stadt und seine vielköpfige Familie.
»Hier ist es«, verkündete Loulou Biche und blieb vor einem Einfahrstor in der Rue Gasparin stehen, zwischen der Rue des Archers und der Place Bellecour. Zugleich angelte sie einen Schlüsselbund aus ihrer Handtasche, steckte einen Schlüssel ins Schloß und öffnete einen Torflügel. Die Rue Gasparin war damals bürgerlich, eher eine Wohn- als eine Geschäftsstraße, wenig verkehrsreich, wenn auch zentral gelegen. Alles in allem eine verschwiegene Straße. Hier hatte die Große Yvonne ihre Wohnung in einem Haus mit zwei Ausgängen. Loulou Biche hatte Wert darauf gelegt, ihrem Beispiel zu folgen, als ein großzügiger Liebhaber ihr eine Wohnung einrichtete. Es war ein Herr namens Weiler, Industrieller der neuen, aus dem Krieg hervorgegangenen Schule, der in der Schwerindustrie sein Glück machte und als steinreich, wenn auch im Geschäftsleben als halsbrecherisch verwegen galt.
»Ich wohne im dritten Stock. Würden Sie mir wohl beim Hinaufsteigen behilflich sein?«
Das Haus war ziemlich protzig, aber schon alt; einen Aufzug gab es nicht.
»Das wollte ich Ihnen eben vorschlagen«, entgegnete Herr Foitrasson beflissen. »Ich habe nicht vergessen, daß ich beauftragt bin, über Sie zu wachen und nachzusehen, ob Sie nicht schwer verletzt sind!«
»Dieser Dummkopf Chabreloche!« erzürnte sich Loulou. »Ich hätte durch die Windschutzscheibe sausen und völlig entstellt werden können.«
Sie übertrieb. Aber Herr Foitrasson, der den Unfall nicht mitangesehen hatte, war schon zu bezaubert, um ihr zu widersprechen. Nicht ohne ein gewisses Vergnügen nahm er zur Kenntnis, daß sie den Notar als Dummkopf bezeichnete. Er war nämlich leicht eifersüchtig auf den kleinen Dickmops, der eine so entzückende junge Frau nachts in seinem Wagen spazierenfuhr.
»Das wäre ein Verbrechen gewesen!« rief er feurig.
»Was soll aus einer Frau werden, die ihre Schönheit einbüßt?«
»Ihre Schönheit ist glücklicherweise keineswegs beeinträchtigt.«
Sie stiegen die Treppe hinauf, sehr fürsorglich geleitete er sie. Er hielt sie am Ellbogen, sein Arm schmiegte sich an Loulous Taille. Bei jedem Schritt spürte er das erregende, weiche Schwingen ihrer Hüfte. Plötzlich erlosch das Licht – eins sinnenverwirrender Augenblick. In völligem Dunkel und tiefster Stille war Foitrasson allein mit dem Geheimnis einer Schönheit, deren Fluidum ihn streifte. Er fragte sich, was ein entschlossener Mann in einer solchen Situation … Aber Loulou tastete nach dem Knopf der Treppenhausbeleuchtung, und grell ergoß sich das Licht über sie, so daß ihm alle Unternehmungslust verging.
»Haben Sie Schmerzen?«
»Ein bißchen, wenn ich das Bein hebe und den Fuß auf die nächste Stufe setze.«
»Wir werden es gleich untersuchen. Aber keine Sorge, das Bein ist nicht so wichtig wie das Gesicht.«
Loulou behielt für sich, was sie darüber dachte. In ihrem Beruf durfte nichts an ihr unschön oder verwelkt sein. Keine Falten, keine Runzeln, keine verdächtige Prellung. Will man zu Höchstpreisen mit der Liebeslust handeln, so muß man sie unter dem Anschein völliger Gesundheit und eines sorgfältig gepflegten Körpers anbieten. Der Mann, der einen aushält, will etwas für sein Geld.
Loulou Biches Wohnung war ein Schmuckkästchen. Tiefe Sofas, Lehnsessel, weiche Kissen. Ein wollüstiger Duft schwebte in dem raffinierten Interieur. Alle Einzelheiten waren so berechnet, daß sie das Körperliche hervorhoben; geschickt angebrachte Lampen mußten nackten Leibern unauffällig schmeicheln. Das Schlafzimmer schien überall verlockend hereinzureichen. Es war eine Offenbarung für Foitrasson, besuchte er doch sonst nur schmucklose Heimstätten, an deren Giebel unsichtbar das Wort Tugend eingemeißelt stand. Dort hingen Kruzifixe an den ihnen gebührenden Plätzen, nicht wie hier Stiche galanter Szenen in Goldrahmen.
»Nehmen Sie Platz, oder nein, gießen Sie sich ein Glas ein! Getränke sind dort in der Anrichte, im Kühlschrank liegt Eis. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick; ich möchte nur meinen Rock ausziehen und nachschauen, ob ich nicht zu sehr beschädigt bin.«
Sie verschwand, ließ aber die Tür halb offen und rief ihn nach kurzem:
»Kommen Sie, sehen Sie selbst.«
Er betrat das Schlafzimmer. Loulou Biche hatte nur ihr Hemd und ein enganliegendes rosa Unterhöschen anbehalten. Es war mit einer durchsichtigen schwarzen Spitze verziert, die um die breiteste Stelle ihres Beckens flatterte und neckisch den abfallenden Schwung der Hüften betonte. Sie stand aufrecht da und preßte die Beine zusammen. Wunderbare Beine.
»Hier, ist das nicht schrecklich?«
Aus einer Schramme am linken Knie perlten ein paar Tropfen Blut, mitten auf dem linken Oberschenkel prangte ein ziemlich großer blauer Fleck, der sich schon violett färbte. Unzweifelhaft ein starker Bluterguß. Das Bein war sicher gegen den Schalthebel oder die Handbremse oder auch gegen das Armaturenbrett gestoßen. Aber auf Foitrasson wirkte die halbverhüllte Loulou deswegen nicht weniger anziehend.
»Nicht schlimm«, erwiderte er, »das heilt bald. Aber zuerst müssen wir uns vergewissern, daß das Kniegelenk nicht gelitten hat.«
Er geleitete sie zu einem Stuhl, hielt ihren Fuß fest und ließ sie das Bein so hoch wie möglich heben. Eine reizvolle Gymnastikübung, die seinem Blick prächtige Verbreiterungen dem Ausgangspunkt zu freigab. Er setzte sie länger als nötig fort. Das Knie ließ sich normal bewegen.
»Schön«, stellte er fest, »zwei kleine Verbände werden genügen. Haben Sie eine Hausapotheke?«
»Im Badezimmerschränkchen finden Sie alles.«
Nach einer Weile kehrte er zurück, beladen mit Mullbinden, Wasserstoffsuperoxyd, Jodtinktur, Klammern und sonstigem.
»Jetzt brauche ich noch abgekochtes Wasser.«
»In der Küche … Soll ich es holen?«
»Nein, ich kann sehr gut selbst Wasser kochen. Ruhen Sie sich inzwischen aus.«
Als alles bereit war, setzte er sich auf einen Schemel und bat Loulou, ihm ihr Bein zu überlassen. Bedächtig legte er es auf seine Knie und begann mit der Behandlung. Zuerst massierte er mit kurzen, kreisförmigen Strichen das wunderbar runde, glatte, glänzende Knie, immer näher zu der Wunde hin.
»Tut es weh?«
»Nein, gar nicht.«
Lachend setzte sie hinzu:
»Es ist sogar angenehm. Sie haben weiche Hände.«
Mit Wasserstoffsuperoxyd wusch er das Blut ab, träufelte etwas Jodtinktur auf die Verletzung und klebte ein Pflaster darüber.
»Morgen früh brauchen Sie es nur wegzureißen. Die Wunde wird sich vollständig geschlossen haben.«
Nun kam der Oberschenkel an die Reihe; herrlich entwuchs er dem Ort, an dem der dünne Stoff verlockende Schatten durchscheinen ließ. Foitrasson wurde sehr unsicher. Er hob den breiten Schenkel leicht an, um ein zusammengefaltetes Handtuch zum Schutz seiner gestreiften Hose darunterzulegen. Er hatte nämlich beschlossen, die Prellung mit Umschlägen zu behandeln, damit sie nicht anschwoll und damit das häßliche blaue Mal bald verschwand. Ein Umschlag ist um so wirkungsvoller, je stärker man ihn auf das Gewebe drückt. Deshalb preßte Herr Foitrasson seine Hand lange auf Loulou Biches Schenkel. Mit der andern Hand massierte er sanft die unbedeckten Stellen des besagten Schenkels, hauptsächlich die weiche Innenseite, die um so verwirrender wurde, je näher er dem Punkt kam, an dem sich die Beine beim Gehen reiben. Er erklärte, damit rege er die Blutzirkulation an und verhindere, daß sich ein gefährlicher Blutpfropfen in der Nähe der Quetschung bilde.
»Sie sind lustig«, war Loulou Biches Antwort.
Sicher zum ersten Mal in seinem Leben wurde Herr Foitrasson als lustig bezeichnet, er, dessen sprichwörtlicher, ja fast düsterer Ernst seinen Angestellten Furcht einflößte. Allerdings taute er auf bei der Berührung eines begeisternden Schenkels, der samtig war und modelliert wie eine Säule. Das Wort »Olymp« kam ihm in den Sinn, obwohl es nicht zu seinem gewöhnlichen Wortschatz gehörte, so lebhaft gaukelte ihm die junge Frau das Bild einer ruhenden Göttin vor, die ihm bei tiefer, nächtlicher Stille gnädig, mit zutraulicher Anmut, einen Teil ihres innerstens Wesens offenbarte. Draußen schlief die ganze Stadt unter ihrem Federbett aus Nebel, selbst die Straßenbahnen waren verstummt. »Verweile doch, du bist so schön …« Schon wieder eine klassische Reminiszenz …
Endlich war der bewunderungswürdige Schenkel für die Nacht verbunden und das Verbandszeug aufgeräumt. Der Verletzten blieb nur noch, sich gründlich auszuruhen, Herrn Foitrasson, sich zu verabschieden. Die junge Frau reichte ihm ihren Hausschlüssel.
»Werfen Sie ihn einfach in den Briefkasten, wenn Sie aufgeschlossen haben.«
»Darf ich mich nach Ihrem weiteren Ergehen erkundigen?«
»Ich stehe im Telefonbuch. Ach ja, ich habe meinen Namen noch nicht genannt: Loulou Biche-Weiler. Aber ich habe mich von Weiler getrennt, also Loulou Biche.«
»Entzückend, und vollkommen ausreichend.«
»Vielen Dank für Ihre freundliche Bemühung, Herr … wie war doch Ihr Name?«
»Foitrasson. Hector Foitrasson, Seidenfabrikant.«
»Ich glaube, ich habe ihn schon gehört.«
»Er hat hierorts einen guten Klang. Ich bin Direktor der Firma Tapaque-Fiarde & Foitrasson. Gemeinhin sagt man Fiarde & Foitrasson. Unsere Geschäftsräume befinden sich in der Rue du Griffon. Auf zwei Etagen.«
»Das läßt sich hören!«
»Oh, gnädige Frau, es macht mehr Mühe als Freude.«
»Stimmt es, daß es in der Seidenindustrie riesige Vermögen gibt?«
Die Frage berührte einen Geheimbereich. In Lyon stellt man sein Vermögen nicht zur Schau, sondern verbirgt es lieber. Man prunkt fast widerwillig, und ein bißchen Knauserei gilt nicht als abträglich. Im Gegenteil: als vertrauenerweckend. Ohne sich eine Blöße zu geben, antwortete Herr Foitrasson:
»Über großes Vermögen wird viel geklatscht … Eine drückende Last, es zu verwalten.«
»Man braucht es doch nur unbekümmert auszugeben.«
»Ausgeben«, wiederholte Herr Foitrasson unwillkürlich abwehrend. »Ausgeben …«
Sein Blick fiel auf die vom Knie bis zu dem reizenden Höschen fest zusammengepreßten Beine der jungen Frau.
»Ausgeben, natürlich. Aber für wen?«
»Kommen Sie wieder!« orakelte Loulou Biche.
»Ja, gewiß.«
»Aber rufen Sie vorher an. Ich muß gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen. Eine alleinstehende Frau ist so leicht kompromittiert …«
Der Mann, der spät in der erkältungsträchtigen Nacht auf die verlassene Rue Gasparin hinaustrat, unterschied sich gewaltig von dem, der ungefähr zwei Stunden zuvor die Palais-Brücke betreten hatte. Er war zutiefst erregt und so fiebrig, daß er die beißende Kälte nicht spürte. Eben war ihm die Offenbarung dessen, was Wollust des Leibes in verfeinertem, luxuriösem Rahmen sein kann, zuteil geworden. Vergebens forschte er in seinem Gedächtnis nach erhebenden Augenblicken seines Lebens, die er gern noch einmal durchlebt hätte. Bis zu diesem Tag hatte sich seine Existenz geordnet, bequem und trübsinnig hingeschleppt. Banal und langweilig. »Eine gesicherte Zukunft ist schön und gut, aber was soll man mit ihr anfangen?« In Gedanken an Frau Marthes Pensionärinnen, die ihn jahrelang zerstreut hatten, dachte er: »Formen – ja, aber von jedem Beliebigen betätschelt … Und keine Seele.« Um die Seele hatte er sich nie groß gekümmert, aber jetzt schrieb er Loulou Biche eine Seele zu, ein kostbares Gewürz zu ihrem prächtigen Körper, ein Mandelkern in einer auf der Zunge zerschmelzenden, leckeren Schale …
Unter derartigen Überlegungen gelangte er auf die vom Nebel verschluckte Place Bellecour und schlug blindlings eine Querrichtung ein, um den Quai zu erreichen. Daher stieß er plötzlich an das Eisengitter der Lemot-Statue, in undeutlichen Umrissen überragte ihn das Reiterstandbild. Er betrachtete den majestätischen Bronzereiter, den Sonnenkönig, der einst zahlreiche Mätressen und illegitime Kinder gehabt hatte. Der vermochte seine Verwirrung nachzufühlen. (In der Gegend der Rue du Plat zeigte man sich gern monarchistisch, denn das wirkte aristokratisch. In früheren Zeiten war es bei reich gewordenen Kaufleuten Brauch, das Vermögen mit einem Adelsbrief zu krönen. So hielten es damals auch die Schöffen, die Fürsten der Stadt, und von daher stammten die meisten derzeitigen Lyoner Adelstitel.) Hector Foitrasson konnte nicht anders: er mußte das, was ihm das Gemüt erfüllte, der imposanten Statue anvertrauen:
»Ihre Schenkel sind göttlich, Sire! Einfach göttlich!«
Aber Ludwig XIV., der in seiner Jugend gerade hier in der Nähe der Place Bellecour die zweifellos sehr schönen Schenkel der Marie Mancini kennengelernt hatte, war unempfänglich für die Reize von Loulou Biches Beinen. Die verlockendsten Schenkel der Welt konnten eine Glut, die vor fast dreihundert Jahren überwältigend gewesen war, nicht wieder aufflammen lassen. Obwohl er als Standbild an den Schauplatz seiner jungen Liebe zurückgekehrt war, konnte der morganatische Gatte der Maintenon auf seinem Sockel nur noch durch die Jahrhunderte reiten, mit allen Organen auf ewig im Metall erstarrt. Der Glanz seiner langen Regierungszeit, die gewonnenen Schlachten und die eroberten Festungen, die annektierten Provinzen und die vorteilhaften Verträge – das alles entschwand unter dem leichten Staub der Geschichte. Ein Glück, daß der Monarch überhaupt wieder in den Sattel gehoben worden war unter einem republikanischen Regime, das sich nicht anders als mit dem Enthaupten eines seiner Abkömmlinge durchsetzen konnte.
»Sire, ihre Schenkel sind göttlich! Eines Königs wahrhaft würdig!«
Das Gesicht mit dem Bourbonenprofil unter dem Siegerlorbeer bewegte sich nicht in seinem Heiligenschein aus Nebel. Die herabrinnenden Tröpfchen schienen von einem abartigen, bei einer Temperatur von fast null Grad unverständlichen Schweißausbruch zu zeugen. Vom Kirchturm der Charité schlug es halb drei. Langsam schritt Herr Foitrasson in der Richtung weiter, die seinem Gefühl nach zum Quai Tilsitt führte.
Hector Foitrasson war der Sohn eines Beamten, der in der öffentlichen Registratur eine ehrenhafte Laufbahn durchmessen hatte, aber nicht mehr. Als der Sohn nach der Reifeprüfung vor der Berufswahl stand, erklärte Jules Foitrasson, in einer überwiegend gewerbetreibenden Stadt müsse man sich ohne Zögern dem Großhandel zuwenden. Nur dort bestehe Aussicht, nicht dahinzuvegetieren, wie es ihm im Staatsdienst beschieden gewesen war. Hector absolvierte drei Jahre Handelshochschule und errang ein gutes Abschlußzeugnis. Die Hochschule verschaffte ihm eine Anstellung in der zu Recht berühmten Firma Tapaque-Fiarde, wo er den Posten eines Verkäufers erhielt. Dort begegnete ihm der glückliche Zufall in Gestalt von Fräulein Mathilde Tapaque-Fiarde, der Tochter des Hauses, die das Unternehmen erben sollte, da ihr ältester Bruder eine Karriere in der Seidenindustrie ausgeschlagen hatte und Marineoffizier geworden war und ein zweiter Bruder mit zwölf Jahren an Hirnhautentzündung gestorben war. Herr Just Tapaque-Fiarde mußte also, um die Erbfolge zu sichern, auf einen Schwiegersohn bauen.
Unglücklicherweise war Mathilde Tapaque-Fiarde nicht mit einem ansprechenden Äußeren gesegnet. Sie hatte ein alltägliches Gesicht mit großer, leicht verbogener Nase und vorquellenden Augen, ein flaches Hinterteil und einen schlaffen Hängebusen (was zu sehen war). Insgesamt wirkte sie groß und männlich. Sie war nicht zum Verlieben, aber sie besaß etwas, das für einen bestimmten Typ von Männern einem starken Aphrodisiakum gleichkommt, nämlich Vermögen, bestehend aus einem Drittel des Familienbesitzes (sie hatte noch eine Schwester): die größte Seidenfirma im damaligen Lyon, ein sehr schönes Landhaus in Irigny, ein großes Gut in den Dombes mit vierhundert Hektar Wald und Wiesen, einen von den Urgroßmüttern her angehäuften Schatz an Schmuckstücken, mehrere Mietshäuser (darunter auch das am Quai Tilsitt). Schließlich ein ansehnliches Paket Wertpapiere, das seine Existenz der bei den Tapaque-Fiarde vererbten Finanzpolitik verdankte. Die Jahresgewinne wurden der unaufhörlich steigenden Reserve zugeschlagen. Die Familie lebte vom Ertrag dieser Reserve, ohne ihn je ganz auszugeben. Angesichts dieser zweiten Spartätigkeit konnte das Familienoberhaupt selbstgefällig äußern: »Dieses Jahr haben wir etwas beiseite gelegt«, und er sagte es jedes Jahr. Kurz: Mathildes zukünftiges Vermögen ruhte auf einer sicheren Geldgrundlage, die in den Panzerschränken eifersüchtig gehütet wurde und den Erben nur angenehme Überraschungen bereiten konnte.
Obwohl Mathilde häßlich oder zumindest reizlos war, litt sie mit zwanzig Jahren nicht unter Komplexen. Sie war fest entschlossen zu heiraten und viele Kinder zu bekommen. Vor allem wollte sie nur einen schönen Mann ehelichen. Das war ihre fixe Idee, und sie hatte ja auch die Mittel, sich ihren Wunsch zu erfüllen. Wozu hätte die große, mühevolle Arbeit und der angesammelte Reichtum ihrer Vorfahren gedient, wenn sie sich nicht hätte kaufen können, was ihr am meisten am Herzen lag? Männliche Schönheit fand sie hinreißend.
Ihre Wahl fiel auf Hector Foitrasson, der diese Schönheit besaß mit einer Größe von 1,80 m, breiten Schultern, vollem schwarzem Haar, regelmäßigen Gesichtszügen und einem ernsthaften, entschlossenen Ausdruck. Man mochte Mathilde noch so lange vorhalten, er sei nur ein kleiner Angestellter, der sich noch nicht bewährt hatte – sie erwiderte unerschütterlich: »Der oder keiner!« Ihren Eltern gegenüber setzte sie hinzu: »Wollt ihr eigentlich Enkel oder nicht? Von einem krummen oder bleichsüchtigen Kerl lasse ich sie mir nicht machen.« Man redete ihr zu, es gebe doch viele schöne Männer in den guten Lyoner Familien. »Wenn sie schön und reich sind«, entgegnete sie, »schulden sie mir nichts und werden mich ständig demütigen. Ich mache mir keine Illusionen, das dürft ihr mir glauben, und ich habe mir die Sache gut überlegt.« Es ging nicht anders – sie setzte ihren Willen durch. Ihr Vater konnte seine Bewunderung für ein so willensstarkes Mädchen nicht verhehlen. »Sie ist eine echte Tapaque-Fiarde! Das hat sie von meiner Mutter, die immer das Hauswesen regiert hat und bis zum Alter von zweiundneunzig Jahren gefürchtet war.«
In Irigny, wo man sich im Park absondern konnte, wurde ein großer Ball veranstaltet. Mathilde warf sich Hector buchstäblich an den Hals. Sie forderte ihn zum Tanz auf und ließ keinen Augenblick von ihm ab. Der Tanz war nur ein Vorwand, um ihn in einen Laubengang zu ziehen, wo niemand stören würde. Dort brachte sie im Schutze der Nacht ihr Anliegen vor.
»Hector, Sie sind schön, Sie gefallen mir. Ich frage Sie nicht, ob ich Ihnen gefalle; das ist unwichtig.«
»Aber …« stammelte Hector.
»Lassen Sie mich ausreden! Sie werden meine Eltern um meine Hand bitten. Sie werden keinen Korb bekommen, dafür verbürge ich mich. Und ich mache aus Ihnen einen der bedeutendsten Männer in Lyon. Ich verlange keine sofortige Antwort. Überlegen Sie es sich eine Woche lang. Wie alt sind Sie?«
»Fünfundzwanzig.«
»Ich werde in drei Wochen einundzwanzig. Wir passen also im Alter zusammen. Für Sie sieht die Sache folgendermaßen aus: Wenn Sie sich im Seidenhandel als fähig erweisen, haben Sie die Aussicht, mit fünfzig Jahren, also als alter Herr, Prokurist zu werden. Wenn Sie mich heiraten, fangen Sie mit fünfundzwanzig Jahren als Millionär an.«
»Ich bin überrascht …« stotterte Hector.
»Das glaube ich gern«, entgegnete Mathilde. »Und jetzt lassen Sie sich küssen! Ich habe wahnsinnige Lust dazu! Wir sprechen nicht mehr darüber, ehe Sie sich entschieden haben. Teilen Sie mir persönlich Ihren Beschluß mit, mit Ja oder Nein. Wenn Sie nicht dumm sind – und ich halte Sie nicht für beschränkt –, lautet Ihre Antwort ja. Zahllose Männer in dieser Stadt wären gern an Ihrer Stelle. Aber Sie habe ich gewählt. Und ich verpflichte mich, daß Sie nicht unglücklich werden mit mir. Sollte ich dieses Versprechen vergessen, so brauchen Sie mich nur zu mahnen: ›Mathilde, erinnere dich an Irigny unter dem Laubengang.‹ Und nun will ich Sie noch einmal küssen, und dann gehen wir zu den Gästen zurück.«
Zu Hector Foitrassons Entlastung ist zu sagen, daß er noch nicht ans Heiraten gedacht und auch die Ehe nicht in ehrgeizige Pläne eingebaut hatte. Er meinte wohl, er würde eines Tages heiraten und möglichst eine gute Partie machen, aber das stand noch in ferner Zukunft. Er lebte bei seinen Eltern, hatte keine großen Bedürfnisse, keine Geldsorgen, und sein Schätzchen Marinette genügte ihm als Mätresse vollauf. Er spielte im Rameau-Saal Billard und bevölkerte als begeisterter Verehrer des Belcanto regelmäßig den Olymp des Stadttheaters. Außerdem war er ein vielbegehrter Tänzer. Kleinbürgerliche Mütter mit heiratsfähigen Töchtern umschwärmten ihn. Sonntags fuhr er mit dem Motorboot zur Ile-Barbe und mietete ein Boot. Kilometerweit ruderte er, während Marinette hinten im Boot lag und ihr kristallklares Lachen erschallen ließ, das von der Wasseroberfläche widerhallte. In Gartenwirtschaften am Flußufer aßen sie zusammen gebackenen Fisch und heiße Würstchen und fuhren abends mit der Vorortbahn zurück. Sein Leben war völlig sorgenfrei, und vorläufig wünschte er sich nichts Besseres. Mathilde Tapaque-Fiardes Erklärung platzte in sein Leben wie ein Donnerschlag aus heiterem Himmel. Hector war viel zu verdutzt, als daß er sich allein entschließen konnte. Als guter Sohn wollte er seine Eltern um Rat fragen. Er malte sich die Verblüffung seines Vaters, des ärmlichen Rentners, aus, wenn er sich eines Abends vor die dampfende Suppenschüssel setzen und kaltschnäuzig verkünden würde: »Ich kann Millionär werden, wann ich will. Es würde mich höchstens sechs Monate kosten.« Genauso geschah es.
»Ich möchte dich bitten, dich nicht über uns lustig zu machen«, entgegnete Foitrasson sen. streng. »Wenn du Witze reißen willst, dann über ein anderes Thema.«
»Es ist kein Witz, bestimmt nicht!«
Hector berichtete von seinem Tête-à-tête mit Mathilde im Laubengang.
»Sie hat dich aufs Glatteis geführt, mein Junge, und du gehst ihr wie ein unerfahrener Tölpel in die Falle. Diese reichen Mädchen sind zu allem fähig.«
»Aber sie hat mich geküßt, Vater!«
»Auch so eine Laune von ihr. Ich kenne die Lyoner Millionäre nur zu gut, mein Sohn. Diese Leute setzen ihre Verkaufsverträge aufs i-Tüpfelchen genau auf und feilschen um Pfennige bei den Eintragungskosten. Sie legen dir kein Vermögen zu Füßen.«
Hector brachte nicht über die Lippen, daß Mathilde Tapaque-Fiarde alles andere als hinreißend war. Aus Scham.
»Ja, aber«, mischte sich Frau Foitrasson ein, »wenn es wahr wäre? Mein Sohn ist so hübsch und wohlerzogen, daß sich ein Fräulein aus der großen Welt durchaus in ihn verlieben kann.«
»Ich glaube es nicht«, erklärte der Vater.
Diese Ungläubigkeit ärgerte Hector. Hier nahm die Heirat ihren Ursprung.
»Vater, du brauchst nur eins zu tun. Mach dich stadtfein, zieh dein bestes Paar Handschuhe an und bitte für mich um die Hand von Fräulein Tapaque-Fiarde. Ich wette ein Jahresgehalt, daß du nicht umsonst gehst.«
»Ich werde mich nie einer Demütigung aussetzen, die mir bis an mein Lebensende die Schamröte ins Gesicht treiben würde.« Sein Starrsinn war nicht zu brechen. Schließlich meldete sich Frau Foitrasson:
»Dann gehe ich eben!«
»Du machst dich lächerlich, armer Schatz! Ich jedenfalls will mit der ganzen Geschichte nichts zu tun haben.«
Frau Foitrasson hielt es trotz allem für vorsichtiger, schriftlich um einen Besuchtstermin zu bitten. Postwendend erhielt sie einen ausgesucht höflichen Brief mit Angabe des Tages und der Stunde. Angetan mit ihrem Sonntagsstaat, aber doch leicht zitternd, begab sie sich zum Quai Tilsitt. Mathildes Mutter empfing sie sehr einfach und freundlich:
»Ich glaube, ich weiß, was Sie herführt. Es geht doch um unsere Kinder, nicht wahr?«
Frau Foitrasson brach in Tränen aus.
»Gnädige Frau«, schluchzte sie, »ich wage nicht zu sagen, warum ich gekommen bin.«
»Aber beruhigen Sie sich doch. Ich bin vorbereitet. Es ist ja auch Mathildes Idee … Ich werde sie übrigens rufen.«
Das war vorher abgesprochen, Mathilde wartete im Nebenzimmer. Sie trat in den Salon, schritt sogleich auf Frau Foitrasson zu und schloß sie in die Arme.
»Mutter! Ich bin so glücklich, wirklich glücklich. Ich werde Ihnen eine gute Tochter sein.«
Frau Foitrassons Tränen flossen von neuem. Unter Schluchzen stammelte sie immerzu: »Mein liebes Kind! Mein liebes Kind!« Sie ließ sich nur schwer beruhigen. Mathilde geleitete sie am Arm bis zur Haustür. Der Pakt war besiegelt. Drei Monate später heiratete Hector Foitrasson Mathilde Tapaque-Fiarde. Die Hochzeit wurde mit großer Pracht gefeiert, um den Stand des Bräutigams aufzuwerten. »Sie läßt es sich etwas kosten«, tuschelten die Freundinnen der Braut, »aber sie hat für nächtliche Kurzweil gesorgt. Einen echten Frauenheld leistet sie sich!«
Als Beamtensohn war Hector zur Achtung vor Verträgen und Verpflichtungen erzogen worden. Reichtum brachte Pflichten mit sich, Lasten wäre zu viel gesagt. Er machte gewissenhaft das, was man von ihm verlangte, und zwar zuerst innerhalb der kürzestmöglichen Zeit Mathilde acht Kinder, hübsche, gesunde Kinder. Eine verdienstliche Tat, die bei den Tapaque-Fiarde beifällig aufgenommen wurde. Aber er ließ durchblicken, seine Kräfte seien erschöpft. Mathilde, die erreicht hatte, was sie wollte, gestand ihm das gern zu und ließ ihm eine sexuelle Freiheit, von der er behauptete, er könne nichts mit ihr anfangen, was durchaus glaubhaft war, denn er hatte nie große Forderungen an sie gestellt und war in letzter Zeit sichtlich etwas unlustig. Trotzdem teilten sie weiterhin das Lager, huldigte Mathilde doch einigen sehr strengen christlichen Grundsätzen, zum Beispiel: Der Gatte muß bei der Gattin schlafen, das ist die Grundlage des durch das Sakrament ratifizierten Vertrags. Was daran eigentlich christlich sein soll, ist nicht verständlich, aber das Ehebett knüpft zweifellos die Familienbande und die Interessengemeinschaft enger. Ist das Bett zum neutralen Gelände geworden, so kann man sich dort in aller Ruhe über das Wohlergehen des Hauswesens und der Landgüter unterhalten, über Geldanlagen, Kindererziehung, gesellschaftliche Verpflichtungen, Dienstboten usw. Eheleute mit getrennten Schlafzimmern nehmen Junggesellengewohnheiten an, ihre Persönlichkeiten entwickeln sich getrennt statt ineinander aufzugehen. Diese Verschmelzung vollzieht sich am besten durch gegenseitige Nähe, im nächtlichen Schweiß und beim Erschlaffen der Leiber. Daß das Körperliche im Menschenleben überwiegt, wird im Bett ununterbrochen deutlich, gerade bei den banalen Zügen eines engen Zusammenlebens. Mathilde versuchte gar nicht mehr, Gefallen zu erregen, sondern ließ sich gehen. Sie trug lange, weite Nachthemden aus dickem Stoff, die wenigstens den Vorzug hatten, ihre Krampfadern und hervortretenden Venen zu verbergen. Ihre Haare flocht sie zu zwei steifen Zöpfchen, die sie mit Schnürsenkeln festband. Damit war Hector jeder Verpflichtung ihr gegenüber enthoben.
Als seine Zuchthengstaufgabe der ersten Ehejahre beendet war, hatte Hector Recht auf Ruhe und spielte nur noch die dekorative Rolle des schönen Gatten und achtenswerten Familienoberhaupts. Das entsprach seinen Wünschen, und er hätte sich sehr gut mit dem verpflichtungsfreien Ehebett abgefunden, wenn Mathilde nicht eine Eigenheit besessen hätte, die seinen Geruchssinn beleidigte: sie roch nach gekochtem Lauch. Man stelle sich den schalen Dunst einer Gemüsesuppe vor, die im Herdwinkel herumsteht, ehe sie wieder aufgewärmt wird. Hector hatte von jeher Lauch abscheulich gefunden. Von Zeit zu Zeit rauchte er eine Zigarette, um sich vor dem alles durchdringenden Geruch zu retten. Eigentlich schmeckte ihm der Tabak nicht, er rauchte nur nachts. Zu Marinettes Zeiten hatte er nie geraucht, seine kleine, blonde, rundliche Freundin hatte nach frischgemähtem Gras und unter den Achseln nach Farnkraut gerochen.
Um Mathilde Foitrasson Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, ist zu sagen, daß sie ihr Versprechen vom Laubengang hielt und nie unausstehlich war, sondern Hector Dank wußte, daß er sie mit einem Schwarm kleiner Tapaque-Fiardes gesegnet hatte. Vollkommen glücklich war sie, wenn sich die Kleinen an den Händen faßten und wie Orgelpfeifen aufgereiht vor ihr standen. Die öffentliche Meinung mußte zugeben, daß sie ihre Wette, eine dauerhafte Verbindung mit einem schönen Mann einzugehen, gewonnen hatte, obwohl jedermann geunkt hatte, diese Dummheit würde bedauerliche Folgen zeitigen. Es fehlte ihr nicht an Schwung und Tatkraft, sie stand mehreren Wohltätigkeitsvereinen vor. Im erzbischöflichen Palais war sie hoch geachtet und galt etwas in der Lyoner Gesellschaft. Kurz: Sie hatte den Nachteil ihrer körperlichen Reizlosigkeit so klug überwunden, daß sie es weiter gebracht hatte als ehemalige Jugendfreundinnen, die viel mehr Schönheit mitbekommen hatten, deren Ehen aber gescheitert waren. Ihre Reize waren längst verblaßt. Die einen, einst jugendfrisch und mollig, waren Matronen mit breiten Hüften und dicken, über die Stühle quellenden Hinterteilen. Die anderen waren eingetrocknet und hatten eine Lederhaut.
Mathilde, die nichts zu verlieren hatte, gewann zusehends. Mit fünfundvierzig Jahren bot sie einen durchaus erfreulichen Anblick. Es war ihr bestes Alter; innere Gelassenheit und eine leichte Gewichtszunahme glätteten ihre früher zu eckigen Züge.
Um drei Uhr morgens langte Hector Foitrasson nach erregenden Stunden endlich zu Hause an. Im Schlafzimmer schlummerte Mathilde tief und fest und schnarchte leise, wie es ihm vertraut war. Der bekannte Lauchdunst schlug ihm entgegen und überlagerte die feinen Düfte, die er bei Loulou Biche eingeatmet hatte, obwohl er versucht hatte, sie mit dem Taschentuch vor der Nase auch im Nebel zu bewahren. Er schloß sich ins Badezimmer ein, um eine Zigarette zu rauchen, und blies den Rauch kräftig durch die Nase. Das war das sicherste Mittel zum Schutz seiner Geruchsnerven. Er hatte es schon mit Eukalyptusöl versucht, aber dann verströmte er einen unangenehmen Apothekengeruch. Als seine Naseninnenwände mit Nikotin tapeziert waren, legte er sich zu Bett und schlief ein.
»Der Schenkel ist göttlich! Ganz und gar göttlich!«
Hector Foitrasson hatte das, was sein Unterbewußtsein bedrängte, im Schlaf laut ausgesprochen, seine Bettgenossin wachte auf. Träume waren bei ihm etwas Außergewöhnliches, denn er hatte eine gute Verdauung. »Sollte er anfangen, im Schlaf zu reden? Das wäre neu.« Aber Mathilde tröstete sich mit dem Gedanken, daß sie, als Großmutter, nichts zu befürchten hatte und daß nichts ihre Lebenspläne stören könnte, höchstens ein Krankheitsfall. Zum Glück schnarchte Hector gleichmäßig und reglos ohne angsterfüllten Schluckauf. Von dieser Seite drohte keine Gefahr. Mathilde schlief wieder ein.
Draußen herrschten immer noch dichter Nebel und undurchdringliche Stille. In ihren warmen, abgedichteten Häusern schliefen die Lyoner wie Murmeltiere jenen tiefen, ruhigen Schlaf der Stunden vor dem Morgengrauen. Das Gewerbetreiben der Großstadt begann erst um neun Uhr, wenn Büros und Geschäfte aufmachten. Aber schon lange vorher klingelten Wecker im Dunkeln, flammten Lichter an den Fourvière- und Croix-Rousse-Hängen auf. Auf den Kochern brodelte der Kaffee, den die Arbeiter hastig hinunterstürzten, ehe sie auf die kalte Straße eilten, um die ersten Straßenbahnen und Omnibusse, die sie an ihre Arbeitsplätze brachten, zu erwischen. Auf dem Quai Saint-Antoine legten die Gemüsegärtner schon um fünf Uhr früh ihre Waren aus, damit sich Kleinhändler und Restauranteinkäufer mit Obst und Gemüse eindecken konnten. Ganze Warenposten wurden versteigert. Die Kneipen zwischen dem Pont Tilsitt und dem Pont du Change boten Suppe mit Käsefäden und Wursträdchen feil und schenkten belebenden Weißwein und Treberschnäpschen aus. Bleiches Dämmerlicht begann das Treiben zu erhellen.
Loulou Biches bewundernswerter Schenkel war wie ein zweiter Polarstern an den Lyoner Himmel gerückt. Noch ahnte niemand etwas, auch Hector Foitrasson nicht, dessen Leben doch vom Erscheinen dieses Gestirns zutiefst aufgewühlt werden sollte. Obwohl die Stadt noch im Bann des Nichtwissens lag, waren die Ereignisse in Gang gekommen, wahrscheinlich wegen des Glatteises, aber auch wegen der Ungeschicklichkeit eines leicht beschwipsten Notars, der so begehrlich nach den wollustverheißenden Reizen seiner Beifahrerin geschielt hatte, daß er kopflos geworden war. Oft spielt das Schicksal an der Bande, wie beim Billard, um die Menschen zu überraschen. Die Bande, die es sich an jenem Tag ausgesucht hatte, war ein vollkommen gestalteter Schenkel von seltener Samtigkeit, der weich und federnd die Kugeln in verschiedenen Richtungen zurückschicken und zahlreiche Querschläger verursachen sollte.
Vielleicht erscheint es abwegig, daß ein verlockender weiblicher Körperteil zum Ausgangspunkt einer Geschichte wurde, die sich in Lyon zutrug, einer Stadt, die als arbeitsam, seriös, fromm, ja ein bißchen zugeknöpft gilt, »die Stadt der Geizkrägen und der Halsabschneider«, wie Baron Ruffieu bei schlechter Laune sagte. (Er konnte seine Lebenshaltung nur mit geliehenem Geld bestreiten, und trotz seines Titels waren immer weniger Leute geneigt, ihm etwas zu borgen.) Wie überall schlummern aber in Lyon die Leidenschaften und brechen plötzlich aus. »Dort sind die Alkoven heiß«, bemerkte die schöne Patata, die die Sitten ihrer Zeitgenossen besser als sonst jemand beobachtete und kommentierte. Ihr zufolge vergnügte sich die ungeheuer reiche Stadt Lyon, die Stadt mit den goldenen Eingeweiden, die sich über heimlich aufgehäuften Besitz kauerte, mit Seitensprüngen in der besten Gesellschaft, bei denen in skandalöser Weise Frauentausch betrieben wurde, und zwar in den bekannten, seit Vorväterzeiten dem Handel großen Stils verschriebenen Familien wie den Brécard-Peytrachon, den Dupont-Bouvine, den Tapaque, den Roustagnat, den Pétavitte, den Schlumberg, den Chuintte usw. Germaine de Patatas Behauptungen waren jedoch mit Vorsicht zu genießen, denn sie warf sich etwas zu auffällig zur Verteidigerin der tudendsamen Schönheit auf. Es war stadtbekannt, daß sie ihren Gatten aus ihrem Bett verjagt hatte, und niemand hatte je gehört, daß sie sich einen Nachfolger geholt oder irgend jemandem die geringste körperliche Gunst gewährt hätte. Dabei begeisterten sich für ihre imposante Gestalt noch einige Bewunderer, die dem weiblichen Ideal »ein prachtvolles Weibsstück« aus den Jahren um 1900 treu geblieben waren. Wer einsame Nächte so sehr liebte, konnte nur tendenziös über diejenigen Frauen sprechen, die lieber ihre Nächte mit anderen teilten und dabei ein Vergnügen empfanden, das die Einsame nie erlebt hatte. Die sogenannten »Sitten« beruhen auf dem gebieterischen Zwang der Natur, und jeder folgt der seinen, wohin sie ihn führt. Das wird sich aus der Fortsetzung der begonnenen Geschichte ergeben. »Der Schenkel ist göttlich!« murmelte Hector Foitrasson noch zwei- oder dreimal im leichten Schlummer. Im Traum hielt er den zauberhaften Schenkel wieder auf seinen Knien und atmete seinen berauschenden Duft ein.
II Der Erzähler stellt sich vor
Ehe ich die Chronik fortsetze, deren Anfang der Leser eben erfahren hat, stelle ich mir mehrere Fragen. Mit welchem Recht spreche ich über meine Zeitgenossen so unverblümt, wie es ein möglichst genauer Bericht von ihren Taten und Gedanken verlangt? Muß man nicht schließen, ich übte Vergeltung, die sich nur mit verletzter Eitelkeit oder einer verfehlten Karriere erklären ließe? Tatsächlich beobachtete ich häufig, daß energielose und verkrachte Existenzen jenen Mitmenschen nicht verzeihen, die ein Werk geschaffen oder ihre Unternehmungen zu gutem Ende geführt haben. Sie setzen sie systematisch herab, sie erklären jeden Erfolg mit niedriger Gesinnung oder Bloßstellung. Hört man sie, so müßte man meinen, Reinheit bestehe darin, daß man nichts wagt oder in allem scheitert. Einen solchen Trost gönne ich ihnen neidlos.
Bin ich aber berechtigt, der Boshaftigkeit des Publikums Charakterbilder auszuliefern, die zwar unter falschem Namen gezeichnet, aber doch zuweilen erkennbar sind? Darf ich mir erlauben, als kleiner Provinz-Saint-Simon am Ende meines langsam sich rundenden Lebens, doch immerhin zu meinen Lebzeiten, Memoiren über meine Epoche und meine Bekannten zu veröffentlichen? Werde ich mir nicht viele Feinde machen, obwohl ich mich immer bemühte, keine Feinde zu haben, und seit fast vierzig Jahren als durchaus liebenswürdiger, gegebenenfalls hilfsbereiter Mensch gelte, der seine Freunde nicht verrät?
Von vornherein sei festgehalten, daß mich kein Groll antreibt, daß ich mich an niemandem rächen muß. In den Kreisen, in denen ich mich bewegte, wurde ich so zuvorkommend behandelt, wie ich es mir nur wünschen konnte, mein Leben ist planmäßig verlaufen und hat mir weitaus mehr Freuden als Leiden beschert. Mein Selbstgefühl wurde in der schmeichelhaftesten Weise befriedigt, weit mehr, als es meinen Verdiensten entsprach. Ich nehme mich selbst nicht übertrieben wichtig, Einbildung liegt mir nicht.
Es war mir stets ein leidenschaftliches Vergnügen, meine Umgebung zu beobachten, da für mich die Taten der Menschen das unterhaltsamste Schauspiel bilden. Mein Gedächtnis für menschliche Gefühle und Laufbahnen ist unbestechlich. Noch nach dreißig Jahren könnte ich vertrauliche Mitteilungen, die ich in Augenblicken seelischer Aufgeschlossenheit erhielt, Wort für Wort wiederholen, wobei der oder die Betreffende, die mir einst ihr Herz ausschütteten, erröten und schwören würden, nie so etwas ausgesprochen zu haben, obwohl ich die Begleitumstände, den Ort, die Zeit und das Datum genau anzugeben vermag. Schließlich würden sie mir vielleicht glauben. Unaufhörlich und mit unglaublicher Leichtigkeit widersprechen sich die Menschen selbst, zuweilen schon nach einer Stunde. Nur wenige Personen kenne ich, die nie den Umständen oder ihrem Augenblicksinteresse entsprechend ihre Ansichten wechselten und die widersprüchlichsten Behauptungen verfochten. Ich würde mich mit fast allen meinen Bekannten entzweien, wollte ich ihnen gewaltsam ihre aufeinanderfolgenden Erscheinungsbilder, die sie längst vergessen haben, vor Augen stellen. Jetzt, da ich nur noch von Erinnerungen lebe, möchte ich als letzte Zerstreuung die Elemente der Vergangenheit zu einem kleinen Fresko der Lyoner Gesellschaft zusammenstellen, wie ich sie in einem bestimmten Rahmen und Milieu kennengelernt habe. Bleibt die Frage der Darstellungsform.
Ich habe gelesen, der Romanschriftsteller schlüpfe in die Haut seiner Gestalten – damit war die für meinen Bericht geeignete Form gefunden. Im vorhergehenden Kapitel konnte der Leser bemerken, daß ich mich nicht scheute, geheime Gedanken von Herrn Foitrasson oder Herrn Crebbs zu enthüllen. Ich habe mir vorgenommen, in dieser Art fortzufahren. Nichts ist so spannend, wie die Menschen äußerlich darzustellen und zugleich innerlich zu analysieren, wobei sie häufig in Gegensatz zu sich selbst geraten. Dazu muß man sich in sie hineinversetzen können, was nur wenigen gegeben ist, denn die meisten Menschen sind mit sich selbst so sehr beschäftigt, daß sie ihren Mitmenschen keine Aufmerksamkeit schenken.
Anders als viele Erzähler habe ich die auftretenden Personen selbst mehr oder weniger genau gekannt. Fast alle vertrauten mir Geheimnisse oder Geständnisse an, das übrige erfuhr ich von Dritten, siebte jedoch ihre Aussagen sehr sorgfältig, denn ich weiß nur zu gut, wieviel geklatscht wird, vom Unwahrscheinlichsten bis zum Ungeheuerlichsten. Auch in der besten Gesellschaft wird gehetzt, man setzt seine besten Freunde herab oder die, die man dafür ausgibt. Zwischen dem Tratsch der Dienstboten und dem der Vornehmen besteht nur ein Milieuunterschied. Alles, was ich nicht sicher wußte, schied ich daher aus und glaube, der Wahrheit so nahe wie möglich gekommen zu sein. Ich trieb die Gewissenhaftigkeit sogar so weit, daß ich meine Antipathien hintanstellte. Sie richten sich weniger gegen Leute, die mir schadeten (dazu waren nur wenige fähig), als gegen solche, die mich mit ihrer Prahlerei und ihrem lächerlichen Dünkel unerhört ärgerten und reizten. Ich weiß, daß Eitelkeit die vorherrschende Leidenschaft der Menschen ist und auf jedem Gebiet auftritt, in der Liebe, in Geldgeschäften, im Selbstbestätigungsdrang usw. Ich habe viele aufgeblasene, hohle Angeber gekannt. Gelegentlich werde ich sie anstechen. Dann werden sie den falschen Dampf ablassen, wie die Luft leise zischend aus einem geplatzten Schlauch entweicht.
Mein Name ist Gaël-René Chimney d’Oro (der italienische Namensbestandteil stammt aus frühen Familienbeziehungen angeblich zur Zeit der Italienischen Kriege im 16. Jahrhundert, als zwischen Mailand und Lyon enge Beziehungen entstanden). Für gute Freunde bin ich einfach Gaël, für ebensolche Freundinnen »mein kleiner Gaël«, und »Herr Konsul« oder »lieber Konsul« für die offiziellen und gesellschaftlichen Kreise, zu denen mir meine Stellung Zugang verschafft. Ich bin tatsächlich Ehrenkonsul eines südamerikanischen Staates, dessen Name nichts zur Sache tut. Diese im großen ganzen ehrenamtliche Würde erlaubt es mir, in der vornehmsten Gesellschaft der Stadt zu verkehren. Wenn man über hundert bedeutende Leute freundschaftlich grüßt und ungefähr tausend andere mit einem Hauch von Wohlwollen, darf man sich schmeicheln, in einer fünfhunderttausend Seelen zählenden Stadt etwas zu gelten. Ich werde zu wichtigen Anlässen in die Präfektur, ins Rathaus und zum Militärgouverneur eingeladen, ich bin Mitglied der Lyoner Universität (in meiner Eigenschaft als Zeitungsdirektor), des Rotary- und des Automobilclubs, dazu Präsident einer Gemäldegalerie. Ich gehöre zum Verwaltungsrat von zehn Kunst- und Sportvereinen, zur Jury von Schönheitswettbewerben usw. Schließlich unterhalte ich die besten Beziehungen zum erzbischöflichen Palais, da ich der Religion Zugeständnisse mache, die mich wenig stören. Auch religiös Gesinnte haben ja ein so dehnbares Gewissen, daß ihnen für ihr persönliches Verhalten große Freiheit bleibt. Nur wenn es um den Anschein geht, sind sie Prinzipienreiter.
Da ich keine Enkel habe, fehlt es mir an Beziehungen zur jüngsten Generation, die mich als rückständigen Mummelgreis betrachtet. Dagegen beobachte ich stets mit Vergnügen die frischen Mädchenjahrgänge. Schon mit fünfzehn Jahren haben sie eine entzückende Art, ihren spitzen Busen zu betonen, die Hüften zu schwenken und mit klappernden Absätzen entschlossen ihrem Geschick entgegenzugehen. Ich muß schon sagen: sie verstehen ihre Schaufenster herzurichten, die kleinen Frauenzimmer! Noch so lange kann ich mir einreden, sie seien meist strohdumm und ich würde mich nicht lange mit ihnen vertragen – ich bin deshalb nicht weniger empfänglich für ihren reizenden Anblick. Früher berührte mich weibliche Jugendlichkeit nicht so stark wie heute. Damals war ich selbst jung, sozusagen auf gleichem Fuß mit den Mädchen, und hielt die Liebe für eine Art Freihandel, für einen Tausch, bei dem jeder auf seine Rechnung kommt. Jetzt im Abstand der Jahre sehe ich, daß ein junger, unverdorbener, fester Körper das schönste auf der Welt ist, das einzige, das Bewunderung verdient. Wenn auch das Köpfchen hohl ist, so ist das Äußere vielleicht um so rührender. Schönheit ist ja so vergänglich; es ist völlig normal, daß sie bei jungen Mädchen noch von Dummheit begleitet ist. Der köstlichste Reiz liegt im ersten Samt, im ersten Flaum ihrer Jugend, und der erfahrene Liebhaber verlangt nicht mehr.
Meine Hinneigung zu den Mädchen veranlaßt mich zu Nachsicht den heutigen jungen Männern gegenüber. Der jetzigen Jugend wird vorgeworfen, sie glaube nichts und habe keine Ideale. Sollten wir nicht zuerst unsere Schuld bekennen, ehe wie sie anklagen? Wir wurden in eine friedliche und beständige, langsam lebende Welt hineingeboren, die den Menschen Zeit zum Träumen und Genießen ließ. Zweimal verheerten wir diese Welt mit Blut und Feuer und erreichten schließlich nichts als Verträge, die den ursprünglichen Kriegszielen vollständig widersprechen. Und jetzt stehen wir vor der furchterregenden Atomzukunft.
Ich habe den Eindruck, daß ich aus einer Welt scheiden werde, die viel mehr in Unordnung und von Gefahren bedroht ist, als sie es in meinen jungen Jahren war. Kein Anlaß, stolz zu sein oder Lektionen zu erteilen. Die einzigen nützlichen Lehren kann man aus unseren Fehlern und Irrtümern ziehen. Ich wünsche unseren Nachkommen, sie mögen von apokalyptischen Schrecken verschont bleiben. Aber wer könnte nach zwei Weltbränden – in dreißig Jahren zehn Jahre Krieg – beschwören, die entsetzliche Gefahr sei auf ewig gebannt? Ich bin Junggeselle, meines Wissens ohne Nachkommen, und beglückwünsche mich zuweilen, daß ich keine dem Moloch der menschlichen Dummheit anheimfallenden Kinder in die Welt gesetzt habe.
Geboren und aufgewachsen bin ich am Boulevard des Belges in unserem Stadthaus, dessen Rückfront zum Parc de la Tête d’Or hin liegt. Kindermädchen und Hauslehrer erzogen mich in meiner Kindheit. Dann wurde ich den Jesuiten anvertraut, weil es meine Mutter wünschte. Sie nahm die Erziehung ihres einzigen Sohnes in die Hand. Ihrer Ansicht nach ist ein von den Jesuiten geschulter Geist in der Lage, sich im Gewirr spitzfindiger Probleme nicht zu verlieren, sondern sich zu seinem Vorteil herauszureden. Im Ersten Weltkrieg beendete ich die Schule. Erst 1918