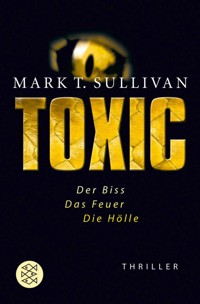8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mitglieder einer radikalen Organisation überfallen an Silvester den exklusiven Jefferson-Club in Montana und nehmen die sieben reichsten Männer der Welt als Geiseln. Ihr Motto: Gerechtigkeit. Ihr Plan: Ein öffentliches Eingeständnis ihrer Schuld. Ihre Forderung: Überweisung des Vermögens auf ein Konto der Organisation. Um ihr Anliegen zu unterstreichen, töten sie zwei Menschen. Für Mickey Hennessy, den Sicherheitschef des Clubs, beginnt ein Wettlauf mit dem Tod, denn seine drei Kinder befinden sich ebenfalls in der Gewalt der Killer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mark T. Sullivan
LIMIT
Reich – Gewissenlos – Tot Thriller
Aus dem Amerikanischen von Irmengard Gabler
Fischer e-books
Dem kapitalistischen System wohnt ein Hang zur Selbstzerstörung inne.
Joseph Schumpeter
1
Gegen elf Uhr an diesem Silvestermorgen setzte der Winter ein. Der Wind blies von Norden und brachte klirrende Kälte. Bleischwere Wolken wälzten sich heran und warfen einen blassen, kristallinen Schimmer über die Westflanke der Jefferson Range, einer Gebirgskette im Südwesten Montanas.
Drei Transporthubschrauber flogen in östlicher Richtung auf die fernen Berge zu, über ein Tal hinweg, das aus Farmland bestand und von den Windungen eines Flusslaufs durchzogen war. Als sie sich den Gebirgsausläufern näherten, setzten Schnee und Hagel ein. Die Sicht wurde zunehmend schlechter. Der Pilot des vordersten Vogels wurde nervös.
»Wir kriegen eine Menge Schnee und Seitenwind, General«, sagte er ins Mikrophon, die Augen auf den harten Kerl neben ihm gerichtet, der von Kopf bis Fuß in einen weißen Tarnanzug gehüllt war und einen Klettergurt umgelegt hatte. »Sollen wir die Sache wirklich durchziehen?«
Der General drehte ihm den Kopf zu und musterte ihn kalt. »Wir haben einen Zeitplan«, entgegnete er eisig. »Den setzen wir nicht aufs Spiel.«
Der Pilot wandte sich wieder nach vorn. Der Ausdruck in den Augen des anderen vermittelte ihm das ungute Gefühl, verzichtbar zu sein.
»Dann macht euch auf was gefasst«, sagte er schließlich.
Sie gewannen an Höhe und tauchten in die Wolken ein. Die Sicht betrug hier keine sechzig Meter mehr. Heftige Seitenwinde setzten dem Hubschrauber zu und brachten ihn ins Schlingern. Der Pilot hatte Mühe, den bockigen Vogel auf Kurs zu halten. Einige der fünfzehn Passagiere im Rumpf, ebenfalls in Tarnanzügen, fluchten leise.
»Auf dreitausend Metern wird’s noch schlimmer«, rief der Pilot zähneknirschend. »Ich kann nicht garantieren, dass ihr heil unten ankommt.«
»Überflieg die erste Landezone«, sagte der General. »Nimm die zweite.«
»Dann wird aber der Fußmarsch länger«, sagte der Pilot.
»Lässt sich eben nicht ändern«, blaffte der General.
Der Pilot ging auf Funk, gab die Order an die beiden anderen Helikopter weiter und drehte mit dem Wind nach Süden ab. Das Schlingern wurde schwächer, aber die Sicht blieb unverändert schlecht. Zweimal geriet der Hubschrauber in den dichten Wolken zu tief und hätte mit seinen Kufen fast die Wipfel der Kiefern rasiert. Trotz der eisigen Luft, die durch die Türritzen hereinzog, trat dem Piloten der Schweiß auf die Stirn und lief ihm über die Nase. Er hatte fünfzig Einsätze im Irak hinter sich und war zweimal in einen Sandsturm geraten, aber gegen diese Waschküche hier war das das reinste Kinderspiel gewesen.
Den General schien die heikle Lage nicht im Mindesten zu berühren. Der Ausdruck berechnender, grimmiger Entschlossenheit war ihm förmlich ins Gesicht geschnitten. Er warf einen Blick über die Schulter, in den Bauch des Helikopters. Säuerlicher Schweißgeruch lag in der Luft, den er nur allzu gut kannte: Soldaten, die sich ihrer Sterblichkeit bewusst wurden. Sein Blick schweifte über die Männer und Frauen auf den Bänken. In den meisten Gesichtern las er mehr oder weniger dasselbe – angespannte Erwartung.
Drei jedoch wirkten irgendwie fehl am Platz, ängstlicher, empfindlicher als die übrige Crew. Ein Mann, zwei Frauen. Sie saßen nebeneinander, warfen sich verstörte Blicke zu. Er erhaschte den Blick der Frau, die ihm am nächsten war. Anfang zwanzig. Eher niedlich als hübsch, klein und drahtig, das rotblonde Haar zu Dreadlocks gezwirbelt, die Nase gepierct.
»Alles klar, Mouse?«, fragte der General.
Mouse starrte den General an, als wäre sie eine Art Prophetin, und sagte: »Höchste Zeit, dass sie endlich für das Unheil büßen, das sie in die Welt gebracht haben.«
Zustimmendes Raunen von den anderen. Der hellblonde Bursche neben Mouse setzte mit einem starken französischen Akzent hinzu: »Höchste Zeit, dass wir ihnen Feuer unter die fetten Hintern machen.«
»Gut so, Christoph«, stimmte der General zu. »Rose? Ist dir schlecht?«
Die Braunhaarige mit der großen Nase neben Christoph stöhnte elend: »Wenn das Geschaukel so weitergeht, muss ich kotzen. Ich bin diesen Scheiß nicht gewöhnt. Ich weiß nicht, ob ich’s noch bis zur zweiten Zone schaffe.«
Das Gesicht des General wurde hart. »Reiß dich zusammen, sonst fliegst du raus.«
Rose legte stöhnend den Kopf auf die Knie. Der Blick des Generals drang tiefer in den Bauch des Helikopters und blieb auf einem massigen Schwarzen haften, dem der kahle Schädel wie ein Basketball zwischen den breiten Schultern saß.
»Truth, gleich ist es so weit«, sagte er. »Landezone zwei.«
Truth wischte sich mit seiner Boxerpranke übers Gesicht. »Sollen wir Ballast abwerfen?«
»Wir sind schon auf das Notwendigste runter. Wir müssen eben die Ärsche zusammenkneifen.«
Der Pilot rief: »Noch vierhundert Meter, General!«
Der General drehte sich wieder nach vorn und blickte durch die Scheibe. Der Schnee fiel in abertausend weißen Wirbeln auf den Steilhang, der aus mächtigen Schieferplatten bestand. Eine trügerische Angelegenheit.
»Noch hundertfünfundsiebzig Meter«, sagte der Pilot, wobei er die Anzeige auf seinem GPS im Auge behielt.
Truth und noch zwei Männer schafften etliche große, gummierte Rucksäcke vor den Ausstieg und öffneten die Schiebetüren. Frostige Luft trieb wirbelnde Flocken in die Kabine und brachte den Kieferngeruch des Waldes mit sich.
»Das da ist euer Felsen«, rief der Pilot.
Der General sah einen schmalen Felsvorsprung aus dem Wald ragen, über einer sechzig Meter tiefen Schlucht.
Er deutete auf die alten, knorrigen Kiefern, die ganz in der Nähe aus dem felsigen Untergrund wuchsen.
»Mach einen Schwenk und orientiere dich an den Bäumen«, riet er dem Piloten. »Jetzt wird sich zeigen, wie gut du wirklich in Form bist. Wenn du die hinteren Rotorblätter kappst, sind wir alle hinüber.«
Der Pilot blinzelte nervös und drückte den Knüppel nach vorn. Der Hubschrauber schwebte über dem steinernen Felsvorsprung. Ganz langsam, zitternd wie eine von Magneten gestörte Kompassnadel, kam die Nase des Vogels herum.
»Los!«, brüllte der General.
Ein paar Kletterseile wurden aus der Tür geworfen. Truth griff nach dem Spezialkarabiner an seinem Brustgurt und klinkte sich am Seil fest. Er trug einen schweren Rucksack, an den etliche Granaten geschnallt waren. Langsam glitt er nach unten. Die gesamte Truppe tat es ihm gleich. Als Letzter schulterte der General seinen Rucksack, setzte die Brille auf und seilte sich ebenfalls ab. Das Seil, an dem er hing, schaukelte heftig im Wind. Truth stabilisierte es von unten und half dem General, sich auszuklinken. Mit ausgebreiteten Armen wie ein Hochseilartist balancierte der General daraufhin über den schmalen Grat, erreichte den Hauptfelsen und kam zu einem Wildwechsel, der in den Wald führte. Nachdem sich alle Mann ohne Zwischenfall abgeseilt hatten, drehte der vorderste Helikopter ab; ein zweiter nahm seinen Platz ein, aus dem weitere Passagiere und Vorräte abgeseilt wurden.
Der General bahnte sich einen Weg durch dichtes Unterholz und sah schließlich den Fuß des Felshangs, wo sich auf einer Lichtung sein Trupp versammelt hatte. Im Schutz einer schneebeladenen Tanne zog er den Rand seiner weißen Wollmütze lang und verwandelte sie in eine Maske mit Löchern für Augen, Nase und Mund. Dann kroch er auf allen vieren unter den Baum. Mit dem Tarnzeug war er praktisch unsichtbar, und so konnte er seine Leute noch einen kurzen Moment unbemerkt belauschen, um vor der Aktion noch etwaige Schwachpunkte auszuloten.
Auf der Lichtung riss sich ein schlaksiger Bursche Ende zwanzig mit dunklem Teint und goldenem Schneidezahn einen Handschuh herunter und stellte mit der bloßen Hand den Kragen seiner Jacke auf. »Das ist kein Spiel mehr«, sagte er, dem Akzent nach aus Oklahoma. »Wir werfen ihnen den Fehdehandschuh hin, das ist wie eine Scheißkriegserklärung.«
Christoph nahm seine Nickelbrille ab und wischte den Schnee von den Gläsern. »Der General hat recht, Dalton«, sagte er. »Wir haben keine Wahl.«
Eine große, attraktive Latina um die dreißig stellte ihren Rucksack neben den beiden ab und sagte: »Sonst geht die Welt zugrunde. Was soll denn dann aus unseren Kindern werden?«
»Ich hab die Rede gehört, Emilia«, sagte Dalton. »Ich bin ja auch hier, oder nicht?«
»Wirklich, Dalton?«, meldete sich ein Pitbull von einem Kerl zu Wort, mit einem Blick wie ein Fallbeil und tätowierten Tränen unter beiden Augen. »Andernfalls zieh Leine, bevor’s hier richtig zur Sache geht. Die nächste Stadt ist ja nur – mal überlegen – vierzig Meilen weit weg.«
»Halt die Luft an, Cobb!«, schoss Dalton zurück. »Wir werden ja sehen, wer die besseren Nerven hat, wenn’s drauf ankommt.«
»Ganz genau«, sagte Cobb und sah Dalton aus schmalen Schlangenaugen an.
»Eure Schwänze könnt ihr ein andermal vergleichen«, sagte Mouse mit vor Leidenschaft bebender Stimme. »Denkt an unser Ziel!« Sie hob die Faust. »Für eine bessere Welt!«
»Ja, für eine bessere Welt!«, stimmte Christoph ihr zu. Auch er hob die Faust.
Der General lächelte.
Truth und die Leute aus dem dritten Helikopter erreichten jetzt die Lichtung. Sie schleppten die gummierten Rucksäcke hinter sich her, öffneten sie und verteilten schwarze Sterling-Maschinenpistolen und Patronengurte mit 9-Millimeter-Munition.
Der General trat aus seinem Versteck auf die Lichtung, nahm seine Waffe entgegen, lud sie und sagte: »Na schön. Dann wollen wir der Welt mal zeigen, was wir von der Dritten Front unter Gerechtigkeit verstehen.«
2
Neun Meilen weiter nördlich fielen pro Stunde zweieinhalb Zentimeter Neuschnee. Frischer Pulverschnee lag auf dem Hellroaring Peak und den Skipisten des Jefferson Clubs, einem fünftausend Hektar großen Erholungsgebiet für die Superreichen und Mächtigen, die sich als Einzige die Mitgliedschaft leisten konnten.
Die Aufnahmegebühr betrug 6,5 Millionen Dollar und verschaffte dem Mitglied eines der Chalets, die weitläufig über das Gelände verteilt waren, und dazu ein zehn Hektar großes Grundstück. Außerdem war jedes Mitglied berechtigt, uneingeschränkt die luxuriösen Clubeinrichtungen zu nutzen: das Clubhaus, die Kuranlagen, den Golfplatz, die Ställe, die Fischteiche, das Jagdrevier und die exquisite Küche.
Aber eigentlich kamen die Leute vor allem zum Skilaufen her. Zehn Meter Schnee fielen jedes Jahr auf dem Hellroaring Peak. Da der Club nur knapp achthundert Mitglieder zählte, von denen die meisten den Großteil des Jahres anderswo verbrachten, blieb der Schnee auf den clubeigenen Pisten oft tagelang tief und unberührt liegen.
Um die Mittagszeit schwang sich Michael Hennessy, genannt Mickey, aus dem Sessellift, der Skibegeisterte zügig auf den Hellroaring Peak beförderte, und lenkte lachend seine Skier in den frisch gefallenen Pulverschnee, der ihm leicht wie Gänseflaum um Stiefel und Schenkel stob.
Hennessy war groß, breitschultrig, Mitte vierzig, hatte kupferrotes Haar und war ein ausgezeichneter Skiläufer. In geschmeidigen Bögen glitt er durch den Schnee hinunter zur Fortune’s Alley, einer sechshundert Meter langen Abfahrtspiste entlang der Flanke des Hellroaring Peak. Hennessy war in Vermont groß geworden und schon als Junge gern Ski gelaufen. Am liebsten wäre er durch den unberührten Tiefschnee gebrettert, abseits der regulären Piste. Doch da er wichtige Gäste im Schlepptau hatte, kam er mit einem Abschwung zum Stehen.
Über ihm, noch in Liftnähe, glitten ein Mann und ein Junge zögerlich auf Snowboards durch den lockeren Schnee. Der Junge verlor schon nach wenigen Metern das Gleichgewicht und fiel hin. Eine Frau auf Skiern eilte ihm zu Hilfe, während der Mann allzu abrupt abbremste und ebenfalls stürzte. Hennessy fluchte im Stillen. Das konnte ja den ganzen Tag dauern, und er hatte weiß Gott Wichtigeres zu tun, als hier den Skilehrer zu spielen. Aber Befehl war Befehl, und wenigstens schneite es.
Aus dem Funkgerät, das er sich vorn an seinen schwarzen Parka geschnallt hatte, rauschte eine Stimme: »Hören Sie mich, Boss?«
»Laut und deutlich«, entgegnete Hennessy.
»Grant und seine Familie haben gerade das Tor passiert. Jetzt sind alle da.«
»Roger. Ich lasse es Mr. Burns wissen, sobald ich unten bin.«
Hennessy steckte das Mikro wieder über das Namensschild, das ihn als Zweiten Sicherheitschef des Jefferson Clubs auswies, und ließ den Blick über den Waldrand entlang der Piste schweifen. Aus alter Gewohnheit. Hennessy war ein ehemaliger Agent für den D. S. D., den Diplomatischen Sicherheitsdienst des amerikanischen Außenministeriums, und hatte sechs Jahre in der Einheit gedient, die für den amerikanischen Außenminister verantwortlich war. Seine Pflichten im Jefferson Club nahm er genauso ernst. Dessen Mitglieder zahlten für die zuverlässigsten Sicherheitsmaßnahmen weltweit, und es war Mickey Hennessys Aufgabe, ihren Ansprüchen gerecht zu werden.
Besonders an diesem Tag. Mit Aaron Grant befanden sich nämlich jetzt die sieben reichsten Männer der Welt auf dem Clubgelände, dazu der Vorsitzende des Bewilligungsausschusses im amerikanischen Senat sowie mehrere ehemalige Sportgrößen und Hollywoodstars. Er hatte sich monatelang genauestens auf dieses Wochenende vorbereitet. Das war auch der Grund, warum Hennessy in der Zwickmühle war, als seine Schützlinge ungelenk auf ihn zugerutscht kamen. Einerseits wäre es vernünftiger gewesen, wenn er mit dem Sicherheitsteam des heutigen Abends die letzten Details durchgesprochen hätte, anstatt diesen Leuten die Piste zu zeigen. Andererseits hatte man nicht alle Tage die Gelegenheit, mit Jack Doore, dem reichsten Mann der Welt, seiner Frau und dem einzigen Kind der beiden Ski zu laufen.
»Meine Güte, was für eine Blamage!«, rief Jack Doore, als er endlich neben Hennessy zu stehen kam, wobei unter dem Helm und der Skibrille nur sein breites Grinsen zu sehen war. »Ich hatte gehofft, meine Erfahrung als Surfer würde mir helfen.«
»Das kommt noch«, versicherte Hennessy. »Morgen soll es hier oben mindestens 70 Zentimeter Neuschnee geben.«
»Um Himmels willen!«, rief Stephanie Doore, die auf ihren Skiern angerutscht kam, ihren Sohn Ian im Schlepptau. »Und wenn man hinfällt?«
»Dann heißt es mit den Armen rudern!«, meinte Hennessy trocken.
Sie lachte. Ihr Mann sagte: »Dann breche ich bestimmt den Weltrekord im Rudern.«
»Und ich?«, fragte Stephanie Doore lachend.
»Keine Sorge, wir teilen uns die Medaille«, antwortete Jack Doore.
Der Kleine zupfte seine Mutter am Ärmel. »Ian kann auch surfen, Mami«, sagte er.
»Aber ja, Schatz«, sagte Stephanie Doore liebevoll.
»Ian scheint hungrig zu sein«, meinte sein Vater.
»Das Restaurant ist geschlossen, wegen der Party heute Abend, aber das Café ist geöffnet«, sagte Hennessy. »Es ist in der Nähe der Liftstation, gleich neben dem Schokozimmer.«
Ian spitzte die Ohren. »Mmmmm, Schokolade.«
»Klingt ganz schön dekadent«, meinte Stephanie Doore.
»Aber nur für die schlanke Linie«, sagte Hennessy. »Übrigens, Mr. Grant und seine Familie sind jetzt auch eingetroffen.«
»Zu spät, wie immer«, sagte Jack Doore. »Und rein ins Vergnügen!«
Zur Erleichterung aller bewältigten die Doores die Piste, die an einem Erlebnisparcours für Snowboarder entlangführte, ohne größere Stürze und erreichten heil die Talstation vor der Lodge, dem Clubhaus.
Dieses Gebäude war das architektonische Juwel der Anlage. Es umfasste fünf Etagen, war aus Granit, glatt gehobeltem Holz und handgesägten Planken gebaut und sollte an eine Berghütte in den Adirondacks erinnern. Das Gebäude war allerdings mit japanischen Stilelementen, anheimelnd und gewaltig zugleich, ein wenig dem Zeitgeist angepasst worden. Das Bauwerk bestand aus zwei Flügeln, die an eine beheizte Terrasse unterhalb der Skihütte angrenzten. Wo sie sich trafen, ragte eine halbrunde Glaswand auf, hinter der sich der Ballsaal befand. Das große Atrium darüber war gleichsam das Herz des Gebäudes.
Im Norden blickte man auf einen Eislaufplatz, im Süden auf die berühmten Schwimmbecken des Clubs. Letztere waren einem Bergbach nachempfunden, beidseitig von Felsformationen aus Granit begrenzt, die mehrere Etagen hoch und von einer Wasserrutsche durchbrochen waren.
Nachdem ein Servicemitarbeiter die Skier und Snowboards entgegengenommen hatte, führte Hennessy die Doores auf die beheizte Terrasse, wobei er die Gelegenheit nutzte, ihnen die Vorzüge einer Mitgliedschaft schmackhaft zu machen: die Motorschlitten, die geführten Skitouren, der 18-Loch-Golfplatz, die Jagdreviere, Fischweiher und Pferdeställe. Dann das Clubhaus mit seiner legendären italienischen Küche, dem Wellnessbereich, den Tennisplätzen und Saloons, dem Börsenzentrum, dem Medienraum und dem großen Festsaal für besondere Anlässe, wo an diesem Abend der große Silvesterball stattfinden würde.
Nachdem er alles dargestellt hatte, fragte Stephanie Doore: »Was kostet denn die Mitgliedschaft?«
Hennessy erläuterte ihr die Konditionen und beendete seinen Vortrag mit den Worten: »Sollten Sie sich allerdings für eine der begehrteren Parzellen entscheiden, müssten Sie mit einem Aufpreis von fünf Millionen rechnen.«
»Wenn wir also ein richtiges Sahneschnittchen wollen, müssen wir elf Komma fünf Millionen Dollar löhnen?«, meinte Jack Doore. »Nicht schlecht.«
»Und der Jahresbeitrag?«, fragte Stephanie Doore.
»Wenn Sie sich für das Premium-Paket entscheiden, zahlen Sie nicht einen Cent zusätzlich. Nie mehr.«
Stephanie Doore schien noch immer unentschlossen. »Wie viele Zuhause brauchen wir, Jack? Würde uns eine normale Mitgliedschaft nicht auch genügen? So etwas ist doch möglich, oder?«
»Natürlich«, räumte Hennessy ein. »Eine Suite ist immer für Sie verfügbar, außerdem können Sie die Clubeinrichtungen auf der ganzen Welt nutzen, auch die Yacht vor Kreta, das Schloss bei Royal Troon in Schottland und, sobald es fertig ist, das Celadon Kurhotel an der Südküste Thailands. Eine normale Mitgliedschaft kostet allerdings einen Jahresbeitrag von fünfzigtausend Dollar.«
»Ian hat Hunger, Mami«, sagte Ian.
Hennessy deutete auf die Glasfront am Ende der Terrasse. »Das Café ist gleich dort drüben.«
Jack Doore zögerte. »Der Aktienhandel hier läuft im Realzeitverfahren, sagten Sie?«
Hennessy nickte. »Ich kann Ihnen den Raum zeigen, während Ihre Frau das Essen bestellt.«
Doore nickte seiner Frau zu. »Für mich eine Portion Chili.«
»Du hast doch Urlaub, Jack«, tadelte sie ihn. »Fällt dir denn gar nichts Ausgefalleneres ein?«
»Nein«, sagte Doore. »Ich mag gutes Chili.« Er grinste Hennessy an. »Es ist doch gut, oder?«
»O ja, Sir.«
»Dann will ich eins mit Käse.«
Hennessy führte die Doores von der Terrasse in einen warmen Raum, wo sie Helme, Mützen, Brillen, Jacken und Skistiefel ablegen konnten. Ein Servicemitarbeiter nahm alles entgegen und gab jedem ein Paar pelzgefütterte Hüttenschuhe aus Schafleder.
»Die gefallen mir«, stellte Jack Doore nach einem prüfenden Blick fest.
»Das sagen alle«, sagte Hennessy und musterte den Mann erneut.
Doore war ungefähr in seinem Alter, aber mit den blonden Strähnen, die ihm in die Stirn fielen, wirkte er wie Ende zwanzig. Kaum zu glauben, dass dieser jungenhafte Bursche so genial war. Sein Betriebssystem YES! hatte in wenigen Jahren die ganze Welt erobert. Dank YES! ließ sich fast jedes elektronische Gerät problemlos an einen Computer anschließen und steuern. Das Computersystem der Lodge basierte auf YES!, ebenso das Sicherheitssystem auf dem Clubgelände. Dass heutzutage praktisch alles mit YES! als Grundlage arbeitete, bewiesen die 80 Milliarden Dollar, die Doore damit verdient hatte.
Hennessy spürte einen Anflug von Neid und Sorge. Trotz der Pension, die ihm zustand, und trotz der Investitionen, die er über die Jahre hin getätigt hatte, war sein Portfolio nicht wie es sein sollte. Wenn er daran dachte, wurde er meistens nervös. Er geriet ins Grübeln, während er Doore in das große Atrium führte, dessen roh verputzte Wände abgenutztem Sattelleder glichen. Alte Navajo-Teppiche lagen auf den grob gehobelten Tannenholzdielen. Skulpturen von Rod Zullo, Gemälde von Russell Chatham und andere Originale moderner Künstler schmückten Tische und Wände. Die brennenden Scheite im Kamin – eine Konstruktion aus Bruchsteinen, die in der Raummitte fünf Stockwerke aufragte – verbreiteten Kiefernduft.
»Da hatte aber jemand einen Blick fürs Detail«, bemerkte Doore anerkennend auf dem Weg zur Treppe am hinteren Ende des Atriums.
»Mrs. Burns hat sich persönlich um die Bauarbeiten und die Ausstattung der Räume gekümmert«, sagte Hennessy. »Sie würde sich sehr über Ihr Kompliment freuen.«
»Ich sage es ihr auf der Party heute Abend«, versprach Doore.
»Hennessy! Kommen Sie her! Auf der Stelle!«
Beim Klang der schnarrenden Stimme drehte Hennessy sich um. Sein Blick fiel auf einen Chinesen um die fünfzig, der in schwarzer Hose, Rollkragenpulli und mit getönter Brille an der Bar stand.
Hennessy wurde rot. »Bitte entschuldigen Sie mich eine Minute, ja? Ich habe für Herrn Hoc Pan ein Sicherheitsproblem zu lösen.«
Jack Doore sah zu dem Mann hinüber. »Chin Hoc Pan? Der ist hier Mitglied?«
»Seit zwei Jahren«, antwortete Hennessy mit leicht entnervtem Unterton. »Ich bin gleich wieder bei Ihnen.«
Hennessy steuerte auf Chin Hoc Pan zu und streckte ihm die Hand entgegen. Der Chinese sah sie nur verächtlich an, und anstatt sie zu drücken, verkündete er: »Mein Gauguin ist noch immer nicht gesichert.«
Hennessy holte tief Luft. »Mr. Hoc Pan, wie gesagt, ich brauche ein wenig Zeit, um die Sicherheitsvorkehrungen in Ihrer Villa aufzustocken.«
»Sie hatten Zeit genug«, sagte Hoc Pan. »Ich zahle viel für meine Mitgliedschaft. Ich erwarte Taten.«
Wieder holte Hennessy tief Luft. Der Immobilienhai aus Hongkong war zur Zeit der viertreichste Mann der Welt. Und obendrein eine der größten Nervensägen im Club. Er war Junggeselle, reagierte phobisch auf Keime und verbrachte den Großteil seines Lebens an Bord einer Boeing 747. Als leidenschaftlicher Kunstsammler hatte Hoc Pan unlängst ein Gemälde von Paul Gauguin erstanden, das seit fast siebzig Jahren nicht zum Verkauf gestanden hatte. Aus unerfindlichen Gründen hatte Hoc Pan beschlossen, das Bild in seinem Chalet aufzuhängen, und von Hennessy verlangt, alles stehen und liegen zu lassen und die Sicherheit seines kostbaren Schatzes zu gewährleisten.
»Seien Sie unbesorgt, Sir«, sagte Hennessy mit fester Stimme. »Unser Sicherheitssystem ist durchaus in der Lage, Ihren Gauguin ausreichend zu schützen, bis wir die entsprechenden Spezialisten engagieren können.«
»Nicht gut«, blaffte Hoc Pan. »Das Bild ist sechzig Millionen wert. Wer ersetzt mir die, falls es jemand klaut? Sie?«
Hennessy wurde rot und konterte: »Ich könnte es in unseren Tresorraum schließen, bis …«
»… Gauguins Meisterwerk in einem Verlies? Wie sollte ich das ertragen!«, schoss der Immobilienhai zurück. Er schnaubte verächtlich und sagte entschlossen: »Ich werde Foster anrufen. Geben Sie mir seine Nummer!«
Gregg Foster war Mickey Hennessys Vorgesetzter, der Sicherheitschef von HB1 Financial, einer Schwesterfirma des Jefferson Clubs. Das vergangene Jahr hatte Foster jedoch in Thailand verbracht, um die Bauarbeiten und Sicherheitssysteme der dortigen Clubanlagen zu überwachen, die ebenfalls zur Firma gehörten. Seit vierzehn Tagen befand er sich auf einer Trekkingtour durch Patagonien und war unerreichbar.
»Mr. Foster ist im Urlaub, Sir«, sagte Hennessy müde. »Ich habe schon seit zwei Wochen nichts mehr von ihm gehört, und so wird es wohl auch noch eine Woche bleiben. Mindestens.«
»Dann Burns …« Hoc Pan blieb beharrlich. »… dann möchte ich mit Horatio Burns sprechen!«
Wieder holte Hennessy tief Luft, ehe er sagte: »Ich glaube, er ist unten im Ballsaal, Sir. Auf Mrs. Burns’ Anweisung ist dort jedoch bis sechs Uhr abends der Zutritt verboten.«
»Nicht für mich!«, sagte Hoc Pan, schnalzte angewidert mit der Zunge und trollte sich.
»Macht er sich Sorgen um seine Sicherheit?«, fragte Jack Doore, als Hennessy zurückkam.
Hennessy musste seinen Ärger unterdrücken. »Dazu besteht nun wirklich kein Grund. Und falls Sie mir einen kleinen Umweg gestatten, zeige ich Ihnen auch, warum.«
3
Auf der ersten Etage, im Flur des Nordflügels, blieb Mickey Hennessy vor einer Tür aus Tannenholz stehen, über der sich eine Überwachungskamera befand. Er drückte auf die Klingel. Eine Matrix aus blauen Lichtstrahlen tastete seine Gesichtszüge ab. Die Tür ging auf.
Hennessy und Doore traten in einen Raum, in dem Bildschirme dominierten: drei Reihen mit jeweils sechs Bildschirmen. Zwei Sicherheitsleute hatten die Monitore fest im Blick.
Diese zeigten Echtzeitaufnahmen von unterschiedlichen Orten des Erholungsgebiets: Man sah die überdachte Auffahrt, die Pools, die Sessellifte, die Eislaufbahn, die Flure auf jedem Stockwerk, die Personaleingänge, die Ställe und das Haupttor an der Einfahrt zum Club.
»Innerhalb der Lodge und in jedem Chalet sind kostbare Kunstwerke, wie zum Beispiel Mr. Hoc Pans Gauguin, alarmgesichert«, erklärte Hennessy. »Sollte eines davon unvermittelt bewegt werden, wird im Sicherheitszentrum ein Alarm ausgelöst, und wir können sofort reagieren. Wie Sie sehen, überwachen Kameras den Großteil der öffentlichen Clubbereiche sowie die Auffahrten zu den einzelnen Chalets. Die Kameras sind mit Bewegungsmeldern verbunden, die – das muss ich leider sagen – allzu oft von Wildtieren ausgelöst werden, von denen es hier draußen natürlich wimmelt. Zum Glück gilt dies nicht für unseren Laserzaun.«
Hennessy beschrieb die Barriere, die das Clubgelände von der Wildnis trennte: Es handelte sich dabei um eine Weltneuheit, die ganz ohne Stacheldraht, ohne Pfosten und Betonmauern auskomme. Die Schönheit der Landschaft, schwärmte er, bliebe völlig unangetastet. Der Zaun sei vielmehr ein Netz aus optischen Sensoren, dessen Entwurf und Installation ein Vermögen gekostet hätten. Das Netz sei drei Meter hoch und einen halben Meter tief in der Erde und bestehe aus Laserstrahlen – natürlich von YES! kontrolliert –, die jedes größere Wesen »sondierten«, das die Grenze überschreite, Pferde und Wildtiere ausgenommen.
»Die Sensoren reagieren nur auf Menschen?«, fragte Doore.
»So ist es«, sagte Hennessy. »Wir hatten nur zwei Überschreitungen in diesem Jahr, und die waren beide Male während der Jagdsaison.«
»Beeindruckend«, sagte Doore.
Hennessy wandte sich an einen der Wachmänner, die die Bildschirme im Auge hatten: »Irgendwelche Bewegungen?«
Krueger, der Jüngere, Ernsthaftere der beiden, blickte auf. »Vorhin, an der Toreinfahrt. Jetzt ist alles wieder ruhig, bis auf die Lieferwagen, die das Gelände gerade verlassen.«
Lerner, ein fröhlicher Bursche Anfang dreißig, der das Foto seiner zweijährigen Tochter an seinen PC geklebt hatte, drehte sich zu Hennessy um und nickte. »Bei diesem Wetter rührt sich gar nichts, Boss. Nicht mal ein Elch.«
Der Raum, wo Börsengeschäfte getätigt werden konnten, befand sich im Erdgeschoss des Südflügels. Mit Hilfe seines elektronischen Hauptschlüssels öffnete Hennessy die Flügeltüren aus Zedernholz, die eine kunstvolle Schnitzerei schmückte: ein Elchbulle, der mit einem Grizzly kämpfte.
Die Türen gaben den Blick in einen vor Geschäftigkeit pulsierenden Raum frei, der am heutigen Silvestertag unerwartet gut besucht war. Vor jedem der zwanzig Börsenterminals hatte sich eine Schlange gebildet. Der Saal wimmelte von Geschäftsleuten, die ihre Orderns in die Telefone raunten und an der Cappuccino-Bar am hinteren Saalende oder an der Theke gleich neben der Tür Informationen und heiße Tipps austauschten. Die meisten hatten einen gehetzten Gesichtsausdruck. Manche wirkten regelrecht panisch.
»Was ist denn los?«, fragte Jack Doore und wurde plötzlich nervös.
»Nur das übliche Last-Minute-Sicherungsgeschäft. Man versucht, durch Leerverkäufe etwaigen Turbulenzen während der Feiertage entgegenzuwirken«, sagte ein Mann, der unweit des Eingangs in der Schlange vor einem der Terminals stand. Er sprach mit britischem Akzent und zog an einer unangezündeten Davidoff-Zigarre. Seine lackschwarzen Haare waren zurückgegelt, seine Nägel manikürt. Seine Haut wirkte ungewöhnlich straff und geschrubbt für einen Mittsechziger, was bei Hennessy den Verdacht nahelegte, dass er sich erst kürzlich einer kosmetischen Operation unterzogen hatte. Sein Skianzug war ein Einteiler und passte ihm tadellos, wie es sich für den sechstreichsten Mann der Welt gehörte.
»Sir Lawrence«, sagte Hennessy. »Wie gefällt es Ihnen hier?«
»Dieser Raum ist ganz zweifellos ein Plus«, erwiderte Sir Lawrence ungerührt, ohne Hennessy auch nur eines Blickes zu würdigen.
Hennessy nahm es gleichmütig zur Kenntnis und sagte: »Jack Doore, Sir Lawrence Treadwell.«
Sir Lawrence stutzte und streckte Doore energisch die Hand entgegen. »Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Tut mir leid, dass ich Sie in Ihrem, äh, Sportdress nicht gleich erkannt habe.«
»Kein Problem«, sagte Doore und schüttelte Sir Lawrence die Hand. »Sie sind in der Ölbranche tätig?«
»Genau. GlobalCon, Öl und alles, was damit zusammenhängt«, sagte Treadwell. »Möchten Sie hier Clubmitglied werden, Doore?«
»Scheint mir genau das Richtige zu sein für meinen Sohn. Wie man so hört, ist die Gegend hier ein richtiges Schneeloch.«
»Ein Schneeloch?«, fragte Sir Lawrence verwirrt.
»Schneesicher, zum Skilaufen«, erklärte Hennessy.
»Soso«, sagte Sir Lawrence, leicht irritiert. »Das ist nichts für mich. Ich kann kaum auf den verdammten Dingern stehen. Aber sagen Sie mal, Doore, hätten Sie kurz Zeit, etwas Geschäftliches mit mir zu besprechen?«
Doore sah unbehaglich drein. »Ich hab meiner Frau versprochen, hier Ferien zu machen.«
»Nur zehn Minuten. Länger wird’s nicht dauern«, meinte Sir Lawrence beharrlich.
Doore fügte sich achselzuckend. »Zehn Minuten. Aber zuerst muss ich noch eine Order durchgeben.«
»Großartig!«, sagte Sir Lawrence.
Hennessy gab sich alle Mühe, die Tatsache zu ignorieren, dass der britische Milliardär ihn keines Blickes gewürdigt hatte. Sir Lawrence wusste eben, welche Rolle Hennessy im Club-Kontext spielte: ein Spießer mit kleinem Bankkonto. Die Vorstellung wurmte Hennessy, und er überlegte, welche Schritte sein Finanzberater am Jahresende noch unternehmen könnte, um die Rendite seines Portfolios zu steigern.
»Das System reagiert doch sofort, nicht wahr?«, fragte Doore.
»Wir haben Standleitungen zu allen wichtigen Börsen weltweit«, antwortete Hennessy, »unsere Spezialsoftware, Nasdaq Level III, garantiert die Ausführung der Deals binnen Bruchteilen von Sekunden, unsere Server sind ausnahmslos von Megadata und laufen mit YES!. Sechs Satelliten verbinden uns mit dem Internet. Unsere Mitglieder haben jederzeit die Möglichkeit, über extra sichere Datenverbindungen online zu gehen. Darauf legt Mr. Burns den allergrößten Wert.«
»Beeindruckend«, sagte Doore. »Wirklich beeindruckend.«
Damit entschuldigte er sich und ging zu einem der Terminals. Sir Lawrence folgte ihm kurzerhand, ohne sich um Hennessy zu kümmern. Der lehnte sich gleichmütig an die Wand zwischen dem Eingang und einer von Grünpflanzen abgetrennten Lounge und beobachtete unauffällig das Geschehen. Auch dies war eine alte Angewohnheit: Mit der Umgebung zu verschmelzen und dabei die Augen offen zu halten, hatte zu seinen Agentenpflichten gehört.
Fast zehn Minuten stand er so, zunehmend besorgt wegen der rasanten Gangart der Geschäftsabschlüsse, als er jemanden mit starkem deutschen Akzent sagen hörte: »Ich hab eben mit Zürich telefoniert. Es gibt viel mehr Leerverkäufe an den Börsen als erwartet, viel mehr Sicherungsgeschäfte als sonst zu dieser Jahreszeit.«
»Wer ist daran beteiligt?« Die zweite Stimme, ziemlich rau, gehörte einem Amerikaner.
»Das weiß keiner«, sagte der Deutsche. »Allerdings soll einer davon Treadwell sein.«
Hennessy spähte durch den Blätterwald, sah die Silhouetten zweier Männer, die in Clubsesseln saßen und Espresso tranken. Obwohl sie ihm den Rücken zukehrten, erkannte er sie auf der Stelle.
Der Größere und Ältere der beiden war Albert Crockett, ein berüchtigter Corporate Raider und der fünftreichste Mann der Welt. Crockett war um die siebzig und hatte die Ausstrahlung eines Totengräbers: hängende Schultern, das spärliche Haupthaar bereits ergraut, Leichenbittermiene. Der andere war Friedrich Klinefelter, der siebtreichste Mann der Welt. Er leitete die Firma Mobius Hedge Funds L. L. C., die in den vergangenen drei Jahren weltweit den meisten Profit eingefahren hatte. Klinefelter war ein Spätfünfziger mit falkenhaften, aristokratischen Zügen und silbergrauem Haar, das er straff nach hinten gegelt trug wie ein veraltetes Ralph-Lauren-Model. Er trug sportliche Kleidung, Tuchhose und Pullover, seine Haltung aber war steif und sein Blick unstet.
»Sind Sie sicher, was Sir Lawrence angeht?«
»Es handelt sich um Gerüchte«, erwiderte Klinefelter. »Aber bei diesen großen Mengen müssen noch andere involviert sein. Irgendjemand weiß etwas.«
»Ach was!«, knurrte der Corporate Raider. »Die spinnen doch. Die Aktienmärkte sind stark. Die Kurse gehen so bald nicht den Bach runter.«
»Und was ist mit Burns? Der hat die Cashquote erhöht, genau wie Ross Perot vor dem Schwarzen Montag 1987.«
»Das hat er Lou Dobbs erzählt, jetzt schießen sich alle auf ihn ein«, sagte Crockett wegwerfend. »Die Story im Journal, ätzend … Da drüben ist Treadwell. Wer steht denn da neben ihm? Ist das Doore?«
Hennessy merkte auf und sah, dass Sir Lawrence Treadwell und Jack Doore bereits zurückkamen. Seine Gedanken wirbelten. Horatio hat die Cashquote erhöht, und Sir Lawrence und noch ein paar andere starten Leerverkäufe. Er hatte eine Menge gelernt in den vergangenen vier Jahren hier im Jefferson Club, aber im Augenblick zählte für ihn nur das eine: Wenn Finanzmärkte einbrachen, ging der kleine Anleger zugrunde, während der Profi ein Vermögen verdiente. Er musste mit seinem Finanzberater sprechen. Jetzt gleich.
Doch da blieben Jack Doore und Sir Lawrence vor ihm stehen und gaben einander die Hand.
»Ich komme auf Sie zurück«, sagte Doore.
»Warten Sie nicht zu lange«, meinte Treadwell. »Die Gelegenheit ist günstig.«
»Alles klar«, sagte Doore, ehe er sich an Hennessy wandte. »Chili mit Käse?«
Hennessy nickte. »Unbedingt.«
Sie gingen über den langen Flur zurück zum Atrium. »Wie schätzen Sie unsere Wirtschaft momentan ein, Sir?«, fragte Hennessy.
Doore sah ihn verwundert an. »Sie sind schon der zweite innerhalb von zehn Minuten, der mich das fragt.«
»Tut mir leid. Es ist nur, weil gemunkelt wird, dass es so viele Leerverkäufe gibt.«
Doore zuckte mit den Schultern. »Was soll ich dazu sagen? Ich sehe keine Probleme für YES!.«
»Sir Lawrence zum Beispiel geht short«, sagte Hennessy.
»Ach ja?«
»Heißt es.«
»Ich habe YES!-Aktien gekauft, weil ich fand, dass sie unterbewertet sind«, sagte Doore. »Aber was weiß ich schon? Sir Lawrence ist einer der cleversten Investoren der Welt, ich dagegen bin Wissenschaftler, kein Geschäftsmann.«
Doores Familie saß an einem Tisch am Fenster und sah zum Skihang hinüber. Stephanie Doore war eine schlanke Blondine Ende dreißig mit anmutigem Lächeln und vollendeten Manieren. Ian, der fröhlich Eiscreme in sich hineinschaufelte, war ungefähr acht, etwas breit gebaut und hatte einen blonden Bürstenhaarschnitt. Dass er leicht autistisch veranlagt war, bemerkte man kaum.
Jack Doore setzte sich neben seine Frau, schaute aus dem großen Panoramafenster und wollte gerade etwas sagen, als er erschrocken zurückwich.
Hennessy warf einen Blick auf die Piste, und was er sah, versetzte ihm einen schweren Schlag in die Magengrube. Drei Snowboarder heizten in mörderischer Geschwindigkeit den Parcours hinunter. Jeder war mit einer Maschinenpistole bewaffnet.
4
In Midtown, Manhattan, im 25. Stockwerk des Hochhauses am Federal Plaza 26, saß Cheyenne O’Neil, FBI-Agentin und Spezialistin für Finanzkriminalität, in ihrer tristen Bürozelle und starrte auf den großen Computerbildschirm und die aufgewühlte See aus Aktienkursen, Geboten, Offerten und Abschlussbestätigungen. Daneben, auf geteilten Bildschirmen, die Kopien diverser Firmendokumente. Sie plagte sich schon so lange mit Zahlen und juristischem Fachjargon herum, dass ihr die Ziffern und Buchstaben allmählich vor den Augen verschwammen.
Cheyenne lehnte sich zurück, nahm die Brille ab und rieb sich die Augen. Sie warf einen Blick auf den Fernseher, der an die Decke montiert war. Eben lief der Bloomberg Report, ohne Ton. In zwei Stunden schlossen die Börsen für dieses Jahr, und der Dow Jones war um 87 Punkte gestiegen und stand jetzt bei 16180. Der NASDAQ-Index hatte genauso eindrucksvolle Gewinne zu verbuchen.
Cheyenne brauchte den Ton nicht einzuschalten, um zu wissen, wie sich die Experten zu alledem äußerten. Es war ihren fröhlichen Gesichtern anzusehen, dass sie, wie schon seit Monaten, von der ungebrochenen Angriffslust des Bullen und dem unermüdlichen Aufwärtstrend der amerikanischen Wirtschaft schwärmten und dem wiedererstarkten Dollar ein Loblied sangen.
Sie massierte sich den verspannten Nacken. »Es muss da sein, ich weiß es«, murmelte sie, »ich sehe es nur nicht.«
FBI-Agent John Ikeda, ein drahtiger Japano-Amerikaner Mitte dreißig und seit drei Jahren Cheyennes Partner, stieß sich im Büro nebenan vom Schreibtisch ab und rollte auf seinem Stuhl in die Türöffnung.
»Das kommt noch«, sagte er. »Geld hinterlässt immer Spuren. Man muss nur wissen, wonach man sucht.«
»Ich weiß aber nicht genau, wonach ich suche«, entgegnete sie.
»Unregelmäßigkeiten«, sagte Ikeda. »Die Profis sind vorsichtig. Such also nicht nach Auffälligkeiten, die gibt es nämlich nicht, allenfalls Muster, die sich wiederholen oder irgendwie aus dem Rahmen fallen.«
»Das klingt ja, als sei ich auf Gespensterjagd«, sagte sie.
»So ist es auch!«, blaffte ein untersetzter, athletisch gebauter Mann im grauen Anzug, mit Geheimratsecken und Hosenträgern.
Cheyenne zuckte zusammen und fuhr herum. Hinter ihr stand ihr Vorgesetzter, Special Agent Pete Laughlin.
»Es ist da, Captain«, sagte sie. »Ich kann es förmlich riechen.«
»Das sagen Sie mir schon seit sechs Monaten, und immer noch kein Ergebnis«, sagte Laughlin.
»Wer Betrügereien dieses Ausmaßes aufdecken will, braucht eben Zeit«, gab Cheyenne zurück.
»Zeit, die Sie nicht haben, O’Neil«, entgegnete Laughlin ungerührt. »Am Montag gehen Sie wieder an den Twindle-Fall. Ihre fixe Idee ist zweitrangig. Fangen Sie das neue Jahr richtig an.«
»Aber Cap …«, protestierte sie.
»Das ist ein Befehl, O’Neil«, sagte Laughlin und wandte sich ab.
Cheyenne sprang auf. »Und wenn ich doch noch etwas finde?«
Laughlin blieb stehen und starrte sie an. »Und was sollte das sein?«
»Was weiß ich?«, rief sie wütend. »Vielleicht finde ich ja noch die heiße Spur.«
Laughlin lachte sarkastisch. »Über die Feiertage?«
»Klar«, sagte sie und schürzte trotzig die Lippen. »Warum nicht? Es kostet Sie nur ein Flugticket, mehr nicht.«
»Wohin?«, fragte er misstrauisch.
»Montana«, antwortete sie. »Crockett und Klinefelter machen beide Ferien im Jefferson Club. Klinefelter reist am Dienstag wieder ab. Wer weiß, wann wir wieder die Gelegenheit bekommen, beide verhören zu können.«
Laughlin winkte ab. »Und was wollen Sie sie fragen? Sie haben rein gar nichts in der Hand. Also kriegen Sie auch nichts. Kein Flugticket.«
»Bitte, Cap«, bettelte sie.
Er wandte sich zum Gehen. »Ende der Diskussion. Am Montag geht’s mit Twindle weiter.«
Zähneknirschend ballte Cheyenne die Fäuste und machte Anstalten, ihrem Boss nachzulaufen; Ikeda jedoch hielt sie zurück, schüttelte den Kopf und raunte: »Keine gute Idee. Wenn du ihm auf die Nerven gehst, gibt er dir nur noch die beschissenen Fälle. Dagegen wäre der Twindle-Fall das reinste Paradies, das kannst du mir glauben. Mach Pause. Oder noch besser, geh nach Hause. Wir haben Silvester, verdammt nochmal!«
Sie schüttelte wütend den Kopf. »Na und? Sollen diese Verbrecher damit durchkommen?«
»Mach ’ne Pause«, wiederholte Ikeda mit Nachdruck.
Cheyenne seufzte. Er hatte recht. Es hatte keinen Sinn, sich bei Laughlin unbeliebt zu machen. Plötzlich fühlte sie sich ausgelaugt. Sie ging über den Flur in die Damentoilette, trat an ein Waschbecken und spritzte sich etwas Wasser ins Gesicht. Nachdem sie sich mit einem Papiertuch abgetrocknet hatte, begutachtete sie ihr Spiegelbild.
Cheyenne O’Neil hat zwar keine Verabredung und verbringt Silvester allein, ist aber trotzdem eine selbstbewusste, intelligente und taffe junge Frau, die mit ihren einunddreißig Jahren keinen Tag älter aussieht als neunundzwanzig. Abschluss mit Auszeichnung an der Syracuse University. Master of Business Administration in Stanford. Klassendritte an der FBI Academy. Fit wie ein Turnschuh, obwohl sie heute noch nicht trainiert hat. Tolle grüne Augen. Glänzende kastanienbraune Mähne. Zarte und reine Haut, bis auf den Pickel, der sich am Haaransatz anbahnt. Boshafter Humor. Wahnsinnig ehrgeizig. Wahnsinnig fixiert auf diesen Fall.
War sie obsessiv, zwanghaft?, fragte sie sich, während sie zurückging und sich wieder an den Schreibtisch setzte. Einen Augenblick spielte sie mit dem Gedanken, es für heute gut sein zu lassen. Doch dann meldete sich wieder ihr Bauchgefühl zu Wort: Irgendwo in diesen Unmengen von Geldtransaktionen gab es den Beweis, dass zwei der reichsten Männer der Welt in beidseitigem Einvernehmen dunkle Geschäfte betrieben: Albert Crockett, Corporate Raider, und Friedrich Klinefelter, Manager von Mobius LLC.
Seit das FBI im vergangenen Mai einen anonymen Hinweis erhalten hatte, versuchte Cheyenne herauszufinden, wie Crockett und Klinefelter mit ihren Machenschaften im großen Stil gegen bestehendes Finanzrecht verstießen. Crockett, so vermutete sie, nahm ein bestimmtes Unternehmen zur Übernahme ins Visier und setzte dann Klinefelter in Zürich davon in Kenntnis, woraufhin dieser über diverse Hedgefonds gerade so viele Anteile von besagter Firma erwarb, um eine Meldung bei der Börsenaufsichtsbehörde zu vermeiden, die für die Kontrolle des Wertpapierhandels zuständig war. Sobald nämlich eine Einzelperson oder ein Unternehmen mehr als fünf Prozent des Kapitals einer amerikanischen Aktiengesellschaft aufgekauft hatte, trat die Aufsichtsbehörde auf den Plan.
Hatte also Klinefelter über diverse Fonds insgesamt zwölf Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals der Zielfirma an sich gebracht, begann Crockett über seine vielen Holdinggesellschaften aggressiv zu kaufen. Waren über fünf Prozent des Aktienkapitals der Zielfirma in seiner Hand, meldete er seine Position der Aufsichtsbehörde, kaufte aber weiter, bis er fünfzehn oder zwanzig Prozent der Anteile innehatte. An diesem Punkt der Übernahme pflegte er das Direktorium des Unternehmens der Misswirtschaft zu bezichtigen und zu verlangen, dass die Firma ihre Vermögenswerte abstieß, oder dass man ihm, Crockett, einen Sitz im Direktorium gab, wo er dann anfing, nach und nach die Manager der Firma zu feuern und durch eigene Leute zu ersetzen.
Albert Crockett, so viel wusste Cheyenne inzwischen, galt als ein schlauer Beurteiler unterbewerteter Unternehmen. Sobald sich herumsprach, dass er eine feindliche Übernahme plante, schnellten die Börsenkurse für die anvisierte Firma fast unweigerlich in die Höhe, und Klinefelters Beteiligungsgesellschaften fuhren bedeutende Gewinne ein. Cheyenne vermutete außerdem, dass Crockett seinerseits eine beträchtliche Summe bei Mobius investiert hatte, was bedeutete, dass er von Klinefelters Gewinnen auch selbst profitierte. Und Klinefelters Zwölf-Prozent-Anteil würde Crockett den Rücken stärken, sollte jemand seine Übernahmepläne durchkreuzen wollen.
Diese Geschäftsstrategie war nicht nur ausgesprochen lukrativ, sondern erfüllte zudem den Tatbestand des Insiderhandels, der Verdunkelung und Schieberei, und zwar in einem Ausmaß, das bei Weitem das übliche Eine-Hand-wäscht-die-andere-Prinzip überstieg.
Das Problem war nur, dass Cheyenne das Hinterzimmer, in dem diese Absprachen getroffen wurden, nicht finden konnte. Mit Klinefelter, der sich in diesem Zusammenhang vollkommen bedeckt hielt, hatte sie noch nie gesprochen, und das eine Mal, als es ihr gelungen war, Crockett ein paar Fragen zu stellen, war er von einer Schar Rechtsanwälte umgeben gewesen, die ihr unabhängige Gutachten zugunsten der fraglichen Investitionen vorgelegt hatten. Klinefelters Beteiligung bestand demnach lediglich aus einem untrüglichen Geschäftssinn.
»Clevere Männer ticken eben ähnlich!«, hatte Albert Crockett herablassend auf ihre Fragen geantwortet.
Dies war also der Stand der Dinge, und das schon seit drei Monaten. John Ikeda hatte ihr geraten, mögliche Treffen oder Telefonate zwischen den beiden Männern aufzuspüren. Doch der Staatsanwalt, der mit ihr gemeinsam an dem Fall arbeitete, hatte keinen der Richter davon überzeugen können, Einzelverbindungsnachweise von den Verdächtigen zu fordern und Zugang zu ihren Computern zu erhalten. Cheyenne war außer sich gewesen. Wer unter Terrorverdacht geriet, dachte sie, der hatte keinerlei Rechte. Wer dagegen des Diebstahls verdächtigt wurde, genoss nach wie vor rechtlichen Schutz, vorausgesetzt, er hatte das nötige Kleingeld.
Sie verdrängte ihre Bitterkeit, denn sie musste eine Möglichkeit finden, sich in dem Meer von Transaktionen, das vor ihr waberte, zurechtzufinden. Viele hunderttausend Anteile, alle über diverse Handelsgesellschaften und online gekauft. Milliarden von Dollar, in einer Art und Weise ins Spiel gebracht, dass sich kaum zurückverfolgen ließ, worum es eigentlich ging.
Für diese Leute ist das Ganze nur ein einfaches Pokerspiel, dachte sie bitter. Wem sie damit schaden, ist ihnen egal. Wer die meisten Chips anhäuft, der hat das Spiel gewonnen.
Cheyenne saß nachdenklich vor ihrem Bildschirm und scrollte durch die Dokumente. Dabei entdeckte sie Daten zu Crocketts Übernahme von Harrison Timber, einer Holzverarbeitungsfirma in Oregon.
Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, ein Pokerspiel zu gewinnen, dachte sie. Der Gedanke wuchs in ihr, bis er sie völlig ausfüllte. Sie knallte ihr Laptop zu und packte es in die Aktenmappe. Dann griff sie sich ihren Mantel und schlüpfte hastig hinein.
Ikeda bemerkte es. »Wo willst du hin?«
»Zum Flughafen«, sagte sie.
Ikeda sprang erschrocken auf. »Keine gute Idee.«
»Ganz im Gegenteil, die Idee ist brillant«, sagte sie.
»Was willst du denn da draußen?«
»Einen Bluff starten«, sagte sie und eilte zu den Aufzügen.
5
Im Café des Jefferson Clubhauses stand Hennessy am Fenster und starrte, blass geworden, hinaus auf den Snowboard-Erlebnisparcours neben der normalen Abfahrtspiste. Der erste Snowboarder trug einen weißen Anorak und heizte Richtung Absprungschanze. Seine Verfolger in Grün und Gelb waren ihm dicht auf den Fersen. In fünf Metern Höhe eröffneten sie das Feuer. Sogar aus hundert Metern Entfernung sah Hennessy die Farbbälle wie orangefarbene Blitze durch die verschneite Luft sausen und auf den weißen Anorak der Jagdbeute klatschen.
Der erste Snowboarder konnte sauber landen. Er carvte in die Halfpipe und raste die gegenüberliegende Wand hinauf. Die Boarder hinter ihm waren weniger elegant und mussten knirschend auf den Brettkanten rutschen, um die Kurve zu kriegen. Dies verschaffte dem Gejagten den nötigen Vorsprung.
Er fegte über die Bande hinaus, schnellte in einer Drehung nach oben und landete wieder in der Halfpipe, wo er geradewegs auf die Verfolger zuhielt und sie nun seinerseits mit Farbe beschoss. Einer von ihnen stürzte. Der andere glitt weiter und ballerte zurück.
Sein Gegner aber war schon davongesaust, auf die Talstation zu. Er sprang auf das Geländer einer Absperrung und schrammte darauf entlang, die Arme in Siegerpose nach oben gerissen.
»Der Junge fährt wie der Teufel!«, stellte Jack Doore bewundernd fest. »Alle Achtung!«
»Tja, wie der Teufel persönlich«, stimmte Hennessy mit säuerlicher Miene zu. »Aber gestern erst haben mir die drei Clowns einen Motorschlitten zu Schrott gefahren. Ich muss der Sache ein Ende machen, bevor noch jemand zu Schaden kommt.«
Hennessy stürmte in seinem roten Fleecepulli und den ledernen Hausschlappen hinaus auf die beheizte Terrasse. Er hielt sich gegen die wirbelnden Flocken schützend die Hand vor Augen und sprang die Treppe hinauf zum Skilift, um die drei abzufangen, bevor sie wieder bergauf fuhren.
Da kamen sie auch schon angeflitzt. Ihre Anoraks waren mit orangefarbenen Flecken gesprenkelt, und alle drei hielten sich die Bäuche vor Lachen. Der Größte ließ sich rücklings in den Schnee fallen. Die anderen taten es ihm gleich, ungeachtet der Blicke, mit denen sie von anderen Skiläufern bedacht wurden.
Die Hände in die Hüften gestemmt, baute Hennessy sich vor ihnen auf und verzog das Gesicht angesichts der beißenden Kälte.
»Nehmt gefälligst die Helme ab! Ich will eure Gesichter sehen«, sagte er und unterdrückte nur mit Mühe seinen Ärger.
Der Snowboarder im grünen Anorak sagte: »Wir haben’s mal wieder vermasselt, Leute.«
»Total«, sagte der Große in Weiß und schob sich die bekleckerte Brille nach oben. Darunter kam ein sommersprossiger Vierzehnjähriger zum Vorschein mit einem Wischmopp aus roten Haaren. Er maß Hennessy mit einer Miene, die besagte: Was habe ich denn verbrochen?
Der grüne Snowboarder schob die Brille nach oben und enthüllte dunklere Haare, blaue Augen und ein wissendes Grinsen. Auch er war vierzehn, dünner und mit Akne geplagt. Der kleinste Snowboarder, im gelben Anorak und ein Mädchen, nahm den Helm ganz ab. Auch sie war vierzehn, stämmig gebaut, mit sanften, braunen Augen und schulterlangem, dunkelblondem Haar unter der braunen Wollmütze, die sie sich tief in die Stirn gezogen hatte.
»Ich hab ja gleich gesagt, dass die Idee bescheuert ist«, sagte sie missmutig mit Bostoner Akzent.
»Aber mitgekommen bist du trotzdem.«
»Die zwei haben mich gezwungen.«
»Es war ihre Idee«, protestierte der Sommersprossige. Auch er sprach mit Bostoner Akzent.
Hennessy verzog das Gesicht und sagte zu dem Mädchen: »Ich dachte, die Idee wär bescheuert?«
»Dann war es eben meine blöde Idee«, gab sie zurück. »Eine neue Sportart ist am Anfang immer eine doofe Idee. Wie bei Jake Burton. Den hat man zunächst auch nicht ernst genommen.«
»Snowboard-Paintball, ist doch cool, oder?«, sagte der Größere.
»Ich wette, das hat noch keiner hier im Club ausprobiert«, sagte der Grüne.
»Nein, vermutlich nicht«, knurrte Hennessy.
»Reg dich nicht auf, alter Herr«, sagte das Mädchen und öffnete ihre Bindung.
»Genau, Dad«, sagte der in Weiß. »Das Zeug ist schließlich abwaschbar. Das weißt du doch.«
Hennessy schüttelte den Kopf. »Gebt mir die Pistolen, geht in die Umkleideräume, zieht die Klamotten aus und bringt sie in die Wäscherei. Morgen früh geht’s ab nach Hause, und ihr packt mir kein schmutziges Zeug in die Koffer. Eure Großmutter rastet sonst aus.«
Die drei waren Hennessys Kinder, Drillinge, und gerade im pubertären Alter. Connor, der Junge in Grün, war mit fünf Minuten Abstand Hennessys Jüngster und der Gutmütigste von den dreien. Er übergab ihm schweigend seine Farbpistole. Bridger, der Älteste, im weißen Anorak, war der typische Elefant im Porzellanladen. Er überlegte nicht lang, bevor er aktiv wurde, und maulte: »Oma ist daran gewöhnt. Sie fährt uns sogar zu den Turnieren.«
»Das kann ja sein, aber es hilft euch jetzt auch nicht weiter«, sagte Hennessy.
Bridger klatschte die Pistole in Hennessys behandschuhte Rechte. Hennessys Tochter Hailey sah ihn trotzig an und übergab ihm die ihre mit den Worten: »Da, nimm die Pistole, aber lass uns weiter snowboarden. Komm schon, Dad, es schneit wie wild! Der Nachmittag wird superklasse.«
»Tja, den werdet ihr leider verpassen. Ich will, dass ihr eure Koffer packt und euch dann was Ordentliches anzieht für heute Abend! Keine Rapster-Kappen, keine Schlabberhosen.«
»Ich geh da nicht hin«, sagte Bridger. »Das ist nur was für die Kinder von reichen Leuten.«
»Und heute Abend ausnahmsweise auch für solche armen Kinder wie euch. Wir gehen alle gemeinsam zur Party. Verstanden? Und ihr zieht die Klamotten an, die euch eure Mutter eingepackt hat.«
Bridger stülpte sich mit Nachdruck den Helm über und griff sich sein Brett. »Zu Befehl, Sergeant.«
»Sergeant klingt nicht schlecht.«
»Wann kriegen wir die Pistolen zurück?«, fragte Connor.
»Wenn ihr zum Flughafen fahrt. Ich leg sie euch in die Koffer.«
Bridger zog maulend ab. Connor folgte ihm, das Brett über die Schulter geworfen. Hailey schob schmollend das Kinn nach vorn und bildete die Nachhut.
Hennessy sah ihnen noch eine Zeit lang hinterher und fragte sich, warum er so schlecht mit ihnen auskam. Dann wurde ihm kalt, und er eilte auf die Tür zum Café zu. Doch ehe er sie erreichte, hörte er eine vertraute Frauenstimme seinen Namen rufen.
»Hennessy!«, rief sie. »Mickey!«
Mit einem sehnsüchtigen Blick in die Wärme blieb Hennessy stehen und drehte sich um. Eine Frau kam über die Terrasse auf ihn zu. Sie trug einen eng anliegenden weißen Skianzug mit pelzbesetzter Kapuze, eine verspiegelte Brille und zog auf einem blauen Plastikschlitten ein kleines Mädchen, jünger als Ian Doore, hinter sich her. Das Mädchen trug den gleichen Skianzug wie seine Mutter.
»Ms. Wise«, sagte Hennessy und nahm alle drei Paintball-Pistolen in die eiskalte linke Hand.
»Ich muss spätestens morgen Mittag in Bozeman am Jet-Port sein und möchte den Paparazzi entgehen. Ich will nicht, dass sie Andriana fotografieren. Ist das klar?«, fragte sie.
»So klar wie gestern«, entgegnete Hennessy.
»Warum waren sie dann bei unserer Ankunft in der Halle und haben versucht, uns zu fotografieren?«
»Vielleicht, weil Sie eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt sind?«, antwortete Hennessy und bereute seine Worte augenblicklich.
Cheryl Wise musterte ihn kalt: »Die Berühmteste von allen. Merken Sie sich das!«
»Sehr wohl, Ma’am.«
»Mami!«, quengelte die Kleine auf dem Schlitten.
Die Schauspielerin ignorierte sie. »Wenn Sie mir nicht garantieren können, dass meine Tochter in den Jet steigen kann, ohne dass man ihr eine Kamera vor die Nase hält, will ich mit Mr. Burns persönlich sprechen. Auf der Stelle!«
In Hennessys Schnurrbart bildeten sich allmählich Eiszapfen.
»Wer will das nicht, Ms. Wise«, sagte er müde. »Wer will das nicht.«
6
Die Hennessy-Drillinge stapften durch das Schneetreiben auf die Umkleideräume zu, am äußersten Ende des Südflügels. Vor der Garage mit den Motorschlitten sagte Connor: »Ist doch irgendwie ätzend, dass wir die Dinger nur das eine Mal ausprobieren konnten.«
»Woher hätte ich denn wissen sollen, dass er solche Sprünge nicht schafft?«, fuhr Bridger ihn an.
»Tja«, sagte Hailey. »Vielleicht hättest du dein Hirn einschalten sollen?«
»Ich hab ihn immerhin gelandet«, sagte Bridger.
»Ja, auf ’nem Felsen«, sagte Connor.
In der Nähe der Küche duftete es nach Knoblauch und Zwiebeln. Ein älterer Mann mit blassgrauem Bart und wettergegerbter olivfarbener Haut, bekleidet mit einem Kapuzenmantel, einer weißen Hose, Gummistiefeln und Handschuhen, kam aus der Küche getrottet, einen Eimer in der rechten Hand.
»Gehen Sie sie wieder füttern, Giulio?«, fragte Bridger gespannt.
Der alte Koch musterte die Anoraks der Teenager. »Was habt ihr denn schon wieder angestellt? Euch mit Farbe beschmiert?«
»So ähnlich«, gab Connor zu.
»Nicht gut«, stellte der Chefkoch mit Nachdruck fest.
Giulio Cernitori, Chef der viel gerühmten Küche des Clubs, war ein ausgezeichneter, wenn auch launischer Koch, der seine Ausbildung in den besten Restaurants von Mailand, Como und Florenz absolviert hatte. Nachdem er die drei zurechtgewiesen hatte, musste er grinsen. »Ihr wollt zusehen, wie ich sie füttere?«
Die Drillinge sahen einander an. Connor sagte: »Ihr habt Dad gehört.«
Bridger zuckte mit den Schultern. »So was kriegen wir zu Hause nicht zu sehen, stimmt’s, Hailey?«
Seine Schwester nickte. »Das ist schon was anderes als Tauben füttern im Park.«
Chefkoch Giulio stapfte den Abhang hinauf, wobei er einer ausgetretenen Spur im Schnee folgte.
»Dad wird ausrasten«, sagte Connor zu seinen Geschwistern.
»Manchmal bist du ein richtiger Hosenscheißer«, entgegnete Bridger und stapfte dem Koch hinterher, auf den Waldrand zu. Hailey warf ihr Brett in den Schnee und folgte den beiden.
Nach kurzem Zögern ließ auch Connor sein Brett fallen und bildete das Schlusslicht. Nach wenigen Minuten hatten sie den Waldrand erreicht. Der Schnee fiel hier weniger dicht, und an manchen Stellen zeigte sich noch immer der mit Kiefernnadeln bedeckte Waldboden und verströmte einen feuchtwürzigen Geruch. Am Rand einer Lichtung blieben die Teenager zurück. Giulio dagegen ging weiter und schüttelte den Eimer.
Eine Elster schwang sich kreischend von einem Ast und zog träge Kreise über dem Koch. Zwei Raben flogen von ihren Schlafplätzen auf und landeten dann vor dem alten Italiener im Neuschnee. Erwartungsvoll reckten sie die schwarzgefiederten Köpfe, als er in den Eimer langte, eine Handvoll Fleischbrocken herausfischte und auf den Boden warf. Die Elster landete ebenfalls. Die Raben zupften die Elster am langen, schwarz-weißen Schwanz, um die Rivalin von der Mahlzeit fernzuhalten, und machten sich dann über die Leckerbissen her.
Giulio griff erneut in den Eimer und warf weitere Brocken aus. Bald füllte sich die Luft um ihn herum mit heiserem Krächzen. Lachend hielt er einen Streifen Fleisch in die Höhe. Einer der Raben kam mit aufgerissenem Schnabel angeflogen und schnappte danach. Da streckte Giulio den zweiten Arm nach vorn. Nach kurzem Zögern ließ der Rabe sich darauf nieder und wurde mit dem Fleisch belohnt.
Den Leckerbissen fest im Schnabel, flog der Rabe auf und versuchte zwei Elstern zu entkommen, die krächzend hinter ihm her jagten. Giulio warf die restlichen Brocken in den Schnee und ging zu den Drillingen zurück.
»Ein schlauer Bursche, nicht?«, sagte er lächelnd.
»Der Klügste von allen!«, sagte Hailey und klatschte begeistert in die Hände. Sie hatte dem Koch schon einige Male beim Füttern der Vögel zugesehen und war immer wieder fasziniert.
»Eindeutig der Klügste«, sagte Bridger.
»Gut. Gut«, sagte Giulio, klopfte ihm auf die Schulter und stapfte wieder hügelabwärts. »Jetzt geh ich zu Mr. Burns und bespreche das Menü mit ihm.« Vor dem Eingang zur Küche blieb er stehen. »Kommt ihr im Sommer wieder?«
Hailey zuckte die Schultern. »Falls meine Eltern dann noch miteinander reden.«
Connor wurde ärgerlich. »Klar kommen wir wieder.«
»Gut«, sagte Giulio. »Dann bringe ich euch das Kochen bei, vor allem euch Jungs. Auf die Weise habt ihr immer satt zu essen, auch wenn ihr keine Frau abkriegt.«
Er ging lachend hinein. Die Drillinge hörten ihn mit Töpfen hantieren, und ein verlockender Duft nach gutem Essen drang zu ihnen heraus.
»Gehen wir«, sagte Connor und trottete davon. »Koffer packen.«
»Schade, dass wir nicht noch länger bleiben können«, meinte Bridger und folgte ihm.
Hailey sagte: »Morgen früh um neun fliegen wir, daran lässt sich nun mal nichts ändern. Am Montag fängt die Schule wieder an. Und am Mittwoch kommt Mama mit Ted aus den Flitterwochen.«
»Hör schon auf«, sagte Bridger. »Du nervst.«
»Ich sag nur, wie’s ist«, sagte Hailey.
»Vielleicht werden wir eingeschneit? Oder eine Lawine kommt runter, und wir müssen hier oben bleiben?«, meinte Bridger.
»Träum weiter, Junge«, sagte Connor. »Träum weiter.«
7
Nach dem Mittagessen verabschiedete sich Mickey Hennessy von den Doores, die noch Ski laufen wollten, und begab sich nach unten in den großen Ballsaal. Dieser war in den vergangenen vierundzwanzig Stunden zur Sperrzone erklärt worden, weil Horatio und Isabel Burns, die Gründer des Clubs, ihn für den Silvesterball schmückten.
Er besprach sich mit dem Wachpersonal, das am Eingang postiert war, und erfuhr mit Genugtuung, dass sie Chin Hoc Pan und Cheryl Wise abgewiesen hatten, als diese Horatio Burns sprechen wollten.
Hennessy betrat den Saal und traute seinen Augen nicht: Abertausend glitzernde Eiszapfen hingen von der Decke, Pappeln, um deren blattlose Zweige sich silberne Lichterketten wanden, säumten das Parkett. Er kam sich vor wie im Palast der Schneekönigin.
Letzte Vorbereitungen waren im Gange. Einige Handwerker schleppten Teile einer Bühne zur Hintertür herein. Die Bandmitglieder brachten ihre Instrumente, Mikrophone und Verstärker an. Die Verantwortlichen für das Bankett deckten die Tische mit feinstem Kristall und Tafelsilber und schmückten sie mit eleganten Blumenbouquets, in denen silberne Blätter und rubinrote Rosen dominierten.
Inmitten der hektischen Betriebsamkeit standen Küchenchef Giulio und Horatio Burns und führten gestikulierend eine hitzige Debatte.
»Was heißt hier, Sie mögen meine Sauce nicht?«, wollte Giulio wissen.
»Zu viel Knoblauch«, entgegnete Horatio Burns säuerlich. »Ich will nicht, dass meine Gäste sich schon nach dem ersten Gang die Zähne putzen müssen. Ende der Diskussion.«
Horatio Burns trug eine gebügelte Wrangler, ein gestärktes Hemd aus französischer Baumwolle, dazu schwarze, maßgefertigte Cowboystiefel und einen passenden Gürtel mit silberner Schnalle. Burns, wenn auch schon Ende fünfzig, war eine beeindruckende Erscheinung: eins fünfundneunzig groß, athletisch, auf eine raue Weise gut aussehend mit grauem Haar und jadegrünen Augen, die jedes Objekt, das sie begutachteten, nach seinem Wert bemaßen, in diesem Fall den Koch Giulio.
Hennessy ging davon aus, dass der Koch klein beigeben würde. Die meisten Leute waren von Burns eingeschüchtert. Kein Wunder. Um Burns’ Erfolgsstory rankten sich wilde Legenden.
Burns war als Waisenkind in Wyoming zur Welt gekommen, in einem Ort namens Gillette. Sein Vater hatte auf einer Bohrinsel gearbeitet und war bei einem Unfall ums Leben gekommen, als Horatios Mutter mit ihm schwanger war. Sie war bei seiner Geburt gestorben. Horatio war ein intelligentes, eigenwilliges und rauflustiges Kind gewesen. Er hatte die erste Zeit im Waisenhaus verbracht und war dann von einer Pflegefamilie zur nächsten weitergereicht worden, bis er sich mit siebzehn endgültig davongemacht hatte, um den Traum seines verstorbenen Vaters zu verwirklichen, der darin bestand, entlang des Powder River in Wyoming und Montana ohne Genehmigung nach Erdgas zu bohren.
Burns war schon beim ersten Versuch fündig geworden und hatte mit neunzehn seine erste Million verdient. Er investierte den Gewinn, um alte Schürfrechte und Claims aufzukaufen, und baute vor allem Phosphor und Bauxit ab. Mit vierundzwanzig verkaufte er für zweihundertsiebenundfünfzig Millionen Dollar seine erste Firma, Burns Minerals, und stieg ins globale Immobiliengeschäft ein. Später wandte er sich dem Transportwesen und dem Lebensmittelhandel zu. Sein Gehirn schmiedete unentwegt Pläne, und seine körperliche Verfassung ermöglichte es ihm, seinen Rivalen immer einen Schritt voraus zu sein. Zudem war er mit einer überaus charismatischen Persönlichkeit gesegnet. So mancher Gegner war seinem Charme erlegen und hatte es später bitter bereut. Wer dem Tycoon in die Quere kam, lernte schnell, dass er in erster Linie ein Konkurrent war. Und ein äußerst schlechter Verlierer.
Burns hatte die sieben höchsten Berge der Welt bezwungen, den Mount Everest sogar zweimal, hatte in einem selbst entworfenen Segelboot allein den Globus umrundet, beim Sporttauchen vor Mallorca spanische Schiffswracks entdeckt und mit dem Gold, das sie geladen hatten, ein beachtliches Vermögen gemacht. Er war aufbrausend, konnte schon mal aus der Haut fahren. Und derzeit war er – der jüngsten Rangliste im Forbes Magazine zufolge – ungefähr vierundsechzig Milliarden Dollar schwer.
Küchenchef Giulio zeigte sich unbeeindruckt. »Ich rede mit Ihrer Frau«, drohte er ihm. »Die versteht mehr vom Essen als Sie.«
»Wenn Sie das tun, Giulio, sind Sie gefeuert«, knurrte Burns.
»Geht nicht«, stellte Giulio trocken fest, ehe er sich zum Gehen wandte, »Sie haben mich schon an Heiligabend rausgeworfen.«
»Warum sind Sie dann noch hier, zum Teufel?«, brüllte Burns ihm hinterher.
»Ihre Frau hat mich am Ersten Weihnachtstag wieder eingestellt.«
Die Umstehenden, die den letzten Teil der Auseinandersetzung mit angehört hatten, mussten lachen. Burns rang entrüstet nach Worten, gab es auf und grinste achselzuckend in die Runde. Da klingelte sein Handy.
»Horatio«, fauchte er hinein, hörte kurz zu und sagte: »Genau, Bill. Wie sieht’s mit dem NASDAQ-SPDR-Investmentfonds aus?«
Er hörte erneut zu, wobei er wie ein Radargerät den gesamten Ballsaal in Augenschein nahm; schließlich entdeckte er Hennessy und winkte ihn zu sich. Hennessy folgte seiner Aufforderung und hörte ihn sagen: »Na schön, wenn du meinst, dann leg noch hundert Millionen drauf für Put-Optionen auf den NASDAQ SPDR, Laufzeitende Januar. Mit DOW und AMEX machen wir’s genauso. Wir suchen ein Fix von fünfzehn bis achtzehn Prozent. Nimm diesmal Isabels L.-L.-C.-Konto.«
»Schön, Sie zu sehen, Horatio«, sagte Hennessy, nachdem Burns das Gespräch beendet hatte.
Burns sah auf die Uhr. »Sind alle Gäste eingetroffen?«
»Die Grants waren die Letzten. Sie sind vor etwa drei Stunden angekommen. Sie wohnen im Chalet neben den Doores.«
»Wie viele Leute sind heute im Einsatz?«
Mit dieser Frage hatte Hennessy gerechnet. Burns wollte stets auf Heller und Pfennig wissen, wie hoch seine Ausgaben waren. Hennessy sagte ihm, dass fünfzehn Sicherheitsleute im Einsatz waren, drei Mann die Pisten glätteten, zwölf Leute in der Küche und zwölf im Saal beschäftigt waren, außerdem ein vierköpfiges Team hier im Clubhaus Bereitschaftsdienst hatte.
»Habt ihr euch mit den Bodyguards abgesprochen?«, fragte Burns.
»Mr. Crockett ist der Einzige, der seinen eigenen Leibwächter mitgebracht hat«, sagte Hennessy. »Die Übrigen scheinen sich auf unser Sicherheitssystem zu verlassen.«
»Kein Wunder«, sagte Burns, ein kaum wahrnehmbares Lächeln umspielte seine Lippen. »Es gibt kein besseres.« Das Lächeln verschwand, wich wieder dem Pokerface. »Kommen Sie mit Fosters Pflichten zurecht?«
Da sein direkter Vorgesetzter auf Trekkingtour in Patagonien war, lag die gesamte Verantwortung für die Sicherheit von HB1 Financial auf Hennessys Schultern.
»Bis auf einen kleinen Zwischenfall in Hongkong war alles ruhig«, sagte Hennessy. »Während der Neujahrsfeier sind dort im Büro ein paar Glasfenster zu Bruch gegangen.«
Burns nickte abwesend und wandte sich ab, schon mit dem nächsten Punkt auf der Liste beschäftigt.
Hennessy räusperte sich. »Kann ich Sie was fragen, Horatio?«
Der Multimilliardär sah ihn verdutzt an, so als hätte Hennessy ihm den Zeitplan vermasselt. »Schießen Sie los!«
»Haben Sie das ernst gemeint, als Sie zu Lou Dobbs sagten, Sie würden die Cashquote erhöhen?«
Burns musterte Hennessy kurz und sagte dann: »Ist schon vor zwei Wochen passiert, Mickey. Sobald ich ein wenig Logik am Markt erkenne, überlege ich mir, was zu tun ist.«
»Soll ich dasselbe tun, was meinen Sie?«, fragte Hennessy. »Mit meinem Rentenportfolio, meine ich. Und dem College-Fonds für die Kinder? Falls die Kurse in den Keller gehen, wäre ich außerstande, ihnen die Ausbildung zu finanzieren.«
Burns wandte sich zum Gehen. »Normalerweise gebe ich meinen Angestellten keine Investitionsempfehlungen, Mickey.«
»Ich habe ein Gespräch belauscht, im Börsenraum. Es soll auffällig viele Leerverkäufe geben für die Jahreszeit. Also hab ich mich gefragt, ob ich dasselbe tun sollte. Was meinen Sie?«