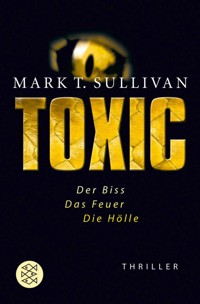
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Er lag nackt auf dem Bett. Und er hatte keine Ahnung, warum er sterben musste. Eine Serie von bizarren Sexualverbrechen erschüttert San Diego. Als Sergeant Moynihan zu einem neuen Tatort gerufen wird, findet er dort einen nackten Mann ans Bett gefesselt - von einer der giftigsten Schlangen der Welt zu Tode gebissen. Der Täter hat eine geheimnisvolle Botschaft hinterlassen.... Verschliessen Sie die Türen! Lassen Sie das Licht an! Sie werden keinen Schlaf finden, bis Sie zuende gelesen haben!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mark T. Sullivan
Toxic
Der Biss – Das Feuer – Die Hölle Thriller
Über dieses Buch
>»Es gibt keinen besseren Thriller als diesen...« Tess GerritsenEine Serie von bizarren Sexualverbrechen erschüttert San Diego. Als Sergeant Moynihan zu einem neuen Tatort gerufen wird, findet er dort einen nackten Mann ans Bett gefesselt - von einer der giftigsten Schlangen der Welt zu Tode gebissen. Der Täter hat eine geheimnisvolle Botschaft hinterlassen....Verschliessen Sie die Türen! Lassen Sie das Licht an! Sie werden keinen Schlaf finden, bis Sie zuende gelesen haben!
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Mark T. Sullivan ist Journalist und wurde bereits zweimal für den Pulitzer Prize for Investigative Reporting nominiert. Der Autor lebt nach Stationen in Boston, Agades/Westafrika, Washington, D.C. und Vermont heute mit seiner Familie in Montana.
Besuchen Sie den Autor im Web unter www.marktsullivan.com.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: HAUPTMANN & KOMPAGNIE, Werbeagentur, München – Zürich
Coverabbildung: Art Wolfe/Getty Images
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel ›The Serpent's Kiss‹ bei Atria Books, New York.
© Copyright 2003 by Mark T. Sullivan
Die Publikation erfolgt durch die Vermittlung von Linda Michaels Limited, International Literary Agency.
Für das E-Book:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2012
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402045-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
Epilog
Danksagung
Für Linda Chester und Joanna Pulcini, die mir ebenso wunderbare Freundinnen wie Literaturagentinnen sind.
So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Nod, jenseits von Eden, gegen Osten. Und Kain erkannte sein Weib …
Genesis, 4:16–17
Prolog
Der nackte Mann auf dem Bett lag im Sterben, und er hatte keine Ahnung, weshalb.
Mondlicht sickerte durch die dünnen Vorhänge, die sich am Fenster neben dem Bett bauschten. Er roch das Meer und versuchte stöhnend, seine Gedanken zu sammeln. Doch was ihm durch den Kopf ging, war ohne Logik und Zusammenhang: Die Krone eines frei stehenden Baumes im Dämmerlicht eines Gartens; das zielstrebige Rascheln eines unsichtbaren Tieres, das durch hohes Gras gleitet; der säuerliche Geschmack eines grünen Apfels; die schwüle Atmosphäre nach dem Sex. Fragen stürmten auf ihn ein: Wie heiße ich? Wie bin ich hierher geraten? Warum fließt in meinen Adern auf einmal Feuer statt Blut?
Auf all diese Fragen fand er keine Antwort. Schon eine ganze Stunde lang erreichten sein Bewusstsein nur noch Bruchstücke von Wahrnehmungen. Keine Vergangenheit. Keine Zukunft. Nur zusammenhanglose Momente einer entsetzlichen Gegenwart.
Beispielsweise spürte er, wie sich ein gelber Schleier über seine Augen legte, verschwand und wiederkam, als befände er sich in einem kleinen Boot auf stürmischer See, die Augen voller Salzwasser. Und als könne er nur ab und zu von einem Wellenkamm aus den Horizont erspähen. Seine Zähne klapperten. Die Finger, die Zehen und die Kopfhaut juckten und schmerzten. Sein linker Oberschenkel und seine rechte Armbeuge fühlten sich geschwollen an, hohl und straff, und das Blut pochte darin, dass er meinte, die Haut müsse aufplatzen. Unregelmäßiger Pulsschlag hallte in seinen Ohren wider.
Mit einem Mal setzte sein Atemreflex aus. Nun wurde jeder Atemzug zu harter Arbeit. Mühsam musste er die Brust aufblähen und Luft einsaugen. Ein marternder Druck baute sich in seinem Schädel auf, direkt hinter den Augäpfeln. Schrei, dachte er. Schrei, damit jemand kommt und dir hilft.
Aber er brachte nur ein hilfloses, rasselndes Geräusch heraus. Er spürte, wie sein Herz stockte, zögerte, dann wieder schlug, wie ein stotternder Motor, der mit schlechtem Treibstoff kämpft.
Wasser, dachte er. Ich brauche Wasser. Er versuchte, die Hände zum Mund zu führen, um irgendwie seine Zunge beiseite zu schieben, damit er etwas schlucken konnte, aber es gelang ihm nicht; seine Handgelenke schienen hinter seinem Kopf festgebunden. Auch die Beine konnte er nicht bewegen.
Einen Moment lang wurde er ohnmächtig. Dann fuhr ihm ein gewaltiger Stich durch den Brustkasten und peitschte ihn ans Ufer des Bewusstseins zurück. Atmen, atmen.
Nun konnte er kaum noch etwas sehen. Das ganze Zimmer, das Bett, die Decke, die Vorhänge und das Mondlicht verschwammen in einer schmutzig gelben Brühe.
Mit einem Mal spürte er, dass da etwas war in dieser Flüssigkeit, ein schemenhafter Umriss, der in seine Richtung schwamm. Die Schattenform schien zu leuchten, sie trug eine Kapuze und wirkte irgendwie erotisch. Ein Höhlengeruch wie nach vermoderndem Holz schien ihr zu entströmen. Dazu ein trockenes, rasselndes Geräusch.
»Hilfe«, brachte er mühsam hervor.
Der Schatten beugte sich über ihn. Eine Stimme kam wie durch eine meterdicke Wasserwand zu ihm: »Ich werde dir helfen: Markus, Kapitel sechzehn … «
Die Stimme sprach weiter, doch der Mann achtete nicht mehr auf die unverständlichen Worte. Seine Aufmerksamkeit wurde jetzt von einem Gewicht gefesselt, das plötzlich auf seiner Brust lastete, kühl, glatt und sich windend, und die Stimme, die aus der Flüssigkeit zu ihm drang, war nur noch wie ein Gesang aus der Ferne.
Etwas Schartiges bohrte sich in seinen Kinnansatz. Flüssiges Feuer ergoss sich in seinen Körper. Er krampfte sich zusammen, rang nach Luft, und seinem verlöschenden Geist erschien eine letzte Vision: Gewitterblitze zuckten über einen Nachthimmel. Zikaden sangen. Eulen schrien. Bedrohlich krochen Wolken über den Horizont, er erwartete sie auf einer Felsklippe in einem Wald aus Buscheichen, Kiefern und Kudzu. Die Regentropfen wurden dicker und dunkler, dann verwandelten sie sich in Hagelkörner. Der Eisregen verdichtete sich zu einem Wirbel, der ihn ins Wanken brachte und von seinem Felsausguck riss. Taumelnd stürzte er in eine schwarze, brodelnde flüssige Tiefe.
1
Dreißig Stunden später, morgens um Viertel vor acht, zogen Wolken vom Pazifik landeinwärts, grau wie Tahitiperlen, getrieben von einem eisigen, unermüdlichen Wind, der die Wellen niederdrückte und an den Klippen nagte. Ein ungewöhnlich unfreundliches Wetter für einen Landstrich, der ansonsten vom Klima verwöhnt ist. Aber an diesem Morgen des 1.April, einem Samstag, war es kalt in La Jolla, Kalifornien. Hätte jemand Mary Aboubacar gefragt, ein Zimmermädchen, das erst kürzlich aus Kenia eingewandert war, so hätte sie sogar ohne Zögern gesagt, es sei eiskalt.
Mary bibberte, sah den aufgewühlten Ozean tief unter ihr und kehrte dem Wind den Rücken. Die hoch gewachsene Frau war Ende zwanzig und hatte eine Haut wie die Farbe von cremigem Mokka. Sie schlug den Kragen ihrer Jacke hoch und griff nach dem Eimer mit dem Putzzeug. Dann setzte sie ihren Weg durch das üppig bewachsene Areal eines Apartmentkomplexes fort, der den einfallslosen, aber treffenden Namen »Sea View Villas« trug. In der Anlage wohnten die Forscher und Laboranten, die mit Zeitverträgen in der boomenden Biotechnologie-Industrie von San Diego arbeiteten und sich hier monatsweise für 2000 Dollar einmieteten. Für Wäsche und Putzfrau waren 400 Dollar extra fällig.
Marys Chef hatte sie um sechs Uhr morgens angerufen und sie gebeten einzuspringen, weil sich die Samstagsputzfrau krankgemeldet hatte. Für Mary war es schon die zweite Extraschicht, und sie hatte noch sieben Objekte vor sich.
Sie stemmte sich gegen den Wind. Der betonierte Weg bog zu Gebäude Nummer fünf ab, einem dreistöckigen Bau, der sie an eine Botschaft in Nairobi erinnerte. Weiß verputzte Wände, verzierte Holztüren und ein Dach in der Farbe des roten Lehms, wie es ihn in dem Hochland gab, wo sie aufgewachsen war.
Mary setzte den Eimer an der Treppe ab und machte einem Mann Platz, der die letzten Treppenstufen herunterhastete. Die Einwohner von Sea View sahen alle irgendwie gleich aus: Jung, reich und immer in Eile, und sie wohnten hier nur so kurz, dass Mary ihre anfängliche Gewohnheit aufgegeben hatte, sie zu grüßen. Dennoch registrierte sie, dass es ein Weißer war und sie ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Und er kam ihr aufgeregt vor. Mit einem burgunderroten Lederkoffer verschwand er Richtung Parkplatz.
Mary rieb sich den Rücken, nahm ihren Eimer wieder auf und ging in den zweiten Stock hinauf zu ihrem ersten Objekt. Sie klingelte, wartete eine Weile, klingelte noch einmal. Als ihr niemand antwortete, drückte sie die Klinke herunter und öffnete die Tür einen Spaltbreit. »Der Reinigungsservice«, rief sie mit ihrer singenden Stimme. »Niemand zu Hause?«
Mary stieß die Tür ganz auf. Mit zögernden Schritten trat sie ein, knipste das Licht an und erfasste den großen Wohnraum mit einem Blick. Das war eine Luxuswohnung mit freier Aussicht und Möbeln in Sonderausstattung. Gläserne Schwebetüren führten auf einen Balkon mit Meerblick. Die Vorhänge mit dem Fischgrätenmuster waren zugezogen. Cremeweißer Teppich. Couchtisch mit Glasplatte, Ledersofa und Zweiercouch vor Fernseher und Stereoanlage. Die Küchenzeile hinter einem Tresen komplett in Edelstahl.
Die Wohnung sah aus, als sei sie gerade sauber gemacht worden. Nirgends eine Zeitung. Kein Geschirr im Abwaschbecken. Der Teppich frisch gesaugt. Es roch nach Putzmittel.
Mary zog einen Zettel aus der Tasche und verglich ihre hingekritzelten Notizen mit der Nummer an der Außentür – Haus fünf, Wohnung neun. Sie zuckte die Schultern und freute sich über ihr Glück. Dieses Objekt konnte sie als erledigt eintragen, ohne einen Finger krumm gemacht zu haben.
Sie war schon drauf und dran, zu ihrem kleinen Pausenversteck draußen an der Klippe zu gehen, um dort in Ruhe eine Zigarette zu rauchen, als sie zur Sicherheit doch noch einen Blick auf den Rest der Wohnung werfen wollte. Sie ging durch den Flur, wo eine gerahmte Fotografie der Coronado vorgelagerten Inseln bei Sonnenuntergang hing. Als sie auf dem Teppich vor der verschlossenen Tür des Schlafzimmers rotes Kerzenwachs sah, runzelte sie die Stirn. Ein übler Geruch stieg ihr in die Nase, und sie hielt einen Moment inne. Offenbar war der jetzige Mieter – sie kannte nicht einmal seinen Namen – auf der Toilette gewesen, als sie an der Tür geklingelt und gerufen hatte.
Sie klopfte. »Hallo?« Da sie nichts hörte, drückte sie die Klinke herunter und öffnete die Tür. Ein heftiger Windstoß schlug ihr durchs offene Fenster entgegen. Mary warf einen Blick in das Schlafzimmer und sprang entsetzt zurück.
»Ebola!«, schrie sie und rannte über den Flur zur Haustür. »Ebola!«
2
Etwa fünfundzwanzig Kilometer entfernt, auf einem Baseballplatz in North Park, in einem bedeutend schmuckloseren Teil von San Diego, erlebte Jimmy Moynihan zu dieser Stunde sein erstes Golgatha.
Das erste Inning war gerade vorbei, und Jimmy lag drei zu null hinter dem besten Hitter der League zurück, einem Brocken namens Rafael Quintana, gerade einmal zwölf Jahre alt, dessen Schultern vermuten ließen, dass ihn sein alter Herr mit testosteronfördernder Kraftnahrung voll stopfte.
»Los, Jimbo, zeig’s ihm«, rief ich ihm vom Zaun am rechten Spielfeldrand zu. »Ich will ›Strike‹ hören.«
Jimmy sah durch seine Brille an mir vorbei. In Gedanken ganz woanders, spielte er hinter seinem Rücken mit dem Ball. Er war unsicher. Schlecht für einen Pitcher. Ganz ähnlich wie ich im Alter von zehn war er ein langer, schmaler Kerl mit Sommersprossen, dichtem schwarzem Haar und einer mächtigen Zahnspange im Mund. Und genau wie ich war er mit einem überraschend starken Arm und flüssigen Bewegungen gesegnet. Aber ich habe in vielen Jahren gelernt, dass es Tage gibt, an denen man in Form ist, und solche, an denen einem nichts gelingt, und an diesem feuchtkalten Morgen sah es so aus, als würde mein einziger Sprössling rein gar nichts zustande bringen.
Er holte zum Wurf aus. Ich schickte ein stummes Gebet zum Gott der Little League. Jimmy servierte den Ball wie auf dem Silberteller, eine Idealvorlage, hüfthoch. Rafael pulverisierte ihn. Das ergab drei Runs. Und ich fühlte mich wie der Typ, dem Paul Newman in Butch Cassidy und Sundance Kid in die Eier tritt.
Ich war auf einen Tränenausbruch von Jimmy gefasst, wie er normal ist bei einem Kind, das was auf den Deckel bekommt. Aber in seinen Augen blitzte nur Zorn auf, und er trat gegen das Mal.
»Was sagst du dazu?«, fragte Don Stetson, mein Assistenztrainer, ein zäher Kerl, der mich vergötterte, weil ich vor Urzeiten, vor vielen, vielen Monden, einmal in den Major Leagues Pitcher gewesen war. Allerdings nur neunzehn Spiele lang.
»Dass wir Rafaels Geburtsurkunde überprüfen sollten, vielleicht ist er alt genug, mit uns nach dem Spiel ein paar Coronas zu kippen. Ein, zwei Bluttests wären vielleicht auch angesagt.«
»Unsinn, Shay«, meinte Don. »Die machen uns gerade platt.«
»Das sehe ich auch. Mist, wie ich das hasse«, erwiderte ich, trat aufs Spielfeld und rief: »Time!«
Ich lief über das Feld zu Jimmy, der immer noch mit dem Fuß das Mal bearbeitete. Er würdigte mich keines Blickes.
»Das ist in die Hose gegangen«, sagte ich und nickte zum Zaun am linken Spielfeldrand.
»Mir geht’s prima, alles bestens«, antwortete Jimmy. »Lass mich weitermachen.«
»Früher oder später kriegt jeder mal eins aufs Dach.«
»Du nicht.«
»Es gibt noch vieles, was du über deinen Alten lernen musst.«
»Das sagt Mom auch immer.«
»Kluge Frau, deine Mom.«
»Sie meint das nicht nett.«
»Sieh mal an«, antwortete ich. »Jetzt schick Lawton rein und übernimm seinen Posten im Rightfield. Und mach mir Ehre da draußen. Aufgegeben wird nicht, klar?«
Er blickte zu mir auf und antwortete sarkastisch: »Aufgegeben wird nicht. Schön, Dad, ich werd’s mir merken.« Er drückte mir den Ball in die Hand, drehte sich um und rannte nach links. Ich sah ihm nach, schüttelte den Kopf und ging zur Trainerbank zurück. Jungs haben es wirklich nicht leicht: Gerade mal zehn Jahre sind sie auf dieser Erde, da müssen sie schon lernen, dass das Leben eine harte Sache ist.
Von den Stehplätzen aus sah uns meine Exfrau Fay zu. Selbst in ausgefransten Shorts und einem alten Sweatshirt sah sie noch umwerfend aus. Rotblondes, sonnendurchflutetes Haar fiel ihr wild über die Schultern, umrahmte sommersprossige Wangen, eine Adlernase und Lippen, die sich halb spöttisch, halb bestürzt kräuselten, als ob sie alleine die grausame Ironie des Lebens zu würdigen wüsste. Aber es waren ihre Opalaugen, die mich packten – die mich schon immer gepackt hatten –, diese rauchigen Augen, mit denen sie mich mühelos durchschauen konnte. Was ungefähr die Hälfte unseres Problems ausmachte.
Sie schaute mich an, und ich zuckte mit den Schultern. Sie lächelte mir nicht zu, sondern hob nur die Augenbrauen und wandte sich ihrem neuesten Kerl zu. Der hieß Walter Patterson, stand auf Gartenarbeit und selbst gebackenes Brot, trommelte, ging zu Lyriklesungen und war für lange Strandspaziergänge zu haben – die übrige Zeit rackerte er sich als Chefarzt in der Notaufnahme des Universitätsklinikums von San Diego ab, dem größten Krankenhaus im County.
Walter hatte regelmäßige Arbeitszeiten, versäumte nie eine Verabredung, brach nie ein Versprechen, lief nicht anderen Frauen hinterher, spielte nie verrückt und überließ es Fay, die Grenzen ihrer Beziehung zu bestimmen. Das ist wahrscheinlich sein größtes Plus, dachte ich und wandte mich wieder dem Spiel zu.
Jimmy war als Nächster am Schlag. Da meldete sich der Piepser an meinem Gürtel.
»Mist«, sagte ich, als ich die Nummer sah. Ich zog mein Handy heraus und ging hinter die Trainerbank. »Das ist hoffentlich nichts Unangenehmes. Mein Kleiner ist gleich dran.«
»Tut mir Leid, Sergeant«, meldete sich die glockenhelle Stimme von Lieutenant Anna Cleary, der Diensthabenden. »Wir haben eine Leiche. Der Sheriff hat Mondanzüge für die Besichtigung geordert.«
»Mondanzüge?«
»Die Streife sagt, es könnte eine bakteriologische Verseuchung vorliegen. Rogers will nichts riskieren. Der Arzt auch nicht.«
»Klingt prickelnd.«
»Hab ich mir gedacht, dass es was für Sie ist.«
»Sie sind immer so nett zu den Mühseligen und Beladenen, Anna«, sagte ich.
»Nur zu Ihnen, Shay«, erwiderte sie.
»Wo?«
»Sea View Villas, La Jolla.«
»Tod unter den Schönen, Superreichen und Dompteuren der DNA«, meinte ich, schaltete das Handy aus und kam wieder hinter der Trainerbank hervor, um Jimmy an der Homeplate zu sehen. Als er sich fertig machte, sah er mich mit diesem »Bitte geh nicht weg«-Blick an, mit dem ich in den letzten vier Jahren zu leben gelernt hatte. Ich fummelte meine Dienstmarke heraus. Bei ihrem Anblick stieg wieder die Wut in ihm hoch, und er wandte sich ab. Das Gewicht der ganzen Welt lag in seinem Schlag, und in meinem Bauch breitete sich das bekannte hohle Gefühl aus, das mich immer packt, wenn ich ihn allein lassen muss.
3
Zwanzig Minuten später war ich bei den Sea View Villas und parkte meine metallic-grüne Corvette. Dieses Auto in einem tadellosem Zustand zu erhalten, war mehr oder weniger das Einzige in meinem Leben, was ich mühelos schaffte. Im Dienst fahre ich den guten alten Sportwagen aber so gut wie nie. Für meine Ausflüge auf die dunkle Seite von San Diego stellt mir die Polizei einen zivilen Plymouth zur Verfügung. Aber Jimmy liebt das Gefährt, und an diesem Morgen war ich an der Reihe, ihn zum Spiel zu bringen. Und eine Fahrt in einer alten Corvette ist nun wirklich das Mindeste, was ich für ihn tun kann.
Diesiger Nebel hing über dem Parkplatz, als ich ausstieg, und man roch das Meer. Ich ging zu dem uniformierten Polizisten, der an der Hecktür eines weißen Vans vom Sondereinsatzkommando für Gefahrstoffe stand. Das Blaulicht verfing sich mit einem merkwürdigen Stroboskopeffekt im Nebel, und ich stutzte, weil vor mir plötzlich das Bild eines viel jüngeren, einundzwanzigjährigen Seamus Michael Moynihan auftauchte, der auf klickenden Stollen durch einen dunklen Tunnel lief, in dem der Geruch von Schweiß, Ruhm und rasch verflogenen Träumen hing.
Solche Flashbacks aus meinem früheren Leben hatte ich schon seit Monaten mit wachsender und frustrierender Regelmäßigkeit: Kaum erblickte ich die Maschinerie der Mordkommission in Aktion, da sah ich mich selbst, wie ich vor vielen Jahren durch diesen Tunnel dem strahlenden Sonnenlicht und einer jubelnden Menge entgegenlief.
Ich bleibe geblendet stehen und schaue auf meinen Handschuh. Mir ist zumute, als ob ich gleich kotzen müsste. Die Rufe im Stadion schwellen ohrenbetäubend an, wie Sirenen, die mich ins Licht und in die sagenumwobenen Gefilde von Fenway Park locken.
Beim Warm-up schaue ich bewusst nie in die Zuschauerränge. Ich konzentriere mich auf meinen Catcher, auf seinen Handschuh, auf das schimmernde Gras und den feuchten roten Sand zwischen uns. Nur ab und zu erlaube ich mir zwischen zwei Würfen einen kurzen Blick auf die Wand, die links von mir in schwindelerregende Höhe wächst. Dann endet die Nationalhymne, und ich nehme meine Position ein, ohne zu ahnen, dass es mein letztes Spiel in der Major League sein wird.
Nach dem Warm-up erlaube ich mir schließlich einen Blick zur Tribüne. Zuerst erscheint mir die Menge nur als ein Gewimmel tausender lärmender Farbflecke, ein lebendig gewordenes impressionistisches Gemälde.
Dann treten einzelne Gesichter hervor, allesamt weiblich. Die Rothaarige an der Ecke vom Schutzzaun winkt mir zu. Ich könnte schwören, dass ich sie kenne. Die Brünette drei Reihen hinter der Trainerbank der Yankees hebt ihr Bier, bei ihr bin ich mir nicht sicher. Die Blonde hinter der Third Base klimpert mit ihrem Hotelzimmerschlüssel, und ich wende mich erschrocken ab: Die kenne ich wirklich.
»Play ball!«, ruft der Schiedsrichter. Gerade werfe ich einen letzten Blick in die Menge, vorbei an der Blonden in die Tribüne, die an das Green Monster, die hohe Schutzwand von Fenway Park, grenzt. Dort steht ein Mann. Er ist hager, trägt ein blaues Polohemd und hat dichtes rotes Haar. Eine Sekunde lang bin ich völlig verwirrt. Er sieht aus wie mein Vater. Und mir ist, als liefe meine gesamte Vergangenheit und Zukunft in diesem einen Augenblick zusammen. In diesem einen Augenblick.
Ich blinzle, schüttle den Kopf, und weg ist er. Ein Geist. Ein Gespenst, das mich bis auf den heutigen Tag verfolgt. Alles mag sich ändern, das jedoch nie. Die Fixpunkte meines Lebens: Baseball, Frauen, der Tod.
Der Nebel ging in eiskalten Regen über, der mich aus meinen Erinnerungen riss. Auf den letzten Metern zu dem Sonderfahrzeug beschleunigte ich meinen Schritt. Gleich darauf half man mir in einen Anzug, mit dem ich auch in Tschernobyl eine gute Figur gemacht hätte. Kein Mensch wusste, ob wir es wirklich mit Ebola zu tun hatten, aber wir wollten es natürlich nicht darauf ankommen lassen.
Als ich den Hosenbund festzurrte, traten die hinter dem Van versammelten Polizisten zur Seite, um einem gebräunten Mann in der blauen Windjacke der Mordkommission Platz zu machen. Detective Rikko Varjjan war Anfang vierzig, groß und wog seine neunzig Kilo. Er hatte eine schon leicht ergraute Stoppelfrisur, im linken Ohr trug er einen Diamantstecker.
»Wie läuft’s?«, fragte ich.
»Missy unterhält sich gerade mit dem Hausverwalter«, nuschelte Rikko mit dem starken Akzent eines Israeli. »Jorge befragt die Putzfrau. Ich? Ich bete, dass es ein Selbstmord ist, was sonst?«
»Sie hoffen wohl immer, dass es Selbstmord ist, Detective Varjjan, was?«, lachte Dr.Marshall Solomon, der medizinische Gutachter des San Diego County, der neben mir gerade in seinen Kampfanzug verpackt wurde.
Rikko verzog das Gesicht. »Erklären Sie es zum Selbstmord, dann kann ich nach Hause gehen und bei der Ballettvorführung meiner Kleinen zusehen. Ich verpasse das nicht gerne, nur weil irgendein Schwachkopf sich vom Leben in den Tod befördert hat.«
Ich musste grinsen. Typisch Rikko. Sein Vater war ein ungarischer Jude, ein Überlebender von Treblinka, der nach Israel emigriert war, wo er eine Amerikanerin aus San Diego kennen lernte. Wie alle jungen Israelis hatte Rikko in der Armee seines Landes gedient. Während der Intifada in den späten achtziger Jahren war er Patrouillenführer in Jerusalem gewesen. Danach war er in den Jerusalemer Polizeidienst gewechselt und einer der Besten in der Mordkommission der Heiligen Stadt geworden.
Vor sieben Jahren arbeitete er an einem Fall, der ihn nach San Diego führte. Dort lernte er mich kennen, und über mich meine Schwester. Die beiden verliebten sich ineinander. Er hatte genug vom Leben in Israel und bewarb sich bei der Polizei von San Diego. Da er eine doppelte Staatsbürgerschaft besaß und beeindruckende Leistungen vorweisen konnte, wurde er bald eingestellt. Seine Einschüchterungstaktik gegenüber Verdächtigen ist nicht bei allen Vorgesetzten gut angesehen. Aber er arbeitet sehr erfolgreich. Außerdem ist er ein lustiger Kerl und mein bester Freund.
Normalerweise ist Rikko durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Aber an diesem Morgen wirkte er verunsichert. »Doc, hatten Sie es schon mal mit Ebola zu tun?«
Solomon, ein hagerer Typ mit silbrigem Spitzbart, schüttelte den Kopf. »Vor ein paar Jahren hatten wir mal einen Fall von Hantavirus, ein entfernter Verwandter des Ebolavirus, draußen im East County. Die Autopsie war ein Albtraum. Die Gesundheitsbehörde ließ dafür einen komplett versiegelten Container einrichten.«
Ich schüttelte mich und bat den Helfer vom Seuchenteam, mehr Klebeband um meine Handgelenke zu machen, als eine kleine, kräftig gebaute Asiatin durch den Regen auf uns zukam, in der einen Hand einen Starbucks-Becher, in der anderen ein schmales weißes Notizheft.
»Ich habe eine vorläufige Identifizierung des Opfers, Sarge«, erklärte sie.
»Lassen Sie hören.«
»Morgan Cook, Jr.«, begann sie. »Biotechnologe bei Double Helix. Seit etwa drei Monaten hier. Verheiratet. Kinder. Hat ein Haus im Norden von L.A. Fährt an den Wochenenden normalerweise nach Hause. Der Hausverwalter hat keine Klagen über ihn. Verhielt sich unauffällig.«
»Ist sich die Putzfrau sicher mit dem Ebola?«, wollte Rikko wissen.
Solomon verzog spöttisch das Gesicht. »Klar doch«, warf er hin. »Sie hat einen Doktortitel in Raumpflege, kann also mit Leichtigkeit eine der seltensten und gefährlichsten Viruserkrankungen der Welt diagnostizieren.«
»Nicht so voreilig, Doc«, widersprach Missy und wedelte mit dem Notizblock. »Sie sagt, sie hat als Schwesternhelferin in einem Krankenhaus in Nairobi gearbeitet und dort Ebola-Leichen gesehen.«
Selbst der unförmige Polizeiregenmantel konnte die athletische Figur von Missy Pan nicht kaschieren. Auf dem College war sie Mittelfeldspielerin in der zweiten Hockey-Nationalmannschaft gewesen. Sie hat die kräftigsten Beine und die breitesten Schultern, die ich je an einer Frau gesehen habe. Ihre Versuche, ihre Gestalt ein wenig weicher erscheinen zu lassen, sind zum Scheitern verurteilt – von ihrer Statur geht einfach der Eindruck geballter Kraft aus. In ihr steckt ein Drache, habe ich oft gedacht, der über wilde Entschlossenheit, ein ansteckendes Lachen und die Fähigkeit verfügt, vierundzwanzig Stunden durchzuarbeiten, ohne auch nur einmal zu gähnen. Wirklich kein einziges Mal.
»Wir werden das schon noch herausfinden, danke schön, Detective«, grummelte Solomon in ihre Richtung.
»Hat jemand eine Ahnung, woran Cook in dieser Biotechnologie-Firma gearbeitet hat? Vielleicht an irgendeinem Virus, über das wir besser Bescheid wissen sollten?«
»Ich kümmere mich drum«, versprach Missy und ging zu ihrem Wagen.
Rikko sah ihr durch den Regen nach und ließ seinen Blick dann zu dem gelben Absperrband am Treppenaufgang zu Gebäude Nummer 5 schweifen. »Glaubst du, man kann sich irgendwie mit Ebola das Leben nehmen?«
»Schätze, das kommt alle Tage vor«, erwiderte ich. »In Mombasa.«
4
»Ein kleiner Schritt für Moynihan«, sagte ich und stieß die Wohnungstür auf, die nach Mary Aboubacars Flucht immer noch einen Spalt offen stand.
»Ein großer Sprung für Amerikas beste Polizeitruppe«, gluckste Dr.Solomon mit schaurig rauschender Stimme durch die Funkübertragung. Wir waren beide mit Kameras ausgerüstet, ich mit einer Polaroid, er mit einer Nikon.
Bei der Besichtigung eines Leichenfundorts hätten Solomon und ich normalerweise gleich ein Team vom Erkennungsdienst mitgenommen. In diesem nun wirklich ungewöhnlichen Fall wollten wir die erste Inaugenscheinnahme aber allein durchführen, um abschätzen zu können, ob weitere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden mussten. Schließlich konnte Cook ja tatsächlich an Ebola gestorben sein. An der Tür zum Schlafzimmer blieb ich stehen. Durch das offene Fenster wurde der Regen durch das ganze Zimmer geweht. Der Teppich war bereits voll gesogen, der Spiegel an der gegenüberliegenden Wand mit Tröpfchen besprüht. Der Tote lag auf dem Bett.
»Allmächtiger«, entfuhr es mir.
In meiner Zeit bei der Polizei hatte ich schon so einiges zu Gesicht bekommen: Stark verweste Tote, Wasserleichen, die fürchterlichsten Schussverletzungen und Mordopfer, die regelrecht hingemetzelt worden waren. Aber so etwas hatte ich noch nicht gesehen. Mir wurde schwindlig, und mir wurde flau im Magen, wie damals mit zehn Jahren bei meiner ersten Achterbahnfahrt.
»Allmächtiger kann man hier wohl sagen«, sagte Solomon. »Fotografieren wir ihn erst einmal in situ, bevor wir reingehen.«
Ich nickte, schluckte und wappnete mich mit der Gefühllosigkeit, die mein Beruf verlangt. Dann knipste ich das schwache Deckenlicht über dem Bett an und fummelte mit der Polaroid herum. Ich nudelte zehn Bilder durch, Solomon schoss unterdessen mit seiner Nikon.
»Schreckliches Licht, wie üblich, aber das sollte reichen«, sagte ich und wies zum Fenster. »Ich mach das mal zu.«
»Pass bloß auf, dass du dir nicht irgendwo den Anzug aufschlitzt«, warnte mich Solomon. »Nach neuesten Untersuchungen wird Ebola nicht auf dem Luftweg übertragen. Aber wir gehen lieber kein Risiko ein.«
»Keine Angst, Doc, ich mach hier keine Turnübungen.«
Die Plastikhüllen, die ich über meinen Sneakern trug, knisterten auf dem cremefarbenen Teppich. Ich passierte einen Kleiderschrank aus Kiefernholz sowie einen blauen Koffer mit dazu passender Laptoptasche, bevor ich vorsichtig durch die Wasserpfütze auf das doppelflüglige Fenster zutrat, um es zu schließen. Ich wandte mich um und blickte auf eine nasse, niedrige Kiefernkommode unter einem wasserblinden, tropfenden Spiegel. Darauf lagen eine Toilettentasche für Herren und deren teilweise verstreuter und regennasser Inhalt: Rasierschaum, Haarwasser, Deo, Männerparfüm Southern Nights und eine angebrochene Schachtel Kondome.
Die Nachttischchen zu beiden Seiten des schmiedeeisernen Betts passten zum Kleiderschrank und zur Kommode. Darauf standen Nachttischlämpchen, die dem rustikalen Charakter der gesamten Möblierung entsprachen. Das Zimmer hätte wunderbare Weichzeichneraufnahmen für einen Landhausmöbelkatalog hergegeben.
Wäre da nicht die Leiche gewesen.
Der Tote lag nackt auf dem Rücken, Arme und Beine weit gespreizt. Die malvenfarbene Tagesdecke, das weiße Betttuch und die Bettdecke hatte er ans Fußende gestrampelt. Er hatte zottiges, sonnengebleichtes Haar wie ein Surfer. Der Kopf war in den Nacken geworfen und der Oberkörper nach links geneigt, als habe er sich in den letzten Momenten seines Todeskampfes herumgeworfen. Sein Körper war mit schwarzen Flecken übersät und an manchen Stellen extrem geschwollen. Besonders entlang der rechten Hüfte und am linken Arm spannte sich die Haut wie über einer Trommel. An diesen Stellen zeigten sich rote Hautblasen, die wie Glasrubine aussahen, die meisten von der Größe eines Zehncentstücks, manche auch so groß wie eine Dollarmünze. Mindestens ein Dutzend davon waren aufgeplatzt. Blut und Körperflüssigkeit waren aus den Wundstellen ausgetreten und an Armen und Beinen zu einem blassroten Marmormuster eingetrocknet. Geronnenes Blut verkrustete die schlaffen Mundwinkel. Es sah aus, als hätte sich ein verwirrter Greis mit Lippenstift beschmiert. Zwischen den Beinen war ein bräunliches Rinnsal zu sehen, das sich über das weiße Bettzeug schlängelte.
Auf dem Nachttisch zur Rechten lagen eine Brieftasche und ein umgefallenes Bilderrähmchen. Ich legte die Kamera auf den Boden, drehte den Rahmen um und sah einen gut aussehenden Mann, Mitte dreißig, mit Surferfrisur und kräftigem, muskulösem Körperbau. Er saß auf einem Felsen, flankiert von einer hübschen, rundlichen Frau und zwei kleinen Kindern, einem Jungen und einem Mädchen. Alle vier trugen khakifarbene Shorts und blaue Polohemden. Ein vom Fotografen arrangiertes Familienporträt.
Ich stellte es wieder hin und griff nach der Brieftasche. Die Handschuhe des Schutzanzugs waren ziemlich klobig, weshalb sich der gesamte Inhalt über den Boden verstreute: Kreditkarten, Visitenkarten, Mitgliedskarte der Ehemaligenorganisation einer texanischen Universität, ein kalifornischer Führerschein – alles auf denselben Namen ausgestellt.
»Morgan Cook junior, was haben sie bloß mit dir gemacht?«, murmelte ich in das Mikrophon.
Solomon, der auf der anderen Seite der Leiche stand, blickte auf. »Gute Frage«, rauschte es in meinem Kopfhörer.
»Nun, war unsere Ms Afrika mit ihrer Diagnose auf dem Holzweg?«
»Blutaustritt aus den Körperöffnungen, das passt zu Ebola. Entfärbung und Zerstörung des Gefäßsystems ebenfalls. Außerdem zeigen Opfer von Ebola und verwandten Viren häufig Bullae – das sind diese Blasen und Pickel hier auf der Haut. Der Tod ist schon vor einer ganzen Weile eingetreten, wahrscheinlich vor mehr als einem Tag, teilweise sind das schon Verwesungsmale. Was aber nicht zu Ebola passt, sind das rechte Bein, der linke Arm, der Kopf und der Hals.«
»Aha?«, sagte ich.
»Wenn das Ebola ist, woher kommen dann die großen Ödeme gerade an diesen Stellen?«, dachte Solomon laut nach. »Warum ist nicht der ganze Körper gleichmäßig entstellt? Und schau dir mal das linke Handgelenk und das rechte Fußgelenk an.«
Ich musste meine Position ändern, um zu sehen, was er meinte. Da fiel es mir auch auf: Beide Gelenke waren eingeschnürt wie eine Sanduhr, und an diesen Stellen war die Haut besonders dunkel und glänzte stark. »Wo zum Teufel kommt das her?«, fragte ich.
Solomon wies zum rechten Handgelenk und zum linken Fußgelenk, die weniger schwärzlich angeschwollen waren und auch nicht so glänzten. »Das war das Gleiche, was die drei durchgehenden Furchen um die beiden anderen Gelenke verursacht hat.«
»Seile.«
»Als Fesseln«, sagte Solomon.
Der Leichenbeschauer beugte sich vor, um durch seinen Sehschlitz die Blutblasen und offenen Wunden am Hals der Leiche begutachten zu können. Schließlich streifte er seinen Kopfschutz ab. »Mit diesem blöden Ding kann man ja nichts sehen.«
Ich sah ihn an, als wäre er durchgedreht. »Doc, du riskierst...«
»Das ist kein Ebola, Shay«, meinte er finster. »Dieser Mann ist an Gift gestorben.«
»Gift?«
»Schlangenbisse.«
»Das kommt von Schlangenbissen?«
Solomon nickte. »Manche Schlangengifte zerstören das Gewebe und das Gefäßsystem, ganz ähnlich wie Ebola. Und sie rufen auch derartige Blutblasen und Schwellungen hervor. Aber ich habe noch nie einen gesehen, den es so schlimm erwischt hat. Wie es aussieht, ist Cook mehrmals gebissen worden. Wir werden seinen Körper mit der Lupe absuchen müssen, um die Bissstellen zu finden.«
Ich ließ den Blick von den Abschürfungen der Fesseln zu den trommelartig geschwollenen Stellen von Cooks Körper schweifen und bekam wieder das Achterbahngefühl. »Was ist das für ein Irrer, der jemanden auszieht, fesselt, und dann eine Schlange auf ihn loslässt?«
»Du bist die Leuchte der Mordkommission von San Diego, mein Freund. Das herauszufinden ist dein Job.«
5
Die Polizei von San Diego arbeitet bei der Untersuchung von Todesfällen etwas anders als die Gesetzeshüter in den meisten anderen amerikanischen Städten. Wie aus Film und Fernsehen einschlägig bekannt, versuchen in Los Angeles, Chicago oder New York immer zwei Detectives gemeinsam, die Fragen zu lösen, die sich beim Auffinden von Personen mit einer Körpertemperatur unter 37 Grad ergeben. Nicht so hier an der schönen Pazifikküste nahe der mexikanischen Grenze. Bei uns besteht ein Team immer aus vier Detectives und einem Sergeant.
Und das funktioniert prima. Die Mordkommission von San Diego kann sich der höchsten Aufklärungsquote in ganz Amerika rühmen. Die allerhöchste Aufklärungsquote überhaupt aber hat seit drei Jahren in Folge mein Team – Rikko Varjjan, Missy Pan, Jorge Zapata und Freddie Burnette. Wie das kommt? Weil wir ein erfolgreiches Experiment sind.
Die Idee, aus modernen kommunikationstheoretischen Überlegungen für die Polizeiarbeit geboren, bestand darin, ein Team zusammenzustellen, das den kulturellen Schmelztiegel von San Diego widerspiegelt. Dieses Konzept war anfangs sehr umstritten und stößt auch nach wie vor bei manchen auf Skepsis. Unbestreitbar aber ist die Tatsache, dass sich die Mitglieder meines Teams zwanglos unter die verschiedensten Bevölkerungsgruppen der Stadt mischen können, die bei uns den Anteil der erfolgreich gelösten Fälle sechsunddreißig Monate lang auf Rekordniveau gehalten hat.
Vier Wochen vor der Entdeckung von Cooks Leiche hatte allerdings Freddie Burnette, eine meiner besten Detectives, bei einer Verfolgungsjagd eine schwere Knieverletzung erlitten. Die Arbeit mit einem unterbesetzten Team war nicht leicht. Ich musste mich neben den offenen Fällen noch um den Verwaltungskram kümmern. Unsere Aufklärungsquote sank, und ich spürte den Druck von oben, besonders von Lieutenant Aaron Fraiser, meinem Vorgesetzten.
Und tatsächlich, kaum fünf Minuten, nachdem Solomon und ich das Apartment verlassen hatten, eilte Lieutenant Fraiser den Weg herauf. Er ist ein rosiger Typ mit Hängeschultern, kahl rasiertem Schädel und großen Ohren, ein ehemaliger Marine. Für mich hatte er nie viel übrig gehabt, unter anderem deshalb, weil er mich (ganz zu Recht übrigens) für den Spitznamen verantwortlich machte, den er bei der Polizei weghatte: Arsch mit Ohren. Er sah gereizt aus, ein Eindruck, der sich noch verstärkte, als er mich, Rikko und Missy erblickte.
»Wunderbar, unsere Multi-Kulti-Truppe ist an dem Fall dran«, grummelte er. »Was liegt an?«
Ich setzte ihn rasch ins Bild. Er hörte zu, verzog dabei das Gesicht zu einer Grimasse. »Wer hat hier die Leitung?«
Die Leitung bei der Untersuchung eines Todesfalls rotiert normalerweise. Die Arbeit besteht im Wesentlichen darin, sämtliche zu einem Mordfall gehörenden Spuren zusammenzutragen. Der Leiter führt außerdem die Fallakte – in ihr wird der Ablauf des Mordes beschrieben, so gut er sich aus den Spuren rekonstruieren lässt. Darauf stützt sich der Staatsanwalt bei seiner Anklageerhebung. Normalerweise wird der Team-Sergeant nicht Leiter des Falls, aber bei unserer knappen Personaldecke kam es für mich nicht infrage, die Aufgabe jemand anderem aufzuhalsen.
»Zu Ihren Diensten.«
Fraiser klappte die Ohren an. »Gott stehe uns bei.«
»Ihr Vertrauen in mich ist wieder einmal überwältigend.«
Der Arsch kniff die Augen zusammen und schritt von dannen, um zu überprüfen, ob man die Sea View Villas ordentlich abgesperrt hatte. Welch glückliche Fügung, dass sich just in diesem Augenblick die Wolkenschleusen öffneten und ein heftiger Schauer über dem Gelände niederging. Er dauerte gerade mal fünf Sekunden, doch Fraiser war bis auf die Knochen durchnässt.
So schön kann das Leben sein.
Die folgenden sechseinhalb Stunden verbrachten die Kriminaltechniker mit der Spurensicherung. Als Leitender konzentrierte ich mich darauf, alles, was wir fanden, fein säuberlich aufzulisten. Das war zunächst nicht viel. Die Möbel, die Tischflächen und die Gläser in der Küche waren sorgfältig abgewischt worden. Desgleichen die Türgriffe, innen wie außen. In die Abflüsse des Waschbeckens im Badezimmer und in die Badewanne hatte man Rohrreiniger geschüttet und dann ordentlich nachgespült.
Die einzigen brauchbaren Fingerabdrücke fanden sich auf der Nachttischlampe, auf dem Gestänge an der Kopfseite des Bettes und auf der Parfümflasche neben dem Toilettenbeutel. Mehr Glück hatten wir bei der Suche nach Fasern und Haaren auf den Teppichen, Polstermöbeln und Fußböden. Eigentlich zu viel Glück: Obwohl die Sea View Villas versprachen, vor jedem Mieterwechsel eine Dampfreinigung durchzuführen, fanden wir auf dem Teppich im Schlafzimmer, im Badezimmer und tief in den Fasern des Flurteppichs sowie im Wohn- und Essbereich Haare von dreizehn verschiedenen Personen. In einer an die Küche angrenzenden Kammer entdeckten wir einen Staubsauger, dessen Inhalt zur Laboruntersuchung ging. In Cooks Toilettenbeutel fiel uns noch ein Röhrchen Wellbutrin auf, ein Mittel gegen leichte Angstzustände.
Schließlich machte Rikko unter den Kleidern im Koffer eine interessante Entdeckung: Die aktuelle Nummer von Ménage, einem Pornomagazin, das sich auf Sex mit zwei Partnern spezialisiert hat. Es enthielt einschlägige Fotos in beiderlei Varianten: Zwei Männer, die einer Frau zu Willen sind, und zwei Frauen mit einem Mann. Hinter der Fernseh- und Musikanlage war eine DVD versteckt, deren Inhalt in dieselbe Richtung ging.
»Unser MrCook hatte ein Sexualleben«, meinte Rikko und hielt mir die Scheibe hin.
»Wer hätte das gedacht«, antwortete ich.
An den Pfosten der schmiedeeisernen Bettstatt fand die Spurensicherung grüne Nylonfasern, wie man sie zu Fallschirmschnüren verdrillt. Das Gestänge des oberen Bettteils war mit Fingerabdrücken übersät, als wäre es von allen Seiten angefasst worden. Die Laken wiesen blutige Hautschuppen auf, eingetrocknetes Sperma, Vaginalflüssigkeit und Spuren eines Gleitgels. Dummerweise fand sich im Schlafzimmer nur blondes Scham- und Kopfhaar. In den Falten der Decke stießen wir dann endlich auf etwas, das Solomons These erhärten konnte, dass Cook an einem Schlangenbiss abgenippelt war: Zwei gezackte Hautstückchen, eines so groß wie ein Fingernagel, das andere dreieckig und noch etwas größer.
»Eine Klapperschlange?«, fragte Rikko und hielt die Plastiktüte der Spurensicherung im Wohnzimmer gegen das Licht. Solomon half unterdessen, Cooks Leichnam auf einer fahrbaren Trage aus der Wohnung zu rollen.
»Scheint so«, sagte ich und sah aus dem Fenster. »Wir brauchen einen Experten. Wenn wir nicht genau sagen können, von was für einer Schlange das stammt, macht uns der Anwalt der Verteidigung die Hölle heiß.«
Missy trat ein. »Ich habe gerade mit Alfred Woolsley gesprochen, dem Chef von Double Helix.«
»Und?«
Sie nahm einen Schluck von ihrem Latte Macchiato. »Er hat Cook vor vier Monaten von einer Firma namens Biogen abgeworben und ihm die Leitung eines Forschungsprojekts für eine viel versprechende neue Behandlung bei Nierenversagen übertragen. Cook und seine Frau Sophia wollten aus Westlake Village hierher ziehen, sobald ihre Kinder das Schuljahr beendet hätten. Cook kam vorerst allein und fuhr jedes zweite Wochenende nach Hause – eine Fahrt von fünf Stunden. Laut Woolsley war Cook ein hart arbeitender Wissenschaftler: Von seiner Aufgabe besessen, brillant, zeitweise launisch, jemand, der in seiner Freizeit für den Minitriathlon trainierte. Seiner Aussage nach war Cook zuletzt Donnerstagmittag an seinem Arbeitsplatz, danach hatte er frei, weil er sich um den Verkauf seines Hauses kümmern wollte. Laut Cooks Sekretärin hätte er am Freitag um zwei Uhr nachmittags einen Termin mit einem Makler von Sotheby’s Realty gehabt.«
»Den Makler schon angerufen?«, grummelte Rikko.
»Längst erledigt«, meinte sie. »Cook ist nicht aufgetaucht und hat den Termin auch nicht abgesagt.«
Ich runzelte die Stirn. »Dann bleiben uns also ungeklärte zweiundsiebzig Stunden von seiner Abfahrt bei Double Helix bis zur Entdeckung der Leiche.«
»Korrekt«, bestätigte Missy. »Und seine Frau sagt, sie hätte seit Mittwoch früh nichts mehr von ihm gehört. Sie ist unten in einem Ferienzentrum in Los Cabos, zusammen mit den Kindern und ihren Schwiegereltern. Ich habe sie von Double Helix aus angerufen.«
»Wie hat sie es aufgenommen?«
»Sie ist fix und fertig«, erklärte Missy ernst. »Sie nimmt den ersten Flug.«
Jorge Zapata kam mit einer Phantomzeichnung in der Hand herein. Er hatte den ganzen Morgen mit Mary Aboubacar an dem Bild des Mannes gearbeitet, den sie aus Haus Nummer fünf hatte herauskommen sehen: Breites Kinn, scharfe Nase, hervortretende Augen, schmale Lippen, die innere Anspannung verrieten, und braunes, nach hinten gekämmtes Haar.
»Haben Sie das schon in der Nachbarschaft herumgezeigt?«, fragte ich.
»Bin überall durch«, erklärte Jorge und schüttelte den Kopf. »Außer der Putzfrau hat ihn niemand gesehen.«
Jorge ist zweiunddreißig Jahre alt, knapp eins achtzig groß, hat dichtes, schwarzes Haar und zusammengewachsene Brauen, die sich wie eine wollige Raupe über seine ganze Stirn erstrecken, sowie einen geschmeidigen, in vielen Jahren Geländelauf trainierten Körper. Er hat das Zeug zum Starpolizisten, in der kürzestmöglichen Zeit von sieben Jahren hat er es zum Detective gebracht, außerdem ist er ein Computer-Crack.
»Klappere auch alles um die Absperrung herum ab«, sagte ich. »Notiere sämtliche Autonummern, und halte auch unter den Schaulustigen nach dem Knaben Ausschau. Aber kein Wort zu den Journalisten.«
»Wird gemacht.« Jorge zog den Reißverschluss seiner Regenjacke hoch und verschwand.
Es war inzwischen etwa fünfzehn Uhr dreißig, und der Regen ließ nach. Weit draußen auf dem Ozean stand eine Lichtsäule auf dem von elfenbeinfarbenem Schaum gekrönten Wellenkamm, der mich an knirschende Zähne denken ließ. Ich besah mir noch einmal die Zeichnung. Ein müdes Gesicht mit kräftigen Backenmuskeln, buschigen Augenbrauen und schmalen Lippen. Einen Moment lang blitzte das Bild von einem regennassen Dock bei Nacht in mir auf, und von einem Mann, der hinter hölzernen Kisten kauerte. Dieser Mann hatte das Gesicht von der Zeichnung, das Gesicht desjenigen, den Mary Aboubacar gesehen hatte.
Ich hob leicht erregt den Blick von der Zeichnung und spürte, wie mir das Blut in den Kopf schoss. Eine Kollegin von der Spurensicherung kam mit erschrockenem Gesicht auf mich zu.
»Sergeant, ich … äh«, stammelte sie. »Ich habe Luminol im ganzen Schlafzimmer versprüht und … vermutlich konnte man es bei dem Regen erst nicht sehen. Sie sollten sich das mal anschauen.«
Luminol ist eine chemische Substanz, die mit dem in Hämoglobin enthaltenen Eisen reagiert und einen bläulichen Leuchteffekt erzeugt, den man »Chemoluminiszenz« nennt. Wir setzen es ein, um auch kleinste Blutspuren zu finden.
Ich verdrängte das Bild des Mannes auf dem Dock und eilte hinter der Kriminologin her. Als ich die großen, leuchtenden Flecken sah, die die Chemie auf dem Spiegel hervorgerufen hatte, blieb ich wie angewurzelt in der Schlafzimmertür stehen und betrachtete die leuchtenden Buchstaben, die die Chemikalie auf den großen Spiegel gezaubert hatte. Mittendrin waren neun halb verwischte Worte zu lesen:
Welch unsagbare Freude, den Tod in Händen zu halten.
6
Es war nach sechs Uhr abends, als ich meinen ersten Bericht auf Lieutenant Fraisers Schreibtisch legen konnte und zum Parkplatz des Präsidiums trottete. Ich stieg in mein grünes Monster, drehte den Zündschlüssel um und fand Trost in dem machtvollen Geblubber seiner 7½-Liter-Maschine.
Es war etwas Wind aufgekommen, und als ich auf der Auffahrt zum Freeway 163, der sich durch einen steilwandigen Canyon schlängelt, Gas gab, war der Asphalt bereits trocken. Ich ließ das Seitenfenster herunter und drückte auf die Tube. Die vierhundert Pferdestärken der alten Corvette pressten mich in die Schalenledersitze, und kühle Abendluft peitschte mir ins Gesicht und verwirbelte das schreckliche Bild von Morgan Cook und der blutigen Botschaft, die der Killer auf dem Spiegel hinterlassen hatte.
Die Corvette hatte ich gekauft, nachdem ich am Ende meines zweiten Studienjahres in Stanford bei den Boston Red Sox unterschrieben hatte. Die anderen Jungs hatten sich für ihre Einstiegsprämie meist einen brandneuen Porsche oder BMW zugelegt. Aber in der Straße von Roslindale, wo ich aufgewachsen war, damals ein Arbeiterviertel vor den Toren von Boston, gab es einen Installateur, der eine wunderbar gepflegte schwarz glänzende 67er Corvette mit chromblitzenden Seitenauspuffrohren fuhr. Von hinten sah sie aus wie der Kopf einer Libelle. Von vorne wirkte sie eckig und bedrohlich – nicht umsonst nannte man sie auch »Stingray«, Stachelrochen. An Sommertagen fuhr ich oft mit dem Fahrrad die Straße hinunter, nur um einen Blick auf die 67er zu werfen, wenn der Installateur sie aus der Garage holte, um an ihr herumzuschrauben oder Lackpflege zu betreiben. Nichts wünschte ich mir so sehnlich wie, einmal mitfahren zu dürfen, aber ich traute mich nie zu fragen.
Eines Tages jedoch fuhr der Installateur einfach so bei uns vor, klopfte und fragte meine Mutter, ob er mich zu einer Spazierfahrt mitnehmen könne. Ich nehme an, er hatte gehört, dass mein Vater am Abend zuvor getötet worden war, auch wenn er es mit keinem Wort erwähnte. Ehrfürchtig ließ ich mich auf dem Beifahrersitz nieder. Er fuhr raus auf die I-93, nach Süden entlang der Küste durch Dorchester Richtung Quincy. Die Seitenfenster waren heruntergelassen, und wir brausten mit neunzig Meilen die Stunde dahin. Die salzige Luft des Atlantik peitschte mein Gesicht und stach mir in die Augen. Sie blies das bedrückende Bild meiner Mutter hinweg, die sich am Küchentisch die Seele aus dem Leib weinte.
Selbst jetzt noch, fast achtundzwanzig Jahre später, kann mir eine Fahrt in meiner 67er über das hinweghelfen, was ich als Bulle zu sehen bekomme. Als ich die Interstate 8 erreichte, die wichtigste Ost-West-Verbindung von San Diego, ging es mir schon wieder etwas besser.
An einem normalen Samstagabend wäre ich Richtung Norden nach Del Mar gebraust, wo es eine tolle kleine Bar gibt, in der Rock-’n’-Roll-Bands auftreten, was jede Menge interessante und hübsche Frauen anzieht. Aber irgendwie hatte mir dieser trübe Tag jede Lust auf menschliche Gesellschaft verdorben, ich wollte einfach nur noch ein bisschen durch die Gegend brettern. Ich machte einen Abstecher durch Mission Valley und zurück ins Zentrum und fuhr dann auf den lang gezogenen Bogen der Brücke, die das Festland mit Coronado Island verbindet. Über Seitenstraßen gelangte ich auf die Westseite der Insel.
Vor dreißig Jahren war Coronado eine verschlafene, konservative Gegend, in der hauptsächlich Offiziere der U.S. Navy wohnten. Heute ist die Insel ein piekfeiner Vorort von San Diego. Die Preise der Anwesen dort können sich mit allem messen, was in Kalifornien gut und teuer ist. Die Neureichen und Kurzzeit-Berühmtheiten blättern selbst für Bruchbuden locker eine Million hin, um sie dann abzureißen und sich stattdessen Retortenschlösser hinzusetzen.
Sechs Blocks nördlich vom Hotel Del Coronado fand ich die gesuchte Seitenstraße und parkte die Corvette unter Palmen, die sich vor einer weiß getünchten Mauer erhoben. Darüber zeigten sich im Licht der Straßenlaterne die verwitterten Holzschindeln und der Giebel des Hauses. Ein rotes Holztor war von einem Bogen wilder Rosen umrankt. Eine ganze Weile blieb ich sitzen und schaute mir das an, als würde es mein halbes Leben bedeuten.
Ich stieg aus und öffnete das Tor. Den größten Teil des Gartens nahm der Pool ein, den Fay im Jahr zuvor hatte anlegen lassen. Dahinter erhob sich ein kleines Treibhaus. Es schien noch mehr Orchideen zu geben, bestimmt waren es schon dreihundert verschiedene, etliche blühten in Töpfen rund um den Pool. Durch die gläserne Schwebetür konnte ich Jimmy sehen, immer noch in seiner Baseballhose. Er saß auf dem Fußboden vor dem Fernseher und schaute sich Zeichentrickfilme an. Fay war in der Küche und spülte Geschirr. Sie trug einen Overall und sah darin noch umwerfender aus als sonst.
Leise klopfte ich auf der Höhe von Jimmy an die Glasscheibe. Seine Mutter entdeckte mich gleich und zog ein finsteres Gesicht. Jimmy blickte auf, zögerte einen Augenblick, strahlte dann übers ganze Gesicht und lief zur Tür. »Hallo, Dad«, begrüßte er mich.
»Hallo, Jimbo«, sagte ich und umarmte ihn. »Wie ist das Spiel gelaufen?«
»Im vierten Inning wegen Regen abgebrochen», antwortete er. »Hast du für morgen schon die Angelruten gerichtet? Wie ist dein neuer Fall?«
Ich seufzte. »Scheußlich ist er, mein neuer Fall, Sportsfreund. Und Angeln fällt morgen leider ins Wasser.«
»Wie bitte?«, fragte er spürbar enttäuscht.
»Wir sind knapp mit Leuten im Moment, und das ist wirklich eine der übelsten Geschichten, die ich je gesehen habe.«
Jimmy nickte zwar, doch er wandte die Augen von mir ab, und sein Gesicht nahm einen Ausdruck an, den ich bisher nur bei Fay gesehen hatte: Verstört und voller Zweifel. »Und nächsten Sonntag?«, fragte er. »Falls du bis dahin den Fall gelöst hast, meine ich.«
»Nächsten Sonntag ganz bestimmt«, versprach ich.
Hinter mir räusperte sich meine Ex. »Kann ich mal draußen mit dir sprechen, bitte?«
Ich klopfte Jimmy auf die Schulter. »Wir sehen uns die ganze Woche beim Training.«
»Klar«, sagte Jimmy und rang sich ein Lächeln ab, bevor er sich wieder seinen Zeichentrickfilmen zuwandte. Fay ging mit mir nach draußen und schloss die Glastür. Der Duft der Orchideen hing schwer in der Luft. Sie rieb sich die Stirn mit dem Handrücken, ein sicheres Zeichen, dass sie mir eine Gardinenpredigt halten wollte.
»Es wäre mir recht, wenn du in Zukunft vorher anrufen würdest, wenn du vorbeikommst«, begann sie. »Ich könnte auch zickig werden und die Besuchsregelung wortwörtlich auslegen. Aber daran liegt mir nichts, deshalb erwarte ich von dir, dass du die Höflichkeit aufbringst, anzurufen, bevor du hier reinschneist. Du weißt, wie man ein Handy bedient, Shay.«
»Hast Recht. Tut mir Leid. Ist Walter da?«
»Das geht dich nichts an. Und außerdem ist es schon das zweite Mal, dass du einen Angelausflug mit deinem Sohn absagst.«
Bedauern und Schuldgefühle erstickten meinen Zorn, der schon in mir aufzuwallen begann.
»Nichts zu machen. Das ist ein Mord wie in einem Horrorfilm. Das Opfer war ungefähr in meinem Alter. Es geht mir nahe.«
Fay sah mich mit ihren alles durchdringenden rauchigen Opalaugen an. »Du hast wirklich ein inniges Verhältnis zu Leichen, Shay. Woher kommt es bloß, dass du mit den Lebenden so wenig anfangen kannst? Siehst du den Jungen da drinnen? Er ist dein Fleisch und Blut, aber trotzdem kommt er bei dir immer erst an zweiter Stelle. Du merkst gar nicht, wie er zu dir aufschaut. Es dauert nicht mehr lange, und er sieht an dir vorbei.«
»So wie du?«
Über Fays Gesicht huschte ein gequältes ironisches Lächeln. »Nein, so wie du es mit mir gemacht hast.«
Wir sahen uns wortlos an. Die gemeinsam verbrachten Jahre standen zwischen uns wie eine Mauer. Ich fühlte mich mit einem Mal sehr müde.
»Hör zu, können wir das auf ein andermal verschieben? Ich habe eine medizinische Frage. An Walter.«
»Ich reiche dir wohl nicht?«
»Ich brauche keine Säuglingsspezialistin. Ich benötige seine Spezialkenntnisse.«
Fay sah mich forschend an. »Und du benimmst dich auch?«
»Tue ich das nicht immer?«
»Nein«, sagte sie, zuckte mit den Schultern und wandte sich zum Haus. »Warte hier.«
Gleich darauf kam sie zurück, einen drahtigen, bärtigen Mann in dunklem Trainingsanzug und Birkenstock-Sandalen im Schlepptau. Bei meinem Anblick ballte er kurz die Hände zu Fäusten, öffnete sie wieder und ballte sie erneut. »Fay meint, Sie bräuchten meine Hilfe?«
»Ja, Walt. Sie haben doch schon öfter mit Schlangenbissen zu tun gehabt? In der Notaufnahme, meine ich.«
Walter wusste genau, dass ich weiß, wie sehr er es hasst, Walt genannt zu werden. Er verzog das Gesicht, antwortete aber höflich: »Kommt vor. Leute, die sich in den Canyons rumtreiben, hauptsächlich im Osten des County. Gelegentlich auch Touristen und Saisonarbeiter. Wieso?«
»Ich arbeite an einem Fall, wo jemand durch einen Schlangenbiss zu Tode gekommen ist. Wie oft kriegen Sie dergleichen im Jahr zu Gesicht?«
»Fünfzehn-, vielleicht zwanzigmal. Wenn es die Leute innerhalb der ersten beiden Stunden zu uns schaffen, geht es selten tödlich aus. Die Seren wirken sehr gut. Wir verwenden CroFab, das ist das allerneueste.«
»Und es stirbt sich ziemlich hässlich, wenn man kein Serum bekommt?«
»Kann man denn auch schön sterben?«, meinte Walter süffisant.
»Wahrscheinlich nicht«, antwortete ich. »Aber das ist keine Antwort auf meine Frage.«
Walter hörte auf, seine Hände zu ballen. »Patienten, die gebissen wurden, berichten von extremen Schmerzen. Im fortgeschrittenen Stadium des Vergiftungszustands vergisst man offenbar, wer und was man ist, und sogar, dass einen eine Schlange gebissen hat. Man merkt, dass man stirbt, aber man versteht nicht, warum. Ziemlich grausige Angelegenheit, körperlich wie psychologisch.«
»Warum psychologisch?«
Nun hatte Walter Oberwasser, und das wusste er auch. Er verfiel in den Tonfall eines erfahrenen Arztes, der vor einem Studenten doziert.
»Am Anfang steht man unter Schock, weil man gebissen worden ist, was natürlich Angst auslöst und den Adrenalinpegel steigen lässt – das muss man in den Griff kriegen, wenn man überleben will«, meinte er. »Dem steht das Wissen gegenüber, dass man gebissen worden ist und einem nur noch eine begrenzte Lebenszeit verbleibt. Das ist ziemlich quälend, bis schließlich das Denkvermögen aussetzt. Sterben ist eine Sache, Moynihan. Etwas anderes ist es, sich darüber voll im Klaren zu sein, besonders, wenn der Tod aus dem Maul eines Tieres kommt, das als das archetypisch Böse gilt.«
7
Eine halbe Stunde später parkte ich in einer Garage von Shelter Island, ungefähr zehn Meilen nördlich von Coronado, und ging dann zu Fuß zu dem Yachthafen, wo ich wohne. Unter meinen Schuhen knirschte der Kies. Der Duft von Glyzinen mischte sich in die Salzluft. In Gedanken war ich bei Walters Beschreibung des Todes durch Schlangenbiss.
Das archetypisch Böse. So ungern ich es zugab, Fays Freund hatte Recht: Der Mörder von Cook hatte es mit kalter Berechnung darauf angelegt, die Seele seines Opfers in tiefste Qualen zu stürzen. Ich hatte es mit einem Foltermord zu tun, der an Sadismus nicht zu übertreffen war.
Ich öffnete das Tor zum Yachthafen und ging hinunter zu den Anlegeplätzen. Über die hölzernen Planken schritt ich zu Z-30, dem letzten Liegeplatz direkt am Hafendamm, hinter dem das offene Meer beginnt. Mein Zuhause ist eine dreizehn Meter lange, hochseetaugliche Motoryacht mit Flybridge, die eine Reichweite von dreihundert Meilen hat. Sie verfügt über zwei 530 PS starke Cat-Dieselmotoren, die es auf einunddreißig Knoten bringen. Das Cockpit ist mit Satellitenkommunikation, Loran, Sonar, GPS und Computer ausgestattet. Voll eingerichtet zum Schwertfischfang, samt Kampfstuhl auf dem Achterdeck. Ein schlankes Boot mit aerodynamischem Rumpf und Aufbauten.
Mein verstorbener Exschwiegervater, Harry Gordon, hat zwei Jahre seines Lebens der Planung und dem Bau des Bootes gewidmet. Harry hatte sich als Kreditbeschaffer für Start-up-Unternehmen aus dem Bereich Handheld-Kommunikationsgeräte, dem Rückgrat der Wirtschaft von San Diego, eine goldene Nase verdient. Das Schwertfischboot war Harrys letzte Prämie, die Anerkennung für ein erfolgreiches Leben. Aber eine Woche vor der Schiffstaufe starb er an einem Herzanfall. Er war noch nicht einmal mehr dazu gekommen, seinem Boot einen Namen zu geben.
Fay und ich lebten damals schon getrennt. Ihre Mutter bekam das Haus mit dem Blick auf den Mount Soledad und den größten Teil von Harrys Vermögen. Fay erbte das Boot und genügend Geld, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Trotzdem hat sie ihre Stelle als Ärztin auf der Frühgeburten-Station der Universitätsklinik von San Diego nicht aufgegeben. Kalifornien gehört zu den Bundesstaaten der USA, in denen bei einer Scheidung das gesamte Vermögen durch zwei geteilt wird. Als es mit unserer Trennung ernst wurde, beschlossen wir, dass Jimmy sein Zuhause behalten sollte. Zum Ausgleich bot mir Fay Harrys Boot an. Ich lehnte zunächst ab. Aber sie bestand darauf und betonte, sie könne es ohnehin nicht unterhalten, würde sich aber freuen, wenn es in der Familie bliebe. Außerdem hätte es auch für Jimmy eine Bedeutung.
Vor nunmehr fünf Jahren, am Vorabend unserer Scheidung, lag ich mit der fünften Flasche Bier an Deck meines noch namenlosen Bootes und sah eine Sendung von National Geographic über die Tuareg im Niger. Auf Kamelen zogen sie in lang gestreckten Karawanen über das Sandmeer, um Salz aus den Minen am äußersten Ende der Sahara zu holen. Sie trugen Turbane von leuchtendem Indigo, die ihrer glatten braunen Haut einen bläulichen Schimmer verliehen. Sie kauerten sich um funkensprühende Lagerfeuer, tranken Tee und stimmten einen schrillen Gesang an, der mir die Haare zu Berge stehen ließ. Natürlich verstand ich kein Wort, aber der Kommentator erklärte, ihr Lied würde den Schmerz eines Lebens ohne Bindungen beschreiben.
Ich stolperte zum Kühlschrank, holte den Champagner heraus, trat hinaus in die Nacht, zerschlug die Flasche am Bug und taufte mein neues Heim auf den Namen Nomad’s Chant – Das Lied des Nomaden.
Ich tippte den Code in das Sicherheitssystem der Nomad’s Chant, kletterte auf das Achterdeck und ging in die Kajüte. In der Kombüse nahm ich mir ein Bier aus dem Kühlschrank und ging durch den kleinen Salon ins Cockpit. Ich schaute nach, ob der Computer irgendwelche Fehlfunktionen zu vermelden hatte, fuhr das Sicherheitssystem herunter und ging unter Deck.
In meiner geräumigen Kajüte steht ein riesiges Bett mit brasilianischer Holzverkleidung. Auf dem Klappschreibtisch waren Steuerunterlagen verstreut. In den offenen Schränken stapelten sich Romane und Biographien. Auf der Musikanlage türmten sich leere CD-Hüllen. Und es lag ein Geruch in der Luft, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Die erste Ahnung von etwas, das mir schon in Dutzenden finsteren Wohnungen entgegengeschlagen war – der bittere, ätzende Geruch, den ein alternder, allein lebender Mann verbreitet.
Bevor ich vollends in Melancholie versank, zog ich ein Sweatshirt an und ging zu der Kajüte, in der Jimmy schläft, wenn er bei mir ist. Über seinem Bett hängt mein altes Trikot von den Red Sox mit der Nummer 67. Fast hätte ich die immer noch unordentlichen Laken glatt gezogen, doch dann ließ ich es, wie so oft, wenn ich weiß, dass er eine Weile nicht kommt. Ich trank das Bier aus, holte mir noch eins – damit war ich an meinem Limit – und setzte mich mit einem Notizblock in der Kombüse an den Tisch.
Welch unsagbare Freude, den Tod in Händen zu halten.
Wer von Jugend an Sport treibt, lernt, seine Stärken auszuspielen. Mein Fastball war Mitte der neunziger Jahre auf dem Höhepunkt. Mein Curve und mein Change up konnten sich sehen lassen. Aber damit hatte ich mein Repertoire auch schon erschöpft. Mein Sinker und mein Slider waren mal so, mal so. Mit dem Splitter hatte ich schon immer meine Schwierigkeiten gehabt. Aber was mir an Technik fehlte, machte ich mit schierer Kraft und der Fähigkeit wett, mich in den Kopf des Batters zu versetzen und zu erahnen, was er gerne hätte, um dann aus meinem Arsenal genau den Wurf auszuwählen, der ihm am ungelegensten kam.
Und genauso gehe ich auch bei der Aufklärung eines Verbrechens vor. Spuren sammeln und verfolgen, das verstehen andere aus unserer Einheit besser, Jorge und Missy beispielsweise. Rikkos Spezialität ist es, Verdächtige zum Singen zu bringen. Er zieht dazu eine bühnenreife Show als Guerillero-auf-Peyote-Trip ab, dass denen der Arsch auf Grundeis geht. Meine Stärke ist die Analyse: Ich nehme die Elemente des Rätsels, wie sie sich gerade bieten, lasse meine Einbildungskraft spielen und füge sie zu einem Bild dessen zusammen, was passiert sein muss.
Welch unsagbare Freude, den Tod in Händen zu halten.
Die Worte riefen in mir die unangenehme Vorstellung einer Schlange hervor, die über ausgestreckte Handflächen kriecht. Ihr Kopf gleitet auf den nackten Morgan Cook zu, der panisch an seinen Fesseln zerrt. Der Typ mit den schmalen Lippen von der Phantomzeichnung gerät in Verzückung. Seine Hände zittern leicht, als die Viper zubeißt.
Ich spürte einen wachsenden Druck im Kopf, während sich dieses Bild vor mir entfaltete. Das Blut pochte in meinen Schläfen. Wieder stand das regennasse nächtliche Dock vor mir und der Mann, der hinter leeren Kisten versteckt eine Pistole umklammerte. Mein Herz schlug wie wild, meine Kehle schnürte sich zu, und ich schnappte panisch nach Luft.
Ich nahm mein Bier und ging nach oben auf die Brücke. Dort stand ich und versuchte mich zu beruhigen, mir einzureden, dass diese plötzlich hochgespülten Flashbacks nichts zu bedeuten hatten. Es dauerte einige Minuten, bis ich mich so weit beruhigt hatte, um mich in den Kapitänsstuhl zu setzen, in die Dunkelheit hinauszuschauen und dem Plätschern der Wellen und dem entfernten Tuten des Nebelhorns am Point Loma zu lauschen. Ein Schiff fuhr vorbei, hinaus aufs Meer, und ich sah ihm mit dem unruhigen Gefühl nach, dass auch ich mich auf eine Reise ins Ungewisse begab.





























