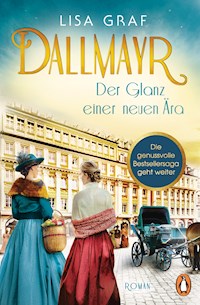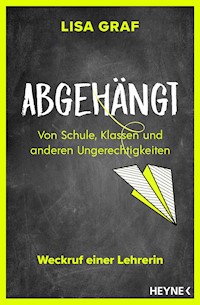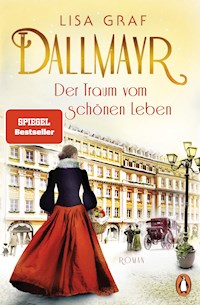14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lindt & Sprüngli-Saga
- Sprache: Deutsch
Ein Junge, der dem Schicksal trotzt. Eine Erfindung, die die Schokoladenherstellung revolutioniert.
Bern 1863: Kurz bevor die Räder einer vorbeifahrenden Kutsche den kleinen Tagträumer Rudolphe Lindt auf dem Marktplatz erfassen, wird er von einem bildhübschen Blumenmädchen gerettet. Von diesem Augenblick an ist klar: Der junge Lindt hat überlebt, um Großes zu vollbringen! Doch nicht etwa so, wie es sich seine Familie wünscht. Der Sohn eines Apothekers wird zum Schulabbrecher und stürzt sich in das Abenteuer. In Bern eröffnet er schließlich eine Schokoladenfabrik und schafft etwas Einzigartiges, das ihm einen Platz in den Geschichtsbüchern sichert: Der Junge, der einst eine herbe Enttäuschung für seine Familie war, revolutioniert die Schokoladenherstellung. Während Rudolphe Lindt das Conchieren erfindet, richten sich die Blicke der Welt auf ihn. Vor allem Chocolatier Sprüngli kann nicht glauben, was er vollbracht hat …
Opulent, dramatisch und akribisch recherchiert – die unvergessliche Familiensaga rund um die weltberühmten Schweizer Chocolatiersfamilien Sprüngli & Lindt. Ein liebevoll gestaltetes Paperback rundet dieses einzigartige Lesevergnügen ab!
Die Fortsetzung des Nummer-1-Spiegel-Bestsellers Lindt&Sprüngli – Zwei Familien, eine Leidenschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Lisa Graf ist in Passau geboren. Nach Stationen in München und Südspanien schlägt sie gerade Wurzeln im Berchtesgadener Land. Sie hat nicht viele Schwächen, aber zu Lindt-Schokolade konnte sie noch nie Nein sagen. Mit ihren grandiosen Familiensagas Dallmayr sowie Lindt & Sprüngli eroberte sie sowohl die Herzen ihrer Leserinnen als auch die Bestsellerliste und schaffte es bis an die Spitze der SPIEGEL-Bestsellerliste.
Außerdem von Lisa Graf lieferbar:
Dallmayr. Der Traum vom schönen Leben. Roman.
Dallmayr. Der Glanz einer neuen Ära. Roman.
Dallmayr. Das Erbe einer Dynastie. Roman.
Lindt & Sprüngli. Zwei Familien, eine Leidenschaft. Roman.
www.penguin-verlag.de
LISA GRAF
Zwei Rivalen, ein Traum
ROMAN
Dies ist ein historischer Roman. Er basiert auf der Unternehmensgeschichte von Lindt&Sprüngli. Zahlreiche tatsächliche Abläufe und handelnde Personen sind jedoch so verändert und ergänzt, dass Fakten und Fiktion eine untrennbare künstlerische Einheit bilden.
Eine Zusammenarbeit mit Lindt&Sprüngli gab es nicht, insbesondere besteht keine wie auch immer geartete Lizenzbeziehung. Die Verwendung des Firmennamens erfolgt also ausschließlich aus beschreibenden und nicht aus markenmäßig-kennzeichnenden Gründen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Redaktion: Lisa Wolf
Umschlaggestaltung: bürosüd
Umschlagabbildungen: © Abigail Miles/Arcangel; © Ildiko Neer/Trevillion Images; © Wikimedia Commons/Public Domain
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-30175-0V002
www.penguin-verlag.de
Für Kathrina, Hedi, Marie und Elise,für Binia, Avéline und für Fanny
Die Sonne sank und ließ die Welt der Ruh, Die Abendnebel gingen ab und zu; Ich lag auf Bergeshöhen matt und müd, Tief in der Brust das ungesungne Lied. Da nickten, spottend mein, die schwanken Tannen, Auch höhnend sah das niedre Moos empor Mit seinen Würmern, die geschäftig spannen, Und lachend brach das Firmament hervor.
Aus: Ein Tagwerk von Gottfried Keller (1819 – 1890)
»Wenn sie aus deinem Korbe naschen, Behalte noch etwas in der Taschen.«
Gedichte, Zahme Xenien 5
»Die Menschheit, merk ich, mag noch so sehr zu ihrem höchsten Ziele vorschreiten, die Zuckerbäcker rücken immer nach.«
Brief an Marianne von Willemer, Weimar, den 13. Januar 1832
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), der auf Reisen stets ein Schokoladenkännchen mit sich führte
Bern
1863
Rudolf Lindt
»Rudolf!«, rief das Kindermädchen.
Rudolf drehte sich kurz zu ihr um und winkte.
Caroline stand mit seinen Schwestern Anna und Emma am Verkaufsstand direkt vor diesen widerwärtigen Geranienstöcken mit ihren dicken dunkelgrünen Blättern, die behaart waren und sich wie Katzenpfoten anfühlten. Sie hielt suchend nach ihm Ausschau, winkte ihm und forderte ihn auf, dass er zu ihnen kommen sollte. Aber Rudolf schüttelte nur den Kopf. Er hasste Geranien. Sie mochten ja auf den Balkonen und Veranden der Bürgerhäuser schön aussehen mit ihren roten Blüten. Aber sie stanken nun einmal, und deshalb mochte Rudolf sie nicht. Eine Blume, die nicht fein duftete, sondern übel roch, das war wie eine Sonne, die nicht wärmte, oder Gras, das einem in die Fußsohlen stach wie ein Stoppelfeld, wenn man barfuß darauf lief.
»Bleib dort stehen!«, rief Caroline.
Anna, die Ältere seiner beiden Schwestern, presste missbilligend die Lippen aufeinander. Obwohl sie jünger war als Rudolf, spielte sie sich wie ein zweites Kindermädchen auf, schnüffelte ihm hinterher und verpetzte ihn zu jeder Gelegenheit bei den Eltern. Emma, die Vierjährige, drückte sich eng an ihre große Schwester und folgte ihr wie ein Schatten.
Rudolf hob die Hand zum Zeichen, dass er Caroline gehört hatte, und blieb stehen. Er ließ den Blick über den Wochenmarkt schweifen. Alles schien in Bewegung. Selbst die Marktleute liefen hinter ihren Buden und Ständen herum und gestikulierten, priesen laut ihre Waren an oder zankten sich mit Kundinnen, die sich darüber beklagten, dass ihr Gemüse nicht frisch genug wäre oder die Kartoffeln bereits faulig rochen. Dabei ging es immer um den Preis, so viel hatte Rudolf schon verstanden. Denn nach dem Gezänk, das zwei-, dreimal hin und her ging, fing meist das Feilschen an.
»Ich gebe dir vier für deine Herdöpfel«, sagte der Mann mit dem schwarzen Filzhut.
»Vier? Du bist aber lustig. Sechs müssen es mindestens sein.«
Der Mann lupfte seinen Hut ein wenig und kratzte sich über dem rechten Ohr. Dann schüttelte er den Kopf und ging weiter.
»Halt, halt«, rief ihm der Verkäufer nach. »Dann machen wir fünf, und gut ist’s.«
Der Käufer blieb noch einmal stehen, kratzte sich wieder am Kopf, dann nickte er und kam zurück.
Rudolf hatte Caroline und seine Schwestern schon vergessen und trat ein Stück weiter auf die Marktgasse hinaus, auf der Menschen, Pferde, Fuhrwerke nur so durcheinanderwuselten. Gemüsehändler aus dem Umland boten ihre Waren direkt von ihren Wagen herunter feil. Die Eierfrau saß auf einem Schemel mit drei Beinen und balancierte einen großen runden Korb auf ihrem Schoß. Ein Blumenmädchen hatte seine Veilchensträuße auf einem verschlissenen Tuch am Boden ausgebreitet. Es war nicht viel älter als Rudolf, nur zwei, drei Jahre vielleicht, und es hatte sehr schöne weiße Zähne, wenn es lächelte. Rudolf lächelte zurück, ohne dabei den Mund zu öffnen, denn ihm fehlten immer noch die beiden oberen Schneidezähne, obwohl er im Sommer schon acht Jahre alt wurde. Er hätte gern die nächsten ein, zwei Jahre übersprungen, um auch schon so groß zu sein wie das Blumenmädchen. Vor allem hätte er gern ihre Zähne gehabt.
»Kannst du kurz einmal nach meinen Blumen schauen?«, sprach ihn das Mädchen an. »Ich bin gleich wieder da.«
Noch bevor Rudolf antworten konnte, war sie schon zum Schützenbrunnen gelaufen, hatte einen Krug unter der Schürze hervorgezogen und ihn mit Wasser gefüllt. Sie stellte den Krug ab und hielt den Mund direkt unter den Wasserstrahl. Sie schluckte so gleichmäßig, als habe sie das schon sehr oft gemacht. Als sie genug hatte, wischte sie sich mit dem Handrücken über den Mund und kam mit ihrem gefüllten Krug zurück. Sie grinste und zeigte dabei wieder ihre wunderbaren weißen und vor allem vollständigen Zähne. Sie hätte Danke sagen können, tat es aber nicht.
Gegenüber hatte ein Gemüsehändler aus dem Tessin seinen Stand. Er trug ein rotes Schnupftuch um den Hals und einen bleistiftdünnen Schnauzer, der aussah wie aufgemalt. Gurken waren auf seinem Handwagen gestapelt, auf der einen Seite grüne, auf der anderen dickere, dunkellilafarbene, wie Rudolf sie nie zuvor gesehen hatte.
»Buongiorno«, grüßte ihn der Händler. »Bellissime zucchine«, sagte er und zeigte auf die grünen Gurken. Die mit der lila Schale nannte er »Melanzane«. Er nahm eine gelbe Gurkenblüte, groß wie ein Trinkbecher, knipste sie mit dem Fingernagel von der Frucht und überreichte sie Rudolf. »Bellissima fiore di zucca«, sagte er und legte sie ihm in die hohle Hand.
Rudolf bedankte sich, und gleich fiel ihm der Vater ein. Ob er schon einmal eine so große Gurkenblüte gesehen hatte? Die Apotheke des Vaters lag nur ein paar Schritte entfernt auf der anderen Seite der Marktgasse. Mit der Blüte, die gar nicht ganz in seine Hand hineinpasste, lief Rudolf los. Das Klappern von Pferdehufen auf dem Kopfsteinpflaster und das Knirschen von eisenbeschlagenen Reifen eines Fuhrwerks bemerkte er viel zu spät. Er hatte schon den Schweißgeruch des Pferdes in der Nase und sah das Erschrecken in den großen tiefbraunen Augen des Tieres, als es den Kopf hob und anfing zu tänzeln, als wollte es gleich steigen. Rudolf blieb wie gelähmt stehen. Da spürte er, wie ihn jemand am Arm packte und ihn mit einem Ruck von dem Pferd und dem schweren Fuhrwerk wegzog. Er strauchelte und sah in ein Paar weit aufgerissene braune Augen und einen offenen Mund mit ebenmäßigen, schneeweißen Zähnen. Der Gurkenhändler beugte sich über ihn. »Madonna!«, rief er und bekreuzigte sich.
Rudolf rappelte sich vom Pflaster auf, klopfte sich den Schmutz von der braunen Wollhose und grinste das Blumenmädchen schief an. Noch bevor er ein Wort herausbrachte, rüttelte jemand an seinen Schultern. Er drehte sich um, und da standen Caroline, hinter ihr Anna, die sich vor Schreck die Hand vor den Mund hielt, und Emma, der Tränen über das runde Gesichtchen kullerten.
»Rodolphe, was machst du für Sachen?«, herrschte Caroline ihn mit ihrem französischen Akzent an und hielt ihn immer noch an der Schulter fest. »Hast du dir wehgetan?«
In der Aufregung hatte sie ihn Rodolphe genannt, was sie sonst nur tat, wenn sie allein waren oder wenn sie ein bisschen Französisch mit ihm sprach. Die Eltern hörten es nicht gern, aber Rudolf liebte es, wenn sie seinen Namen französisch aussprach.
»Sie hat mich vor dem Pferdefuhrwerk gerettet.« Rudolf zeigte auf das Blumenmädchen.
»Dann musst du dich bei ihr bedanken«, sagte Caroline. Sie wandte sich an das Mädchen. »Wie heißt du denn?«
»Binia«, sagte sie.
»Und wo wohnst du?«
»Unten«, sagte das Mädchen und zeigte zum Zytgloggen-Turm und zur Kramgasse, wo die Altstadt sich in Richtung der Aare hinunterzog, »in der Matte. Mein Papa ist Schiffer.«
Und meiner ist Apotheker, wollte Rudolf sagen, und wir wohnen gleich hier oben, in der Marktgasse. Aber das hatte sich diese Binia sicher schon selbst zusammengereimt, nachdem sie Caroline als welsches Kindermädchen und seine Schwestern Anna und Emma in ihren weißen Blusen und dunkelblauen Wolljacken als Mädchen aus besserem Hause als ihrem erkannt hatte.
Rudolf reichte ihr ganz förmlich die Hand und sagte: »Danke, Binia.« Dann wandte er sich an Caroline. »Wartet hier, ich bin gleich wieder da.«
»Aber pass bitte auf!«, rief Caroline ihm nach.
Rudolf lief zur Confiserie Kuentz, die nur ein paar Schritte entfernt war, und zählte rasch nach, wie viele Rappen er in der Tasche hatte.
»Was darf es sein?«, fragte ihn das nette Fräulein mit dem Spitzenhäubchen, als er an der Reihe war.
Rudolf entschied sich für Schokolade.
»Und welche hätte der junge Herr denn gern?«
»Die von Kohler«, antwortete Rudolf.
»Eine gute Wahl«, meinte der Konditor, der eben aus der Backstube in den Laden trat. »Und außerdem noch die Marke aus der Familie, mit der der junge Herr Lindt verwandt ist, stimmt es nicht?« Kuentz kannte seinen Vater, den Apotheker Lindt in der Marktgasse, und wahrscheinlich auch seinen Großvater, den Arzt Dr. Lindt, der seine Praxis in der Hotelgasse gehabt hatte.
»Ja, das stimmt«, sagte Rudolf. »Monsieur Kohler aus Lausanne ist mein Großonkel.«
»Dann könntet ihr ja die Schokolade gleich bei ihm in der Fabrik einkaufen.«
»Ich brauche sie aber jetzt gleich«, sagte Rudolf. »Es soll ein Geschenk sein.«
»Dann verpacken wir es auch recht schön, gell, Greth?«
Rudolf zögerte. »Ein einfaches Papier tut es auch«, entschied er.
»Keine Schleife?«, fragte der Confiseur.
»Nein, keine Schleife.« Rudolf sah seine beiden Schwestern draußen am Schaufenster stehen und neugierig zu ihm hineinlinsen.
Als er mit seinem Päckchen aus dem Laden kam, fragte Anna: »Und was ist da drin?«
»Das geht dich nichts an«, sagte Rudolf und lief zurück zu Binia, um ihr das Päckchen zu überreichen. Mit den wenigen Rappen, die er noch übrig hatte, kaufte er ihr eines ihrer Veilchensträußchen ab und schenkte es Caroline. Als er zur Mitte der Gasse zurückblickte, wo er beinahe unter die Räder des Fuhrwerks geraten wäre, lag dort die gelbe »Fior di zucca« – er hatte sich den Namen der Blüte gemerkt –, von den Pferdehufen zertrampelt und von den Rädern des Fuhrwerks platt gedrückt.
•
Binia Haab
Gleich nachdem der Junge mit dem Kindermädchen und den beiden kleinen Schwestern fort war, zog Binia das Päckchen aus der Rocktasche. Sie wickelte eine Tafel Schokolade aus dem Papier. »Chocolat Kohler« stand auf dem hübschen blau-weißen Papier, in das sie noch einmal zusätzlich verpackt war. Auch das öffnete Binia, hielt sich die dunkle Schokolade an die Nase und roch daran, fuhr einmal mit der Zunge darüber und packte sie dann wieder ein. Sie wollte ihren Schatz noch ein wenig aufheben, ihn nicht hier, unter all den Leuten, einfach verschlingen und dann mit leeren Händen nach Hause gehen, ganz so, als sei gar nichts geschehen. Dabei war heute etwas ganz Bedeutendes passiert: Sie hatte die erste Schokolade ihres Lebens geschenkt bekommen. Wer wusste schon, ob das je wieder vorkommen würde? Da konnte sie die doch nicht einfach aufessen wie ein Stück Graubrot oder einen reifen Apfel. Einerseits hätte sie gern jemandem davon erzählt und den Freunden aus der Matte diese Kostbarkeit gezeigt. Andererseits hätte sie dann wohl oder übel teilen müssen. Doch das wollte sie nicht. Die Schokolade gehörte nur ihr allein. Sie hatte sie sich verdient, weil sie diesen feinen Pinkel mit den hellen Augen und den Lippen, die für einen Jungen fast zu schön geschwungen waren, nicht aus den Augen gelassen hatte. Auch nicht, als er mit seiner albernen gelben Blüte dabei war, geradewegs in das nächste Fuhrwerk, das über die Marktgasse trabte, hineinzulaufen. Schnell war sie bei ihm gewesen, hatte ihre Veilchen einfach liegen lassen und ihn am Arm zurückgerissen, bevor der Gaul ihn niedertrampeln konnte. Ein Träumerle war dieser Bursche. Und wie er sich bemüht hatte, seinen Mund geschlossen zu halten, um seine Zahnlücken zu verbergen. Das war eigentlich süß. Ob sie ihn noch einmal wiedersehen würde? Auf dem Markt vielleicht, zufällig. Sie lebten zwar in derselben Stadt, aber sie unten am Fluss, er oben, gar nicht so weit auseinander und doch in zwei Welten. Die Mutter hatte Binia mit den Veilchen auf den Markt geschickt und ihr vorher Gesicht und Hände geschrubbt. Sie hatte ihr einen Zopf geflochten, ihn im Nacken zu einer Schnecke gedreht und mit Haarnadeln festgesteckt. Sogar eine frisch gewaschene Bluse hatte sie anziehen müssen, wie am Sonntag. Trotzdem hatte sie nicht einmal die Hälfte ihrer Sträußchen verkauft. Es musste an den Veilchen liegen, die man jetzt im Frühling am Waldrand selbst pflücken konnte. Sie selbst hatte nichts falsch gemacht, auch kein einziges Mal in der Nase gebohrt, nicht gepfiffen oder geflucht. Binia steckte die übrig gebliebenen Sträuße in ihren Krug. Vielleicht konnte sie es ja am nächsten Markttag noch einmal versuchen. Viel hatte sie nicht eingenommen. Die Münzen steckten in der einen Rocktasche. In der anderen das Päckchen mit der Schokolade. Sie rollte ihr Tuch auf, band es sich um den Hals und lief unter den Bögen des Zytgloggen-Turms hindurch, am Zähringerbrunnen vorbei, die Kramgasse und dann die Gerechtigkeitsgasse hinunter Richtung Aare. Von der Nydegggasse nahm sie die Treppe hinunter in das Matte-Quartier. Doch von dort lief Binia nicht gleich nach Hause, sondern sie schlüpfte unter den ersten Bogen der Nydeggbrücke. An diesem Platz nahe am Fluss, der so grün war, weil er aus einem Gletscher entsprang, war sonst niemand außer ihr. Binia setzte sich auf einen der großen, vom Sand und von der Strömung glatt geschliffenen Steine und packte ihre Schokolade aus. Sie hielt wieder die Nase an die braunen Rippen, beschnupperte sie, leckte sie ab und biss ein erstes, winziges Stück davon ab. Es schmeckte sehr süß, aber nicht nur nach Zucker. Der Duft war nicht von Veilchen oder einer anderen Blüte, die Binia kannte, und der Kakao fast ein wenig bitter, doch zusammen mit der Süße des Zuckers und diesem betörenden Duft entstand etwas ganz Neues. So also schmeckte Schokolade! Binia saß noch eine Weile unter der Brücke und ließ Stückchen um Stückchen auf der Zunge zergehen. Nur den allerletzten Bissen packte sie wieder ein, um ihn noch ein paar Stunden oder Tage aufzubewahren. Dann nahm sie ihren Krug und lief nach Hause.
•
Rudolf Lindt
Sie hatten ausgemacht, dass die Eltern nichts von dem Vorfall erfahren sollten. »Es ist ja zum Glück nichts passiert«, sagte Caroline, bevor sie das Haus betraten. Rudolf war klar, dass sie ein schlechtes Gewissen hatte, weil sie ihn beim Geranienaussuchen aus den Augen verloren hatte. Und es erzählte auch wirklich niemand etwas beim Heimkommen. Sogar Anna und die kleine Emma hielten den Mund. Die Mutter hatte nur Augen für die Geranienstöcke. Sie mochte das grelle Rot der Blüten und die dicken Blätter und schien ihren Gestank gar nicht zu bemerken. Das Hausmädchen musste gleich anfangen, sie in Kübel zu pflanzen und nach draußen auf die Fensterbank zu stellen. Aus dem Esszimmer waren Geplapper und kleine Schreie zu hören. Fanny, seine jüngste Schwester, hatte sich in ihrem Laufställchen mit beiden Hände an den Gitterstäben hochgezogen. Als sie Rudolf erkannte, streckte sie die Ärmchen nach ihm aus und gluckste vor Freude, als er sie herausnahm. Fanny war so ein hübsches Baby mit ihren nussbraunen Augen und den blonden Löckchen.
Caroline nahm das Mittagessen mit dem Personal in der Küche ein. Als der Vater nach Hause kam und die Familie sich zu Tisch setzte, platzte Anna dann doch mit der Geschichte vom Markt heraus.
»Heute wäre Rudolf auf der Marktgasse beinahe überfahren worden«, berichtete sie.
»Wirklich?«, fragte die Mutter. »Caroline hat gar nichts davon erzählt. Und Rudolf auch nicht.« Sie sah ihren Sohn an.
»So schlimm war es nicht«, behauptete Rudolf. »Ich habe nur kurz nicht achtgegeben.«
»Und wo war Caroline?«, fragte sein Vater und trank seine Suppe aus der Tasse, wie er es immer tat. »Ist sie nicht dafür da, auf euch Plagegeister aufzupassen?«
»Sie war am Geranienstand«, erklärte Rudolf.
»Ein Blumenmädchen aus der Matte hat ihn gerade noch rechtzeitig weggezogen«, machte Anna mit ihren sechs Jahren sich wichtig, »sonst hätte ihn das Fuhrwerk überrollt oder das Pferd zertrampelt. Totgetrampelt!«
Rudolf stieß mit dem Fuß gegen Annas Schienbein. Sie schrie kurz auf, hielt aber trotzdem nicht den Mund.
»Und dann hat er dem armen Mädchen noch Schokolade bei Kuentz gekauft!«, petzte sie.
»Wieso ausgerechnet Schokolade?«, fragte die Mutter.
»Wieso denn nicht?«, fragte Rudolf. »Jeder mag doch Schokolade, besonders die Damen.«
»Ich denke, es war ein armes Mädchen, das Blumen am Markt verkauft hat, wie Anna erzählt, und keine Dame«, sagte die Mutter. »Nötiger als Schokolade wird sie wohl Mehl, Kartoffeln, Fleisch und Eier haben. Etwas, womit ihre Mutter die Familie satt bekommt.«
»Na gut«, sagte Rudolf und ließ sich seine Enttäuschung nicht anmerken. »Dann kaufe ich ihr eben am nächsten Markttag auch das noch.«
»Hast du denn so viel Geld?«, wollte der Vater wissen.
»Ich nehme es von meinem Ersparten.«
»Aber ist das nicht zu viel?« Die Mutter schüttelte den Kopf. »Erst Schokolade, und dann auch noch Fleisch?«
»Zu viel?«, fragte Rudolf. »Diese Binia hat mir das Leben gerettet. Ist das nicht mehr wert als die paar Rappen in meinem Kässeli?«
»Da hat er allerdings recht«, sagte der Vater. »Und wenn dein Geld nicht reicht, dann kommst du zu deiner Mutter oder zu mir und borgst dir welches.«
Rudolf warf seiner Schwester einen triumphierenden Blick zu. Natürlich mit geschlossenen Lippen. Wenn doch endlich die oberen Schneidezähne nachwachsen würden! Es war so demütigend, mit diesen großen Zahnlücken herumlaufen zu müssen. Wenigstens hatte Anna vergessen zu petzen, dass Caroline ihn wieder Rodolphe genannt hatte, obwohl die Mutter das nicht mochte.
In seinem Kässeli war längst nicht so viel, wie Rudolf gedacht hatte. Jetzt fiel es ihm wieder ein, dass er zu Carolines Geburtstag erst vor Kurzem Geld ausgegeben hatte. Die Mutter fand zwar, das sei nicht nötig, aber Rudolf wollte ihr doch etwas Schönes schenken, weil sie das erste Kindermädchen war, das er richtig gernhatte, und weil sie ihm zum Einschlafen französische Lieder vorsang, wenn die Schwestern schon eingeschlafen waren. Ganz leise und mit ihrer schönen Stimme, oder sie trug ihm eine der Fabeln von Lafontaine vor. »Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage.« Erst auf Französisch, und dann übersetzte sie ihm die Geschichte vom Fuchs, der viel schlauer war als der Rabe und ihm durch eine List ein Stück Käse abluchste.
Am nächsten Tag hatte Caroline ihren freien Nachmittag. Als die Köchin sich nach dem Mittagessen zurückzog, um ein Nickerchen zu machen, und Rudolf sie hinter der Tür zu ihrer Kammer schnarchen hörte, schlich er sich in die Speisekammer. Zuunterst packte er Brot in einen Korb, darauf zwei dicke Würste und obenauf ein Dutzend Eier, die er einzeln in Zeitungspapier wickelte. Ein paar Äpfel steckte er noch dazwischen und deckte ein Tuch darüber. Er wollte weder vom Personal noch von anderen Erwachsenen draußen auf der Gasse auf den Inhalt des Korbs angesprochen werden.
Rudolf konnte sich nicht mehr daran erinnern, wann er zuletzt in der Matte gewesen war, dem Quartier unten in der Aare-Schlaufe, in dem die Wohnhäuser nicht so prächtig waren wie bei ihnen oben in der Stadt. Entweder hatte sein Vater einen Handwerker aufgesucht oder dringende Apothekerwaren abgeholt, die von den Schiffern die Aare abwärts transportiert wurden. Vielleicht war er auch gar nicht mit dem Vater selbst hinuntergegangen, sondern mit einem Gehilfen aus der Apotheke, der ihn mitgenommen hatte. Soweit Rudolf wusste, hatten die Mätteler, wie man die Bewohner des Quartiers nannte, ihre eigene Schule, und einer wie er, aus der Oberstadt, hatte dort keine Kameraden und schon gar keine Freunde. Immerhin erinnerte Rudolf sich noch, wie man zur Matte hinunterkam. Auf der Rückseite des Münsters, von der großen Aussichtsplattform unter den Kastanienbäumen, konnte man auf die engen Häuserzeilen der Matte hinuntersehen. Er konnte von dort oben die Boote und Flöße beobachten, die flussabwärts trieben, um in der Matte entladen zu werden. Es waren ganz schön viele und von oben sahen sie aus wie Spielzeugschiffe.
Am Ende der Münstergasse fand Rudolf den Eingang zur Mattetreppe. Sie war steil und hatte wirklich sehr viele Stufen. Er versuchte, sie beim Gehen zu zählen, kam aber nur bis fünfunddreißig. Er musste ja auf seinen Korb und das Dutzend Eier darin achtgeben. Er hatte ein weiteres Stück geschafft, als er schnelle Schritte hinter sich hörte. Rudolf wandte sich um und sah, wie zwei größere Burschen, einer mit Schiebermütze und Hosenträgern über dem Hemd und ein etwas kleinerer, aber immer noch größer als er selbst, die Treppe hinter ihm herunterkamen. Rudolf packte den Korb fester und hörte sie rasch näher kommen. Sie redeten miteinander, aber er konnte nicht alles verstehen. Als die beiden ihn schließlich einholten, während Rudolf sich nahe an der Wandseite hielt, sprach ihn der mit den Hosenträgern an. Rudolf reagierte nicht. Sein Herz klopfte viel zu laut. Er trat noch mehr zur Seite, machte ihnen Platz, aber sie dachten nicht daran weiterzugehen und ihn in Ruhe zu lassen.
»Wo willst du denn hin?«, sagte der Bursche jetzt offenbar zum zweiten Mal.
»In die Matte«, antwortete Rudolf.
»Soso, zu uns in die Matte will das Bübchen. Und was hat er dort zu suchen, der kleine Knirps mit seinen Kniehosen, den sauberen Strümpfen und den gewichsten Schuhen? Schau ihn dir an, Jürg. So einen feinen Pinkel triffst du bei uns in der Matte selten. Stimmt’s?«
Jürg grinste. »Wo willst du denn hin mit deinem Korb? Gehst du einkaufen?«
»Nein«, antwortete Rudolf, »ich bringe etwas«, und sah Wurst und Eier schon in den Taschen der beiden Jungen verschwinden. Vielleicht nahmen sie ihm auch gleich den ganzen Korb ab. Die Köchin würde ihn ganz bestimmt nach den Lebensmitteln fragen, die er sich aus der Speisekammer besorgt hatte. Aber wenn der Korb auch noch weg war, dann würde er so richtig Ärger bekommen.
»Schau an«, meinte der Größere mit seinem rotblonden Schopf und den Sommersprossen um die Nase, als er das Tuch anhob, mit dem Rudolf seine Schätze abgedeckt hatte. Unter seinen Fingernägeln saß dick der Dreck. Rudolf bildete sich ein, dass er ihn sogar riechen konnte. Dazu den säuerlichen Schweiß, der auf dem abgetragenen Hemd des Rothaarigen helle Ringe unter den Achseln bildete. »Und wohin genau?«
Rudolf hob resigniert die Schultern. Er ahnte, dass sein ganzer Plan womöglich jetzt schon an diesen beiden Burschen scheitern würde und er mit leeren Händen nach Hause kommen und ein Donnerwetter der Köchin erleben würde, auf das unweigerlich eine Woche Hausarrest folgte. Wenn er bloß heil in die Marktgasse zurückkam. So, wie der Rothaarige ihn ansah, war selbst das fraglich. Rudolf zog die Nase hoch und nahm seinen ganzen Mut zusammen. »Zu einem Mädchen«, antwortete er.
»Oho!« Der Rothaarige stieß Jürg in die Seite. »Bist du dafür nicht ein bisschen zu kurz geraten? Du hast ja noch nicht mal alle Zähne im Gebiss.«
Rudolf schniefte. Er hatte ihn an seiner wundesten Stelle erwischt, aber im Grunde war es egal. Aus der Sache würde er kaum mehr heil herauskommen, und am Ende hätte er vielleicht noch andere wunde Stellen, zusätzlich zu seinen Zahnlücken.
Nachdem sie eine Weile dagestanden und über ihn gelacht hatten, fragte der mit den Hosenträgern: »Und hat das Meitli auch einen Namen, hm?«
Rudolf zögerte. Würde er ihr damit vielleicht schaden? Es genügte ja schon, wenn er Prügel einstecken müsste. Aber was blieb ihm anderes übrig? »Sie heißt Binia«, antwortete er schließlich.
»Binia?« Die beiden sahen ihn an, als hätte er Dornröschen oder Aschenputtel gesagt. Als wollte er sie auf den Arm nehmen.
»Meinst du etwa die Binia Haab?«, fragte der Rotschopf.
Rudolf zuckte die Achseln. »Ich weiß nur, dass sie Binia heißt und Blumen oben auf dem Markt verkauft. Ihr Papa ist Schiffer. Kennt ihr sie?«
»Binia? Natürlich! Die kennt hier jeder, oder, Jürg?« Der andere nickte. Aber war das jetzt gut oder schlecht?
»Und der Korb ist für sie?«, fragte der Sommersprossige. Rudolf nickte. »Dann komm mit. Wir bringen dich zu ihr. Jürg, nimm ihm mal den Korb ab, sonst stolpert er noch auf der Treppe, und dann gibt’s Eiersalat.« Er lachte. »Ich heiße Ferdi, und du?«
»Rudolf. Rudolf Lindt.«
»Ist dein Vater so ein hohes Tier, oben in der Stadt?«
»Nur Apotheker.« Rudolf wischte sich mit dem Handrücken die Nase. Er war immer noch auf der Hut, aber seine Aufregung ließ ein wenig nach. Vielleicht würde er ja doch noch um eine Tracht Prügel herumkommen.
•
Binia Haab
Was für ein langweiliger Nachmittag! Die Spielkarten lagen durcheinandergeworfen auf einem zerfressenen Holzpflock, den der Fluss angeschwemmt hatte. Binia saß auf ihrem Thron in der Mitte der verlassenen Lagerhalle mit den kaputten Fensterscheiben. Sie hatte den braunen Zylinder auf dem Kopf, der in der Mitte fast durchgerissen war, und ihr Thron war ein Korbsessel mit unterschiedlich langen Beinen. Nicht einmal ein vierter Kartenspieler war heute aufzutreiben. Wo waren sie denn nur alle? Doch nicht etwa zu Hause über ihren Aufgaben. Vielleicht mussten sie ihren Vätern oder die Mädchen den Müttern zu Hause helfen. Na, sie würden schon noch kommen. Einen Vierten bekamen sie schließlich immer zusammen. Jassen war seit Monaten ihre liebste Beschäftigung, und wenn man sich geschickt anstellte, konnte man an einem Nachmittag sogar ein paar Rappen gewinnen. Oder andere Einsätze, falls einer der Spieler keine Münzen im Sack hatte. Karl und Hansruedi jedenfalls, mit denen sie gerade Karten spielte, würden gleich anfangen zu streiten, weil ihnen nichts Besseres mehr einfiel.
»Scht! Jetzt seid doch mal still, ihr zwei!«, fuhr Binia die beiden an.
»Wieso, was ist denn los?« Karl hatte Hansruedi schon fast im Schwitzkasten.
»Ich glaube, da kommt jemand«, sagte Binia.
»Einer von uns?«, fragte Hansruedi und befreite sich aus Karls Griff.
»Still!«, sagte Binia und kniff die Augen zusammen. Sie lauschte nach draußen. Tok, toktok, klopfte es an die Tür. Und noch einmal tok, toktok.
»Das sind welche von uns«, sagte Binia, als schon jemand die Tür zur Seite schob. Das rostige Laufrad schrammte über das Eisenband, in dem es aufgehängt war. Tageslicht drang durch den offenen Türspalt und blendete sie. Binia erkannte im Gegenlicht eine große, schlaksige Gestalt. Das konnte nur Ferdi sein. Dann musste der Zweite, Kleinere, Jürg sein, so etwas wie Ferdis ewiger Schatten. Aber sie hatten noch einen Dritten dabei, der in die dunkle Halle starrte und sich nicht hineintraute, bis Ferdi zurücklief, ihn an den Schultern packte und vor sich her schob.
Noch während Ferdi »Schau mal, wen wir dir mitbringen« rief, hatte Binia ihn schon selbst erkannt. Sie sprang auf, dass ihr Thron nach hinten kippte, schleuderte den Zylinder in die Ecke und sauste an den dreien vorbei zur Tür.
»Bin gleich wieder da«, rief sie und spürte ihre Blicke im Rücken, blieb aber nicht stehen und sah auch keinen von ihnen an, schon gar nicht den kleinen Kerl aus der Oberstadt, der ihr die Schokolade geschenkt hatte. Rudolf hieß er doch, ja, Rudolf. Was wollte der denn hier?
Sie lief in Richtung des Waschhauses, unter dem ein kleiner Bach durchfloss. Dort kniete sie sich an den Rand des Rinnsals und wusch sich rasch Hände und Gesicht. Dann fuhr sie sich mit den nassen Fingern durch das Haar und flocht es zu einem Zopf. Sie musste ja aussehen wie eine Räuberbraut. Ihr Rock war staubig und das Hemd an mehreren Stellen geflickt. Sie versuchte den Staub aus dem Rock zu klopfen. Es half nicht viel. So wie sie liefen alle Kinder in der Matte herum. Sollte er ruhig mitbekommen, wie sie aussah, wenn sie nicht so hübsch angezogen und zurechtgemacht war wie an den Markttagen, wenn sie zum Blumenverkaufen ging. Jetzt hatte sie zumindest ein sauberes Gesicht. Sie warf sich den Zopf auf den Rücken und lief zurück zur alten Lagerhalle.
Die Tür stand einen Spalt offen. Wie unvorsichtig. Normalerweise hätte sie die Kameraden dafür zur Schnecke gemacht. Aber sie dachte an ihren Besucher, und daran, dass sie sich in seiner Gegenwart benehmen wollte.
An die Dunkelheit musste man sich erst gewöhnen, das machte diesem Rudolf bestimmt nur Angst. Er stand neben ihrem Thron. Natürlich hatten sie ihm nicht erlaubt, sich auf den Sessel zu setzen. Denn es war ihrer. Nie saß jemand anderer darauf, also auch er nicht.
»Hoi, Rudolf. Was machst du denn hier?«
»Er wollte zu dir«, sagte Ferdi. »Wir haben ihn hergebracht, und Jürg hat ihm den Korb getragen. Die Mattetreppe ist ja steil für einen, der noch nicht so lange Beine hat. Er heißt Rudolf.«
»Das weiß ich doch schon, du Schlauberger.« Sie gab Rudolf die Hand.
»Hoi, Binia«, sagte er und lächelte schüchtern aus seinen hellen, blauen Augen. Auch sein Mund lächelte, mit geschlossenen Lippen.
»Was hast du denn da mitgebracht?«, fragte sie.
»Schau.« Ferdi zog das Tuch fort. »Hier haben wir Eier, ein paar Äpfel, oh, zwei dicke fette Würste, und was ist da unten noch? Ah, Brot!«
»Für mich?«, fragte Binia.
Rudolf nickte. »Du weißt schon, wofür.«
»Ja«, sagte sie. »Ich weiß, wofür. Freunde, ich teile Wurst und Brot mit euch.« Sie packte das Brot aus und brach es in zwei Hälften. Eine legte sie auf den Holzstoß, zu den Spielkarten. Daneben eine der Würste. Sie warf jedem einen Apfel zu. »Die Eier bringe ich meiner Mutter«, entschied sie und nahm den Korb. »Komm!«, forderte sie Rudolf auf, der alles aufmerksam beobachtet hatte. »Wir gehen.«
Die Jungen sahen ihnen enttäuscht hinterher, aber Ferdi hatte schon seinen Hirschfänger aus der Tasche gezogen und angefangen, die Wurst unter ihnen aufzuteilen. Und bestimmt würden sie ein wenig um das größte Stück rangeln, bis es doch in Ferdis Magen landete.
Diesmal schob Binia die Tür hinter sich zu, als sie mit Rudolf hinaus in die Sonne trat.
»Gehen wir zu deiner Mutter?«, fragte er.
Binia baute sich vor ihm auf und stemmte die freie Hand in die Hüfte. »Sag mal, hast du mir heute gar keine Schokolade mitgebracht?«, fragte sie.
»Doch«, sagte er. »Aber nur eine aus meinen eigenen Vorräten. Es ist keine ganze Tafel mehr. Eine Rippe fehlt.«
»Zeig sie mir«, sagte Binia. Rudolf griff in die Jackentasche und holte eine angebrochene Tafel hervor.
»Sie ist ein wenig weich geworden«, sagte er und hob die Schultern.
»Das macht nichts.« Binia legte sie mit in den Korb.
Sie liefen am Waschhaus vorbei durch die Gerberngasse bis zur Nydeggbrücke, und Binia zeigte Rudolf ihren Lieblingsplatz unter dem ersten Brückenboden, auf einem schmalen Streifen von Flusssteinen. Sie setzten sich, und Rudolf sah Binia dabei zu, wie sie sich die Schokolade Stück für Stück auf der Zunge zergehen ließ. Er wollte selbst nichts davon haben. Sie aß alles, bis auf die eine Rippe, die sie als Reserve für schlechte Zeiten behielt.
Als die Sonne schon tiefer stand und der Fluss ganz dunkelgrün war, begleitete Binia Rudolf über die Nydeggtreppe hinauf, auf der es schon recht düster war. Einmal, als er fast stolperte, nahm sie Rudolfs Hand und hielt sie, bis sie am Ende auf die Gasse hinaustraten. Erst ein ganzes Stück weiter oben verabschiedete sie sich von ihm. Sie sah ihn an und drückte ihm schnell einen Kuss auf die Wange. Sie hätte schwören können, dass Rudolfs Gesicht in dem Moment glühte und er sich deshalb so schnell von ihr abwandte und davonhastete. Binia blieb stehen und wartete, bis Rudolf sich noch einmal umdrehte und ihr zum Abschied winkte. Und sie hätte außerdem schwören können, dass er dabei lächelte und den Mund geschlossen hielt.
»Dein Korb!«, schrie sie und lief ihm nach. Er wandte sich um und kam ihr ein Stück entgegen. Sie hob ihre Rockschürze und bettete vorsichtig die Eier darin, legte die eine verbliebene Wurst dazu und klemmte das halbe Brot unter die Achsel. Rudolf nahm den Korb und wartete. Fast kam es Binia so vor, als strecke er ihr jetzt die andere Wange hin, als warte er auf einen zweiten Kuss. Aber den Gefallen tat sie ihm nicht. Ein Kuss musste genügen für einen Knirps ohne Zähne. Und wenn er ihr noch so schöne Augen machte.
•
Rudolf Lindt
»Respekt«, brummte Jungfer Ruutz und zwängte sich durch die Eingangstür, die sie nur einen engen Spalt öffnete, als hätte sie Bedenken, zu viel ordinäre Stadtluft in die ehrwürdige Offizin des Apothekers Lindt in der Marktgasse hereinzulassen. »Was bist du gewachsen seit dem letzten Mal, als ich dich hier gesehen habe, Ruedi. Oder sollte ich lieber Rudolf sagen oder gar Herr Lindt?« Ihre Miene blieb missmutig, sodass nicht zu erkennen war, ob sie sich nur über ihn lustig machte oder es ernst meinte.
Rudolf sah an sich hinunter. Er war nicht wesentlich gewachsen, stand allerdings hinter dem Verkaufstresen auf einem Schemel. Er trug Brunos Kittel, den der Gehilfe ihm geholfen hatte anzuziehen und mit einem Stoffband um den Bauch festgebunden hatte, weil er ihm viel zu lang war. Am Ende hatte er noch einen feinzinkigen Kamm aus der Hosentasche genommen, ihm einen exakten Mittelscheitel gezogen und das Haar mit etwas Pomade in Form gebracht. »Jetzt schaust du aus wie ich«, hatte Bruno gescherzt, und Rudolf hatte gedacht: hoffentlich nicht, denn der Gehilfe hatte einen Höcker auf der Nase und etwas zu eng zusammenstehende Augen. Eigentlich sah er ein bisschen aus wie ein Käuzchen, aber das fand vielleicht nur Rudolf. Bruno hatte ihm, bevor er eine Besorgung machen ging, gesagt, dass außer der Jungfer Ruutz wahrscheinlich kein Kunde mehr vorbeikäme, so kurz vor der Mittagspause. Nur sie würde noch ihre bestellte Arnikasalbe abholen. Er sollte ihr lediglich den Salbentiegel aus der Ablage unter dem Tresen reichen und kassieren. Achtundzwanzig Rappen, die Jungfer kannte den Preis, es war nicht ihre erste Salbe. Also stand Rudolf schon mit dem Tiegel in der Hand bereit und sagte: »Achtundzwanzig Rappen.«
»Was, so teuer?«, rief die Jungfer Ruutz und brachte Rudolf damit kurz ins Schwanken.
»Der Preis ist wie immer«, behauptete er, aber sicher war er sich plötzlich nicht mehr.
»Tatsächlich?«, fragte die Ruutz, »achtundzwanzig, weißt du das bestimmt?«
Rudolf ließ sich keinen Zweifel anmerken. Er straffte die Schultern in seinem zu großen Kittel. »Extra für Euch angerührt, mit den Arnikapflanzen, die mein Vati direkt von ganz oben aus dem Gebirge holt.«
»Soso, ich hab gedacht, die wachsen auch auf dem Güsche, da muss man gar nicht so hoch hinaus.« Die alte Dame holte ein Schnäuztuch heraus und putzte sich ausgiebig die Nase. Sie hatte es offenbar nicht eilig. Der »Güsche« war Berns Hausberg und hieß eigentlich Gurten. »Ist dein Vater ein Jäger, weil er ins Gebirge geht?«, fragte sie, als sie mit Schnäuzen fertig war.
»Nein, er geht nur aus Freude«, antwortete Rudolf und behielt die Hand auf dem Salbentiegel.
Die Ruutz schüttelte den Kopf. »Also nicht wegen dem Wild und auch nicht wegen den Medizinpflanzen.«
»Doch, doch, die Heilpflanzen machen ihm ja auch Freude«, gab Rudolf zu. »Er hat doch mit seinem Freund Theo Simler und einigen Kameraden zusammen im letzten Jahr den Schweizer Alpen Club gegründet.« In Olten war das gewesen, in der Bahnhofsgaststätte. »Wir Schweizer dürfen unsere Berge nicht den Engländern oder den Österreichern überlassen«, hatte Simler als Parole ausgegeben, und Rudolfs Vater und einige andere Männer waren derselben Meinung gewesen.
Frau Ruutz schüttelte den Kopf. »Ich verstehe die jungen Leute von heute nicht mehr«, sagte sie. »Und von Männern verstehe ich grundsätzlich nicht viel.« Jetzt spielte doch ein kleines Lächeln um ihren Mund. »Warum muss man sich als angesehener Bürger mit Frau und Kindern freiwillig in Gefahr begeben? Kannst du mir das erklären, Rudolf?« Sie sah ihn eindringlich an. »Gehst du am Ende noch mit hinauf in die Berge mit deinem Vater?«
»Nein«, sagte Rudolf. »Meine Beine sind noch zu kurz.«
»Und dein Kittel noch ein Stück zu lang«, schmunzelte die Jungfer Ruutz. »Also wie viel, sagst du, willst du für die Salbe haben? Ich brauche sie für meine Gelenke. Vor allem die Knie machen nicht mehr so richtig mit beim Gehen.«
»Achtundzwanzig«, antwortete Rudolf, ohne zu zögern. Er war sich jetzt wieder sicher, und sie musste es doch auch wissen. Mittlerweile nahm er an, dass sie ihn nur ein wenig aufs Glatteis führen wollte.
»Und du bist ganz sicher?« Sie angelte die Münzen aus ihrer Börse und betrachtete jede von beiden Seiten, bevor sie sie auf den Tresen legte.
Rudolf nickte und zählte nach. »Zwei fehlen noch.« Umständlich suchte sie noch einen Zweier heraus.
»Teuer ist sie schon, die Salbe vom Lindt«, murmelte die Jungfer Ruutz.
»Aber gut«, sagte Rudolf. »Und sie hilft Euch doch, sonst würdet Ihr kein Geld dafür ausgeben.«
Die Jungfer sah ihn erstaunt an. »Lass deinen Vater ins Gebirge gehen und lern du das Apothekerhandwerk. Ich glaube, du stellst dich gar nicht so dumm an im Geschäftlichen.«
Rudolf legte das Geld in die Kasse, während die alte Dame den Salbentiegel in ihren Korb packte und sich zur Tür wandte.
»Bis zum nächsten Mal«, rief Rudolf ihr hinterher. »Ihr kommt doch bestimmt wieder, wenn der Tiegel leer ist. Unsere Arnikasalbe ist ja auch die beste in ganz Bern.«
»Auf jeden Fall die teuerste«, sagte die Kundin und zwängte sich durch den offenen Spalt der Glastür. Erst von draußen winkte sie noch einmal zurück und lächelte fast.
Als Bruno von seinem Botengang zurückkam, erkundigte er sich bei Rudolf, ob die Jungfer Ruutz ihre Medizin geholt habe. Rudolf nickte.
»Und?«, fragte Bruno.
»Und was?«
»Hat sie denn nicht wie üblich über den Preis gejammert?«
»Doch«, antwortete Rudolf.
»Und? Hast du ihr einen Rabatt gegeben oder ihr ein kleines Stück Seife dazu geschenkt?«
»Nein.« Rudolf knüpfte sich den Gürtel auf, der Brunos Kittel zusammenhielt. »Warum?«
»Weil sie sich immer beklagt, dass sie nicht genug Geld im Sack hat und sparsam haushalten muss.« Bruno half ihm aus seinem Kittel.
»Davon hat sie nichts gesagt«, antwortete Rudolf. »Und du auch nicht.«
Bruno sah ihn ein bisschen merkwürdig an. Aber er hatte doch alles richtig gemacht. Achtundzwanzig, hatte er ihm gesagt, nicht sechsundzwanzig und ein Stück Seife.
»Wenn du das nächste Mal kommst, können wir zusammen Salben anrühren. Oder einen Alkoholauszug mit den Arnikapflanzen herstellen. Du darfst ihn aber nicht probieren, gell?« Bruno zwinkerte ihm zu. »Nicht, dass dir irgendein Blaascht einfällt und wir dich dann ins Spital bringen müssen.«
»Ich will weder Salben rühren noch irgendeinen Unsinn anstellen in der Offizin«, sagte Rudolf.
»Kommst du denn gar nicht mehr her?«, fragte Bruno besorgt. »Wegen der Sache mit der Ruutz?«
»Doch«, sagte Rudolf, »aber wenn, dann nur zum Verkaufen und Kassieren, nicht zum Salbenrühren. Und jetzt habe ich Hunger und gehe heim zum Essen.«
Rudolf kletterte von seinem Schemel, und Bruno hielt ihm die Tür auf wie einem Kunden und machte sogar einen Diener. »En Guete!«, wünschte er ihm im Hinausgehen.
Rudolf war erleichtert, als er draußen auf der Marktgasse stand. Begierig sog er die Düfte der Stadt ein. Heute roch sie vor allem nach Pferdepisse und vergorenen Äpfeln, nach alten Holzfässern und saurem Bier. Von Bruno und der Arbeit in der Apotheke hatte er für heute genug.
Zürich
1868
Katharina Sprüngli
Als Katharina sich endlich von Hedi und der kleinen Greth verabschiedet hatte, sprang sie die Stufen des Treppenhauses am Rennweg hinunter wie ein junges Mädchen, immer zwei Stufen auf einmal. Dabei war es schon mehr als ein paar Jahre her, dass sie tatsächlich eins gewesen war und den jungen Konditor Rudolf Sprüngli geheiratet hatte. Es war ihr nicht leichtgefallen, sich von ihrer Tochter und ihrer Enkelin zu trennen. Dabei war Greth nicht einmal Katharinas erstes, und wahrscheinlich auch nicht ihr letztes Enkelkind, aber das, das am nächsten wohnte und das sie zu Fuß besuchen konnte. Ihre beiden jüngeren Töchter Ida und Elsie waren nach ihrer Hochzeit fortgezogen aus Zürich. Ida nach Rapperswil und Elsie nach Winterthur. Dort konnte sie nicht eben mal schnell nach dem Mittagessen vorbeilaufen.
Katharina nahm die Kuttelgasse hinüber zur Bahnhofstraße. Hoffentlich würde sie noch vor vier Uhr in der Confiserie Sprüngli ankommen. Es würde knapp werden. Auf der Bahnhofstraße, in die sie jetzt einbog, fuhren eine private Kutsche vorbei, zwei Pferdefuhrwerke in gemächlichem Trab und ein von zwei Pferden gezogener Reisewagen mit Passagieren, die rechts und links zu den Fenstern hinaussahen. Auf dem Dach waren Koffer und Reisetaschen gestapelt, die von einem ringsum laufenden Gitter festgehalten wurden. An den Stämmen der Linden, die die Straße säumten, brachten Arbeiter geflochtene Matten an, um sie vor dem Staub zu schützen, den die Pferdehufe aufwirbelten. Die Trottoirs zu beiden Seiten der Straße waren breit genug für die dahinflanierenden Damen und Herren, die zu den prächtigen Villen an der Bahnhofstraße oder zum Hotel Baur unterwegs waren, vor dem ein Bediensteter in Livree gerade einen Kutschenschlag aufriss und einer Dame beim Aussteigen half, die ihre Röcke raffte, um nicht über die Säume zu stolpern.
Während sie das alles beobachtete, musste Katharina wie so oft an ihren Schwiegervater denken. Wie würde David Sprüngli staunen, wenn er die prächtige Straße heute sehen könnte. Immer hatte er sich lustig gemacht über das Quaken der Frösche dort draußen am Neumarkt, wo Rudolf und sie vor neun Jahren in dem imposanten mehrstöckigen Eckhaus ihre neue Confiserie eröffnet hatten. Er würde kaum seinen Augen trauen, wenn er jetzt noch einmal auf die Bahnhofstraße heruntersehen könnte und dort, wo einst der Fröschengraben lag, der längst zugeschüttet war, eine breite Prachtstraße vorfände, die wie ein Boulevard nach Pariser Vorbild angelegt worden war, ungepflastert, aber mit Linden bepflanzt und mit breiten Gehsteigen versehen. An der Stelle des Nordbahnhofs zwischen Sihl und Limmat würde nun der Zürcher Hauptbahnhof entstehen, der zu einem der schönsten Bahnhöfe der Schweiz, wenn nicht ganz Europas ausgebaut werden sollte. Und seit drei Jahren war die Bahnhofstraße nun endlich für den Verkehr freigegeben. Der Neumarkt, an dem die Confiserie Sprüngli wie das Hotel Baur en Ville lag – vom Schwiegervater stets als »Saumarkt« verächtlich gemacht – hieß nun »Paradeplatz«, und dieser Name passte auch viel besser zu dem eleganten Ort, an dem außerdem die wichtigsten Banken der Stadt lagen. Alles hatte sich so entwickelt, wie der Hotelier Johannes Baur es vorhergesehen hatte. Rudolf und Katharina hatten ihm im Gegensatz zu ihrem Schwiegervater vertraut, und nun lag ihre Confiserie mit dem in der ganzen Stadt beliebten Erfrischungsraum an einer eleganten Wohn- und Verkehrsstraße mit Trottoirs, auf denen es sich fabelhaft flanieren ließ. Eine Fortsetzung der Bahnhofstraße zum See war in Planung, doch da musste erst noch allerhand geschehen, weil die engen Gassen des alten und schäbig gewordenen Kratzviertels der Bebauung zum See noch im Weg standen. Aber sie würde bestimmt bald kommen. Der junge Stadtingenieur Bürkli hatte weitreichende Pläne, die er auch durchsetzen würde. Vielleicht nicht heute oder morgen, und vielleicht würden Rudolf und sie es nicht mehr erleben, aber ihre Kinder bestimmt.
Als Katharina das Geschäft betrat und die geschwungene Treppe nach oben lief, bemerkte sie die Bescherung sofort. Am Stammplatz der »Nähgruppe«, die sich immer dienstags bei Sprüngli zum »Zvieri« traf, war belegt. Da hatten entweder die Bedienungen nicht aufgepasst oder die Männer hatten trotz der Hinweise der Kellnerinnen den schönen Fensterplatz in Beschlag genommen. Katharina strich sich die Haare aus dem Gesicht und steckte ihren Dutt mit zwei Haarnadeln fest, da kamen sie auch schon angerauscht, die fünf oder sechs jungen Damen, die auf dem Rückweg von ihrer Nähstunde bei der Witwe Ambühl stets bei Sprüngli auf eine heiße Schokolade und ein Stück Torte vorbeikamen. Man hörte sie vom Betreten des Geschäfts an kichern, tuscheln und Geheimnisse oder auch nur Klatsch und Tratsch aus der Nachbarschaft austauschen. Würden sie sich mit einem anderen Tisch begnügen? Katharina konnte zusehen, wie sie sich zusammenrotteten und mit gesenkten Köpfen auf sie zusteuerten, kaum, dass sie sie entdeckt hatten. Allen voran Frieda, die Tochter des Advokaten Gessner. Also eher kein anderer Tisch für die Damen, dachte Katharina und seufzte. Dann hob sie beide Hände, um Frieda und ihre Nähfreundinnen zu stoppen, und marschierte auf die Männer zu.
»Meine Herren«, setzte sie an. »Ich muss mich für meine Serviererin entschuldigen, die Ihnen diesen Tisch angeboten hat. Er ist am Dienstag ab vier Uhr nachmittags praktisch ein Damentisch und gehört diesen fleißigen Nähschülerinnen, die sich hier auf die Aufgaben vorbereiten, die sie nach einer Eheschließung erwartet.«
»Sie nähen hier, mit Blick auf den Paradeplatz?«, scherzte einer der Männer, die auch noch jung waren, aber sehr erwachsen und gewichtig taten in ihren eleganten Anzügen und mit den Schnurrbärten, die sie älter machen sollten, als sie waren. Katharina kannte sie nicht, vielleicht kamen sie vom Land und sahen sich in Zürich um oder hatten eine Ausbildung in der Kreditanstalt angetreten.
»Sie erholen sich hier von der anstrengenden Arbeit des Nähens«, stellte Katharina richtig, und da sie nicht sofort aufsprangen, wurde sie noch etwas deutlicher. »Die Damen sind Stammgäste in der Confiserie Sprüngli, und da es sich bei Ihnen ja ausschließlich um wohlerzogene Kavaliere handelt, macht es Ihnen sicher nichts aus, am Nebentisch Platz zu nehmen. Ich lasse Ihnen sofort noch zwei Stühle bringen und einen Teller mit feinen Petits fours, als kleine Entschädigung.«
Während der Wortführer noch zögerte, erhob sich der junge Mann von seinem Fensterplatz und knöpfte sich das Jackett zu. Da blieb auch den anderen keine Wahl mehr. Katharina winkte den Serviererinnen, den Tisch umzudecken, und schon stürzten die jungen Damen sich auf ihren Stammplatz und grinsten heftig zum Männertisch hinüber.
Als Katharina ihre Bestellungen entgegennahm, die sie hätte vorhersagen können, so konstant waren die Damen in ihren Wünschen, fragte Frieda sie mit glänzenden Augen nach ihrem Ältesten.
»Wo ist denn Rudolf gerade? Noch in Wien?«
»Nein, er ist jetzt in Paris«, antwortete Katharina und wunderte sich etwas, weil das Fräulein, das sich so für ihren Sohn interessierte, wenn sie recht informiert war, demnächst heiraten würde.
»Oh, là, là, was lernt er denn dort?« Der ganze Mädchentisch kicherte. Diese Frieda war ein ziemlich vorlautes Ding. Da würden die Gessners besonders gut auf sie aufpassen. Ihren Freundinnennachmittag kostete die junge Frau aus, und Katharina konnte das sehr gut nachempfinden. Das war Freiheit, ohne Eltern, ohne Gouvernante, ohne den zukünftigen Ehemann. Sollte sie es genießen und ihren Spaß dabei haben.
»Sie werden es nicht glauben, Mademoiselle, aber er lernt dort, wie man Schokoladenbonbons macht.«
»Oh, das auch«, antwortete Frieda, und ihre Freundinnen fingen natürlich wieder an zu kichern.
»Ja, das auch«, spielte Katharina mit. »Das ist es, was er uns geschrieben hat, und mehr wissen wir nicht.«
»Paris!«, seufzte Frieda und hob die Augen zum funkelnden Deckenleuchter und ließ sie dann über die gerahmten Stiche an den Wänden und die Spiegel gleiten, in denen sie kurz ihr vor Aufregung erhitztes Gesicht betrachtete. »Werden diese Schokoladenbonbons dann auch bald bei uns in Zürich zu haben sein?«
»Davon gehe ich aus.«
»Wann kommt er denn wieder?«, fragte Frieda unumwunden.
»Das dauert wohl noch ein Weilchen.« Katharina wandte sich schon vom Tisch ab.
»Ja, aus Paris wird Rudolf gar nicht mehr wegwollen. Das leichte Leben, die schönen Frauen, der Pariser Chic, sagt man nicht so?«, fragte sie keck. Die armen Gessners, dachte Katharina. Einen Sack Flöhe zu hüten, konnte auch nicht schlimmer sein.
»Ach, unser Rudolf ist doch ein Braver, der stellt schon nichts an.«
»Sind Sie da so sicher? Weit weg von daheim und von der Aufsicht der Eltern?« Das war es also, wovon Frieda träumte, mehr als von Rudolf, dachte Katharina. Und undenkbar für die Tochter eines Zürcher Advokaten. Sie müsste erst unter der Haube sein, bevor sie in Begleitung oder zumindest mit Einverständnis ihres Ehemanns auch nur einen Fuß vor die Tür setzen, geschweige denn reisen dürfte.
Als Katharina die Bestellung weitergab, dachte sie an ihre eigene Zeit als junge, unverheiratete Frau in Luzern, im Hotel ihrer Tante. Wie viel Freiheit sie genossen hatte, weil ihr Vater kein hohes Tier, sondern nur Turmwächter von St. Peter gewesen war. Sie dachte auch an die Wanderschaft ihres Mannes in der französischen Schweiz und ihr Wiedertreffen in Luzern. Und nun war ihr Ältester auf seiner Wanderschaft bis nach Paris gekommen und David Robert, sein jüngerer Bruder, bis nach Deutschland. Er hatte in Wiesbaden das Einmachen von Früchten gelernt und in Leipzig das Eismachen, außerdem den feinen Tortendekor, und nun entwickelte er sich dort gerade zum Dessert-Meister, wenn man seinen Briefen Glauben schenken durfte. Aus ihren Söhnen würden einmal zwei tüchtige Konditoren werden, und das war auch gut so. Denn die Sprünglis betrieben immer noch die Konditorei in der Zürcher Marktgasse, wo Annarösli unverwüstlich und verlässlich den Laden am Laufen hielt. Am Paradeplatz war Katharina nun selbst wieder eingesprungen, nachdem Hedi endlich ihren Coni geheiratet und ihr erstes Kind bekommen hatte. Denn Rudolf, ihr Mann, hatte in seiner Schokoladenfabrik in Horgen zu tun und war schon auf der Suche nach einem neuen Standort für die Fabrik, diesmal möglichst mitten in der Stadt, auch wenn er seine Fußmärsche am See entlang bis nach Horgen dann fast ein bisschen vermissen würde.
Als die Schokolade und die Torten für die »Nähgruppe« serviert wurden, hatten sich der Damen- und der Herrentisch schon miteinander verbrüdert, und es wurden Stühle gerückt und an Likörgläsern genippt. Gut, dass die Gessners nicht daran dachten, Friedas Gouvernante vorbeizuschicken. Am Ende bekäme sie selbst auch noch einen Rüffel, weil sie gegen die Turteleien zwischen beiden Tischen nichts einzuwenden hatte. Ob unter den jungen Damen wohl eine dabei war, die in die engere Auswahl für ihren Ältesten kam? Eher nicht, dachte Katharina, aber wer konnte das schon wissen? Eine junge Frau, die sie ihrerseits insgeheim ins Auge gefasst hatte, saß jedenfalls nicht mit am Tisch.
Bern
1870
Rudolf Lindt
Sowohl die Geographie- wie auch die Geschichtsstunde würden heute ausfallen, hatte Direktor Lüscher ihnen eben verkündet. Unter den Tertianern brandeten Jubel und Hurrarufe auf, nur Rudolf wollte nicht recht mit einstimmen. Besonders Geographie war eines seiner Lieblingsfächer. Er freute sich jede Woche darauf, wenn Lehrer Baumann seine riesige Landkarte ausrollte und über die Kantone der Schweiz und ihre geographischen Besonderheiten referierte oder über ferne Länder wie Ägypten und den Nil mit seinen Überschwemmungen, die fruchtbare Böden in der Wüste hinterließen. Er liebte auch die Sprachen, jedenfalls mehr als das Linearzeichnen oder die Buchhaltung. Dabei hatte ihm der Vater schon so oft erzählt, wie wichtig es für ihn sein würde, die Prinzipien der Buchführung zu verstehen, wenn er nach dem Übertritt aufs Polytechnikum die Matura ablegte und ein Studium begann. Natürlich stand der Wunsch dahinter, sein Erstgeborener würde einmal die Apotheke des Vaters übernehmen. Doch Rudolf hatte selbst noch nie diesen Wunsch verspürt. Er war jetzt fünfzehn Jahre alt, sein Gebiss war endlich vollständig, und er sah täglich im Spiegel nach, ob ihm nicht endlich ein erster Flaum als Vorbote eines Bartes wuchs, wenigstens auf der Oberlippe, wenn schon sonst nirgends. Die Schule war für ihn ein notwendiges Übel, dem er sich nicht entziehen konnte. Aber was nach der Realschule kommen würde, davon hatte er keine Vorstellung. Die Matura oder gar die Universität schienen ihm noch sehr weit entfernt. Wollte er wirklich Apotheker werden wie sein Vater? Er wusste es nicht und wich der Frage der Erwachsenen nach seinen Berufswünschen immer aus. Manchmal antwortete er »Philosoph« oder »Geometer«, um sich aus der Affäre zu ziehen. Dann lachten sie oder sahen ihn merkwürdig an.
Rudolf packte seine Sachen und verließ mit den anderen das Schulhaus. Er ging in der Gruppe der Klassenkameraden noch bis zum Waisenhausplatz, doch was sie dort genau vorhatten mit den geschenkten zwei Stunden, erfuhr er nicht mehr, weil er sich in einem unbeobachteten Moment davonstahl und den Langmauerweg Richtung Fluss hinunterlief. In den Aare-Auen konnte er unsichtbar werden, sobald er die ausgetretenen Wege verließ. Überall raschelte es im Gebüsch, wenn er sich näherte. Amseln stoben auf, er störte Eichhörnchen und Mäuse im Dickicht bei der Futtersuche. Das viele Grün, das Rascheln der Blätter im Wind, die feinen Geräusche der Tiere, das alles ließ Rudolf zur Ruhe kommen. Denn die Vormittage in der Schule gingen ihm eigentlich gegen seine Natur. Der harsche Befehlston der meisten Lehrkräfte, die scharfen Blicke und das In-der-Ecke-Stehen, das Frage-Antwort-Prinzip, mit dem der neue Stoff eingetrichtert wurde, das Geschrei und Gerangel auf dem Pausenhof, dem er sich stets zu entziehen versuchte, der scharfe Ton der Trillerpfeife auf dem Sportplatz, das Niedersausen des Rohrstocks auf die Bank, wenn getuschelt wurde, bei dem Rudolf immer noch furchtbar erschrak, auch nach so vielen Jahren Primar- und Sekundarschule. Es gab immer einen Höllenlärm, dem er nicht entkommen konnte. Dabei wäre ihm nichts lieber gewesen, als daheim zu sein und wie früher die Kinder aus den Patrizierfamilien Unterricht bei einem Privatlehrer zu bekommen, zusammen mit seinen Schwestern. Immer noch war Fanny, die Jüngste, ihm die liebste. Neun war sie vor Kurzem geworden, und sie war gescheit und übte zu Hause das flüssige Lesen mit richtigen Büchern. Die Fibel aus der Schule konnte sie längst auswendig. Und wenn sie etwas gelesen hatte, das sie nicht verstand, kam sie zu ihm und ließ es sich erklären. Die Mutter sah es nicht gern, dass sie beide sich »absonderten«, wie sie es nannte, und so viel Zeit miteinander verbrachten. Nur Caroline achtete ihre besondere Verbundenheit und kümmerte sich dafür mehr um Emma und Anna, und jetzt auch um Rudolfs Bruder August, einen Dreijährigen, den sie unentwegt beaufsichtigen musste. Den ganzen Tag suchte er nach Gelegenheiten, Dinge, die anderen gehörten, kaputt zu machen, Puppen die Arme auszureißen, Seiten aus Büchern zu reißen, sie mit Stiften zu bekritzeln, Kreisel so grob zu schlagen, bis der Fuß abbrach. Doch der Vater verzieh ihm alles und nahm ihn stets in Schutz. Als wüsste August nicht, was er tat. Dabei hatte Rudolf den Verdacht, dass er es ganz genau wusste. Er schien erst zufrieden, wenn eine seiner Schwestern weinte, weil einer ihrer Puppen ein Arm fehlte oder ein Bein. Dadurch war zu Hause nun auch fast so viel Lärm wie in der Schule.
Rudolf grub mit den Händen eine Kuhle in den Flusssand und füllte sie mit Blättern. Dann setzte er sich hinein und malte mit dem Finger Linien in den Sand. Wie still es hier war. Die Amseln gewöhnten sich an ihn, eine Maus lief ganz nah an seinem Bein entlang. Sonst war es leise, und Rudolf atmete auf. Wenn er nicht mit Fanny zu Hause war oder mit ihr zur Münsterplattform ging oder zum Bärengraben, den sie liebte, dann traf er Binia unten an der Nydeggbrücke, oder sie kam am späteren Nachmittag herauf in die Marktgasse, setzte sich an den Schützenbrunnen und wartete auf ihn. In die Wohnung kam sie nie, ebenso wenig, wie er mit zu ihr in die Matte ging, auch wenn er wusste, in welchem Haus sie wohnte. So, wie sie wusste, wo die Lindts wohnten. Rudolf malte noch zwei Spiralen auf den Boden, dann klopfte er sich den Sand von den Hosenbeinen und lief zurück in den Lärm der Stadt.
Als das Hausmädchen ihm in der Marktgasse die Wohnungstür öffnete, wusste Rudolf bereits, dass wieder einmal etwas passiert sein musste. Die Mutter war nicht zu Hause, die Schwestern vielleicht noch in der Schule. Der Tisch war schon gedeckt, aber es war noch zu früh zum Mittagessen. Die Köchin rumorte in der Küche, jemand weinte. Caroline stand in der Tür zum Zimmer der Mädchen und zerrte seinen Bruder an der Hand hinter sich her. Seine geliebte Caroline sah entsetzlich aus. »Au, au«, schrie August und versuchte, sich loszumachen, aber Caroline packte nur noch fester zu. Sie zog ihn über den Gang, riss die Tür zur Besenkammer auf und schob August hinein. Dann warf sie die Tür zu und drehte den Schlüssel um.
»Was ist denn passiert?«, fragte Rudolf.
»Ich kündige!«, schrie Caroline. »Dein Bruder ist ein Ekel. Man kann ihn nicht erziehen. Ich jedenfalls nicht, und ich will es auch nicht mehr. Es ist genug.«
»Was hat er denn angestellt?«, fragte Rudolf.
Das Kindermädchen ging voran in das Zimmer der Mädchen. Seine liebe, schöne Caroline. Das einzige Kindermädchen, das länger geblieben war. Die Einzige, die er wirklich mochte. Sie meinte es doch hoffentlich nicht ernst mit dem Kündigen.
Rudolf betrat hinter ihr das Zimmer. Dort lag Fanny in ihrem Bett, bis zur Nasenspitze zugedeckt. Caroline zog ihre Decke fort.
»Schau dir das an. Diese Bestie!«
Rudolf musste zweimal hinsehen, bevor er begriff, was passiert war. Diesmal hatte August nicht eine der Puppen erwischt, sondern seine Schwester Fanny. Offenbar hatte er ihr einen ihrer Zöpfe abgeschnitten.
»Was machen wir da bloß?« Caroline starrte Fanny an. »Hast du denn nichts gemerkt, Fanny?«
»Ich habe gelesen«, antwortete Fanny und griff sich in das Haarbüschel, das nun auf Schulterlänge endete, während der verbliebene Zopf bis auf die Mitte ihres Rückens fiel. Rudolf wusste ebenso wie Caroline, wie das Lesen bei Fanny ging. Mit dem Finger von Wort zu Wort und von Zeile zu Zeile nämlich, ganz konzentriert auf jede Silbe und besonders die großen Anfangsbuchstaben, die sie immer noch manchmal verwechselte. »August hat die ganze Zeit mit meinen Zöpfen gespielt. Ich habe nicht gemerkt, dass er sich eine Schere besorgt hat. Erst als der eine Zopf plötzlich auf die Decke gefallen ist.«
Sie weinte gar nicht, seine tapfere Fanny. Wahrscheinlich war ihr nicht klar, was das bedeutete. Mit nur einem Zopf konnte sie schlecht herumlaufen.
»Gibt es gar keine andere Lösung?«, fragte Rudolf.
Caroline schüttelte den Kopf.
»Wir müssen zum Coiffeur, am besten, bevor deine Mutter mit den beiden Mädchen nach Hause kommt. Oder dein Vater aus der Apotheke. Und dann kündige ich!«
»Bitte, Caroline«, flehte Rudolf, aber sie schnitt ihm das Wort ab.
»Pass du auf diesen, diesen …«
»Satansbraten auf«, schlug Fanny vor, und Rudolf fragte sich, woher sie dieses Wort kannte. Welches Buch hatte sie denn da in die Finger bekommen?
»Ich passe auf August auf«, versprach Rudolf. »Geht nur.«
Irgendwann hörte das Rumoren in der Besenkammer auf, und Rudolf sah nach, ob sein Bruder sich beruhigt hatte. Als er die Tür öffnete, kroch August auf allen Vieren heraus, das Gesicht verschmiert, wütend. Er griff nach Rudolfs Bein und biss ihn in die Wade. Rudolf schlug nach seinem Bruder, als die Wohnungstür aufgesperrt wurde.
»Was ist denn hier los?«, fragte sein Vater. »Haben wir kein Kindermädchen, das sich um den Kleinen kümmert?« Er nahm den schreienden August auf den Arm. »Solltest du mit deinen fünfzehn Jahren nicht klüger sein und anders mit deinem kleineren Bruder umgehen, Rudolf? Musst du nach ihm treten wie nach einem Hund?« Der Vater wollte nicht einmal wissen, was August angestellt hatte. »Wo ist Caroline?«
»Beim Coiffeur«, antwortete Rudolf und lief in sein Zimmer.
Zürich
1870