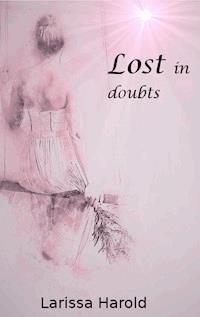Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Marissa Harper ist auf den ersten Blick eine unauffällige, 27jährige Frau, deren Leben perfekt zu sein scheint. Zusammen mit ihrem wohlhabenden Mann Brian lebt sie in der belebten, fiktiven Stadt Halefordcity in New York. Doch Marissas Leben ist alles andere als gewöhnlich, denn sie ist durch ihre unkontrollierbaren, ausgeprägten, irrationalen Ängste an ihr Apartment gefesselt und hat sich selbst längst aufgegeben. Gefangen in ihrer langjährigen Ehe, die an emotionaler Grausamkeit kaum mehr zu übertreffen ist, hält sie es eines Tages nach einem Streit mit ihrem Mann nicht mehr aus und verlässt fluchtartig ihr Apartment. Für sie ist dieser banale Schritt ein Gewaltakt, der von Qualen und Selbstzweifeln begleitet wird. Als sie sich, zusammengekauert auf einer Treppe, hoffnungslos in dem Wunsch verliert, ihrem Leben ein Ende zu setzen, trifft sie zufällig auf den charismatischen James. Obwohl sich die beiden noch nie zuvor begegnet sind, verspüren sie sofort eine außergewöhnliche Verbindung zueinander. Doch Marissa will James keinesfalls an sich heranlassen und ihm ihrem unfreiwilligen Lebensstil, der aus Isolation, Verzweiflung und Selbsthass besteht aufbürden. Daher beschließt sie, sich nicht auf ihn einzulassen, doch James lässt nicht locker. Ungeachtet dessen, dass sie nicht versteht, was für ein Interesse er an jemanden wie ihr haben könnte, wird sie schließlich von ihren Gefühlen übermannt und lässt sich auf ihn ein. Allmählich zeigt er ihr Wege und Möglichkeiten, sich aus ihrer aussichtslosen Situation zu befreien und animiert sie immer wieder, über sich selbst hinauszuwachsen. Schließlich werden die beiden ein Paar und Marissa trennt sich von ihrem niederträchtigen Ehemann. Dadurch realisiert sie sukzessive, dass das Leben auch schöne Seiten haben kann und entdeckt nach vielen Jahren der Isolierung wieder neuen Lebenswillen. Während sie dabei ist, sich mit James' Hilfe mühsam von ihren Erlebnissen zu erholen, wird das Glück der beiden immer wieder auf neue Proben gestellt. Denn James' eigene, einschneidende Vergangenheit, die ihn letztlich zu Marissa führte, schwebt wie ein Damoklesschwert über den beiden. Derweil ist Brian nicht gewillt sich von seiner hörigen Frau einfach so abservieren zu lassen und schmiedet finstere Pläne, mit denen er James und Marissa mehr als einmal in Gefahr bringt. Während die beiden, trotz Marissas immer wiederkehrenden Problemen, jede Hürde zu überwinden scheinen, holt Brian zu einem letzten, feigen Schlag aus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Epilog
Prolog
Manchmal möchte ich einfach verschwinden, gänzlich unsichtbar sein. Von nichts und niemandem wahrgenommen werden. Ich möchte wirklich in mir verschwinden, aber wünsche mir insgeheim, dass andere mir beim Verschwinden zusehen. Die unsagbare Kraft sehen, die es mir abverlangte, Stück für Stück aufzuhören zu existieren. Doch wenn ich einen Moment innehalte, stelle ich fest, dass ich schon längst verschwunden bin.
Ich bin nur noch eine Hülle, ein Abziehbild meiner Selbst, das ausschließlich von Leid und Schmerz zusammengehalten wird...
Kapitel 1
Weinend verlasse ich mein Apartment. Nur wohin soll ich gehen? Es regnet, aber das ist nicht das Problem.
Zitternd ziehe ich mir meinen schwarzen Strickmantel enger um den Leib. Mit wackeligen Beinen gehe ich die gepflasterte Straße geradeaus und konzentriere mich einzig und allein auf den Regen, der meinen Mantel durchnässt.
Vor meinem geistigen Auge spielen sich die letzten zwanzig Minuten ab.
»Dann verpiss dich doch, du Miststück!«, brüllt Brian.
Völlig verdutzt sehe ich ihn an. »Ich will hier liegen und einfach meine Ruhe haben. Verdammt, du nervst«, schreit er und wendet mir auf der Couch seinen Rücken zu. Ich spüre die Wut in mir hochkommen, kontrolliere sie aber gleich wieder. »Schatz«, sage ich so ruhig wie möglich, um ihn nicht noch weiter zu reizen. »Schreist du mich gerade tatsächlich an, weil ich deine Klamotten wegräume?«
Sofort wendet Brian sich mir wieder zu und sieht mich an, eine Mischung aus Wut und Entsetzen zeichnet sich in seinem Blick ab. Oh ja, ich habe es nicht runtergeschluckt, du hast richtig gehört. »Wen interessiert es, ob du hier sauber machst oder nicht? Soll ich dafür auch noch dankbar sein? Nur weil du offensichtlich nichts Besseres mit deiner Zeit anzufangen weißt, brauchst du mir nicht auf den Sack gehen. Und jetzt verschwinde, bevor ich mich vergesse!«
Beim letzten Satz schwingt eine leichte Schadenfreude in seiner Stimme mit. Er weiß, dass ich nicht wegkann. Nur deshalb hat er die Macht, mich so zu behandeln. Ich schnappe mir meinen Mantel, schlüpfe in meine grauen Sneakers und verlasse fluchtartig und völlig geistesabwesend das Apartment.
Das große Straßenschild mit der Aufschrift „Mainstreet“ ist nur noch zwanzig Schritte von mir entfernt. So weit war ich schon seit Monaten nicht mehr von zuhause weg.
Bei dieser Erkenntnis muss ich bitter lächeln. Ich bin siebenundzwanzig Jahre alt und fühle mich hier draußen völlig verloren. Mein Apartment ist gute zehn Minuten von hier entfernt. Zehn Minuten! Aber für mich ist das ein Gewaltakt. Schlagartig hört es auf zu regnen. Ich bin zehn Minuten von meinem Apartment entfernt... Zehn Minuten!
Hektisch sehe ich mich um. Da ist es wieder, dieses beklemmende Gefühl, das von ganz unten in meinem Körper nach oben aufsteigt. Schlagartig habe ich das Gefühl, ohnmächtig zu werden. Instinktiv kralle ich mich in dem Ärmel meines Mantels fest, so als ob dieser mir etwas Halt bieten könnte. »Nein Marissa, du wirst nicht ohnmächtig, das ist nur die Angst in deinem Kopf«, versuche ich mir im Flüsterton beruhigend einzureden. Doch wie zu erwarten hilft es nicht. Mit weichen Knien gehe ich ein paar Schritte weiter zu dem örtlichen Café. Wie üblich ist es nicht gut besucht, zu meinem Glück. Neugierige Leute, die mich mit ihren Blicken durchbohren, sind das Letzte, das ich jetzt gebrauchen kann. Langsam setze ich mich auf die kalten Stufen in der Gasse neben dem Café und umklammere mich selbst so fest wie ich nur kann. Wieso bin ich nur herausgestürmt? Warum bin ich nicht einfach zuhause geblieben?
Ich habe das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Weinend lege ich meinen Kopf auf die eng angewinkelten Knie und wünsche mir, einfach zu sterben.
»Kann ich dir vielleicht helfen?«, holt mich eine tiefe, fremde Männerstimme aus meinen Gedanken heraus. Erschrocken schaue ich nach oben und versuche meine Tränen wegzublinzeln, um sein Gesicht besser erkennen zu können. »Keine Ahnung, kannst du?«, antworte ich unhöflicher, als ich vorhatte. Abwehrend hebt er seine Hände und schenkt mir ein atemberaubendes Lächeln. »Sorry, du sahst aus, als ob du Hilfe brauchen könntest.« Lässig fährt er sich mit der Hand durch sein dunkelblondes Haar. Jetzt wo ich ihn mir genauer ansehe, stelle ich fest, dass er sehr gut aussieht. Obwohl es gerade noch geregnet hat, sind seine knapp schulterlangen Haare trocken. Erst jetzt bemerke ich einen Schlüssel in seiner Hand, den er in kleinen, kreisförmigen Bewegungen hin und her schwenkt. Hinter ihm steht ein schwarzes Motorrad samt Helm auf dem Sitz. Ob das ihm gehört? Ungefragt setzt er sich zu mir auf die Treppe, irgendwie ist mir dabei unwohl. »Mieser Tag?«, fragt er geradeaus, ohne mich anzusehen. »Mieses Leben«, antworte ich und wische mir die letzten Tränen aus dem Gesicht. Er nickt und schaut nachdenklich in die Wolken. »Ich hole uns einen Cappuccino aus dem Café nebenan«, beschließt er und steht auf. »Was hältst du davon? Du trinkst doch Kaffee, oder?« Obwohl sein Tonfall so selbstsicher und arrogant klingt, wirkt er dennoch keineswegs abschreckend auf mich. Etwas verwirrt schaue ich in seine blauen Augen, die mich halb erwartungsvoll und halb belustigt ansehen.
»Nein«, platzt es aus mir heraus, noch bevor ich überhaupt weiß wieso. »Ich kenne dich doch gar nicht«, füge ich als lahmen Erklärungsversuch hinzu. Schon wieder erscheint dieses sexy Grinsen auf seinem Gesicht. »Oh, wie unhöflich von mir. Ich bin James. Und da du mich jetzt kennst, möchte ich dich bitten, hier zu warten, während ich uns einen Cappuccino hole.« Ohne eine Antwort von mir abzuwarten dreht er sich herum und geht Richtung Café. Bevor er aus meinem Blickfeld verschwunden ist, rufe ich ihm hinterher: »Ich bin Marissa.«
James nickt mir freundlich zu und ohne es zu wollen muss ich lächeln.
Nachdem wir unseren Cappuccino halb geleert haben weiß ich von James, dass er aus Downtown kommt, täglich ziellos mit seinem Motorrad durch die Straßen fährt, um den Kopf frei zu bekommen, er vierunddreißig Jahre alt und gerade erst hergezogen ist. Und dass er als Maler arbeitet. Unwillkürlich stelle ich ihn mir bei der Arbeit vor und unterdrücke ein Grinsen. Irgendwie hätte ich ihn mir besser als Model vorstellen können, als mit Farbklecksen übersät. Nach einer Weile des Schweigens sieht er mich mit ernster Miene an. »Was ist mit dir? Wieso warst du so aufgelöst?« Ich finde es befremdlich, von einem fast unbekannten Mann so intime Fragen gestellt zu bekommen. Dennoch denke ich einen kurzen Augenblick über seine Fragen nach. Wieso war ich so aufgelöst? Weil meine achtjährige Ehe mittlerweile eine Katastrophe ist? Weil ich ein Wrack bin? Oder einfach nur, weil ich mich selbst hasse? Da ich James wahrscheinlich nie wiedersehen werde, antworte ich wahrheitsgemäß.
»Ich hatte einen riesigen Streit mit meinem Mann.« Mehr braucht er nicht zu wissen. Für den Bruchteil einer Sekunde frage ich mich, ob er mir auch einen Cappuccino spendiert hätte, wenn ihm bewusst gewesen wäre, dass ich verheiratet bin. Doch dann fällt mir wieder ein, dass ich unattraktiv und wertlos bin. Wahrscheinlich hatte er nur Mitleid. Diese Erkenntnis versetzt mir unversehens einen Stich in die Eingeweide. »Das muss ein heftiger Streit gewesen sein«, sagt er gedankenverloren und wischt mir eine Träne von der Wange. Wieso weine ich schon wieder? »Tut mir leid«, entschuldige ich mich und versuche die Fassung wiederzuerlangen. Doch leider gelingt es mir nicht. »Was genau tut dir denn leid?«, fragt er verwundert. »Dass ich die ganze Zeit heule und dich mit meiner Scheiße zutexte.« Verzweifelt wische ich mir erneut mit dem Handrücken durchs Gesicht und wende meinen Kopf von James ab, um meine Tränen zu verbergen. Unvermittelt zieht mich James näher zu sich heran und legt seine Arme um mich. Reflexartig mache ich mich innerlich ganz steif. Noch nie hat mich jemand in den Arm genommen, wenn ich geweint habe. Meine Eltern haben mich ausgelacht oder ignoriert, Brian wird jedes Mal wütend und verletzend. Mein Kopf ruht auf seiner Brust. Ich nehme einen tiefen Atemzug und stelle fest, dass er sehr gut riecht. Komischerweise fühle ich mich gerade sehr wohl, fast entspannt. Obwohl ich James gar nicht kenne, habe ich das Gefühl, dass ich genau das jetzt gebraucht habe. Einen kurzen Moment gebe ich mich diesem Gefühl voll und ganz hin und schließe die Augen. Mit einem leisen Seufzer löse ich mich schließlich aus seiner Umarmung und stelle mich der Realität. Beschämt sehe ich ihn an. »Ich danke dir«, flüstere ich. Unwillkürlich rufe ich mir in Erinnerung, wie ich hier vor weniger als einer Stunde zusammengekauert und am Boden zerstört Platz genommen habe. Von meiner Panik existiert nicht mehr die kleinste Spur. Der so selbstbewusste James blickt einen Augenblick zu Boden und zuckt beinahe verlegen mit den Schultern. »Ich habe doch gar nichts gemacht. Doch wenn ich je etwas für dich tun kann, lass es mich wissen.« Er grinst und zieht eine Augenbraue hoch. Wie kann man nur so unverschämt gut aussehen? Ich blinzle drei Mal hektisch und schaue ihn verlegen an. »Okay«, hauche ich atemlos. Etwas unbeholfen stehe ich auf und verabschiede mich.
»Rufst du mich mal an?«, fragt James, als ich ihm den Rücken zuwende. »Meinst du das ernst?« Nervös fange ich an zu kichern, das ist völlig untypisch für mich.
Selbstsicher kommt er auf mich zu und streckt mir seine Hand entgegen. »Gib mir dein Handy!«, fordert er mich auf. Wortlos reiche ich es ihm. Nachdem er seine Nummer eingespeichert hat, gibt er es mir mit einem selbstzufriedenen Gesichtsausdruck zurück und fährt mit einem breiten Grinsen auf seinem Motorrad davon.
Kapitel 2
Als ich nach Hause komme ist es im Apartment ganz still. Leise ziehe ich meine Sneakers aus und hänge meinen Strickmantel ordentlich an den Garderobenhaken. Vorsichtig werfe ich einen Blick ins Wohnzimmer und sehe, dass Brian vor dem gigantischen Flatscreen eingeschlafen ist. Es ist mir jedes Mal ein Rätsel, wie er nach so heftigen Auseinandersetzungen, die mich in einem vollständigen emotionalen Chaos verharren lassen, einfach so tun kann, als ob nichts gewesen wäre. Ich werde unter diesen Umständen weder essen noch schlafen können, denn meine Gedanken kreisen sich einzig und allein um das warum. Warum ist er so abwertend und grausam zu mir geworden? Seit wann sind ihm meine Gefühle so gleichgültig? Was heute vorgefallen ist, war nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und keinesfalls das Schlimmste, was er mir in den letzten Jahren angetan hat. Dennoch verletzt es mich jedes Mal zutiefst, wenn er mich so behandelt. Und ihm ist das alles schlichtweg egal. Um Brian nicht zu wecken und mir weiteren Zorn zuzuziehen, schleiche ich mich in die Küche, um mir einen Tee zu machen. Meine Haare sind vom Regen noch völlig durchnässt und ich friere. Als ich nichtsahnend die Küche betrete, trifft mich der Schlag. Sämtliche Schränke sind ausgeräumt, drei Teller liegen zerbrochen auf dem Boden und der gesamte Inhalt der Haferflocken wurde mutwillig aus der Vorratsdose über die Anrichte verstreut. Die sonst so liebevoll gepflegte 25.000 Dollar Designerküche ähnelt einem Schlachtfeld. Jetzt packt mich die Wut. Was denkt er sich nur? Aufgebracht stampfe ich ins Wohnzimmer und tippe Brian zweimal auf die Schulter. Verschlafen sieht er zu mir hoch und richtet sich ein wenig auf. »Na, auch wieder zuhause?«
»Was soll das?«, frage ich um Beherrschung ringend und deute mit dem Kopf Richtung Küche.
»Reg dich mal ab. Wen stört das denn?« Er schnaubt abfällig und grinst mich provozierend an. Ich nehme all meinen Mut zusammen und balle meine Hände zu Fäusten.
»Geh und räum das weg! Ich habe den ganzen Tag, wie jeden Tag, alles sauber gemacht und dir deinen Kram hinterhergeräumt. Ich bin nicht deine Putzfrau!«, sage ich bestimmend und versuche, das Zittern in meiner Stimme zu verbergen. In seinem Blick sehe ich, dass ich diese magische Grenze, die er über die Jahre aufgestellt hat, überschritten habe. »Du räumst den ganzen Tag meinen Kram weg? Zu mehr bist du auch nicht zu gebrauchen. Mach es doch selber und jetzt kannst du mich mal!«, fährt er mich eisig an. Er legt sich wieder auf die Couch und schließt die Augen. Fassungslos starre ich ihn an.
»Ich finde es widerlich wie du mich behandelst. Du denkst doch, dass du alles mit mir machen kannst. Wenn du nicht aufpasst, bin ich eines Tages einfach weg«, sage ich leise, beim letzten Satz bricht meine Stimme kaum merklich.
»Wo willst du denn hin? «, keift Brian mich an.
»Ich höre mir deine Scheiße nicht länger an. Sieh zu, dass du alleine klarkommst!« Im Eiltempo stürmt er zur Tür und greift nach seinen Schuhen. »Nein, bitte nicht schon wieder«, flehe ich verzweifelt. »Wieso kannst du nicht einfach vernünftig mit mir reden? Warum drohst du mir jedes Mal damit, dich einfach aus dem Staub zu machen, wenn dir etwas nicht passt?« Sofort spüre ich eine Woge der Übelkeit in mir hochkommen. Sein einziges und feigstes Druckmittel, das er gegen mich in der Hand hat, mich zu verlassen. Nur weil er weiß, dass ich ohne ihn aufgeschmissen bin. Ich hasse es so zu sein, doch ich stecke zu tief drin, ich finde keinen Weg mehr nach draußen. »Bitte Brian, lass uns doch in Ruhe über alles reden, es tut mir leid«, schluchze ich und schlage deprimiert die Hände vors Gesicht. Augenblicklich breitet sich dieses enge Gefühl, das mich nur schwer atmen lässt, in meiner Lunge aus. Mit großen Augen sehe ich Brian bittend an. Doch er wirft mir nur einen abfälligen Blick zu, gefolgt von einem boshaften Grinsen. Unbeeindruckt von meinem Leid schließt er die Tür hinter sich und hastet die Treppen hinunter.
Völlig entgeistert schaue ich auf die geschlossene Apartmenttür. In mir breitet sich ein Gefühl der Leere aus, gepaart mit schrecklicher Angst und purer Verzweiflung. Wie so oft ärgere ich mich über meine grenzenlose Dummheit. Ein normaler Mensch hätte diese Beziehung schon längst beendet, würde sich nicht jeden Tag aufs Neue erniedrigen lassen und dann noch betteln, dass der Partner bleibt. Aber so bin ich nicht! Er wird so schnell nicht wiederkommen, das ist mir bewusst. Denn ich soll leiden, das ist Brian immer am wichtigsten. Wie in Trance gehe ich ins Schlafzimmer und öffne die letzte Schublade meiner kleinen, weißen Kommode. Gezielt greife ich nach ganz hinten und hole einen sorgfältig gefalteten, rot gemusterten Schal hervor.
Dann fasse ich in den Schal hinein und ziehe mein kleines, graues Büchlein heraus. Erschöpft setze ich mich auf den flauschigen Teppich, der dekorativ vor der Kommode platziert wurde und fahre behutsam mit meinem Zeigefinger über die zerknickten Kanten des Buchrandes. Dann beginne ich einen meiner Einträge zu lesen:
„Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Die Stimmung zwischen uns wird immer angespannter, jeden Tag muss ich Angst haben, etwas falsch zu machen. Ich freue mich jeden Abend darauf, wenn ich endlich ins Bett gehen kann. Augen zu, Verstand aus und gedanklich so weit weg von hier wie möglich. Als ich schon im Bett lag, kam Brian zu mir und mir war sofort klar, was er wollte. Denn ohne Grund legt er sich schon lange nicht mehr so zeitig neben mich. Da die Stimmung zwischen uns aber so drückend war, habe ich mich schlafend gestellt. Daraufhin ist er total ausgerastet und fing an, mir sämtliche Beleidigungen an den Kopf zu werfen, die ihm einfielen. Ich habe dann versucht zu schlichten und so ruhig, wie es mir möglich war, mit ihm gesprochen. Doch er ließ sich auf kein Gespräch ein und steigerte sich immer mehr in seine Wut hinein. Obwohl ich die ganze Zeit ruhig blieb und versuchte ihn zu beruhigen, ließ er seine unverhohlene Wut ungefiltert an mir aus. Er war so hasserfüllt, dass er mir Dinge vorgeworfen hat, mit denen ich mich nicht mal identifizieren konnte. Egal was ich sagte, er behauptete, ich lüge! Er prügelte verbal immer mehr auf mich ein, bis ich schließlich anfing zu weinen. Wie so oft hatte ich den Eindruck, dass ihn mein Leid erst richtig anstachelte und aus meiner Verzweiflung heraus, habe ich ihn angefleht, endlich damit aufzuhören. Doch er machte einfach weiter. Ich bemerkte die Panik und die Hilflosigkeit in mir aufsteigen. Ich bettelte und flehte, dass er ENDLICH aufhören soll, es war so demütigend. Die Erniedrigung hat mich völlig aufgefressen. Ich kann es nur schwer ertragen, wenn ich so bin, ja, ich hasse es regelrecht! Wann bin ich nur so ein hilfloses, armseliges Etwas geworden? Als Brian dann auch noch anfing sich über meinen Schmerz zu amüsieren und mit meinen Ängsten spielte, hatte ich das Gefühl, er würde meine Seele malträtieren. Wie kann er nur so grausam sein? Dieser seelischen Folter konnte ich keine Sekunde mehr länger standhalten, daher verschwand ich wortlos im Bad, um zu versuchen, mich zu beruhigen. Als ich später wieder ins Schlafzimmer kam, war Brian friedlich eingeschlafen. Es kümmert ihn nicht, was er mir mit seinem Verhalten antut. Da wurde mir das erste Mal bewusst, dass ich ihn hasse. Ich hasse ihn! Wenn ich nicht so auf ihn angewiesen wäre, würde ich ihn verlassen, ihm ein deutliches Zeichen setzen, dass man keinen Menschen so behandelt! Und schon gar keinen, den man angeblich liebt. Doch meine unsagbare Angst vor dem Alleinsein und meine Abhängigkeit von ihm, macht mir dieses schier unmöglich. Wann hat er aufgehört mich zu lieben? Und warum? Ich fühle mich so einsam. Manchmal frage ich mich, ob ich nur geboren wurde, um gequält und erniedrigt zu werden. Ich kann so nicht weitermachen, ich hasse mein Leben so sehr!“
Ich muss heftig schlucken. Jede Emotion und die seelische Folter dieses Tages kommen beim Lesen wieder hoch. Ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass es bereits 16.25 Uhr ist. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Brian heute noch nach Hause kommt, auf null. Als ich vom Fußboden aufstehe, wird mir einen kurzen Moment schwarz vor Augen. Da wird mir bewusst, dass ich heute noch nichts gegessen habe. Wenigstens etwas Gutes.
Träge ziehe ich meine Hose aus und stelle mich auf die Waage. 43,8 kg! Nicht schlecht. Sorgsam stelle ich die Waage beiseite und betrachte mich im Spiegel. Meine langen, braunen Haare sehen zerzaust aus. Ich bin sehr blass, aber das bin ich eigentlich immer. Unter meinen großen, blauen Augen zeichnen sich unschöne Schatten und rote Flecken vom Weinen ab. Mit einem Hauch von Ekel mustere ich die Frau im Spiegel. Mir wurde schon oft gesagt, dass ich hübsch bin, nur dem kann ich absolut nicht zustimmen. Je länger ich mich betrachte, umso größer wird meine
Abscheu. Ratlos verlasse ich das Bad und schaue mich im Apartment um. Gezielt steuere ich das Schlafzimmer an, nehme zwei Schlaftabletten aus dem Nachttisch, schlucke sie hastig herunter und rolle mich auf dem Bett zusammen.
»Schlaf einfach ein, schlaf einfach ein...«, flüstere ich mir selbst immer wieder beruhigend zu. Um mich herum wird es schwarz.
Tagebucheintrag
Heute hat mich nach Ewigkeiten meine Cousine Mia besucht. Als wir noch Kinder waren, standen wir uns sehr nah und hatten ein richtig geschwisterliches Verhältnis. Doch seit sie vor acht Jahren mit ihrer Familie nach England gezogen ist, haben wir nur noch sehr sporadischen und relativ oberflächlichen Kontakt. Da sie nach kurzer Zeit bemerkte, dass es mir offensichtlich nicht gut geht und von dem lebensfrohen, ausgelassenen Mädchen von früher nicht mehr viel übrig ist, habe ich beschlossen, mich Mia anzuvertrauen.
Mit einem Kloß im Hals habe ich ihr von meiner Angststörung erzählt, was diese Krankheit mit mir macht und wie einsam und machtlos ich mich damit fühle. Ihre Reaktion fiel leider ganz anders als erhofft aus. Sie hat in keinerlei Weise Verständnis für meine Situation. Sie betonte energisch, dass es alles nur eine Sache der Priorität und des Willens wäre. Am Ende des Gesprächs behauptete sie sogar, dass das auch keine Krankheit, sondern bloße Anstellerei wäre. Sie würde nicht nachvollziehen können, wie ich mich in meinem Selbstmitleid ausruhen kann.
Brian hat mir schon oft ähnliche Dinge vorgeworfen. Und manchmal frage ich mich ernsthaft, ob sie Recht haben.
Stelle ich mich nur an? Bin ich einfach zu dumm? Woran liegt es, dass ich so bin wie ich bin?
Doch dass ich mir solche Fragen stellen muss, macht mich nicht nur wahnsinnig fertig, sondern es macht mich auch wütend. Wissen denn all die Leute, die sich über solche Krankheiten, ja, ich sage KRANKHEITEN, lustig machen oder es abwertend abtun nicht, was es bedeutet so zu leben? Das ist natürlich nur eine rhetorische Frage, natürlich wissen sie es nicht. Bis zu meinem zwanzigsten Lebensjahr war ich eine ganz normale Frau. Ich war mit meinen Freundinnen unterwegs, hatte Zukunftspläne und bin alleine nach draußen gegangen. Wie jeder andere auch, es sind halt ganz normale, alltägliche Dinge, die kein gesunder Mensch je wertschätzt. Doch diese Leute mögen sich doch einfach mal versuchen vorzustellen, dass dies alles nicht mehr möglich ist. Von jetzt auf gleich. Man wacht eines Tages auf, möchte seinen alltäglichen Dingen nachgehen und plötzlich überkommt es dich. Das erste Mal ist das schlimmste Mal! Denn man ahnt nicht ansatzweise, was einen erwartet. Auf einmal ist es, als würde dir jemand die Kehle zuschnüren, dein Herz rast ohne erkennbaren Grund wie verrückt und in deinem Kopf fahren die Gedanken Achterbahn. Und es kommt aus dem Nichts.
Natürlich sucht man nach Erklärungen, fragt sich was das war, aber man findet keinen logischen Grund. Dann kommen unerwartet wieder gute Tage und bemüht sich, die Ereignisse einfach zu vergessen. Doch diese Panikattacken kommen immer und immer wieder. Und mit jedem Mal wird dieses Gefühl heftiger und intensiver.
Irgendwann verliert man das Vertrauen in sich selbst und in seinen Körper. Und ehe man sich versieht, lebt man einsam, deprimiert und isoliert über Jahre hinweg und fragt sich, ob man schier den Verstand verliert.
Ich habe in der Anfangszeit meiner Erkrankung in einem Onlineforum nach Hilfe gefragt und dort schrieb tatsächlich jemand:
»Selbst krebskranke Menschen stellen sich nicht so an wie du, du solltest dich schämen. Gehe einfach nach draußen, du wirst schon nicht sterben.«
Diese Sätze haben mich so sehr gekränkt und in meinen Selbstzweifeln verstärkt, dass ich tagelang nur noch weinen konnte. Ich verstehe nicht, wieso die Gesellschaft einen als Simulant abfertigt, nur weil man ein psychisches Leiden nicht sehen kann. Ich verstehe es wirklich nicht...
Kapitel 3
Die Wärme der durchs Fenster eindringenden Sonnenstrahlen lassen mich allmählich erwachen. Es ist ein sonniger, angenehmer Tag in Halefordcity, dem wohl kleinsten Stadtteil am Rande von New York. Doch die milden Temperaturen bessern meine Laune nicht im Geringsten. Mühsam versuche ich meine Augen zu öffnen. Die Betthälfte neben mir ist unberührt. Etwas benommen von den Schlaftabletten gehe ich mit wackeligen Beinen ins Wohnzimmer, um nachzusehen, ob Brian auf der Couch geschlafen hat. Doch im Wohnzimmer ist niemand. Steifbeinig schlendere ich ins Badezimmer und stelle mich unter die Dusche.
Danach mache ich mir in der Küche lustlos einen Tee und schaue auf das Durcheinander, das Brian mir hinterlassen hat. Ich kann mich nicht überwinden es zu beseitigen. Mittlerweile ist es schon Mittag, daher versuche ich Brian auf dem Handy zu erreichen. Es ist ausgeschaltet. Da die Vorratsschränke leer sind, müsste ichdringend in den Supermarkt, doch das traue ich mir nicht zu. Ein Gefühl der Übelkeit übermannt mich. Ich bin eine erwachsene Frau und kann nicht alleine einkaufen gehen. Meine Fingernägel vergraben sich so tief in meinen Handflächen, dass es Spuren hinterlässt. Mechanisch scrolle ich durch mein Handy und bleibe bei James' Namen stehen. Gedankenlos betätige ich die Anruftaste und lausche gespannt. Nach dem vierten Klingeln meldet sich eine genervte Männerstimme. »Ja?«, blafft James ins Telefon. »Hi, hier ist Marissa«, sage ich nach kurzem Zögern zaghaft. »Marissa!«, ruft er überrascht aus und sein Tonfall ist um Längen freundlicher.
»Wie schön, von dir zu hören. Was kann ich für dich tun?« Nervös spiele ich mit einer meiner nassen Haarsträhnen und denke fieberhaft nach, was ich darauf antworten kann. Wieso habe ich ihn überhaupt angerufen? »Ich habe durch mein Handy gescrollt und bin irgendwie bei deinem Namen stehen geblieben«, stottere ich verunsichert. Am anderen Ende der Leitung ist es still. Fünf Sekunden, sieben Sekunden, zehn Sekunden...»Bist du noch dran?«, frage ich irritiert. »Sollen wir uns gleich treffen? Ich würde dir gern etwas zeigen.« Gespannt wartet er auf meine Antwort. Doch ich glaube in seiner Stimme noch etwas anderes erkennen zu können. Aufregung? Ich bin mir nicht sicher. »Ich kann nicht rausgehen«, platzt es aus mir heraus. Angespannt schließe ich die Augen und beiße mir so fest auf die Innenseite meiner Wange, bis ich Blut schmecke. Warum habe ich das gesagt? »Was meinst du damit? Wieso kannst du nicht rausgehen?«, fragt er verwirrt. »Hat es etwas mit deinem Mann zu tun?« Sein Tonfall klingt drängend. Ich antworte nicht. Vielleicht sollte ich einfach auflegen und mich nie mehr bei ihm melden. Was habe ich mir dabei überhaupt gedacht? »Kannst du in einer Stunde bei dem kleinen Café sein?«, fragt er in meine Gedanken hinein.
»Ich weiß es nicht«, antworte ich mit zitternder Stimme. »Ich werde dort auf dich warten«, teilt James mir mit und legt auf. Ungläubig starre ich auf mein Handy und schüttle den Kopf. Gedankenversunken gehe ich ins Badezimmer und föhne mir die Haare. Schaffe ich den Weg bis zum Café nochmal? Möchte ich das überhaupt schaffen? Verunsichert schaue ich in den Spiegel und mein Spiegelbild grinst mich verstohlen an. Obwohl ich James erst einmal gesehen habe, verspüre ich ein ungeheures Verlangen, ihn so schnell wie möglich wiederzusehen. Nachdem meine Haare trocken und halbwegs annehmbar sind, schaue ich skeptisch in den Spiegel. Die dunklen Schatten unter meinen Augen sind nach wie vor sichtbar. Genervt greife ich zum Concealer, den ich seit Jahren schon nicht mehr benutzt habe, und versuche meine Augenringe, so gut es geht, zu verstecken. Jetzt fehlt nur noch etwas Eyeliner und Wimperntusche.
»Besser wird's nicht«, flüstere ich mir selbst enttäuscht zu.
Weshalb will sich James eigentlich mit mir treffen? Was hat er vor? Er weiß, dass ich verheiratet bin, ich habe optisch nichts zu bieten und offensichtliche Probleme. Unruhig laufe ich durch das Apartment und zermartere mir den Kopf, was für ein Motiv James haben könnte, mich wiedersehen zu wollen.
Mit zittrigen Beinen und fester Entschlossenheit gehe ich die „Mainstreet“ entlang. Mein rasender Herzschlag erschwert mir jeden Schritt. Ich habe keine Ahnung wie spät es ist, aber ich sehe, dass James bereits am Ende der Straße lässig neben seinem Motorrad steht. Als er mich entdeckt, schenkt er mir sein strahlendes Lächeln und kommt mit zügigen Schritten auf mich zu. James trägt eine dunkelblaue Jeans, ein weißes Shirt und eine schwarze Lederjacke. Grinsend streicht er sich die wirren Haare aus dem Gesicht, er sieht einfach umwerfend aus. »Hey«, begrüßt er mich erfreut. Er sieht mich einen kurzen Augenblick an und umarmt mich zu meiner Überraschung. Zögernd erwidere ich seine Umarmung und schließe einen kurzen Moment die Augen, während ich begierig seinen beruhigenden Duft in mir aufnehme. »Komm mit!«, fordert James mich gut gelaunt auf und ergreift meine Hand. Mit gezielten Schritten gehen wir auf sein Motorrad zu. Mit einem breiten Grinsen reicht er mir seinen Helm. »Wir machen eine kleine Tour«, erklärt er in meinen fragenden Gesichtsausdruck hinein. Sichtlich nervös zupfe ich an einer meiner Haarsträhnen. Der Weg hierhin war für mich schon die reinste Qual. Wie soll ich ihm begreiflich machen, dass ich nicht einfach sorglos mit ihm durch die Gegend fahren kann?
»Was hast du denn vor?«, frage ich, um Zeit zu gewinnen.
»Das wirst du erfahren, sobald wir dort sind.«