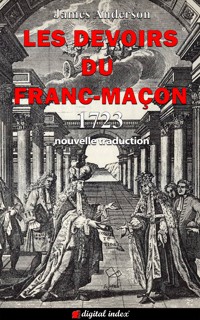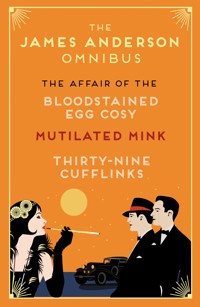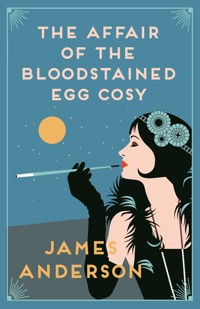17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Polar Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Wüste im Winter. Fallwinde, Schneestürme, die Sicht unter zehn Meter. Ben Jones, den wir aus "Desert Moon" kennen, beliefert mit seinem Truck die Road 117. Er selbst sagt über sich, dass er Menschen Zeit verschafft, während sie auf die Entscheidung warten, ob es bei ihnen auf Leben oder Tod hinausläuft. Was soll er also tun, als er um Hilfe gebeten wird? An einem Stop'n'Gone Truck Stop wartet ein kleiner Junge mit einem Zettel auf ihn: Bitte, Ben. Riesenärger. Mein Sohn. Nimm ihn heute. Er heißt Juan. Ich traue nur dir. Sag keinem was. Mit Kind und Hund im Fahrerhaus erleidet Ben einen Unfall, als ein Truck ihn rammt. Er muss nach Rockmuse fahren, um den Schaden beheben zu lassen. Da erwartet ihn die nächste Katastrophe. John, der Prediger, ist angefahren worden, und liegt halbtot in einem Kino. Seine einzige Überlebens- chance ein ehemaliger Arzt, der selber mehr tot als lebendig in einem Trailer außerhalb der Stadt lebt. Auch in seinem neuen Kriminalroman erzählt James Anderson von Verbrechen mitten in der Wüste, die scheinbar am Rand geschehen und in die Ben verstrickt wird, obwohl er nur seine Ware ausliefern und in Ruhe gelassen werden will. Doch Ben kann nicht anders. Er stellt sich der Gefahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
James Anderson
Lullaby Road
Aus dem Amerikanischen von Harriet FrickeHerausgegeben von Wolfgang Franßen
Originaltitel: Lullaby RoadCopyright: 2018 by James Anderson
This translation published by arrangement with Crown, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC
Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2020Aus dem Amerikanischen von Harriet FrickeMit einem Nachwort von Hanspeter Eggenberger
© 2020 Polar Verlag e.K., Stuttgartwww.polar-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme ohne schriftliche Genehmigung des Verlags verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Eva Weigl, Nadine HelmsUmschlaggestaltung: Robert Neht, Britta KuhlmannCoverfoto: © moritz /Adobe StockAutorenfoto: © James AndersonSatz/Layout: Martina StolzmannGesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesignDruck und Bindung: CPI books GmbH, Leck, Deutschland
ISBN: 978-3-948392-10-9eISBN: 978-3-948392-11-6
Für meine ewigenVorbilder, Kämpferinnen, Heldinnen:Louisa Michaela Cabazut, GroßmutterHelen Zuur, Mutter, Eileen Bernard, TanteLouise Anderson, Schwester, Cheryl Zuur, Cousine
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
DANK
Durch die Wüste: Desert noire
»In meinem Leben ist vieles Schweigen.«Juan Rulfo
»Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der EngelOrdnungen? Und gesetzt selbst, es nähmeeiner mich plötzlich ans Herz: Ich verginge von seinemstärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichtsals des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen,und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht,uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich.Und so verhalt ich mich denn und verschlucke den Lockrufdunkelen Schluchzens.«Duineser Elegien, Rainer Maria Rilke
1
Eine vorübergehende Stille war alles, was den Übergang von Sommer zu Winter markierte. Da ich fast sämtliche meiner knapp vierzig Jahre in der Hochwüste von Utah verbracht hatte, zwanzig davon als Fahrer eines Trucks, war ich zu dem Schluss gekommen, dass es dort nur zwei Jahreszeiten gibt: heiß und windig oder kalt und windig. Alles andere sind nur Abwandlungen dieser beiden Zustände.
In dieser Nacht lag ich im Halbschlaf in meinem Bett und erkannte an der Stille den Wechsel der Jahreszeiten. Ich bilde mir ein, mich mit Stille ein bisschen auszukennen. Echte Stille ist mehr als die Abwesenheit von Geräuschen: Man kann sie spüren. Wenige Herzschläge zuvor hatte ein beständiger Wind die letzten Lautfetzen des Abends zerstreut: ein vorbeifahrendes Auto, Nachbarn, die hinter verschlossenen Türen redeten, irgendwo das Bellen eines Hundes – der übliche gedämpfte Lärm des Lebens um einen herum. Im nächsten Moment war nichts mehr zu hören, absolut nichts, als wäre die Wüste mitsamt ihren Bewohnern verschwunden und hätte nichts zurückgelassen als ein gleichgültiges, sternenloses Licht.
Um vier Uhr früh, dem Beginn meines Arbeitstags, stand der Winter auf seinen Hinterbeinen und wartete. Für die Fahrt zum Logistikzentrum und das Beladen meines Trucks brauchte ich länger als üblich. Es war schon deutlich nach fünf, als ich endlich loskam und in der vormorgendlichen Dunkelheit vorsichtig durch leichten Schneefall über die vereiste Straße fuhr. Das Gebläse der Heizung lief auf Hochtouren, aber die bittere, trockene Kälte, die noch im Wageninneren herrschte, raubte meinem Körper die Wärme und riss mir die Haut auf, bis sie an einen ausgedörrten See erinnerte. Wie immer hielt ich kurz zum Tanken an. Den morgendlichen Ansturm auf die Tankstelle, sofern es dazu gekommen war, hatte ich verpasst, weil ich ein paar Minuten zu früh oder zu spät dran war. An den Zapfinseln stand niemand.
Cecil Boone leitete den Stop ’n’ Gone-Truck-Stop am Highway US 191, kurz hinter Price, Utah. Die unabhängige Tankstelle Stop ’n’ Gone stand auf einem Streifen aus Sand und Schotter und hatte das schäbige Aussehen eines Ladens, der außer billigen Preisen nicht viel zu bieten hat. Cecil war ein stämmiger, mürrischer Mittfünfziger. Als ich den kleinen Shop betrat, saß er hinter der Kasse. Seit mehr oder weniger acht Jahren kaufte ich dort fast täglich meinen Sprit und hatte Cecil bis zu diesem eisigen Oktobermorgen nicht ein einziges Mal lächeln sehen.
Es gibt sicherlich viele Gründe, warum ein Mensch lächelt. Die meisten tun es jeden Tag. Bei meiner Arbeit bekomme ich nicht oft ein Lächeln zu sehen und schenke auch nicht häufig eines, nicht mal mir selbst. So sollte es auch sein. Niemand möchte hochblicken und einen grinsenden Trucker sehen. Meiner Meinung nach hat dieser Anblick eine verstörende Wirkung auf jeden Autofahrer. Schnell ging ich alle möglichen Gründe durch, warum Menschen lächeln – aus Freude, Herzlichkeit, banaler Bosheit – aber mir fiel kein passender für Cecil ein. Im Laden waren nur er und ich – und sein Lächeln.
Ich bezahlte meinen Sprit.
»An der Acht hat jemand was für dich dagelassen«, sagte er.
Ich fragte, was es sei.
»Geht mich nichts an. Aber nimm es auf jeden Fall mit.«
Cecil ging zur Tür seines vollgestellten Büros. »Acht«, sagte er über seine Schulter hinweg. Bevor er die Tür hinter sich schloss, meinte ich, ihn kurz lachen zu hören. Vielleicht waren es auch nur Blähungen.
Mein Truck stand neben der Zapfinsel zwei. Die Acht befand sich am westlichen Ende der Tankstelle. Einen Moment lang schaute ich durch das Fenster in den wirbelnden Schnee. Bisher hatte er sich kaum irgendwo angesammelt. Nur eine dünne weiße Schicht auf Eis. Feine Flocken tanzten um die hohen Bogenlampen, als wäre es eine Szene aus einer kargen Schneekugel. Draußen hielt ich kurz an und spähte in Richtung der Acht. Nichts zu sehen.
In meinem Fahrerhaus wurde es langsam warm. Mir war danach, loszufahren und meinen Arbeitstag zu beginnen. Wer würde an einer Tankstelle etwas für mich dalassen? Wichtig oder wertvoll konnte es nicht sein, sonst hätte derjenige es nicht draußen abgelegt. Vielleicht war es nur ein Scherz. Einen Scherz konnte ich ertragen. Jederzeit. Später. Im ruhelosen Schneetreiben hinter der Windschutzscheibe sah ich Cecils Lächeln auftauchen und verschwinden. Und dieses Lächeln, wenn man es denn so nennen wollte, schien mich herauszufordern, an der Acht vorbeizufahren und einen kurzen Blick auf das Dagelassene zu riskieren. Doch ganz gleich, was Cecil gesagt hatte, ich fühlte mich nicht verpflichtet, es auch mitzunehmen.
Ich wendete den knapp zehn Meter langen Truck und näherte mich langsam der Tankinsel acht. Neben einem zerbeulten Mülleimer schien ein kleiner Haufen aus Kleidungsstücken zu liegen – nichts, das nicht hätte warten können. Aber ignorieren konnte ich es auch nicht. Vorsichtig lenkte ich den Truck zwischen den überdachten Zapfsäulen hindurch, die Seitenspiegel fest im Blick, damit ich nicht die Betonstützen streifte, die die Zapfsäulen vor Idioten in Wohnmobilen oder Miettransportern schützten und vor Jahren auch einmal vor mir, im verkaterten Zustand. Der Stoffhaufen bewegte sich und sandte ein Wölkchen Schnee in den Wind.
Ich legte die Handbremse ein, marschierte zurück zur Acht und rutschte dabei ein paarmal fast auf dem Eis aus. Ein großer weißer Hund lag zusammengerollt neben der Zapfsäule und hob seine lange Schnauze ein, zwei Zentimeter an, als ich näher kam. Seine blauen Augen musterten mich und bohrten sich in eine Stelle zwischen Schulter und Kopf – meinen Hals. Kein Knurren oder Zähnefletschen. Dieser Hund verstand sein Handwerk und meinte es ernst. Etliche Schritte vor ihm machte ich Halt und wir erörterten stumm die Situation.
Unsere Unterhaltung endete, als der Hund aufstand, sich streckte und den pudrigen Schnee aus seinem Fell schüttelte. Sein dicker Pelz blieb weiß. Nicht nur weiß, sondern von einem ungewöhnlich strahlenden Weiß, das das Tier im wirbelnden Schnee wie einen verschwommenen weißen Schatten wirken ließ. Auch war der Hund viel größer, als ich gedacht hatte, eine undefinierbare Mischung aus Husky und deutschem Schäferhund mit einem Schuss Wolf als Zugabe.
Zwei schwarze, mandelförmige Augen tauchten wie schüchterne Fische an die Oberfläche des weißen Fellsees. Hinter dem Rücken des Hundes blickten sie zu mir. Ein Kind.
Beim schnellen Rückmarsch zum Gebäude fiel ich zweimal hin. Die Sohlen meiner alten Cowboystiefel waren dünn wie Papier und ebenso glatt. Ein Kind im Schneesturm auszusetzen, war die Art von Scherz, die Cecil ein Lächeln entlocken konnte. Das entsprach seiner Vorstellung von Humor. Hätte sich auf der Interstate eine Massenkarambolage mit fünf Autos oder ein furchtbarer Unfall mit Fahrerflucht ereignet, er hätte sich vor Lachen nicht mehr eingekriegt. Humpelnd erreichte ich die Tür. Sie war verschlossen.
An der Scheibe hing ein hingekritzeltes Schild auf Augenhöhe, meiner Augenhöhe, einsfünfundneunzig in Stiefeln. ZURÜCK IN ZEHN MINUTEN. Irgendwie bezweifelte ich, dass Cecil zurückkehren würde, solange ich in Sichtweite war. Ich musste meinen Zeitplan einhalten. Er wusste, ich würde keine zehn Minuten warten. Nicht mal fünf.
Ich hämmerte gegen die Tür und brüllte seinen Namen, dann trat ich unten gegen die schwere Scheibe. Zur Belohnung rutschte ich aus und fiel hin. Wenn Cecil sich drinnen aufhielt, würde er sich nicht mehr blicken lassen. Vorsichtig ging ich zur Acht zurück. Der Hund hatte sich nicht gerührt; das Kind kauerte noch hinter ihm. Er machte einen Schritt zur Seite und ließ mich das Kind, einen kleinen Jungen, sehen. Es war die Erlaubnis, mich zu nähern.
Der Junge mochte fünf oder sechs sein, hatte braune Haut und glattes, schwarzes Haar mit Topfschnitt. Er trug nur Jeans und ein weißes T-Shirt. Seine Turnschuhe sahen neu aus und hatten hinten diese roten Blinklichter. An seinem Shirt steckte ein Zettel.
Ohne Hund oder Jungen aus den Augen zu lassen, trat ich einen Schritt näher. Keiner von beiden schien vor mir Angst zu haben, obwohl sie mich aufmerksam beobachteten. Der Junge schaute mir die ganze Zeit in die Augen, selbst dann noch, als ich mich bückte und den Zettel, auf dem vermutlich eine Nachricht für mich stand, von seinem Shirt löste.
BITTE, BEN. RIESENÄRGER. MEIN SOHN. NIMM IHN HEUTE. ER HEIßT JUAN. ICH TRAUE NUR DIR. SAG KEINEM WAS. PEDRO
Die Nachricht war in Großbuchstaben geschrieben, mit schwarzem Filzer, der durch das dünne Papier durchgeblutet war. Ein Kassenzettel. Kein Wort über den Hund, ohne den der Junge womöglich erfroren wäre. Ich las den Zettel mehrmals.
Pedro war der Mann, der beim Truck-Stop die Reifen aufzog. Die Werkstatt befand sich in einer Halle hinter der Tankstelle, dort, wo der poröse Asphalt in Schotter überging. Wir waren so gut befreundet, wie es Fremde, die ab und zu miteinander zu tun haben, eben sind: Ich kannte seinen Namen, er meinen. Viel mehr nicht.
Im letzten Monat hatte ich neue Reifen gekauft. Beim Stop ’n’ Gone bekam ich Markenreifen zum Spottpreis. Pedro und ich hatten den üblichen Mist gelabert. Seinen Sohn hatte er nie erwähnt. Kaum etwas über ihn zu wissen, hatte mich nie gestört. Warum er sich, wenn er Ärger hatte, ausgerechnet an mich wandte und mir sogar seinen Sohn anvertraute, konnte ich mir nicht erklären. Und von seinem Vertrauen fühlte ich mich nicht sonderlich geschmeichelt.
Mir blieben zwei Möglichkeiten: Die Cops holen oder den Jungen mitnehmen. Wenn ich bei der Polizei anrief, musste ich hier auf sie warten. Sie würden mir Fragen stellen, die ich größtenteils nicht beantworten konnte, und auch Cecil, sofern er sich überhaupt zeigte, wäre keine große Hilfe. Sagt man zu einem Cop »ich weiß es nicht«, hört er sowieso nur »dir sage ich es nicht«, was nach meiner Erfahrung immer zu langen, unerfreulichen Unterhaltungen führt.
Den Jungen bei Cecil zu lassen, kam nicht infrage. Wie ich vermutete, hatte Pedro ihn drinnen abgegeben und das kranke Arschloch Cecil hatte ihn und den Hund nur so zum Spaß in den Schneesturm hinausgeschickt. Doch die Alternative hatte einen Haken und einen gewaltigen noch dazu: Ich wollte nicht den ganzen Tag in meinem Truck ein Kind hüten – oder seinen Hund, den ich unter gar keinen Umständen mitnehmen würde.
Ich riss einen Fensterwischer aus seinem Eimer und schleuderte ihn durch das Schneetreiben in Richtung Büro. Eine alberne Geste. Der Wischer verfehlte das Gebäude um Längen und fiel auf den Boden. Die Schneedecke vor Zapfinsel sechs fing ihn geräuschlos auf.
Vorsichtig hob ich den Jungen hoch, trug ihn zu meiner Fahrerkabine und öffnete die Tür. Der Hund huschte an mir vorbei und machte es sich sofort im warmen Fußraum bequem. Ich setzte den Jungen auf den Beifahrersitz, griff mir zwei Handvoll weißes Fell und machte mich bereit, das Tier aus der Kabine zu befördern. Und ich hätte es auch getan, wären da nicht diese blauen Augen gewesen. Die Augen stellten mir eine einfache Frage: Wie gern möchtest du deine Hände behalten? Ich antwortete, indem ich das Fell losließ und die Tür zuwarf.
2
Ich brauchte mehrere Anläufe, um dem schmächtigen Juan den Sicherheitsgurt für Erwachsene umzulegen. Er schaute aus dem Fenster, wehrte sich aber nicht und sagte auch nichts. In seinem Alter war ich vermutlich genauso – ein Waisenkind, das ständig von einem Ort zum nächsten befördert wurde. Immer gab es andere Gesichter, andere Zimmer, andere Autos. Dabei lernte man, sich dem Leben anzupassen, indem man sich in sein Inneres zurückzog, wo man geschützt und unerreichbar war. Da Juan emotionslos auf mich, den Schnee und den Wind reagierte, fragte ich mich, was in seinem kurzen Leben schon alles passiert sein mochte und welcher Vater auf die Idee käme, sein Kind allein bei einem Truck-Stop zurückzulassen.
Die Ohren des Hundes zuckten. Er hob den großen Kopf.
Wenige Sekunden später kam Ginnys alter Nissan kurz vor meinem Truck schlitternd zum Stehen. Sie und ihr drei Monate altes Baby Annabelle bewohnten die andere Hälfte meines schäbigen Doppelhauses. Ginny, knapp achtzehn, unverheiratet und alleinerziehend, hatte zwei Jobs und belegte Wirtschaftskurse am College, fand aber trotzdem noch die Zeit, mir bei der Buchhaltung zu helfen. Vor ein paar Monaten hatte sie mein kleines Fuhrunternehmen gerettet. Und mich. Wie immer war sie auf einer Mission, zu spät dran und in Eile.
Sie sprang aus dem Auto und ich fragte mich, was verdammt noch mal so wichtig sein konnte, dass sie durch die verschneite Stadt gerast war, um mich abzufangen. Ihre lila-roten Haare waren noch stacheliger aufgestellt als sonst. Ich ließ mein Fenster herunter und fragte, was los sei. Sie gab keine Antwort, sondern zog die Babyschale vom Beifahrersitz ihres Autos. Ich bin selten der Schlaueste von allen, es sei denn, ich bin allein, was zum Glück oft vorkommt. Aber niemand musste erst ein Diagramm an die Tafel malen, damit ich eine Ahnung bekam, was Ginny vorhatte.
Ich stieß meine Tür auf. »Nein!«
Ginny ignorierte den Einwand. Die Babyschale in der einen Hand, eine große, pinkfarbene Tasche in der anderen, kam sie auf mich zu. Sie trug noch ihren schwarzen Flanellschlafanzug, der mit fluoreszierend weißen Totenschädeln verziert war. Im Licht der Truck-Stop-Lampen tanzten die Schädel auf ihren Armen und Beinen. Die silbernen Ringe in ihrer Nase, der Unterlippe und einer Augenbraue sandten hin und wieder einen Lichtblitz aus.
Ich stieg aus der Fahrerkabine und hob abwehrend die Hände. »Ich kann nicht.«
Ginny nutzte meine Körperhaltung sofort aus. Sie hängte die pink Tasche über meinen linken Unterarm und schob den Bügel der Babyschale über meinen rechten.
»Du musst«, sagte sie.
Zum ersten Mal seit Beginn unserer Freundschaft pflaumte ich sie an. »Gottverdammt, Ginny. Ich kann nicht mit einem Baby auf die 117 raus! Schon gar nicht bei diesem Wetter.« Ich nickte in Richtung meiner offenen Tür.
Ich wollte noch etwas einwenden, überlegte es mir dann aber anders, wie es jeder Mann tut oder tun sollte, bevor er sich mit einer Frau streitet, noch dazu mit einer, die ihm so wichtig ist wie Ginny mir. Wir waren Freunde, nur Freunde, und das bedeutete mir, wie vermutlich allen Waisen, sehr viel. Eigentlich reichte das Wort Freundschaft für unser Verhältnis nicht annähernd aus.
In wenigen Monaten war Ginny zu meiner Ersatzfamilie geworden, obwohl es Menschen mit schmutzigen Fantasien gab, die nicht müde wurden, uns eine andere Art von Beziehung zu unterstellen. Wenn ich derartiges Gerede hörte, meist gewürzt mit einem verwegenen Zwinkern oder einer weit schlimmeren Geste, platzte mir der Kragen. Gar nicht mal meinetwegen, sondern wegen Ginny.
Im Grunde war Ginny auch eine Waise. Wer ihre Mutter Nadine kannte, wusste, warum. Vor etwa zehn Jahren war ich kurz mit Nadine zusammen gewesen. Ginny war damals noch ein kleines Mädchen. Die Zeit mit Nadine war leider nicht kurz genug gewesen und ich war fast erleichtert, als ich sie eines Morgens mit einem UPS-Fahrer in der Kabine meines Trucks überrascht hatte. In Anbetracht der beengten Umstände hätte das, was sie dort vollführten, einen Platz in einem pornografischen Zirkus oder in einer Folge von Ripley’s unglaubliche Welt verdient gehabt.
Durch Zufall hatten sich die Wege von Ginny und mir mitten in der Nacht im 24-Stunden-Walmart von Price wieder gekreuzt. Das war im Mai gewesen und sie hatte dort die Nachtschicht geschoben. Damals war sie siebzehn, im siebten Monat schwanger und schlief in ihrem Auto. Sie bat mich, ihr zu helfen, einen Zweitjob zu finden, damit sie eine eigene Wohnung hätte, wenn das Baby kam. Ginny war von ihrer Mutter vor die Tür gesetzt worden und aus der Highschool geflogen, hatte aber noch schnell die Mittlere Reife abgelegt und besuchte seitdem einen BWL-Kurs am College.
Ich hatte noch nie jemanden mit so viel Biss wie Ginny kennengelernt. Denn als wäre das nicht alles schon genug, hatte sie sich, ihre Piercings und ihr ungeborenes Kind in Gefahr gebracht, um mich zu retten. Wenn das keine Familie war, dann wusste ich nicht, was den Namen sonst verdiente. Ich war ihr mehr als dankbar. Ich bewunderte sie und versuchte, sie auf meine Art zu beschützen. Das, was wir für den anderen waren und für einander empfanden, hätte allerdings keiner von uns offen zugegeben.
Mir kam die Idee, ruhig und sachlich mit ihr zu reden. »Schau dich mal um«, sagte ich. »Bei diesem Scheißwetter muss ich in die Wüste. Sicher ist ein Baby dort wohl kaum aufgehoben.«
»Ich hab heute Morgen zwei Prüfungen und die Babysitterin hat gerade angerufen. Sie ist krank. Meine Schicht beim Walmart beginnt um zwei. Du kannst und wirst auf Belle aufpassen. Sie ist bei dir auf der 117 sicherer aufgehoben als zu Hause allein in ihrem Bettchen.«
Ich befand mich zwischen Hammer und Amboss und Ginny war offensichtlich der Amboss.
»Ich hab keine andere Wahl. Du hast keine andere Wahl«, sagte sie und ging zu ihrem Auto zurück.
Kaum etwas ging mir mehr auf den Sack als der Spruch »du hast keine andere Wahl«. Mein Leben lang hatte ich mir diesen Satz in allen möglichen Varianten anhören müssen, oft wurde er mir von jemandem, der eine falsche Entscheidung getroffen und sich dadurch in eine blöde Situation gebracht hatte, an den Kopf geworfen. Meistens war er das letzte Mittel von Leuten, die mich davon überzeugen wollten, ein vergammeltes Sandwich sei besser als gar kein Sandwich.
»Bitte, Ginny, nicht«, rief ich. »Es gibt immer eine andere Lösung.«
»Dann finde sie. Hab keine Zeit, mit dir zu streiten.«
Typisch Ginny. Ich konnte reden, so viel ich wollte, nichts würde sie umstimmen. Es lag an mir, zu beweisen, ob ich der Situation gewachsen war. Ginny steckte in der Klemme und brauchte mich. Dass sie mich um einen Gefallen gebeten hatte, musste sie Mut gekostet haben. Wie sie es schaffte, mit achtzehn und allein, ihre Ausbildung, die Arbeit, das Baby und dazu noch meine Buchhaltung unter einen Hut zu bringen, war ein Rätsel und ein Wunder. Sie hatte mich bisher nie um Hilfe gebeten. Und obwohl sie mich schroff behandelt hatte, hatte sie es soeben doch getan. Nie hatte ich sie jammern hören. Und ich würde ihr den Gefallen tun. Das schuldete ich ihr. Sie war meine Freundin. Sie war meine Familie oder kam dem so nahe wie wohl kein zweiter Mensch jemals wieder. Ich war ihre erste, beste und einzige Wahl und jeder, der ein Hirn hatte und etwas taugte, hätte sich über das Vertrauen gefreut.
Ginny ließ den müden alten Motor des Nissans aufheulen, die Kolben protestierten mit lautem Knacken und kotzten blauen Qualm in die Luft. Das Auto bewegte sich nicht. Ginny saß hinter dem Lenkrad. Als sie die Tür wieder öffnete, blieb sie einen langen Augenblick sitzen und starrte mich an, bevor sie ausstieg. Sie ließ den Motor im Leerlauf, ging langsam auf mich zu und lächelte müde.
»Ben, ich weiß nicht mehr weiter.« Sie legte das Kinn an meine Brust. »Bin so fertig, kann nicht mehr denken.«
Dass es ab und zu so sein musste, hatte ich zwar geahnt, aber bisher nie miterlebt. Diese Seite hatte sie mir nie gezeigt. Sie zeigte sie niemandem, vermutlich nicht mal sich selbst. So war sie eben. So ging sie alles im Leben an. Augen geradeaus. Keine Gefangenen. Sie gab kein Pardon und bat auch selbst um keines.
»Willst du einen Tipp?«
Sie ließ den Kopf an meiner Brust und seufzte tief in mein Holzfällerhemd. »Letztens bin ich bei der Arbeit eingeschlafen. Mit dem Gesicht auf einem Ramsch-Regal, das ich eigentlich auffüllen sollte, und hab geschnarcht wie ein Schwein. Als ich aufgewacht bin, standen ein paar ältere Kolleginnen um mich rum, damit der Chef nichts merkt. Hätte mich sonst gefeuert. Die Frauen haben mich so lange schlafen lassen, wie es ging. War mir superpeinlich.«
»Dann tu, was du tun musst.« Ich hätte versuchen können, sie kurz zu drücken, ließ es aber bleiben.
Sie hob den Kopf von meiner Brust und schaute zu mir hoch. »Okay«, sagte sie. »Kneif die Arschbacken zusammen, Cowboy.«
Sie fuhr davon und ließ mich mit einem Baby und einer pinkfarbenen Wickeltasche zurück wie eine zum Tagesvater umfunktionierte Vogelscheuche auf einem Feld aus Asphalt.
Ich ging im Kopf meine extrem kurze Liste an Alternativen durch, als ein Tanklaster vom US Highway 191 abbog und auf den Truck-Stop zukam. Davey Owens fuhr die Strecke zwischen Salt Lake City und Moab. Er war ein schwer schuftender Mann mit Frau und drei Kindern. Davey lenkte seinen langen Laster im Schritttempo zu der Stelle, wo Ginny kurz zuvor noch geparkt hatte, und ließ sein Fenster herunter. Er lehnte sich auf dem nackten linken Unterarm nach draußen und musterte mich von oben bis unten.
»Hab das Gefühl, beim begehrtesten Junggesellen in Price hat sich was getan.«
Ich suchte krampfhaft nach einer passenden Antwort. Davey war grundanständig, ein trockener Alkoholiker und wiedergeborener Christ. Mir fielen nur drastische Beschreibungen ein, was er mit sich selbst anstellen sollte.
»Alles okay bei dir?«, fragte er.
Ich bejahte.
»Dann bringst du deine neue Familie besser schnell ins Warme.«
Sein Laster fuhr wieder an. Davey ließ das Fenster kopfschüttelnd hoch. Ich schüttelte meinen ebenfalls, ob aus Frust oder Fassungslosigkeit, hätte ich nicht sagen können – vermutlich war es eine Mischung aus beidem, die sofort in Resignation umschlug.
Die leere Straße vor mir erstreckte sich ein paar Hundert Meter weit in die ungefähre Richtung von Moab und verschwand dann in einer Wand aus wirbelndem Weiß, eingehüllt in Dunkelheit. Wie ein Tunnel, in dem sich über hundert Meilen das gleiche Bild zeigen würde. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich nicht.
Hinter dem Fahrersitz befand sich ein Klappsitz und der Junge und sein Hund schauten geduldig zu, wie ich mich mit der Babyschale abmühte, bis ich sie mit dem Beckengurt einigermaßen festgezurrt hatte. Annabelle richtete das runde weiße Gesicht und die blauen Augen fest auf mich und bedachte mich, wie ich mir einbildete, mit einem schiefen Grinsen, das Zufriedenheit und Triumph ausdrücken mochte. Während ich eine Decke über das Baby legte und an den Seiten feststeckte, fiel mir der Spruch eines Autors ein: In einem Jungen sieht man nur selten die Andeutung des Mannes, aber in einem Mädchen immer den Geist der Frau. Annabelle war ganz klar die Tochter ihrer Mutter.
Ich musste wieder an die vor uns liegende Straße denken und an das Wetter. Ein schlauerer Mensch mit weniger Erfahrung hätte vorab den Wetterbericht gecheckt. Ich nicht. Mir war klar, ich hätte mindestens hundert verschiedene Vorhersagen gebraucht, eine für jede Meile der zweispurigen Straße, und noch hundert weitere für den Rückweg. Wahrscheinlich würde ich von allem, was Straße und Himmel zu bieten hatten, etwas zu sehen bekommen – Schnee, Eis, Regen, gefrierender Regen, dazu ein Mix aus Sonne und Wolken, tief oder hoch, dunkel oder hell, und gelegentlich sogar alles auf einmal. Irgendwo auf der Strecke erwartete uns vielleicht sogar schönes Wetter – für ein, zwei Minuten.
Mein Weg über die State Road 117 führte über hundert Meilen durch das Herz von Nichts, bevor er in dem sterbenden ehemaligen Bergbaustädtchen Rockmuse, Einwohnerzahl: 1.344, endete. Ich stieg auf mein Trittbrett und versuchte, mit den Augen ein Loch in den wirbelnden Schnee zu bohren, um abzuschätzen, was der Tag für mich bereithielt. Es war so sinnlos, als wollte ich die Zukunft voraussagen. In Wahrheit schindete ich nur Zeit, weil ich auf eine Lösung für mein Problem hoffte. Leider war keine in Sicht. Sollte ich mit der Arbeit beginnen oder umkehren und nach Hause fahren? Unter den Füßen spürte ich das leichte Vibrieren des Dieselmotors, in der Luft hing der seltsam süßliche Geruch von Abgasen, eingeschlossen von Schnee und Kälte.
Schnell ging ich meine Frachtliste durch, um zu entscheiden, welche Lieferungen absolut nicht warten konnten. Einige Rancher und eine Wüstenratte waren auf die Wassertanks in meinem Trailer angewiesen. Die zweihundert Liter konnten über Leben und Tod entscheiden. Beurteilen konnte ich das nicht. Und dann war da noch die Post. Aber die spielte die geringste Rolle.
Ein paar Monate zuvor hatte ich von der US Mail mit etwas Glück den Auftrag bekommen, Sendungen zum Postamt von Rockmuse zu transportieren – allerdings wurde auf diesem Weg nie viel verschickt und niemand interessierte sich sonderlich dafür. Calvin Harper, der Filialleiter der Post, war ein kleiner, umgänglicher Endfünfziger. In der Gegend war er vor allem für seine selbst gebastelten Flugzeugmodelle berühmt, die an Drähten von jedem freien Fleck der Decke des kleinen Postamts baumelten. So viel Zeit blieb ihm bei seinem Job. Wasser. Post. Zehn Kanister Öl. Ersatzteile für ein altes Windrad. Obst und Gemüse für den Gemischtwarenladen von Rockmuse. Dazu allerlei Kleinkram. Wie so oft, kam es nur auf das Wasser an.
Sollte ich mit der Arbeit beginnen oder umkehren und nach Hause fahren? Ginny hatte gewusst, ich würde bei jedem Wetter in die Wüste fahren, ob mit oder ohne Annabelle. Sie hatte mich nicht gebeten, mir den Tag freizunehmen. Vermutlich war sie noch nicht mal auf die Idee gekommen. Und was den Vater des Jungen anging, wer konnte auch nur ahnen, was er sich verdammt noch mal dabei gedacht hatte? Ob es an meiner Arbeitsmoral, der Macht der Gewohnheit oder nur an meinem Dickkopf lag, ich würde auch heute das tun, was ich die Hälfte meines Lebens an fünf Tagen der Woche getan hatte: durch die Wüste fahren.
Ich stieg in die warme Fahrerkabine und wandte mich an meine Passagiere. »Das Wetter«, sagte ich, »mehr kann ich nicht vorhersagen.«
Belle gluckste und Juan starrte auf das rhythmische Hin und Her der Scheibenwischer. Der Hund drehte seinen großen Kopf zu mir und richtete die blauen Augen einmal kurz auf meine Kehle, bevor er die Schnauze wieder im Fell vergrub. Vielleicht war er zu faul, um auf mich loszugehen. Oder er hielt mich nicht für der Mühe wert. Womöglich war er auch nur neugierig, was passieren würde, wenn er mich am Leben ließ. Ich war es ebenfalls – deshalb übergab ich uns vier der Straße und kündigte unseren Aufbruch mit einem geflüsterten Shit an, während ich den ersten Gang einlegte und vorsichtig auf den vereisten US 191 auffuhr. Im besten Fall erwartete uns ein langer Tag, im schlimmsten ein langer, gefährlicher Tag, der uns, wenn überhaupt, erst am späten Abend nach Price zurückführen würde.
3
Mein Truck hatte keine Schlafkabine, weil ich in der Regel nur bei Tag fuhr und nicht auf den langen Strecken unterwegs war; ich konnte mir vom Geld, Platz und Gewicht her keine leisten und brauchte sie normalerweise auch nicht. Natürlich gab es Ausnahmen. In jedem Winter verbrachte ich eine Handvoll ungemütlicher Nächte, gelegentlich auch ein, zwei Tage, im Fahrerhaus und wartete, die Füße auf dem Armaturenbrett, auf den Wetterumschwung. Ginny und Pedro würden vielleicht eine lange Nacht verbringen mit ängstlichem Warten darauf, dass ich ihre verdammten Kinder zurückbrachte. Doch Schadenfreude verspürte ich bei dem Gedanken nicht.
Ich steuerte den Truck im sicheren Dreißig-Meilen-Tempo den steilen Anstieg hinter der Stadt hinauf und schlich die eisige Rutschbahn auf der anderen Seite im niedrigen Gang hinunter, bevor wir die Ebene der Wüste erreichten, auf dem es fünf Meilen geradeaus ging, ohne dass ich von der Strecke etwas gesehen hätte. Die Sichtweite betrug weniger als eine Viertelmeile. Ein Antippen der Bremsen konnte Ärger bedeuten. Der Wind frischte auf und rüttelte an den Seitenwänden des Trailers, als wären sie Segel aus Blech. Wie von unsichtbaren Händen geschoben, scherte der Truck einige Male zur Seite aus.
Weiter vorne konnte ich gerade noch die Rücklichter eines anderen Trucks erkennen und fuhr ihnen in sicherem Abstand hinterher. Alle paar Minuten nahm ich den Blick kurz von der Straße und schaute nach meiner Crew, aber alle wirkten entspannt, was gut war, schließlich war ich so angespannt, dass es für uns alle reichte.
Hinter uns waren keine Scheinwerfer zu sehen. Auch aus der anderen Richtung kam uns kein Fahrzeug entgegen. Eine späte Morgendämmerung schickte schräge Nadeln aus blassrotem Licht durch das schneeige Dach der Dunkelheit. Doch statt die Sichtweite zu verbessern, erschwerte das gebrochene, sich ständig wandelnde Licht den Blick in die Ferne noch.
Die Kreuzung von Highway US 191 und State Road 117 tauchte etwa nach der Hälfte der geraden Strecke auf, ohne dass ein gelbes Blinklicht darauf hingewiesen hätte. Es gab nur ein kleines, unbeleuchtetes Schild und eine keinen halben Meter breite zusätzliche Abbiegespur. Weil die Autos bergab schneller wurden und die entgegenkommenden Trucks vor der siebenprozentigen Steigung das Tempo anzogen, war das Linksabbiegen an dieser Stelle immer gefährlich.
Die Straße schien frei zu sein, aber auch das nahm mir nicht das mulmige Gefühl. An dieser Kreuzung ereigneten sich die schlimmsten Unfälle, mindestens einer im Jahr, und obwohl ich nie in einen verwickelt gewesen war, hatte ich die Unfallwracks einige Male kurz vor Eintreffen der Utah Highway Patrol erreicht. Eine Person, oft sogar mehr als eine, war immer bereits tot oder lag im Sterben, und ich hatte nie mehr machen können, als den Verletzten oder Sterbenden Mut zuzusprechen und in beiden Richtungen der Straße Warnfackeln in den Boden zu rammen.
Juan drehte den Kopf und starrte mich an, als hätte er meine Gedanken gelesen oder vielleicht sogar eine Collage der schrecklichen Bilder gesehen, die sich im Lauf der Jahre in mein Gedächtnis gebrannt hatten. Hoffentlich nicht. Auf diese Erinnerungen hätte auch ich gern verzichtet. Ich drosselte das Tempo fast auf Schrittgeschwindigkeit und blickte immer wieder in die Seitenspiegel. Nichts. Eine lange, stille Minute war das Knirschen des Eises unter den Reifen das einzige Geräusch. Niemand kam uns entgegen. Froh, allein auf der Straße zu sein, startete ich das Abbiegemanöver und setzte zum Überqueren der anderen Spur an.
Die niedrigen Scheinwerfer des Sattelzugs hatte ich nicht gesehen. Die rote Lichtleiste auf dem Dach der Fahrerkabine tauchte plötzlich am Rand meines Sichtfelds auf und zerschnitt die zerstreuten pinkfarbenen Pfähle aus Morgengrauen und Schatten. In dieser Schrecksekunde lächelte Juan zu mir hoch. Das Innere meiner Kabine füllte sich mit dem grellen Scheinwerferlicht des Sattelzugs, während sich der Abstand zwischen uns rasend schnell verringerte.
Selbst wenn der Fahrer uns gesehen hatte, konnte er nicht mehr auf die andere Spur ausweichen, um den Zusammenstoß zu verhindern. Falls er die Bremse auch nur antippte, würde sein Trailer zur Seite ausscheren und sich mitsamt Zugmaschine in einen zwanzig Tonnen schweren, dreißig Meter langen Schneepflug verwandeln, der alles in seinem Weg fortschieben würde.
Aus lauter Panik wollte ich beschleunigen. Das Gaspedal bis zum Anschlag durchtreten. Aber das hätte das Unvermeidliche nur noch schlimmer gemacht. Hätte ich Gas gegeben, wären die Räder durchgedreht. Dadurch wären wir langsamer geworden und die Chancen gestiegen, dass der Truck meine Beifahrerseite rammte. Wo Annabelle saß. Und Juan. Dem anderen Fahrer und mir blieb nur ein Ausweg – einfach weiterzufahren und dabei zu versuchen, den Aufprall auf den hinteren Teil meines Trailers zu lenken. Ich umklammerte das Lenkrad, während wir vorwärts krochen und der Sattelzug auf uns zuhielt.
Eine Sekunde. Zwei.
Unsere Kabine wurde von blendend weißem Licht erfüllt. Ein ohrenbetäubendes Geräusch setzte ein. Strapaziertes Aluminium zitterte kreischend an der gesamten Längsseite meines Trucks entlang, der Trailer schlingerte und kippte zur Seite. Sekundenlang hingen wir in der Luft, balancierten nur noch auf den linken Reifen. Dann setzte der Truck mit einem erschütternden Ruck wieder auf. Wir hatten Bodenhaftung und hielten weiter auf die 117 zu, allerdings in merkwürdig schrägem Winkel. Unsere Scheinwerfer zeigten nicht zur Straße, sondern nach Norden, hinein in den wirbelnden Schnee und die Stille der zerklüfteten Dunkelheit über dem Wüstenrand der 117. Ich kuppelte aus und der Truck kam langsam zum Stehen.
Die Anspannung wich aus meinem Körper, ich sackte nach vorne und legte die Stirn aufs Lenkrad. Stieß den gesamten angehaltenen Atem mit einem Mal aus. Unter meinem rechten Arm schielte ich zum Jungen hin. Juan saß stocksteif auf dem Sitz und zeigte ein breites, zahnlückiges Grinsen, das alles andere als Freude ausdrückte, sondern wie ein stummer, nach innen gerichteter Schrei wirkte. Der Hund hatte sich aufgesetzt und blickte zum Jungen. Ich bin kein Experte für Hunde oder Kinder. Wie ich vermutete, machte der Hund sich Sorgen – Sorgen um den Jungen und niemanden sonst.
Ich richtete mich auf und zwang mich zu einem, wie ich hoffte, beruhigenden Lächeln. Im schwachen Licht der Kabine schaute ich nach Belle. Sie lag sicher in ihrer Babyschale, wach und still und fast vergnügt, als hätte man sie soeben nur leicht geschaukelt.
»Wie wär’s, wenn wir alle mal kurz unsere Windeln checken?«, fragte ich. In den Gesichtern des Hundes und des Jungen rührte sich nichts. Ich öffnete die Tür und sagte: »Okay, ihr habt sicher nichts dagegen, wenn ich meine checke.« Bevor ich ausstieg, zog ich noch schnell die Handbremse und schaltete die Warnblinker an.
Die Sonne hatte sich inzwischen dazu durchgerungen, richtig aufzugehen. Außer Sichtweite des Jungen stellte ich mich vor die Seitenwand des Trailers und legte die Handflächen aufs kalte Blech. Eine wohlverdiente Minute lang stieß ich Flüche aus, vor allem an mich selbst gerichtet. Beim Truck-Stop hatte ich die Wahl gehabt und mich wie einige Menschen, die mich in der Vergangenheit zur Weißglut gebracht hatten, für die einfache, die falsche Lösung entschieden, weil ich mich nicht zwischen schwer und schwerer hatte entscheiden wollen. Die schwerere Entscheidung wäre es gewesen, wieder nach Hause zu fahren. Gedacht hatte ich natürlich daran. Aber wie viele Menschen, die vor einer schweren Entscheidung stehen, hatten sich meine Überlegungen fast nur darauf beschränkt, eine gute Ausrede zu finden, nicht das zu tun, was ich eigentlich hätte tun müssen. In meinem Kopf lief der Hätte-hätte-Refrain in Endlosschleife.
Ich ging zum Heck des Trailers, als ein weiterer entgegenkommender Sattelzug das schleichende Morgengrauen durchbrach. Beim kurzen Check meiner Ladebühne und des Rolltors stellte ich keinerlei Schäden fest. Aber ich wusste, der andere Truck hatte uns getroffen und das mit Wucht. Dann sah ich es, hoch oben in der hinteren rechten Ecke des Trailers – ein Andenken an unser Abenteuer mit beinahe tödlichem Ausgang. Halb vergraben in der Aluminiumhaut des Trailers stak, wie ein verchromtes Artilleriegeschoss, ein Seitenspiegel des Sattelzugs. Das unvermeidliche Zittern meiner Beine war der Beweis, wie knapp wir an einem unschönen Ende vorbeigeschrammt waren. Zwischen Leben und Tod hatten nur Masse, Tempo und ein, zwei Zentimeter entschieden. Erfahrung hilft dir, die richtige Entscheidung zu treffen. Und wenn du die falsche getroffen hast, rettet sie dir eventuell den dummen Arsch.
Der andere Fahrer hatte nicht angehalten, nachdem sein Sattelzug uns gestreift hatte. Es auch nur zu versuchen, wäre gefährlich gewesen. Vielleicht war er zu schnell gefahren. Vielleicht auch nicht. Wie ich vermutete, war er nicht übermäßig gerast. Wegen der Straßenverhältnisse und der geringen Sichtweite war es mir nur so vorgekommen. Er hatte einen Spiegel eingebüßt, das war alles. Ein Stück die Straße runter, wahrscheinlich beim Stop ’n’ Gone, war der Fahrer wohl rausgefahren und hatte den Schaden begutachtet. Und sich Gedanken gemacht. Vielleicht hatte er sogar die Unterhose gewechselt. Irgendwann würde ich mir eine Leiter holen und den Spiegel operativ entfernen müssen. Fürs Erste würde er bleiben, wo er war.
Ich ging zur Vorderseite des Trucks und blieb stehen, um mir den Sonnenaufgang über der Wüste anzusehen. In weniger als einer Minute legte sich das Schneetreiben und der Wind verebbte zu einem Flüstern, während sich blaue Felder zwischen den Wolken auftaten. Die weiße Weite des schneebedeckten Bodens dehnte sich vor meinen Augen mehr und mehr aus, bis die hundert Meilen entfernte nackte Felswand der mit Lichtsprenkeln übersäten Mesa sichtbar wurde, deren flache Kuppe noch von Wolken verhangen war, obwohl schon erste Sonnenstrahlen hindurchstachen. So bedrohlich die Wüste im Sommer auch wirken mochte, es war nichts verglichen mit der kalten, stillen Leere des Winters.
Während ich dort stand und in die öde Weite blickte, fühlte ich mich seltsam zu ihr hingezogen, als wäre sie eine launische Geliebte, die zwar ewige Leidenschaft versprach, nie aber echte Liebe. Dennoch war sie immer da und lockte und manchmal glaubte ich, es sei gerade diese Unveränderlichkeit, die mich anzog, gepaart mit dem schlichten Bedürfnis, etwas wissen zu wollen, das ich niemals wissen konnte, von dieser Landschaft, die sich aus nichts und niemandem etwas machte. Die Utah State Road 117 führte mitten durch ihr blutleeres Herz. Sie auf und ab zu fahren, war mein Job. In seltenen, wohlwollenden Momenten hielt ich das, was ich tat, sogar für wichtig. Ich machte den Job schon so lange, dass ich mir keinen anderen vorstellen konnte. Vielleicht wollte ich es auch gar nicht.
Ich drehte mich um, schaute zur Frontscheibe meines Trucks und dachte an meine Passagiere. Vielleicht hatte Ginny recht. Bei mir auf der 117 war Belle so sicher aufgehoben wie in ihrem Bettchen, vielleicht noch sicherer. Soweit ich es beurteilen konnte, traf das auch auf den Jungen zu. Auf mich in jedem Fall. In der Welt hier draußen, ganz gleich wie gefährlich und unbarmherzig sie war, so ohne Versprechen und Illusionen, fühlte ich mich sicherer als zu Hause in meinem Bett.
4
Bis auf einige Stellen mit Glatteis gab es auf den zehn Meilen bis zum Well-Known Desert Diner keine weiteren Störungen. Der seit Jahrzehnten schon nicht mehr geöffnete Diner war immer meine erste Station, gelegentlich auch meine letzte, selbst dann, wenn ich beim Besitzer Walt Butterfield nichts abzuliefern hatte. Wie üblich parkte ich meinen Truck am Rand des Schotterparkplatzes. Das »Geschlossen«-Schild hing in der Eingangstür und obwohl der Laden nie geöffnet hatte, wirkte er heute noch verlassener als je zuvor. Die beiden altmodischen Zapfsäulen mit den Glaszylindern erinnerten an obdachlose alte Männer, denen die Gesprächsthemen ausgegangen waren. In einer Ecke der Tür hingen die gefrorenen Fäden eines Spinnennetzes. Mit dem sich darin verfangenden frühen Sonnenlicht rundete es das Bild kompletter Einsamkeit wunderbar ab.
Wenn Walt noch der Alte war, dann war er schon seit Stunden auf den Beinen und widmete sich in der etwa fünfzehn mal dreißig Meter großen Stahlblechhütte hinter dem Diner seiner Sammlung alter Motorräder. Dass ich da war, wusste er. Selbst mit achtzig Jahren war sein sechster Sinn, der ihm die Anwesenheit von Besuchern verriet, so scharf wie eh und je und sagte ihm, ob er jemanden ignorieren oder wegschicken musste. Während der Fahrt hatte ich in einem Moment verantwortungsloser Feigheit und Verzweiflung überlegt, Walt zu bitten, sich den Tag über um Belle zu kümmern. Wahrscheinlich würde ich es nicht tun, ganz gleich, welche Ausflüchte mir auch einfallen mochten. Die Chance, dass Walt Ja sagte, war verschwindend gering. Allerdings war Walt immer für eine Überraschung gut und es bestand durchaus die Möglichkeit, dass er sich mir gegenüber einmal nicht wie ein Arschloch aufführte.
Belles Babyschale in der Hand, die Wickeltasche über der Schulter, nahm ich den Kiesweg zum Diner. Eine Windböe ließ das Spinnennetz erzittern und wehte ein paar Krümel trockenen Schnees vom Dach. Aus reiner Gewohnheit oder purem Aberglauben spähte ich immer erst durchs Fenster, um mich vom Inneren des Diners beruhigen und, seit Claires Tod, traurig begrüßen zu lassen.
Alles war in seiner zeitlosen Pracht erhalten und sah wohl noch so aus wie bei der Eröffnung im Jahr 1929. Damals hieß der Diner noch Oasis Café. Walt und seine koreanische Kriegsbraut Bernice hatten den Laden 1953 gekauft und umbenannt. Den Namen Bernice hatte sie selbst gewählt. Er war damals erst zwanzig, sie gerade sechzehn und sprach kein Wort Englisch.
Ich ließ meinen Blick durch den Laden wandern, über den blank gebohnerten Linoleumboden, die Chromeinfassung des Tresens, die lindgrünen Plastikbezüge der Stühle und Barhocker. Als ich die alte Wurlitzer-Jukebox an der hinteren Wand sah, setzte mein Herz ein, zwei Schläge aus. Nur eine Handvoll Monate zuvor, an einem Frühlingsabend im späten Mai, hatte ich Walt und Claire vor der Jukebox beim Tanzen überrascht. Jetzt stand ich da wie an jenem Abend und dachte an den endlosen, zärtlichen Tanz eines Vaters und seiner Tochter, auch wenn keiner von beiden die Verwandtschaft je zugegeben hatte.
Der Diner würde die beiden im ewig gleichen Zustand bewahren, so wie die Tische und Stühle, den einsamen Bestellzettel aus dem Jahr 1987 für das letzte für einen zahlenden Kunden zubereitete Essen und, wie ich vermutete, auch Claires Mutter Bernice, ihre Vergewaltigung, ihr langsames, stummes Sterben und Walts grausame Rache. Auf seine Art hatte der seit Jahrzehnten geschlossene Diner noch immer geöffnet, wenn auch nur für Erinnerungen und Geister.
Walt hatte ich erst gestern gesehen, einem Sonntag und zugleich dem letzten Septembertag. Ich hatte im einsamen Haus in Desert Home zu tun gehabt und mich um die Gräber in der kleinen Grotte im Hügel hinter dem Haus gekümmert. Das Wetter war noch immer sommerlich warm gewesen, nichts hatte darauf hingedeutet, dass der ausgedörrte Boden jemals Kälte erlebt hatte oder erleben würde. Bis hin zur roten Mesa war der Himmel tiefblau und wolkenlos gewesen.
Desert Home war eine nie fertiggestellte Siedlung, etwa eine Meile vom Diner entfernt. Sie war der Traum von Bernice gewesen, aber dieser Traum war 1972 mit ihr gestorben. Das bescheidene Musterhaus war das einzige, das jemals in Desert Home gebaut worden war, obwohl die leeren, sandigen Straßen noch immer da waren und Versprechungen machten. Walt hatte Claire und mir das Haus geschenkt, weil er gedacht – und ich gehofft – hatte, wir würden eines Tages heiraten. Seit Claires Tod hielt ich das Haus instand, obwohl dort niemand lebte und es vermutlich auch nie mehr jemand tun würde.
Unter der glühenden Sonne hatte ich den ganzen Tag über im Haus und bei den Gräbern geschuftet. Machte ich eine Pause, um mir den Schweiß von der Stirn zu wischen, suchte ich den Horizont ab, weil ich mir einbildete, Claires Cello oder ihr Lachen oder ihre Stimme zu hören, die mir jedes Mal hinterhergerufen hatte, wenn ich mich die Anhöhe zum Eingangstor von Desert Home hinaufgeschleppt hatte. Ein paarmal setzte ich mich auf den grünen Stuhl auf der Veranda, spähte zum Wind in der Traufe hoch und hörte nur, was ein Geist dem anderen zuflüsterte.
Am späten Nachmittag stand ich mit dem Rücken zur Grotte und beobachtete die Spur aus Sand und Staub, die sich wie ein rostiger Kratzer allmählich über die straßenlose, beige Weite im Süden zog. Kein Geräusch, nur die blutende pudrige Linie verriet, dass das Motorrad direkt auf mich zuhielt. Aber ich wusste, Walt würde wie in den Monaten zuvor in letzter Minute abdrehen. Ich war nicht der Einzige, den er mied, auch das Haus und die Gräber – von Claire und Bernice. Hätte er es gekonnt, er wäre der Wüste, die alle drei so geliebt hatten, aus dem Weg gegangen. Kurz bevor er mich erreicht hatte, wendete er und fuhr zurück zur 117, zu seinem auf ewig geschlossenen Diner. Wie lange ich danach noch auf dem Hügel gestanden hatte, hätte ich nicht sagen können. Walt war schon lange fort, als die bleigrauen Schatten der nahenden Dämmerung langsam über den Boden der Wüste krochen.
Belle machte sich bemerkbar, indem sie in der Babyschale zu strampeln begann. Der Pulverschnee war vom Innenhof zwischen Diner und Stahlblechhütte gefegt worden. Ich klopfte genau ein Mal gegen die Tür der Hütte. Zweimal zu klopfen, wäre nach Walts Meinung maßlos übertrieben gewesen. Vom letzten Mal, als Walt mir seine Meinung deutlich gemacht hatte, tat mir bisweilen heute noch der Kiefer weh. Wenn er zur Tür kommen wollte, würde er es tun. Belle und ich warteten, während die Kälte ihre Arbeit fortsetzte.
Als ich mich zum Gehen umdrehte, sah ich etwas, das ich noch nie gesehen hatte. Die Hintertür des Diners stand einen Spaltbreit offen. Ein mulmiges Gefühl beschlich mich. Es konnte viele Gründe geben. Dass Walt vergessen hatte, sie zu schließen, kam als einziger nicht infrage. Die Tür führte in die Küche. Ich umklammerte den Griff der Babyschale noch fester und drückte mit einer Schulter gegen die Tür, bis sie sich weit genug geöffnet hatte und ich hineinschlüpfen konnte. Die Küche lag im Schatten und soweit ich es beurteilen konnte, stand alles an seinem Platz. Es war kirchenstill. Walts winziges Schlafzimmer, die ehemalige Abstellkammer, befand sich rechts von mir. Auch diese Tür war leicht geöffnet. Mit einer Stiefelspitze schob ich sie langsam auf.
5
Es war nicht so, dass ich damit rechnete, Walt tot aufzufinden. Er war der robusteste Achtzigjährige auf dem gesamten Planeten, groß, stockgerade Haltung, dichtes weißes Haar und die schlanken Muskeln eines jungen Mannes. Natürlich wusste ich, dass Walt eines Tages, wenn auch nicht heute, sterben musste, aber von uns Jüngeren würde dann wahrscheinlich niemand mehr leben. Verstehen konnte ich nur nicht, was ihn Tag für Tag weitermachen ließ, allein mit seinen Erinnerungen, die die meisten wohl lieber vergessen hätten. Im Grunde fragte ich mich manchmal, was uns alle weitermachen ließ. Aber das war ein Gedankengang, dem ich nicht zu weit folgen wollte.
Die Hände hinter dem Kopf lag Walt vollständig bekleidet auf seinem schmalen Bett. Das einzige Licht fiel durch das kleine Fenster oben in der Wand. Ob Walts Augen geöffnet waren, konnte ich nicht erkennen.
»Glaubst du, ich hätte dich nicht klopfen gehört?«
Ich verneinte. »Die Tür hinten stand offen.«
»Du hältst eine offene Tür für eine Einladung, das Haus eines Mannes zu betreten?«
Walt hatte sich nicht gerührt. In dem kleinen Raum war es so kalt, dass unsere Wörter weiße Atemwölkchen in die Luft sandten. Ich gab keine Antwort, weil wir sie beide schon kannten und ich ihm gegenüber todsicher niemals zugegeben hätte, dass ich mir seinetwegen Sorgen gemacht hatte. Er hätte mir zum Dank für meine Sorge vielleicht wieder einmal die Meinung gegeigt.
»Verdammte Scheiße, Ben. Fährst du neuerdings den Schulbus?«
»Ginny hat mir heute ihr Baby aufgedrückt. Ein Notfall.«
Walt hatte die Hände noch immer hinter dem Kopf verschränkt und rührte sich nicht, während ich auf eine Erwiderung wartete und es im Zimmer langsam heller wurde, weil die Sonne die Rückseite des Diners erreichte. Kurz nach Claires Tod hatten Ginny und Walt sich einmal gesehen. Er wusste, wer sie war, und ich hatte sie ihm gegenüber gelegentlich erwähnt und von ihrem Baby und dem College erzählt und dass ich ihr die andere Hälfte meines Doppelhauses für wenig Geld vermietete, weil sie im Gegenzug meine Buchhaltung machte. Bei der einzigen Begegnung hatten beide kein Wort gewechselt, sondern sich taxiert wie Boxer im Ring. Falls die beiden jemals aufeinander losgingen, hätte ich nicht gewusst, auf wen ich wetten sollte.
Walt schwang die langen Beine aus dem Bett und stellte die Füße in den Stahlkappenstiefeln auf den blanken Boden. »Ich weiß, wessen Baby das ist.« Er nickte in meine Richtung, aber mehr nach rechts unten.
Juan war aus dem Truck geklettert und stand neben mir. Der Hund schob die Schnauze in die Lücke zwischen dem Jungen und meinem Bein. Wütend konnte ich auf das Kind nicht sein. In Wahrheit hatte ich es nämlich vergessen gehabt.
»Ist eine lange Geschichte«, sagte ich, obwohl das nicht stimmte. »Verdammt, Walt, hier drinnen ist es saukalt.«
Walt ging nicht auf meinen Wetterbericht ein. »Bin mir sicher, du findest irgendwen, der sie sich anhören will«, sagte er und stand auf.
Der Revolver hatte auf dem Nachttisch gelegen. Im dämmrigen Zimmer sah ich ihn erst, als Walt ihn hochnahm. Der Junge griff nach meinem Bein und als ich zu ihm herunterschaute, grinste er wieder auf diese merkwürdige Art, obwohl seine Augen alles andere als belustigt wirkten. Das arme Kind hatte wohl schon mal eine Waffe gesehen und wusste, was sie anrichten konnte. Es hatte Angst. Ich war mir ziemlich sicher, Walt würde nicht auf uns schießen, obwohl man sich bei Walt nie ganz sicher sein konnte. Bei manchen Bekannten ist das so. Er hielt den Revolver in der hohlen Hand, wie Wasser oder einen verwundeten Vogel. Ein merkwürdiger Anblick. Es war die Waffe, die er Claire gegeben hatte, damit sie sich vor wilden Tieren schützen konnte, obwohl wir alle gewusst hatten, dass er die Sorte Tier meinte, die auf zwei Beinen geht – und es war auch die Waffe, die sie ihm zurückgegeben hatte, an dem Tag, bevor sie von ihrem Ex-Mann Dennis halb erwürgt und in die Wüste verschleppt worden war.
Mit starrem Blick auf den Revolver sagte Walt: »Manchmal frage ich mich, ob Claire noch leben würde, wenn sie ihn behalten hätte.«
Auf diese Frage wusste auch ich keine Antwort. Keiner von uns beiden war damals dabei gewesen. Alles war vermutlich sehr schnell gegangen. Claire hatte die Waffe nicht aus Angst vor ihrem Ex-Mann zurückgegeben – sie hatte sie zurückgegeben, weil sie Angst vor sich selbst hatte, vor ihrem eigenen Temperament. Sie war überzeugt gewesen, Dennis würde niemals Gewalt anwenden. Ich hatte es besser gewusst. Walt ebenfalls. Wenn er im falschen Moment provoziert wird, kommt bei jedem Menschen eine gewalttätige Ader zum Vorschein, vielleicht gerade bei denjenigen, die sich selbst nicht für gewalttätig halten. Außer Walt und mir wusste niemand, was Claire und ihrem Cello zugestoßen war, und obwohl seitdem ein paar Monate vergangen waren, hatte bis jetzt keiner von uns dem anderen gegenüber auch nur ihren Namen erwähnt.
Walt legte den Revolver wieder auf den Nachttisch und stand nach zwei Schritten vor mir. Der Hund und der Junge wichen zurück. Walt zog Belle behutsam die Decke vom Gesicht. Blaue Augen schauten in blaue Augen. »Ben, du bist ein Idiot.« Er flüsterte fast.
»Hatte keine andere Wahl«, sagte ich, ohne nachzudenken.
Walt erwiderte nichts, aber das musste er auch nicht. Er schaute zum Jungen, zum Hund. »Die Heizung ist kaputt.« Er schob sich an uns vorbei und ging nach draußen. Ich hörte, wie die Tür der Stahlblechhütte geöffnet und wieder geschlossen wurde.
Die Heizung sprang an und blies durch eine Öffnung über unseren Köpfen warme Luft ins Zimmer. Ich marschierte mit meiner kleinen Truppe aus dem Diner, ließ die Tür offen und blieb ein paar Sekunden vor der Hütte stehen und dachte an den Mann darin, an den Revolver, den Diner und die offensichtlich funktionstüchtige Heizung. Die paar Sekunden waren viel zu lang. Walt war mir immer noch ein Rätsel und einige Rätsel musste man nicht lösen, konnte man niemals lösen. Das Beste war, sie einfach hinzunehmen.
Aus dem Augenwinkel sah ich den Hund ebenfalls zur Hütte schauen. Mit der freien Hand wuschelte ich Juan durchs Haar und sagte zum Hund: »Hast dir da drinnen ja fix den eigenen Hintern gerettet.« Eine Sekunde lang wirkte der Hund peinlich berührt, dann senkte er den Kopf.
Zwischen Walt und mir hatte es eine stillschweigende Übereinkunft gegeben, nie über Claire zu reden. Seit heute schien sie nicht mehr zu gelten und ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, nur, dass ich nicht darüber nachdenken wollte. Die Trauer um Claire teilten wir im Stillen, uns verbanden die gemeinsamen Erinnerungen und die irreführende Inschrift auf ihrem Grabstein, der sich neben dem ihrer Mutter Bernice befand, vom Diner weniger als eine halbe Meile entfernt. Dass Walt mich als Idioten bezeichnet hatte, konnte sich auf alles Mögliche beziehen. Seit Jahren behauptete er schon, ich würde nur Loser verhätscheln, wenn ich mit dem Truck die Wüstenratten und Exzentriker entlang der 117 mit dem Lebensnotwendigen belieferte. Natürlich erwähnte er nie, dass er in seinem Well-Known Desert Diner selbst an der 117 wohnte. Er war der König der 117, der Herrscher der Einsamkeit und lebte so fernab von allem, dass selbst ich es nicht begreifen konnte. Aber wenn man die Verluste gegeneinander aufrechnete, war er in einer Wüste voller Verlierer vielleicht der unangefochtene Meister.
Nachdem ich Belles Babyschale wieder auf dem hinteren Sitz festgeschnallt hatte, bedeutete ich Juan und dem Hund, ebenfalls einzusteigen. Der Hund kam der Aufforderung nach. Juan zeigte auf seinen Schritt. Das war eindeutig. Er musste pinkeln. So wie der Morgen bisher verlaufen war, hatte ich meinen üblichen Kaffeekonsum zwar stark eingeschränkt, aber auch ich verspürte das Bedürfnis, die Wüste zu wässern. Ich gab Juan und dem Hund ein Zeichen, mir zu folgen, und überquerte die leere Straße.
Der Hund schnupperte an einem Wacholderbusch und hockte sich hin, um sein Geschäft zu erledigen. Juan schaute zu mir hoch, dann zum Hund und zog seine Jeans herunter. Ich nahm mir fest vor, ihm so schnell wie möglich eine Jacke oder einen Pulli zu besorgen. Obwohl ich etliche Schritte entfernt stand, drehte ich mich aus Höflichkeit um und knöpfte mir die Hose auf, während ich die Aussicht in Richtung Süden genoss.
Es war das erste Geräusch, das ich von dem Hund hörte, und das zweifache scharfe Kläffen hallte durch die Wüste. Juan hatte sich hingehockt und zuerst dachte ich, ich hätte seine Geste falsch gedeutet. Der Hund bellte noch einmal und Urin schoss im dampfenden Nebel auf den gefrorenen Boden. Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, was gerade geschah. Als der Groschen fiel, schaute ich instinktiv weg – Juan war ein Mädchen. Ein Mädchen? Über Frauen wusste ich nicht viel, über Mädchen noch weniger, aber immerhin so viel, dass ich über die Straße rannte, eine Rolle Klopapier aus dem Truck fischte und zurücklief. Mit abgewandtem Gesicht reichte ich ihr die Rolle. Eigentlich hatte sich nicht viel verändert, doch mir kam es vor, als wäre mit einem Mal alles anders.
Ich hatte keine Ahnung, wie lange sie den Drang schon zurückgehalten hatte. Dem stetigen Strömen nach eine halbe Ewigkeit. Für einen Jungen den Babysitter zu spielen, war eine Sache, aber dasselbe für ein Mädchen, die Tochter eines Fremden, zu tun, etwas völlig anders. Vielleicht ging es Frauen da genauso. Keine Ahnung.
Sie brachte mir die Klorolle und hielt das feuchte, benutzte Papier fast damenhaft zwischen Daumen und Zeigefinger von sich weg. Mit einer Stiefelspitze bohrte ich ein Loch in den Schotter und schob es wieder zu, nachdem sie das Papier hineingeworfen hatte.
Ich ging auf ein Knie und fragte sie leise nach ihrem Namen. Der Hund saß neben ihr, den Kopf etwa auf einer Höhe mit ihrem. Vielleicht war auch er überrascht von der Neuigkeit, obwohl ich mir das nicht vorstellen konnte. Sie gab keine Antwort, sondern richtete die großen, dunklen Augen auf die Wüste.
Mit einem Mal setzte sie sich in Bewegung und ging schnell auf den schmalen Pfad zu, der zu den Gräbern und dem Musterhaus führte. Der Hund folgte ihr nicht. Sie wurde schneller, bis sie fast lief, jeder ihrer Schritte war so sicher, als wäre sie den Weg schon ihr Leben lang gegangen, was natürlich nicht sein konnte. An seinem Ende lagen nur ein toter Traum und Erinnerungen aus vierzig Jahren, die mit ihr nichts zu tun hatten.
Nach wenigen Schritten hatte ich sie eingeholt. Behutsam hob ich sie hoch und trug sie den Pfad zurück und über die 117 zum Truck.
Ich war mir verdammt sicher, Pedros Zettel richtig gelesen zu haben – dort stand »Sohn«. Juan – ein Jungsname. Und jetzt befand ich mich mit einem kleinen Mädchen auf einer leeren Straße mitten im Nirgendwo. Pedro hatte etwas von »Riesenärger« geschrieben und ich konnte mir nicht mal ansatzweise vorstellen, in was für einer Scheiße er stecken musste, um seine kleine Tochter einem fremden Menschen – noch dazu einem Mann – anzuvertrauen. Ich war mir ziemlich sicher, nicht pervers veranlagt zu sein, und einigermaßen zuverlässig war ich auch, aber das hatte Pedro nicht wissen können. Ich hätte eine Münze werfen können, ob ich eher wütend oder ängstlich war, aber als die Wut verflogen war, wusste ich, die Angst würde sich nicht legen – Angst um das kleine Mädchen und um Pedro noch dazu.
6
Auf der 117 waren es etwa fünfundzwanzig Meilen bis zu meiner nächsten Station, dem Haus von Dan Brew, einem ehemaligen Grassodenhaus, wie sie in der Prärie hießen. Man hatte sie aus abgetragener, getrockneter Erde errichtet und mit einem Dach aus Wildgräsern versehen. Dans war um die vorletzte Jahrhundertwende von Siedlern erbaut worden und er hatte außer einem Carport aus Blech und einer billigen Solaranlage nichts hinzugefügt. Allerdings hatte er einen Tunnel in den Hügel dahinter gegraben und sich so zwei zusätzliche Zimmer geschaffen.
Drinnen gab es keine sanitären Anlagen, Dan musste draußen aufs Plumpsklo gehen und auf fließendes Wasser verzichten. In einer Zisterne sammelte er Regenwasser. Früher hatte es einen Brunnen gegeben, aber der war vor über einem Jahr ausgetrocknet. Im Sommer kalt, im Winter warm – einfacher als in einem Grassodenhaus konnte man in der Wüste nicht wohnen. Den Rauch, den das Ofenrohr aushustete, konnte ich von der gesamten Holperpiste aus sehen, die über eine halbe Meile in Serpentinen um zwei niedrige Hügel herumführte und vor Dans Tür endete.
Wie den meisten Leuten, die abseits der 117 wohnten, wäre es Dan vermutlich nicht aufgefallen und sowieso egal gewesen, wenn die Welt untergegangen wäre. Seit unserer ersten Begegnung hatte er mehrmals geheiratet und sich wieder scheiden lassen und war, soweit ich wusste, inzwischen bei Ehefrau Nummer sieben oder acht angelangt. Offenbar gehörte Dan zu den Menschen, die ihre Einsamkeit gern mit einem Partner teilen, und obwohl es einen anscheinend endlosen Nachschub an Frauen gab, die aus der Großstadt kamen und die Abgeschiedenheit und Schönheit der Wüste für romantisch hielten, hatten doch alle über kurz oder lang genug von der täglichen Dosis Schönheit und Abgeschiedenheit. In der Regel fing es damit an, dass die Gattin häufiger in die Stadt fahren wollte, und endete damit, dass sie eines Tages in die Stadt fuhr und nicht mehr zurückkam.