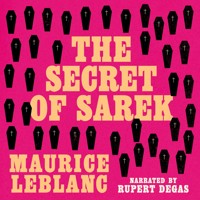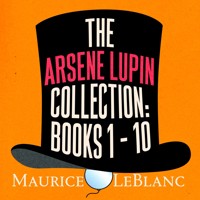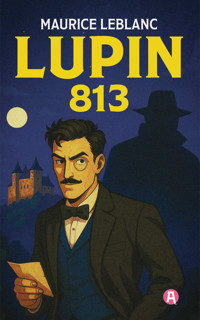
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: aionas verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Band 4 der großen Lupin-Collection - ein tödlicher Code, ein politisches Komplott und Arsène Lupin im Kampf gegen seinen finstersten Gegner
Ein Mord, der Europa erschüttert
Ein hochrangiger Diplomat wird mitten in Paris ermordet - scheinbar ohne Motiv, ohne Spuren. Doch hinter dem Verbrechen verbirgt sich ein geheimer Code: 813. Als die Ermittlungen ins Stocken geraten, tritt Arsène Lupin auf den Plan - nicht als Dieb, sondern als Ermittler in eigener Sache. Denn dieser Fall reicht weit über die Grenzen der üblichen Gaunereien hinaus: Es geht um Macht, Verrat und ein Netzwerk, das bis in die höchsten politischen Kreise reicht.
Ein Gegner, der alles in Frage stellt
Noch nie war Lupin einem Gegner begegnet, der ihm so gefährlich werden konnte. Der geheimnisvolle Drahtzieher hinter dem Code 813 ist nicht nur intelligent und skrupellos - er kennt Lupins Methoden, seine Schwächen, vielleicht sogar seine wahre Identität. Was folgt, ist ein raffiniertes Duell im Schatten der Öffentlichkeit: ein Spiel voller Täuschungen, Masken und doppelter Böden. Für Lupin steht mehr auf dem Spiel als je zuvor. Zum ersten Mal droht er, die Kontrolle zu verlieren.
Ein Roman an der Grenze zwischen Krimi und Thriller
"813" markiert einen Wendepunkt in Maurice Leblancs Werk: Der Ton ist ernster, die Struktur komplexer, die Bedrohung realer. Lupin wird hier nicht nur als Meisterdieb gezeigt, sondern als Mensch, der gezwungen ist, sich mit seiner Vergangenheit, seinen Grenzen und seinem moralischen Kompass auseinanderzusetzen. Der Roman verbindet klassische Kriminalspannung mit Elementen eines politischen Thrillers - überraschend modern, dicht erzählt und voller psychologischer Tiefe.
Ein Meilenstein der Lupin-Collection
Mit "813" erscheint der vierte Band der neu gestalteten Lupin-Collection - einer Reihe, die Maurice Leblancs Romane behutsam modernisiert und neu zugänglich macht. Arsène Lupin erscheint in diesem Roman, wie man ihn noch nie gesehen hat - im gefährlichsten Spiel seines Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Maurice Leblanc
Lupin
813
Ein Kriminalroman
Lupin-Collection Band 4
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1. Die Tragödie im Palace Hotel
Kapitel 2. Das Etikett mit dem blauen Rand
Kapitel 3. Monsieur Lenormand eröffnet seine Kampagne
Kapitel 4. Prinz Sernine am Werk
Kapitel 5. Lenormand bei der Arbeit
Kapitel 6. Lenormand gibt nach
Kapitel 7. Parbury-Ribeira-Altenheim
Kapitel 8. Der olivgrüne Gehrock
Kapitel 9. „Palast Santé“
Kapitel 10. Lupins großer Plan
Kapitel 11. Karl der Große
Kapitel 12. Die Briefe des Kaisers
Kapitel 13. Die sieben Halunken
Kapitel 14. Der Mann in Schwarz
Kapitel 15. Die Karte Europas
Kapitel 16. drei Morde des Arsène Lupin
Epilog. Der Selbstmord
Orientierungsmarken
Cover
Vorwort
Mit 813 legt Maurice Leblanc einen der dunkelsten und zugleich komplexesten Romane der Lupin-Reihe vor. Hier steht nicht mehr nur das raffinierte Spiel zwischen Verbrechen und Gerechtigkeit im Mittelpunkt – sondern eine tiefere Auseinandersetzung mit Identität, Macht und moralischer Verantwortung. Arsène Lupin, der bislang unangefochtene Meister der Täuschung, gerät in ein gefährliches Netz aus internationaler Verschwörung, politischem Einfluss und persönlicher Bedrohung.
Der Titel 813 verweist auf ein Mysterium, das politische Brisanz birgt und Frankreichs Stabilität gefährden könnte. Doch je weiter Lupin in die Ermittlungen eintaucht, desto klarer wird: Sein Gegner ist kein gewöhnlicher Krimineller, sondern ein Schatten aus den höchsten Kreisen – ein Mann, der Lupins Methoden kennt, ihm ebenbürtig scheint und ihn auf eine ganz neue Art herausfordert.
In diesem Roman zeigt Leblanc seinen Helden verletzlicher, getriebener und vielschichtiger als je zuvor. 813 ist kein klassisches Rätselspiel mehr, sondern ein psychologischer Thriller mit doppeltem Boden. Gleichzeitig bleibt der Roman seiner Linie treu: mit raffinierten Wendungen, einer dichten Atmosphäre und einem Meisterdieb, der nie ganz zu fassen ist.
813 markiert einen Wendepunkt im Lupin-Kosmos – nicht nur inhaltlich, sondern auch stilistisch. Wer Lupin bisher nur als eleganten Dieb mit Charme kannte, wird hier eine neue, tiefere Facette entdecken. Leblanc hebt seine Figur auf eine neue Ebene – und liefert einen Kriminalroman, der ebenso spannend wie überraschend modern wirkt.
Kapitel 1. Die Tragödie im Palace Hotel
Monsieur Kesselbach blieb im Eingang des Salons stehen, packte Chapmans Arm und flüsterte: „Jemand war hier drin.“
„Unmöglich, Monsieur. Sie haben selbst aufgeschlossen. Der Schlüssel war die ganze Zeit in Ihrer Tasche.“
„Und trotzdem. Diese Tasche da – sie war geschlossen. Jetzt steht sie offen.“
„Sind Sie sicher, dass Sie sie zugemacht haben? Außerdem: Es ist doch nur Kleidung drin.“
„Weil ich vorher die Brieftasche rausgenommen habe. Wenn nicht … Nein, Chapman. Hier war jemand.“
Er griff zum Telefon an der Wand. „Hier spricht Kesselbach, Suite 415 … Fräulein, verbinden Sie mich bitte mit der Kriminalabteilung. Nummer 822.48 … Ich warte … Guten Tag. Ich möchte Monsieur Lenormand sprechen. Er sagte, ich könne ihn direkt anrufen … Nicht da? … Inspektor Gourel? Sie waren gestern auch da, richtig? Gut. Dasselbe ist wieder passiert. Jemand war in meiner Suite. Wenn Sie sofort kommen, finden Sie vielleicht noch Spuren … In ein, zwei Stunden? Gut. Danke. Fragen Sie nach Suite 415.“
Rudolf Kesselbach – auch „König der Diamanten“ oder „Lord vom Kap“ genannt – verfügte über ein Vermögen von rund zwanzig Millionen Pfund. Seit einer Woche wohnte er im vierten Stock des Palace Hotels. Drei Zimmer: Salon und Schlafzimmer zur Avenue, Chapmans Zimmer zur Rue de Judée.
Nebenan: fünf Räume für Madame Kesselbach, die noch in Monte Carlo war.
Kesselbach ging im Zimmer auf und ab. Groß, sonnengebräunt, noch jung. Die blassblauen Augen hinter der Goldbrille wirkten mild, fast schüchtern – im Kontrast zur markanten Stirn, dem kräftigen Kinn. Er prüfte das Fenster: verschlossen. Der Balkon endete rechts, war links durch eine Steinmauer zur Rue de Judée hin abgeschlossen. Keine Chance, von außen hereinzukommen. Er sah ins Schlafzimmer: keine Tür zum Nachbarraum. In Chapmans Zimmer: die Verbindungstür zu Madames Suite war verriegelt.
„Ich verstehe es nicht, Chapman. Gestern war mein Spazierstock verstellt. Vorgestern waren meine Papiere durcheinander. Wie kommt das alles?“
„Es kommt gar nicht. Sie irren sich. Die Tür zur Lobby ist der einzige Zugang. Und nur Sie und Edwards haben einen Schlüssel. Vertrauen Sie ihm?“
„Natürlich. Er ist seit zehn Jahren bei mir. Aber ab jetzt bleibt er hier, wenn wir auswärts essen.“
Chapman zuckte mit den Schultern. Für ihn klang das alles übertrieben. Was sollte in einem Hotel schon passieren? Kesselbach trug keine Wertsachen bei sich.
Die Tür ging auf. Edwards trat ein.
„Bleiben Sie in der Lobby“, sagte Kesselbach. „Ich erwarte nur Monsieur Gourel. Bis dahin halten Sie die Stellung. Chapman und ich müssen arbeiten.“
Die Arbeit dauerte nicht lang. Kesselbach sichtete seine Post, diktierte zwei Briefe. Dann stockte er. Chapman sah auf – Kesselbach hielt eine schwarze, gebogene Nadel in der Hand. Wie ein Angelhaken. Und starrte sie an.
„Chapman“, sagte Kesselbach und hielt eine verbogene Nadel in die Luft, „sehen Sie das? Die lag eben auf dem Tisch. Ein Beweis. Sie können mir jetzt nicht mehr erzählen, dass niemand hier war.“
„Doch“, sagte Chapman ruhig. „Ich habe sie mitgebracht. Es ist meine Krawattennadel. Ich habe sie gestern Abend herausgenommen, als Sie gelesen haben – und dann etwas gedankenverloren verbogen.“
Kesselbach stand auf, sichtlich frustriert. Er ging ein paar Schritte, blieb stehen.
„Sie machen sich über mich lustig – ich spüre das … und wahrscheinlich haben Sie recht. Seit ich vom Kap zurück bin, verhalte ich mich seltsam. Aber das hat Gründe … Gründe, die Sie nicht kennen.“
Er hielt inne, sah Chapman ernst an, dann sprach er weiter – seine Stimme leiser, aber drängender:
„Ich arbeite an etwas Großem. Einem Plan. Noch ist er vage, aber er nimmt Form an. Und wenn er aufgeht, wird er alles verändern. Es geht nicht ums Geld – davon habe ich genug. Es geht um Macht, Einfluss. Ich bin der Sohn eines Eisenhändlers aus Augsburg – mein ganzes Leben lang haben mich Leute von oben herab betrachtet. Bald nicht mehr. Ich werde über ihnen stehen. Sie werden sehen.“
Chapman sagte nichts.
Kesselbach fuhr fort: „Jetzt verstehen Sie, warum ich so nervös bin. Vielleicht ahnt jemand etwas. Vielleicht beobachtet man mich. Ich glaube das wirklich.“
Das Telefon klingelte.
„Das wird er sein“, murmelte Kesselbach. Er nahm den Hörer ab. „Hallo? … Der Oberst? Gut … Haben Sie Neuigkeiten? … Ausgezeichnet … Sie bringen jemanden mit? In Ordnung. Nein, wir werden nicht gestört. Niemand kommt rein. Mein Sekretär und mein Diener passen auf. Sie wissen ja, wie Sie herkommen – verschwenden Sie keine Zeit.“
Er legte auf und sagte: „Zwei Herren kommen. Edwards soll sie hereinlassen.“
„Und Gourel?“, fragte Chapman.
„Der kommt später. In einer Stunde. Und wenn sie sich begegnen – kein Problem. Sagen Sie Edwards: Er lässt nur drei Personen durch – den Oberst, dessen Begleiter und Inspektor Gourel. Er soll sich die Namen notieren.“
Chapman ging. Als er zurückkam, sah er, wie Kesselbach ein kleines schwarzes Lederetui in der Hand hielt – leer, oder fast. Zögernd wandte Kesselbach es in der Hand, überlegte, ob er es einstecken oder verstecken sollte. Dann ging er zum Kaminsims und warf es in die Reisetasche.
„Zurück zur Arbeit, Chapman. Wir haben noch zehn Minuten. Oh – ein Brief von Madame! Warum haben Sie ihn mir nicht gleich gegeben? Erkennen Sie ihre Handschrift nicht?“
Er war bewegt. Er hob das Papier an, sog den Duft ein, öffnete es langsam und las leise. Chapman hörte Bruchstücke: „… fühle mich müde … bleibe heute im Hotel … langweilig … warte auf deinen Draht …“
„Sie haben das Telegramm heute Morgen abgeschickt, ja? Dann ist sie morgen hier.“
Er wirkte erleichtert. Rieb sich die Hände, atmete tief durch – als hätte sich etwas gelöst.
Es klopfte.
„Jemand ist an der Tür, Chapman. Sehen Sie nach.“
Doch Edwards trat ein: „Zwei Herren fragen nach Ihnen, Sir.“
„Ich weiß. Sind sie unten?“
„Ja, Sir.“
„Gut. Tür zu. Ab jetzt nur noch für Gourel öffnen. Chapman, holen Sie die beiden – aber sagen Sie dem Oberst, ich möchte ihn zuerst allein sprechen.“
Edwards und Chapman verließen das Zimmer und schlossen die Tür. Kesselbach trat ans Fenster und lehnte die Stirn gegen die Scheibe. Unten zogen Kutschen und Automobile über die Avenue. Die Frühlingssonne glänzte auf Lack und Messing, Kastanien trieben erstes Grün.
„Was treibt Chapman da?“, murmelte Kesselbach. „Verliert wieder Zeit mit Reden …“
Er griff nach einer Zigarette, zündete sie an – und erstarrte. Ein Mann stand plötzlich vor ihm. Ein Fremder.
„Wer sind Sie?“, fragte Kesselbach, zurückweichend.
Der Mann war gut gekleidet, mit scharf geschnittenem Gesicht, dunklem Haar, Schnurrbart, kühlen Augen. Er lächelte.
„Ich bin der Oberst.“
„Nein“, sagte Kesselbach. „Der Mann, der mir unter diesem Namen schrieb, sind nicht Sie.“
„Doch. Er war nur ein Vorbote. Jetzt bin ich hier. Und das zählt.“
„Ihr Name?“, fragte Kesselbach.
„Der Oberst. Bis Sie etwas anderes hören.“
Kesselbach spürte einen kalten Schauer. Wer war dieser Mensch? Was wollte er?
„Chapman!“, rief er.
„Ist meine Gesellschaft nicht angenehm genug?“, sagte der Fremde mit leichtem Spott.
„Edwards!“, rief Kesselbach erneut. „Chapman!“
„Chapman! Edwards!“, wiederholte der Mann, spöttisch lachend. „Man ruft euch!“
„Ich verlange, dass Sie dieses Zimmer verlassen“, sagte Kesselbach.
„Wer hindert Sie?“, sagte der Mann und trat zur Seite.
Kesselbach ging zur Tür, öffnete sie – und fuhr zurück: Ein zweiter Mann stand draußen, eine Pistole in der Hand.
„Edwards … Chap…“
Er stockte. In der Ecke sah er Chapman und Edwards, geknebelt und gefesselt am Boden. Sofort wich Kesselbach zum Kamin zurück, tastete nach dem Klingelknopf und drückte ihn – fest, ohne loszulassen.
„Und?“, sagte der Fremde gelassen. „Glauben Sie, das Hotel rennt herbei? Das Kabel ist durchtrennt.“
Kesselbach wirbelte herum – nicht um nachzusehen, sondern um seine Reisetasche zu greifen. Er zog einen Revolver, zielte, schoss – nichts. Er drückte noch einmal. Und noch einmal. Klick. Klick.
„Scheint, als hätten Sie vergessen, ihn zu laden“, sagte der Fremde. „Na los, leeren Sie ruhig das ganze Magazin. Nur zu.“
Kesselbach ließ die Waffe sinken.
Der Mann stellte einen Stuhl mittig in den Raum, setzte sich rittlings, entspannt.
„Setzen Sie sich, mein Freund. Eine Zigarette? Nein? Ich nehme eine Zigarre.“
Er griff zu einer hellen Upmann aus der Schachtel, zündete sie an, zog daran.
„Ausgezeichnet. Danke. Also, reden wir.“
Kesselbach schwieg. Er starrte ihn an – ratlos, fassungslos. Doch der lässige Ton, die Gelassenheit des Fremden wirkten. Die Spannung wich etwas.
Kesselbach zog die Brieftasche aus der Tasche, öffnete sie, zeigte ein Bündel Banknoten.
„Wie viel?“, fragte er.
Der Fremde runzelte leicht die Stirn, als hätte er die Frage nicht ganz verstanden. Dann rief er: „Marco!“
Der Mann mit der Pistole trat näher.
„Der Herr bietet dir Papier für deine Liebste an. Nimm’s, Marco.“
Marco nahm das Geld – mit der linken Hand, während die rechte die Waffe nicht senkte.
„Nun, da wir Ihr großzügiges Angebot entgegengenommen haben“, sagte der Fremde, „kommen wir zur Sache. Ich will zwei Dinge. Erstens: ein kleines schwarzes Lederetui in Form eines Umschlags – Sie tragen es gewöhnlich bei sich. Zweitens: eine kleine Ebenholzschatulle, die gestern noch in Ihrer Reisetasche war. Fangen wir mit dem Etui an?“
„Verbrannt“, sagte Kesselbach.
Der Mann runzelte die Stirn. Für einen Moment schien er sich zu erinnern, dass es Zeiten gab, in denen man solche Antworten anders behandelte.
„Na gut. Das sehen wir noch. Und die Schatulle?“
„Verbrannt.“
„Sie treiben Spielchen mit mir.“ Er packte Kesselbachs Arm und drehte ihn schmerzhaft. „Gestern waren Sie in der Crédit Lyonnais am Boulevard des Italiens. Ein Päckchen unter dem Mantel, Schließfach 16, Nische 9. Sie haben unterschrieben, gezahlt, sind hinuntergegangen – und das Päckchen war weg, als Sie zurückkamen. Stimmt’s?“
„Genau.“
„Also sind Schatulle und Etui im Schließfach?“
„Nein.“
„Geben Sie mir den Schlüssel.“
„Nein.“
„Marco!“
Marco trat näher.
„Schnell, Marco – der Vierfachknoten!“
In Sekunden war Kesselbach gefesselt – Arme hinter dem Rücken, Brust an den Stuhl geschnallt, Beine eng zusammengebunden.
„Durchsuch ihn.“
Marco fand einen flachen Nickelschlüssel mit den Zahlen 16 und 9.
„Perfekt. Kein Etui?“
„Nichts, Boss.“
„Es ist im Schließfach. Monsieur Kesselbach, wie lautet die Kombination?“
„Die sage ich Ihnen nicht.“
„Sie verweigern sich?“
„Ja.“
„Marco!“
„Ja, Boss.“
„Pistole an die Schläfe.“
„Ist dran.“
„Finger an den Abzug.“
„Bereit.“
„Na, Kesselbach – reden Sie?“
„Nein.“
„Ich zähle bis zehn. Marco!“
„Ja, Boss.“
„Bei zehn drückst du ab.“
„Verstanden.“
„Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs …“
Kesselbach hob leicht den Kopf.
„Sie wollen sprechen?“
„Ja.“
„Gerade noch rechtzeitig. Was ist der Code?“
„Dolor.“
„Dolor … Dolores, nicht wahr? Wie rührend. Marco, hör zu: Triff Jérôme an der Omnibushaltestelle. Gib ihm den Schlüssel. Sag ihm das Wort – Dolor. Jérôme geht allein rein, unterschreibt, leert das Schließfach. Verstanden?“
„Ja, Chef. Und wenn der Code nicht stimmt?“
„Dann trenn dich von Jérôme, geh nach Hause, ruf mich an. Und wenn der Code falsch war … reden Kesselbach und ich noch mal. Kesselbach, sicher, dass Sie sich nicht irren?“
„Ja.“
„Dann los, Marco!“
„Und Sie, Chef?“
„Ich bleibe hier. Ich bin ganz ruhig. Kesselbach hat gesagt, niemand außer mir kommt durch diese Tür – nicht wahr?“
„Ja.“
„Sie waren ziemlich energisch bei dieser Aussage … Zeit schinden, war das Ihr Plan? Dann bin ich ein Narr …“ Er hielt inne. Schaute Kesselbach prüfend an. „Nein … es kommt niemand.“
Die Klingel ertönte.
Er presste die Hand auf Kesselbachs Mund.
„Du Schlitzohr – du erwartest jemanden!“
Kesselbachs Augen leuchteten. Selbst der unterdrückte Jubel war spürbar.
„Noch ein Lachen, und ich erwürge dich! Marco – knebel ihn! Sofort!“
Die Klingel ertönte erneut. Der Mann erhob die Stimme und rief in gespieltem Ton: „Edwards! Warum öffnest du nicht die Tür?“ Dann wandte er sich an Marco und flüsterte: „Schnell – bring sie ins Schlafzimmer, dahin, wo man sie nicht sieht.“
Sie schleppten Chapman und Edwards aus dem Blickfeld, legten sie ab, kehrten zurück.
Kaum war Marco wieder im Zimmer, rief der Fremde beiläufig Richtung Tür: „Was, er ist nicht hier? … Schreiben Sie ruhig weiter, Monsieur Kesselbach. Ich mache schon auf.“
Er öffnete langsam. „Monsieur Kesselbach?“
Ein großer, breitschultriger Mann stand da, freundlich, nervös, den Hut zwischen den Händen drehend.
„Ja, ganz recht. Und Sie sind?“
„Monsieur Kesselbach hat mich angerufen. Er erwartet mich.“
„Ach ja, richtig … Einen Moment. Wären Sie so freundlich zu warten?“
Der Fremde ließ ihn in der Vorhalle stehen – mit Blick ins Wohnzimmer – und verschwand, ohne sich umzudrehen. Bei Marco flüsterte er: „Wir sind geliefert. Das ist Gourel.“
Marco griff zum Messer. Der andere packte seinen Arm. „Nein. Ich hab einen Plan. Du bist jetzt Kesselbach. Verstanden? Du sprichst für ihn.“
Marco richtete sich auf, sprach laut, fest: „Bitte entschuldigen Sie. Sagen Sie Inspektor Gourel, ich bin momentan überlastet. Ich empfange ihn morgen früh um neun.“
„Perfekt“, flüsterte der andere. „Bleib ruhig.“
Er ging zurück. „Monsieur Kesselbach bittet um Verständnis – dringende Angelegenheit. Wären Sie so freundlich, morgen früh um neun wiederzukommen?“
Kurze Stille. Gourel wirkte irritiert, zögerte. Der Mann im Flur krampfte die Hand ums Messer.
Dann sagte Gourel: „Na gut. Neun Uhr morgen. Ich komme.“
Er setzte den Hut auf und ging.
Zurück im Wohnzimmer lachte Marco los: „Das war genial, Boss! Den hast du richtig abgefertigt!“
„Los. Folge ihm. Wenn er das Hotel verlässt – gut. Dann geh zu Jérôme. Ruf mich an.“
Marco verschwand.
Der Mann goss sich ein Glas Wasser ein, trank es leer, wischte sich die Stirn, setzte sich neben Kesselbach. Mit einem Nicken: „Aber zuerst – darf ich mich vorstellen.“
Er zog eine Karte: „Arsène Lupin. Gentleman-Gauner.“
Kesselbachs Gesicht veränderte sich – nicht vor Angst, sondern fast vor Erleichterung. Lupin bemerkte es.
„Aha. Sie entspannen sich. Sie wissen – Lupin mag keine Gewalt. Hat nie Blut vergossen. ‚Borgt‘ nur, was ihm nicht gehört. Ein Kavaliersdelikt, nicht wahr? Und Sie denken: Der bringt niemanden um, wenn es nicht sein muss. Stimmt.
Aber – ist es unnötig, Sie zu töten? Das liegt ganz bei Ihnen. Und glauben Sie mir: Das hier ist kein Spiel.“
Er zog einen Stuhl heran, löste den Knebel, sprach ruhig, direkt.
„Seien wir ehrlich. Am Tag Ihrer Ankunft in Paris nahmen Sie Kontakt auf zu einem gewissen Barbareux, Betreiber einer Privatdetektei. Weil Sie nicht wollten, dass Chapman davon erfährt, vereinbarten Sie, dass Barbareux sich als ‚der Oberst‘ ausgibt.
Barbareux ist anständig. Aber einer seiner Leute – ist ein Freund von mir. So erfuhr ich von Ihrem kleinen Geheimnis. Deshalb war ich in Ihrem Zimmer. Mit ein paar falschen Schlüsseln. Ich hab nicht gefunden, was ich suchte – aber ich weiß, dass es da ist.“
Lupin beugte sich vor. Seine Augen bohrten sich in die Kesselbachs, suchten nach einem Zeichen.
„Barbareux sollte einen Mann finden, der sich irgendwo in den Elendsvierteln von Paris versteckt. Pierre Leduc – oder so ähnlich. Ein Meter fünfundsiebzig, blond, helle Haut, Schnurrbart. Spitze des linken kleinen Fingers fehlt. Narbe auf der rechten Wange. Dieser Mann scheint Ihnen wichtig zu sein. Wer ist er?“
„Ich weiß es nicht.“
Ruhig. Fest. Kein Zögern.
Wusste er es wirklich nicht? Oder wollte er nur schweigen? So oder so – Lupin bekam nichts.
„Gut“, sagte er. „Aber Sie hatten mehr Informationen, als Sie Barbareux gegeben haben.“
„Nein.“
„Sie lügen. Zweimal zogen Sie in Barbareux’ Büro Unterlagen aus Ihrem Lederetui.“
„Habe ich.“
„Und das Etui?“
„Verbrannt.“
Lupins Kiefer spannte sich. In seinen Augen flackerte Wut. Drohungen wirkten nicht mehr. Folter kam nicht infrage.
„Verbrannt, ja? Und die Schatulle? Die Ebenholzschatulle ist bei der Crédit Lyonnais, richtig?“
„Ja.“
„Und was ist drin?“
„Meine zweihundert besten Diamanten.“
Lupin lehnte sich zurück, überrascht. Die Brauen gehoben.
„Zweihundert? Kein Wunder, dass Sie lächeln. Spielgeld für Sie. Dann steckt Ihr wahres Geheimnis wohl woanders … Für Sie jedenfalls. Und für mich?“
Er nahm eine Zigarre, zündete ein Streichholz, ließ es abbrennen, ohne zu rauchen. Dann saß er still. Minuten vergingen. Plötzlich lachte er.
„Ich wette, Sie hoffen, das mit dem Schließfach geht schief, was? Und wenn doch – zahlen müssen Sie trotzdem. Für meine Zeit. Ich fessel niemanden zum Spaß. Also – Diamanten oder Etui. Ihre Wahl.“
Er sah auf die Uhr.
„Halbe Stunde … Das Schicksal hat’s nicht eilig. Und grinsen Sie nicht, Kesselbach – ich gehe hier nicht mit leeren Händen raus. Ah – endlich!“
Das Telefon klingelte. Lupin nahm den Hörer, imitierte Kesselbachs Stimme: „Ja, hier Kesselbach … Ja, Mademoiselle, verbinden Sie mich … Marco? Gut. Lief alles glatt? Keine Probleme? Sehr gut. Also – was habt ihr gefunden? Die Ebenholzschatulle? Nichts sonst? Keine Unterlagen? Hm … Und was ist drin – schöne Diamanten? Großartig. Moment, Marco, ich denke nach …“
Er wandte sich an Kesselbach.
„Sind Ihnen die Diamanten wichtig?“
„Ja.“
„Würden Sie sie mir abkaufen?“
„Möglich.“
„Für wie viel? Halbe Million Francs?“
„Fünfhunderttausend – ja.“
„Problem ist: Wie tauschen wir? Ein Scheck? Einer legt den anderen rein. Nein. So machen wir’s: Übermorgen früh gehen Sie zur Crédit Lyonnais, heben fünfhunderttausend in bar ab – große Scheine. Dann spazieren Sie durch den Bois, Auteuil-Seite. Ich bringe die Diamanten – in einer Tasche, nicht in der Schatulle.“
Kesselbach fuhr hoch.
„Nein – auch die Schatulle. Ich will alles.“
„Aha!“ Lupin lachte. „Jetzt hab ich Sie! Die Diamanten sind egal. Aber die Schatulle – an der hängen Sie wie an Ihrem Leben. Also gut. Sie bekommen sie. Auf mein Wort: Morgen früh per Post!“
Er nahm den Hörer wieder.
„Marco, hast du die Schatulle vor dir? Sieht irgendetwas besonders aus? Ebenholz, Elfenbein – japanischer Stil? Aus dem Faubourg Saint-Antoine? Keine Markierung? Moment – was ist das? Rundes Etikett, blauer Rand, Nummer? Ein Ladenschild – unwichtig.
Ist der Boden dick? Nein? Verdammt. Kein doppelter Boden? Dann … das Intarsienmuster außen? Warte – der Deckel! Genau! Der Deckel! Ich hab’s gesehen – Kesselbach hat gezuckt! Seine Augen haben’s verraten! Jetzt sind wir nah dran. Sie haben nicht gemerkt, dass ich Sie beobachtet habe, was, Kesselbach?“
Er grinste – wie ein Kind mit neuem Spielzeug.
„Zu Marco: Na? Was siehst du? Einen Spiegel? Lässt er sich verschieben? Scharniere? Nein? Dann zerbrich ihn. Ja, ich sagte: Zerschlag ihn. Der Spiegel ist nicht original – der wurde später eingebaut!“
Er hielt inne. Lauschte.
„Da! Hören Sie das, Monsieur Kesselbach? Ich hab’s gesagt – wir würden etwas finden! Marco? Was ist es? Ein Brief? Ja! Sieg! Die Kap-Diamanten und Ihr kleines Geheimnis!“
Er setzte sich beide Hörer auf, beugte sich vor.
„Lies langsam, Marco. Umschlag zuerst. Jetzt der Zettel … ‚Abschrift des Briefes aus dem schwarzen Maroquin-Etui.‘ Verstanden. Reiß ihn auf. Du hast doch Kesselbachs Erlaubnis, oder, alter Junge? Nein? Schade – los, Marco.“
Er lauschte.
„Hm … nicht eindeutig, was? Ich wiederhole: ein Blatt Papier, vierfach gefaltet. Frisch gefaltet. Oben rechts: ‚Fünf Fuß neun, linker kleiner Finger ab.‘ Ja – die Beschreibung unseres Mannes. Kesselbachs Handschrift? Gut. Und in der Mitte: ein Wort in Großbuchstaben – ‚APOON.‘“
Stille. Dann: „Marco, fass nichts mehr an. Lass alles liegen. Keine Diamanten, keine Schatulle. Ich bin in zehn Minuten fertig und in zwanzig bei dir. Auto zurückgeschickt? Perfekt.“
Lupin legte auf, ging ins Schlafzimmer, kontrollierte Chapman und Edwards. Sie lebten, waren ruhig, nicht in Gefahr. Er kehrte ins Wohnzimmer zurück. Kein Lächeln mehr. Kalte Augen. Harte Stimme.
„Das Spiel ist vorbei, Kesselbach. Wenn Sie nicht reden, wird’s unschön. Sind Sie bereit, mir die Wahrheit zu sagen?“
„Die Wahrheit worüber?“
„Schluss jetzt. Was bedeutet das Wort ‚APOON‘?“
„Wenn ich es wüsste, hätte ich es nicht aufgeschrieben.“
„Worauf bezieht es sich? Woher haben Sie es? Wann haben Sie es zum ersten Mal gesehen?“
Schweigen.
„Hören Sie, Kesselbach. Ich mache Ihnen ein Angebot. Sie sind reich. Mächtig. Gut. Ich bin Arsène Lupin. König der Diebe. Aber wir sind uns ähnlich. Sie stehlen mit Verträgen, ich mit Dietrichen. Dasselbe Spiel – andere Regeln.
Lassen Sie uns zusammenarbeiten. Ich brauche Sie – weil ich nicht weiß, worum es hier wirklich geht. Und Sie brauchen mich – weil Sie allein nicht weiterkommen. Barbareux? Ein Idiot. Ich bin Lupin. Abgemacht?“
Keine Antwort.
Lupin beugte sich vor. Die Stimme voller Druck: „Sagen Sie ja, Kesselbach. Und ich finde Ihren Pierre Leduc in achtundvierzig Stunden. Darum geht’s, oder? Wer ist er? Warum suchen Sie ihn? Was bedeutet er Ihnen?“
Er legte ihm die Hand auf die Schulter.
„Ein Wort. Ja oder nein?“
„Nein.“
Lupin zuckte nicht. Er nahm Kesselbachs goldene Uhr, legte sie ihm auf den Schoß. Knöpfte die Weste auf, öffnete das Hemd. Nahm einen Dolch vom Tisch, setzte die Spritze an – genau über dem Puls.
„Zum letzten Mal.“
„Nein.“
Lupin blickte auf die Uhr.
„Monsieur Kesselbach, es ist acht Minuten vor drei. Wenn Sie bis dahin nicht sprechen, sind Sie tot.“
Am nächsten Morgen, Punkt neun, betrat Inspektor Gourel das Palace Hotel. Ohne sich an der Rezeption aufzuhalten, nahm er die Treppe in den vierten Stock, bog rechts ab und klingelte an Suite 415. Keine Reaktion. Er klingelte erneut. Dann noch einmal. Insgesamt sechsmal. Nichts.
Am Ende des Flurs entdeckte er einen Oberkellner im Dienstzimmer.
„Monsieur Kesselbach hat letzte Nacht nicht hier geschlafen. Seit gestern Nachmittag haben wir ihn nicht gesehen.“
„Und sein Diener? Sein Sekretär?“
„Ebenso verschwunden.“
„Also blieben alle drei über Nacht weg?“
„Soweit ich weiß – ja.“
„‚Soweit Sie wissen‘? Sie sollten es genau wissen.“
„Monsieur Kesselbach wohnt nicht offiziell im Hotel. Er nutzt eine private Suite mit eigenem Personal. Wir haben keine Einsicht, was dort geschieht.“
Gourel nickte langsam. Das lief anders als erwartet.
„Wenn doch der Chef hier wäre …“ murmelte er.
Er zeigte dem Kellner seinen Ausweis.
„Sie haben die Herren nicht hineingehen sehen?“
„Nein.“
„Aber hinaus?“
„Auch nicht.“
„Woher wissen Sie dann, dass sie gegangen sind?“
„Ein Herr teilte es mir mit. Er kam gestern Nachmittag vorbei.“
„Dunkler Schnurrbart?“
„Ja. Ich begegnete ihm gegen drei Uhr, als er gerade hinausging. Er sagte, die Bewohner der 415 seien verreist. Monsieur Kesselbach würde in Versailles im Hôtel des Réservoirs übernachten. Ich solle Post dorthin nachsenden.“
„Und dieser Mann – wer war er? Mit welchem Recht sprach er für Monsieur Kesselbach?“
„Ich weiß es nicht.“
Etwas stimmte nicht. Gar nichts daran stimmte.
„Haben Sie einen Schlüssel zur Suite?“
„Nein – Spezialschlösser. Nur Kesselbach und sein Personal haben welche.“
Gourel klingelte erneut, dieses Mal mit Nachdruck. Nichts. Als er sich abwenden wollte, legte er das Ohr an das Schlüsselloch.
„Warten Sie … Ich höre etwas … ein Stöhnen!“
Er hämmerte gegen die Tür.
„Sir, Sie dürfen das nicht …“
„Sparen Sie sich das. Holen Sie sofort einen Schlosser!“
Ein Kellner rannte los. Gäste traten aus ihren Zimmern. Personal versammelte sich. Der Flur füllte sich.
„Was ist mit der Nachbarsuite?“ rief Gourel. „Gibt es Verbindungstüren?“
„Ja – aber sie sind immer von beiden Seiten verriegelt.“
„Dann rufe ich die Kriminalpolizei.“
„Und die örtliche?“
„Von mir aus.“
Als er vom Telefon zurückkam, arbeitete der Schlosser bereits am Schloss. Der letzte Schlüssel klickte. Die Tür sprang auf. Gourel stürmte hinein. Das Stöhnen führte ihn zu zwei Körpern am Boden – Chapman und Edwards. Chapman hatte sich den Knebel halb gelockert, Edwards war bewusstlos. Beide wurden befreit. Doch Gourel war bereits weiter.
„Wo ist Monsieur Kesselbach?“
Im Wohnzimmer fand er ihn – an einen Stuhl gefesselt, den Kopf gesenkt.
„Ohnmächtig“, sagte Gourel und trat näher. „Wahrscheinlich beim Befreiungsversuch kollabiert.“
Er schnitt die Seile durch – und der Körper kippte schwer nach vorn.
„Er ist tot! Die Hände eiskalt … Sehen Sie seine Augen!“
„Vielleicht ein Schlaganfall … oder das Herz“, sagte jemand.
„Keine sichtbare Wunde. Wahrscheinlich ein natürlicher Tod“, meinte ein anderer.
Sie legten ihn vorsichtig aufs Sofa und öffneten sein Hemd – und da war das Blut. Eine feine Spur nur, aus einer kleinen Einstichstelle nahe dem Herzen. Winzig – aber tödlich.
An das blutbefleckte Hemd war eine Karte geheftet. Gourel beugte sich vor. Arsène Lupins Visitenkarte. Blutbesprenkelt. Schlicht. Unheimlich.
Er richtete sich auf, die Stimme scharf, befehlend: „Mord. Arsène Lupin. Alle raus – sofort. Niemand bleibt in dieser Wohnung oder im Schlafzimmer. Die beiden bringt in ein anderes Zimmer und lasst sie versorgen. Nichts anfassen. Gar nichts. Der Chef ist unterwegs.“
Kapitel 2.Das Etikett mit dem blauen Rand
„Arsène Lupin …“
Gourel murmelte den Namen erneut, als wäre er zu schwer, um laut ausgesprochen zu werden. Zwei Worte wie ein Totenglockenschlag. Arsène Lupin. Die Legende. Das Gespenst. Der Meisterdieb. Der König der Gauner. Konnte es wirklich er sein? War das möglich?
„Nein, nein“, murmelte Gourel. „Das kann nicht sein. Er ist tot.“
Aber genau das war die Frage – war er es wirklich? Arsène Lupin.
Gourel stand neben der Leiche, starrte auf die Visitenkarte, drehte sie immer wieder zwischen den Fingern, als könne sie verschwinden, wenn er nur blinzelte. Lupin. Als hätte ein Geist seine Spur hinterlassen, als sei ein Toter zurückgekehrt, um ihn zu verhöhnen. Was tun? Sofort handeln? Eigeninitiative zeigen? Nein. Das war nicht seine Art. Gegen so jemanden würde er nur Fehler machen. Außerdem – der Chef war unterwegs. Der Chef war unterwegs. Dieser Gedanke ordnete alles. Gourels fester Anker. Er war loyal, mutig, erfahren – aber kein Mann für Alleingänge. Er funktionierte unter klaren Anweisungen, wenn jemand Stärkeres die Jagd führte. Und seit Lenormand Monsieur Dudouis als Leiter der Kriminalpolizei abgelöst hatte, war diese Abhängigkeit noch stärker geworden. Monsieur Lenormand war nicht einfach ein Chef – er war der Chef. Brillant, methodisch, unfehlbar. Mit ihm ergab alles Sinn. Ohne ihn war Gourel hilflos.
Er sah auf die Uhr. Der Chef würde bald eintreffen. Hoffentlich kam niemand vorher – weder der Polizeikommissar, noch der Untersuchungsrichter, nicht einmal der Gerichtsmediziner. Niemand sollte den Tatort betreten, bevor Lenormand ihn gesehen hatte.
Eine Stimme riss ihn aus den Gedanken. „Na, Gourel? Immer noch am Träumen?“
„Chef!“ Gourel richtete sich auf.
Lenormand machte auf den ersten Blick keinen großen Eindruck. Sein Gesicht war scharf, durchdringend – doch sein Rücken gebeugt, die Haut gelblich und trocken, der Bart grau und struppig. Gebrechlich, alt. Aber hinter der Brille blitzten kühle, intelligente Augen. Er hatte Jahre in Kolonialposten verbracht, Krankheit und Gefahr schweigend ertragen. Das hatte seinen Körper zermürbt, aber seinen Geist geschärft.
Nach der Lösung des berühmten Falls der drei Spanier in Biskra war er anerkannt, nach Bordeaux befördert, dann nach Paris versetzt und schließlich – nach Dudouis’ Tod – zum Chef der Kriminalabteilung ernannt worden. Seitdem bestätigte jeder Fall seine Genialität – seine ungewöhnlichen, aber wirksamen Methoden, seine unheimliche Intuition, seine Fähigkeit, Ergebnisse zu liefern. Sein Name wurde unter Polizisten mit Ehrfurcht geflüstert.
Für Gourel war er mehr als brillant – unantastbar. Ein Gott im abgetragenen olivgrünen Gehrock und verwaschenem, kastanienrotem Halstuch.
Lenormand setzte sich langsam, schlug die Rockschöße zurück, legte die Hände auf den Spazierstock und sagte schlicht: „Bericht.“
Gourel folgte der Anweisung – knapp, präzise, wie er es gelernt hatte. Er schilderte, was er gesehen und gefunden hatte. Am Ende reichte er die Karte hinüber.
Lenormand zuckte zusammen.
„Lupin“, murmelte er.
„Ja“, sagte Gourel. „Er ist zurück.“
„Schon gut“, entgegnete Lenormand ruhig nach kurzer Pause.
„Genau!“ Gourel strahlte, beflügelt von diesen seltenen Worten. „Endlich eine echte Herausforderung! Sie gegen Lupin – das wird sein Ende. Lupin hat seinen Meister gefunden. Lupin ist …“
„Fährte.“
Das Wort kam wie ein Befehl an einen Jagdhund. Und Gourel gehorchte – eifrig, aufmerksam, mit der Nase am Boden.
Lenormand deutete mit dem Stock in eine Ecke, dann auf einen Stuhl – wie auf einen Bau oder ein Dickicht. Gourel durchsuchte alles gründlich.
„Nichts“, sagte er schließlich.
„Für Sie nichts“, murmelte Lenormand.
„Genau das meinte ich, Chef“, sagte Gourel. „Sie … Sie bemerken Dinge, die sprechen, als wären sie lebendig. Echte Zeugen, auch wenn sie nicht atmen. Aber unterm Strich – das ist ein Mord. Ein weiterer für Lupins Akte.“
„Der erste“, sagte Lenormand ruhig.
„Der erste, ja … Aber es musste ja so kommen. So ein Leben führt zwangsläufig zur ernsten Kriminalität. Kesselbach muss sich gewehrt haben …“
„Nein. Er war gefesselt.“
„Stimmt“, gab Gourel kleinlaut zu. „Das ist ja das Seltsame, nicht wahr? Warum jemanden töten, der schon ausgeschaltet ist?“
Er schüttelte den Kopf. „Wenn ich ihn gestern nur festgenommen hätte – als ich ihm an der Tür gegenüberstand …“
Lenormand sagte nichts. Er trat auf den Balkon, passierte das Schlafzimmer und prüfte selbst Fenster und Türen.
„Die Fenster waren geschlossen, als ich eintrat“, sagte Gourel.
„Geschlossen – oder nur angelehnt?“
„Niemand hat sie seitdem berührt. Sie sind fest verschlossen, Chef.“
In diesem Moment hallten Stimmen aus dem Nebenzimmer. Zurück im Salon fanden sie den Bezirksarzt, der die Leiche untersuchte, und bei ihm war Formerie, der Untersuchungsrichter.
„Arsène Lupin!“, dröhnte Formerie. „Endlich bringt mich das Glück wieder mit diesem Verbrecher zusammen! Ich werde ihm zeigen, wozu ich fähig bin … und jetzt ist es Mord! Jetzt ist es persönlich. Zwischen ihm und mir!“
Formerie hatte die Demütigung nie vergessen, die er in der Affäre um das Diadem der Prinzessin de Lamballe erlitten hatte – als Lupin ihn öffentlich bloßgestellt hatte, in einem Fall, über den man bis heute lachte. Die Erinnerung brannte. Und jetzt bot sich die Gelegenheit zur Revanche.
„Die Art des Verbrechens ist offensichtlich“, erklärte Formerie selbstzufrieden. „Das Motiv schnell zu finden. Alles bestens!“
Er wandte sich mit gespielter Höflichkeit an Lenormand. „Monsieur Lenormand, wie geht es Ihnen? Sehr erfreut, Sie zu sehen.“
Er war ganz und gar nicht erfreut. Nicht im Geringsten. Lenormand machte keinen Hehl aus seiner Verachtung für den Untersuchungsrichter, und Formerie wusste das – doch er versuchte Haltung zu wahren.
„Doktor“, sagte Formerie zum Gerichtsarzt, „Sie schätzen die Todeszeit auf – sagen wir – zwölf Stunden? Vielleicht mehr?“
„Ja, Monsieur Untersuchungsrichter.“
„Genau, was ich dachte. Wir sind völlig einer Meinung. Und die Mordwaffe?“
„Ein Messer mit sehr feiner Klinge. Es wurde offenbar mit dem Taschentuch des Opfers abgewischt.“
„Ja, ja … das ist klar erkennbar. Man sieht noch die Spuren. Kommen wir zur Befragung von Sekretär und Diener. Ihre Aussagen werden Licht ins Dunkel bringen.“
Chapman und Edwards waren in ein kleineres Zimmer am Gang gebracht worden. Chapman, der sich rasch erholt hatte, gab einen ausführlichen Bericht: Kesselbachs Nervosität, der erwartete Besuch des ‚Obersts‘ und der plötzliche Angriff.
„Aha!“, rief Formerie. „Ein Komplize! Und Sie hörten seinen Namen – Marco, nicht wahr? Hervorragend! Ein sehr wichtiger Hinweis. Wenn wir ihn fassen, sind wir ein gutes Stück weiter.“
„Ja“, sagte Lenormand ruhig, „aber wir haben ihn nicht.“
„Wir kriegen ihn“, sagte Formerie. „Eins nach dem anderen. Also, Monsieur Chapman, dieser Marco ging, nachdem Monsieur Gourel an der Tür klingelte?“
„Ja. Wir hörten ihn gehen.“
„Und danach? Haben Sie noch etwas gehört?“
„Ja … einige Geräusche, hin und wieder, aber nicht deutlich. Die Tür war geschlossen.“
„Was für Geräusche?“
„Stimmen. Erhobene Stimmen. Der Mann …“
„Nennen Sie ihn beim Namen“, unterbrach Lenormand. „Arsène Lupin.“
„Arsène Lupin muss telefoniert haben“, fügte Chapman hinzu.
„Ausgezeichnet“, sagte Formerie. „Wir werden das Hotelpersonal befragen, das die Telefonverbindung bedient. Und danach – haben Sie ihn gehen hören?“
„Er kam noch einmal herein, um zu sehen, ob wir noch gefesselt waren … und etwa fünfzehn Minuten später ging er. Wir hörten die Haustür hinter ihm zufallen.“
„Ja, natürlich – nachdem der Mord begangen war. Gut … gut … es passt alles. Und danach?“
„Nichts. Die restliche Nacht war ruhig. Ich schlief vor Erschöpfung ein … Edwards auch. Wir wachten erst heute früh auf …“
„Ja, ja – ich weiß.“ Formerie nickte zufrieden. „Es läuft alles hervorragend … es passt.“
Wie ein Jäger, der einen cleveren Gegner abhakt, begann er laut für sich zu rekapitulieren: „Der Komplize … das Telefon … die Tatzeit … die gehörten Stimmen … Gut … sehr gut. Jetzt fehlt nur noch das Motiv. Da es um Lupin geht, muss das Motiv Raub sein. Monsieur Lenormand, ist Ihnen etwas Aufgebrochenes aufgefallen?“
„Nein“, sagte Lenormand.
„Dann wurde der Raub direkt am Körper des Opfers verübt. Haben wir seine Brieftasche gefunden?“
„Ich habe sie in seiner Jackentasche gelassen“, sagte Gourel.
Sie kehrten in den Salon zurück. Formerie nahm die Brieftasche und öffnete sie. Sie enthielt nur Visitenkarten und Ausweispapiere.
„Seltsam. Monsieur Chapman, können Sie bestätigen, ob Kesselbach Geld bei sich hatte?“
„Ja. Am Montag – dem Tag vor dem Mord – waren wir bei der Crédit Lyonnais. Monsieur Kesselbach mietete ein Schließfach …“
„Ein Schließfach? Bei der Crédit Lyonnais? Hervorragend. Das werden wir überprüfen.“
„Und bevor wir gingen“, fuhr Chapman fort, „eröffnete er ein Konto und hob fünf- bis sechstausend Franc in Banknoten ab.“
„Perfekt“, sagte Formerie. „Das liefert uns das Motiv.“
„Aber da ist noch mehr“, sagte Chapman. „Monsieur Kesselbach war in den letzten Tagen sehr beunruhigt – wegen eines geheimen Plans, an dem er arbeitete. Besonders wichtig waren ihm zwei Dinge: eine kleine Ebenholzschatulle, die er im Schließfach der Crédit Lyonnais deponierte. Und ein kleines schwarzes Notizetui aus Maroquinleder mit einigen Papieren.“
„Und wo ist das jetzt?“
„Kurz bevor Lupin eintraf, sah ich, wie er es in diese Reisetasche legte.“
Formerie nahm die Tasche und durchsuchte sie. Das Etui war verschwunden. Er schlug die Hände zusammen. „Aha! Alles passt! Wir haben den Täter, das Mittel und jetzt das Motiv. Dieser Fall ist praktisch gelöst. Nicht wahr, Monsieur Lenormand?“
„Kein einziges Detail davon“, sagte Lenormand flach.
Der Raum wurde still. Der Polizeikommissar war gerade eingetroffen, und trotz aller Bemühungen, den Tatort zu sichern, drängten sich bereits Journalisten und Hotelpersonal in der Lobby, flüsterten und reckten die Hälse. Selbst für einen Mann wie Lenormand, bekannt für seine Schroffheit und Direktheit – die ihm schon einige Rügen eingebracht hatten –, war diese Antwort ein Schock. Und Formerie war sichtlich aus dem Konzept gebracht.
„Aber …“, begann er verlegen, „ich sehe hier nichts, was nicht vollkommen klar wäre. Lupin ist der Dieb …“
„Warum beging er den Mord?“, fuhr Lenormand ihn scharf an.
„Um den Diebstahl zu verüben, natürlich“, entgegnete der Untersuchungsrichter.
„Verzeihen Sie. Die Zeugenaussagen zeigen eindeutig, dass der Diebstahl vor dem Mord stattfand. Kesselbach war gefesselt, geknebelt, ausgeraubt. Warum sollte Lupin – der noch nie gemordet hat – plötzlich einen Mann töten, der bereits hilflos war?“
Formerie strich sich durch seinen langen, blonden Backenbart – eine Angewohnheit, wenn er auf eine Frage stieß, auf die es keine bequeme Antwort gab.
„Es gibt mehrere mögliche Erklärungen“, sagte er langsam.
„Zum Beispiel?“
„Nun … das hängt ab … von gewissen Umständen, die noch nicht geklärt sind. Und überhaupt betrifft Ihr Einwand das Motiv, nicht die Fakten. In allen anderen Punkten sind wir doch sicher einer Meinung.“
„Nein.“
Wieder kam das Nein – schnell, hart, flach. Fast unhöflich. Formerie blinzelte. Diesmal versuchte er gar nicht zu widersprechen. Die Präsenz Lenormands brachte ihn aus dem Gleichgewicht.
„Jeder hat seine Theorien“, sagte der Untersuchungsrichter schließlich gezwungen höflich. „Ich wäre gespannt auf Ihre.“
„Ich habe keine.“
Lenormand stand auf, stützte sich auf seinen Stock und machte ein paar langsame Schritte durch den Raum. Alle sahen ihn an. Es war bemerkenswert zu beobachten, wie dieser kränklich wirkende alte Mann – offiziell nur ein Assistent – den ganzen Raum mit seiner bloßen Präsenz beherrschte. Niemand unterbrach ihn. Niemand wagte es.
Schließlich sagte er: „Ich möchte die Räume sehen, die an diese Suite angrenzen.“
Der Hoteldirektor brachte einen Grundriss. Laut Plan gab es aus Kesselbachs Schlafzimmer auf der rechten Seite nur einen Ausgang – durch den Flur der Suite. Aber Chapmans Zimmer auf der linken Seite hatte eine Verbindung zur Nachbarwohnung – der, die für Madame Kesselbach reserviert war.
„Lassen Sie sie uns ansehen“, sagte Lenormand.
Formerie zuckte genervt mit den Schultern. „Aber die Verbindungstür ist verriegelt, und die Fenster sind verschlossen.“
„Lassen Sie sie uns ansehen“, wiederholte Lenormand ruhig und bestimmt.
Sie gingen in den Raum – den ersten von fünf, die für Madame Kesselbach reserviert waren. Auf Lenormands Wunsch überprüften sie auch die angrenzenden Zimmer. Jede Verbindungstür war auf beiden Seiten verriegelt.
„Keiner dieser Räume ist belegt?“, fragte Lenormand.
„Nein.“
„Wo sind die Schlüssel?“
„Immer im Büro aufbewahrt.“
„Also konnte niemand sie betreten?“
„Niemand“, sagte der Direktor, „außer dem Etagenkellner, der die Zimmer lüftet.“
„Schicken Sie ihn bitte her.“
Einige Minuten später erschien der Kellner. Sein Name war Gustave Beudot. Er wirkte nervös, antwortete aber höflich.
„Ich habe gestern wie üblich die Fenster in allen fünf Zimmern geschlossen.“
„Um wie viel Uhr?“
„Um sechs Uhr abends.“
„Ist Ihnen etwas Ungewöhnliches aufgefallen?“
„Nein, Monsieur.“
„Und heute früh?“
„Ich habe die Fenster um acht geöffnet, wie immer.“
„Und auch da ist Ihnen nichts aufgefallen?“
Er zögerte. Dann, unter Druck, gestand er: „Nun … ich fand ein Zigarettenetui neben dem Kamin in Zimmer 420. Ich wollte es heute Abend im Büro abgeben.“
„Haben Sie es jetzt bei sich?“
„Nein, es ist in meinem Zimmer. Es ist ein Metalletui, dunkelgrau. Eine Seite enthält Tabak und Papier, die andere Streichhölzer. Es hat zwei goldene Initialen: ein L und ein M …“
„Was sagen Sie da?“
Chapman trat vor, sichtlich überrascht. „Ein pistolenmetallenes Zigarettenetui, sagen Sie?“
„Ja.“
„Mit drei Fächern – für Tabak, Papier und Zündhölzer … russischer Tabak, nicht wahr? Sehr mild und leicht?“
„Ja.“
„Holen Sie es … Ich möchte es selbst sehen … nur zur Sicherheit …“
Auf ein Nicken Lenormands hin verließ Gustave Beudot den Raum. Lenormand setzte sich und ließ seinen Blick über Teppich, Möbel, Vorhänge gleiten.
„Das hier ist Zimmer 420, nicht wahr?“
„Ja.“
Der Untersuchungsrichter verzog den Mund zu einem spöttischen Lächeln. „Ich wüsste wirklich gern, wie Sie glauben, dass das mit dem Mord zusammenhängt. Es liegen fünf verriegelte Türen zwischen uns und dem Raum, in dem Monsieur Kesselbach ermordet wurde.“
Lenormand antwortete nicht. Zeit verstrich. Gustave kam nicht zurück.
„Wo schläft er?“, fragte Lenormand.
„Im sechsten Stock“, sagte der Direktor. „Sein Zimmer geht zur Rue de Judée hinaus – also direkt über diesem. Seltsam, dass er nicht zurückkommt.“
„Wären Sie so freundlich, jemanden nachsehen zu lassen?“
Der Direktor ging selbst, Chapman begleitete ihn. Wenige Minuten später kam der Direktor allein zurück – sichtlich erschüttert.
„Und?“
„Er ist tot!“
„Ermordet?“
„Ja.“
„Verdammt, diese Verbrecher sind gerissen!“, rief Lenormand. „Gourel, verriegeln Sie alle Hotelausgänge. Überwachen Sie jede Tür. Und Sie, Direktor – bringen Sie uns zu Gustave Beudots Zimmer!“
Der Direktor ging voran. Als sie aufbrechen wollten, bückte sich Lenormand und hob ein kleines rundes Stück Papier auf, das ihm schon zuvor aufgefallen war. Ein Etikett mit blauem Rand und der Zahl 813. Er steckte es in die Tasche und folgte den anderen.
Eine kleine Wunde im Rücken, zwischen den Schulterblättern. „Die gleiche Art von Wunde wie bei Monsieur Kesselbach“, sagte der Arzt.
„Ja“, fügte Lenormand hinzu, „derselbe Täter, dieselbe Waffe.“
Anhand der Lage des Körpers sah es so aus, als habe der Mann neben dem Bett gekniet und unter die Matratze gegriffen, um das dort versteckte Zigarettenetui zu holen. Sein Arm steckte noch immer unter der Matratze – aber das Etui war verschwunden.
„Dieses Etui muss wirklich gefährlich gewesen sein“, sagte Formerie zögerlich, nun sichtlich verunsichert.
„Offensichtlich“, erwiderte Lenormand. „Immerhin kennen wir die Initialen: L und M. Und mit dieser Spur, plus dem, was Monsieur Chapman zu wissen scheint, werden wir es herausfinden …“
Plötzlich erstarrte Lenormand.
„Chapman! Wo ist er?“
Sie blickten sich im Korridor um, suchten in der Menge. Kein Zeichen von Chapman.
„Monsieur Chapman kam mit mir“, sagte der Direktor.
„Ich weiß – aber er kam nicht mit Ihnen zurück.“
„Nein, ich ließ ihn bei der Leiche.“
„Sie ließen ihn? Allein?“
„Ich sagte zu ihm: ‚Bleiben Sie hier … rühren Sie sich nicht.‘“
„Und niemand war in der Nähe? Sie haben niemanden gesehen?“
„Im Flur? Nein.“
„Aber was ist mit den anderen Zimmern? Um die Ecke – könnte sich dort jemand versteckt haben?“
Lenormand war nun eindeutig alarmiert. Er ging hastig durch den Flur, öffnete Türen, prüfte Ecken. Dann rannte er plötzlich mit überraschender Geschwindigkeit die Treppe hinunter. Der Direktor und der Untersuchungsrichter folgten ihm.
Unten fand er Gourel an der Eingangstür.
„Ist jemand hinausgegangen?“
„Nein, Chef.“
„Und der Nebenausgang zur Rue Orvieto?“
„Dort habe ich Dieuzy postiert.“
„Strikte Anweisung?“
„Ja, Chef.“
Die Hotellobby war voller nervöser Gäste, die flüsternd verschiedene Versionen des Verbrechens austauschten. Das Personal war aufgerufen worden und traf nun einer nach dem anderen ein. Lenormand befragte sie sofort. Niemand wusste etwas.
Ein Zimmermädchen aus dem fünften Stock trat vor. Vor etwa zehn Minuten war sie zwei Männern begegnet, die eilig die Dienertreppe zwischen fünftem und viertem Stock hinunterkamen.
„Sie kamen sehr schnell herunter. Der eine zog den anderen hinter sich her. Zwei so gut gekleidete Herren auf der Dienertreppe – das war ungewöhnlich.“
„Würden Sie sie wiedererkennen?“
„Den ersten nicht. Er drehte den Kopf weg. Schlank, blond, schwarze Kleidung, weicher schwarzer Hut.“
„Und der andere?“
„Ein Engländer. Großes, glattrasiertes Gesicht, karierter Anzug, ohne Hut.“
Das war eindeutig Chapman.
„Er wirkte … seltsam. Benommen, verwirrt.“
Lenormand reichte Gourels Wort nicht. Er befragte die Portiers beider Ausgänge:
„Kannten Sie Monsieur Chapman?“
„Ja, Monsieur. Er grüßte uns immer.“
„Und Sie sahen ihn heute nicht hinausgehen?“
„Nein, Monsieur. Heute nicht.“
Lenormand wandte sich an den Polizeikommissar.
„Wie viele Männer haben Sie?“
„Vier.“
„Zu wenig. Rufen Sie Verstärkung. Volle Abriegelung. Behandeln Sie das Hotel wie ein belagertes Gebäude.“
„Aber was ist mit meinen Gästen?“, protestierte der Direktor.
„Ihre Gäste sind mir egal, Monsieur. Mein Auftrag ist, den Mörder zu fassen – um jeden Preis.“
„Dann glauben Sie also …“, begann der Untersuchungsrichter.
„Ich glaube nichts, Monsieur. Ich weiß: Der Täter ist noch im Hotel.“
„Dann ist Chapman …?“
„Ob er lebt, weiß ich nicht. Aber es ist nur eine Frage von Minuten – vielleicht Sekunden. Gourel, nehmen Sie zwei Männer und durchsuchen Sie jedes Zimmer im vierten Stock. Der Direktor schickt einen Angestellten mit. Die übrigen Stockwerke durchsuchen wir, sobald Verstärkung da ist. Los, Gourel. Wir jagen Großwild.“
Gourel und sein Team stürmten los. Lenormand blieb in der Lobby, nahe der Rezeption. Anders als sonst setzte er sich nicht. Er schritt auf und ab zwischen Haupteingang und Rue Orvieto, prüfte die Ausgänge, gab laufend Anweisungen:
„Direktor, behalten Sie die Küche im Auge. Möglicher Fluchtweg. Die Fräulein am Telefon darf keine Gespräche nach außen zulassen. Nur Verbindungen – und alles muss protokolliert werden. Und: Liste aller Gäste mit Initialen L oder M.“
Die Anspannung wuchs. Gäste standen dicht gedrängt, hielten den Atem an, zuckten bei jedem Geräusch zusammen. Der Gedanke: Der Mörder könnte unter ihnen sein.
Ein älterer Herr mit grauem Haar, Brille, grünem Mantel, kastanienbraunem Schal bewegte sich langsam, gebeugt, mit unsicheren Schritten – alle Blicke folgten ihm.
Immer wieder kehrten Kellner zurück, die Gourel halfen.
„Neuigkeiten?“, fragte Lenormand.
„Nein, Monsieur. Noch nichts.“
Zweimal versuchte der Direktor, ihn zur Aufgabe der Abriegelung zu bewegen. Die Lobby füllte sich mit Reisenden, die abreisen wollten.
„Es ist mir egal“, sagte Lenormand.
„Ich kenne diese Leute.“
„Schön für Sie.“
„Sie überschreiten Ihre Befugnisse.“
„Ich weiß.“
„Das Gesetz wird gegen Sie entscheiden.“
„Sehr wahrscheinlich.“
„Selbst der Untersuchungsrichter …“
„Formerie soll die Dienerschaft befragen. Das ist seine Aufgabe. Der Rest ist meine.“
In diesem Moment stürmte die Verstärkung ins Hotel. Lenormand teilte sie ein, schickte sie in die dritte Etage. Dann sagte er zum Kommissar:
„Ich überlasse Ihnen die Ausgänge. Keine Ausnahmen. Ich trage die volle Verantwortung.“
Er fuhr mit dem Aufzug in die zweite Etage. Es war mühsam und langsam – sechzig Zimmertüren, jedes Bad, jeder Schrank, jede Ecke. Alles vergeblich. Um zwölf Uhr hatte Lenormand die zweite Etage abgeschlossen. Die oberen Stockwerke waren noch in Arbeit. Kein Hinweis. Er hielt inne. Hatte der Täter sich auf den Dachboden zurückgezogen?
Gerade wollte er nach unten, als man ihm meldete, dass Madame Kesselbach eingetroffen sei, begleitet von einer Gesellschafterin. Edwards hatte ihr die Nachricht überbracht.
Lenormand fand sie in einem der Salons. Der Schock hatte sie schwer getroffen. Die Augen trocken, das Gesicht verzerrt, der Körper zitterte wie im Fieber. Groß, dunkle Züge, schwarze Augen mit goldenen Sprenkeln – wie Funken in der Nacht. Ihr Mann hatte sie in Holland kennengelernt. Dolores war eine Amonti – alte spanische Familie. Die Ehe war vier Jahre lang stabil und liebevoll gewesen.